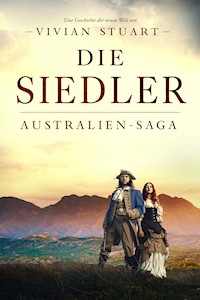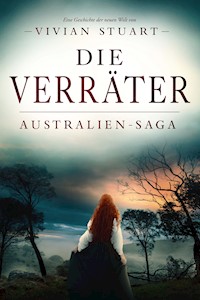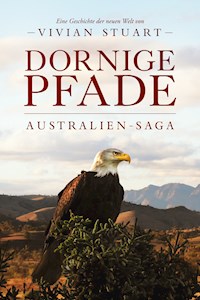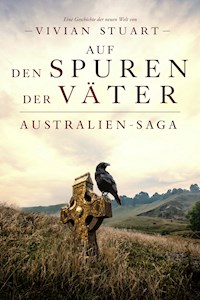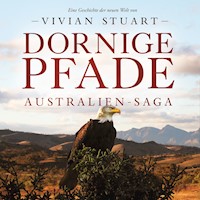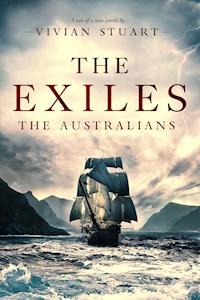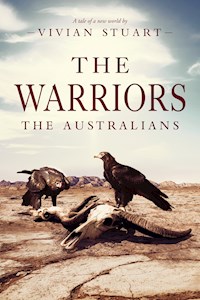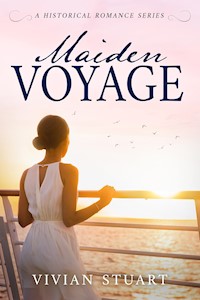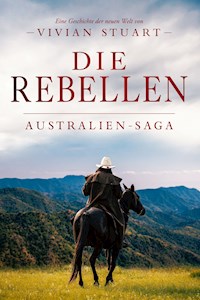
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Jentas EhfHörbuch-Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert werden die Rufe nach einem eigenen Staat auf dem australischen Kontinent lauter. Eine junge Generation wächst heran, die ihr Heimatland unabhängig sehen will. Unter denen, die friedlich für die staatliche Einheit streiten, ist auch die schöne Java Gordon, Tochter von Jessica Broome. Wird ihr Kampf gelingen? Oder ist dies die Stunde derer, die Hass und Gewalt predigen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 882
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Rebellen
Die Rebellen – Australien-Saga 11
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1989
© Deutsch: Jentas ehf 2022
Serie: Australien-Saga
Titel: Die Rebellen
Teil: 11
Originaltitel: The Nationalists
Übersetzung : Jentas ehf
ISBN: 978-9979-64-321-0
Danksagung
Viele Publikationen haben mir dabei geholfen, dieses Buch zu schreiben, vor allem die folgenden: Omdurman von Philip Ziegler (Dorset Press, New York, 1973); Good-Bye Dolly Gray: The Story of the Boer War von Ryne Kruger (J. B. Lippincott Co., Philadelphia, 1960); The Boer War von Eversley Belfield (Leo Cooper, London, 1975); Kitchener: Portrait of an Imperialist von Philip Magnus (E.P. Dutton & Co., New York, 1959); und A History of Australia von C.M.H. Clark, Band 5, The People Make Laws (Melbourne University Press, Melbourne, 1981).
Dankbare Anerkennung schulde ich den Beiträgen von Eugene Janes aus Darwin, Australien, der das Wissen über die Aborigines beisteuerte.
Da ich das diesen unterschiedlichen Quellen entnommene Informationsmaterial meiner Geschichte angepasst habe, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich für eventuelle Abweichungen von den historischen Aufzeichnungen ausschließlich selbst verantwortlich bin. Ich hoffe, sie sind in einem fiktionalen Werk verzeihlich.
Teil 1
1896-1899
1
Australien: 1896
Die flackernden Flammen warfen abwechselnd Licht und Schatten auf die Gesichter einer Handvoll Aborigines, die in einem Wäldchen unweit des Hauptgebäudes von Jon Masons Rinderfarm in Victoria, auf der sie arbeiteten, um ein Lagerfeuer hockten.
Sie lauschten einem Alten, einem Weisen, der aus Achtung vor den nächtlichen Geistern mit gedämpfter Stimme sprach. Den Blick hielt er zum sternklaren Himmel gerichtet, zum Kreuz des Südens.
»In der Traumzeit«, sagte der Alte, »kein Blackfellow. Nur Känguru, Leguan und Vögel. Alle laufen wie Blackfellow. Er immer derselbe Blackfellow, nachdem er zum Känguru, Leguan und Vogel geworden.«
Jon Masons Sohn Thomas, ein ernster Junge von vierzehn, blickte mit seinen großen braunen Augen wie gebannt auf das Gesicht des weißbärtigen Aborigine, obwohl er diese Geschichte schon mehrmals gehört hatte. Doch er wurde nie müde, dem bereitwilligen Alten bei seinen Erzählungen zu lauschen. Neben ihm saß seine Mutter Misa.
Von Misa hatte Thomas, den alle nur Tolo nannten, seine Anmut und die etwas dunklere samoanische Hautfarbe geerbt. Seinem englischen Vater Jon verdankte er sein scharf geschnittenes Gesicht mit der ausgeprägten Nase.
Misa hatte ihrem Sohn den Arm um die Schultern gelegt. Seit Jon sie vor etlichen Jahren in Samoa geheiratet und in seine Heimat mitgebracht hatte, war sie sowohl geistig als auch körperlich gereift. Ihre Brüste und Hüften hatten weiblichere Rundungen angenommen, doch ihre Taille war immer noch schlank. Das tiefschwarze, leicht wellige Haar fiel ihr schwer bis über die Schultern und duftete nach frischen Blüten. Ihre Züge waren feiner als die der meisten Samoaner. Sie hatte wohlgeformte, volle Lippen und große Augen, und wenn sie lächelte, strahlte sie vor Glück — besonders wenn ihr Lächeln Jon Mason galt.
Da sich ihr Ehemann geschäftlich in Melbourne aufhielt und anschließend weiter nach Sydney reisen musste, konnte Misa sich ungestört ihrem bevorzugten Interessengebiet widmen, den Legenden der Aborigines. Als ehemalige Missionsschülerin im samoanischen Apia war sie fromme Christin. Doch ebenso respektierte sie den Glauben ihres eigenen Volkes und auch die alten Mythen der Ureinwohner Australiens.
Die Religion der Aborigines war durch Totems gekennzeichnet und basierte auf der Überzeugung, dass alles im Universum eine Einheit war. Die Geschichte des alten Mannes über die Tiere, die wie Menschen liefen, veranschaulichte die Vorstellung, dass die heutigen Tiere und Menschen aus den Ahnengeistern der Traumzeit hervorgegangen und daher geistig miteinander verbunden waren.
Misa warf ihrem Sohn einen raschen Blick zu und bemerkte in seiner Miene Verblüffung und Konzentration. Dann sah sie hinauf zu den Sternen und ließ die Worte des Alten auf sich wirken. Der Aborigine erklärte, im Leben sei mehr Heiliges und Gutes als Profanes oder Böses. Alle Dinge bildeten eine Einheit. Der Mensch sei in Kunst, Glaube, Leben, Tod, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit der Natur verschmolzen.
»Ich verstehe das nicht ganz«, flüsterte Tolo seiner Mutter ins Ohr.
»Hör einfach zu«, flüsterte sie zurück.
Ein Mensch beginne sein Leben als Geist-Kind eines Tieres, eines Wasserlochs oder sogar eines Felsens, fuhr der Alte fort. Durch seine Mutter bekomme dieses Kind seine Menschengestalt.
Der Alte sprach es nicht ausdrücklich aus, aber wie Misa erfahren hatte, spielte bei den Aborigines das sexuelle Beisammensein für die Empfängnis eines Kindes eine eher untergeordnete Rolle. Diese Anschauung hatte sie doch ein wenig beunruhigt, denn sie wusste, dass die Aborigine-Mädchen mit dem Sex bisweilen etwas zu ungezwungen umgingen. Zwischen ihrem Sohn und Daringa, einem Mädchen auf der Viehfarm, das nach Misas Schätzungen etwa sechzehn war, hatte sich in letzter Zeit eine engere Beziehung entwickelt, auf die Misa immer ein scharfes Auge geworfen hatte.
Bis vor wenigen Monaten bestand dazu noch kein Anlass. Wenn Tolo nicht gerade von seinem Privatlehrer unterrichtet wurde, verbrachte er seine Zeit mit den Aborigine-Jungen, mit denen er auf die Jagd ging und nach Eingeborenenart Vögel und Kaninchen mit genau gezielten Steinwürfen oder mit dem Bumerang erlegte. Inzwischen aber beanspruchte Daringa seine ganze Aufmerksamkeit. Der Ursprung dieser engeren Beziehung der beiden lag in der Klugheit und Neugier des Mädchens. Daringa hatte Tolo gefragt, welcher Zauber in dem Buch gefangen sei, das er gerade las. Und Tolo hatte zu einer Erklärung angesetzt, die in dem Versuch endete, ihr das Lesen beizubringen. Da Daringa bei seinen Lektionen durchaus Begabung zeigte, bat er seine Mutter um ihre Mithilfe. So kam es, dass auch Misa an dem klugen jungen Mädchen, das sich so sehr bemühte, ihr zu gefallen, ein besonderes Interesse entwickelte.
Daringas Vater war ein intelligenter Mann namens Colbee, dessen ausgezeichnete Arbeit Jon so sehr schätzte, dass er ihn zum Oberaufseher über den Viehbestand gemacht hatte. Colbee war jedoch den alten Traditionen verhaftet, und jedes Mal, wenn er seine Tochter aus einem Buch der Weißen lesen sah, verfinsterte sich seine Miene. Zu Misa sagte er, er wisse zwar nicht, welche Geister in dem Buch steckten. Er wisse aber sehr wohl, dass sie nicht von diesem Land stammten, da die Weißen sie an diesen uralten Ort gebracht hätten, den sie nun »Australien« nannten.
»Du musst mit der Zeit gehen, Colbee«, gab Misa ihm zur Antwort.
»Aber warum liest sie ein Buch der Weißen?«, beharrte Colbee. »Sie wird nie weiß sein.«
Darauf fiel Misa keine Erwiderung ein. Die Frage ließ sie daran zurückdenken, in welch schwieriger Situation sie selbst sich befunden hatte, als sie nach Australien kam.
Als sie mit Jon aus Samoa gekommen und in die weiße australische Gesellschaft eingeheiratet hatte, war ihr sehr schnell klar geworden, dass ihre anfänglichen Befürchtungen nicht unbegründet waren. Jon hatte mit ihr über die Einstellung der europäischen Siedler, Australien sei nur für Leute mit weißer Haut gedacht, gesprochen und ihr versichert, er werde sie von niemandem beleidigen lassen. Und er hatte sein Wort gehalten. Kein Mann und auch keine Frau wagte es, Misa etwas Beleidigendes zu sagen — zumindest nicht direkt ins Gesicht.
Jon Mason war einer der reichsten Männer Victorias und folglich einer der mächtigsten Bürger des Staates. Ironie des Schicksals: Sein Reichtum stammte größtenteils von seinem Stiefvater, Marcus Fisher, den er so sehr verabscheute, dass er seinen Namen geändert und den seines Großvaters mütterlicherseits angenommen hatte. Fisher war während eines starken Taifuns im Jahre 1889, kurz vor Jons Hochzeit mit Misa, in Samoa umgekommen.
Dass überhaupt eine Vermählung stattgefunden hatte, verdankten Jon und Misa einem liebenden Gott. Denn einige Jahre zuvor gehörte Misa zu den zahlreichen Polynesiern, die von weißen Australiern unter Vortäuschung falscher Tatsachen nach Queensland gelockt worden waren, wo sie, nachdem sie ihre Arbeitsverträge unterschrieben hatten, unter sklavenähnlichen Bedingungen in den Zuckerrohrfeldern schuften mussten. Jon hatte ihren Leuten zur Freiheit verhülfen, indem er ihnen die Mittel für ihre Heimfahrt nach Samoa zur Verfügung gestellt hatte. Misa hatte sich ihm zur Begleichung dieser Schuld hingegeben, und aus dieser Verbindung war Tolo hervorgegangen. Doch erst viel später hatte Jon seine Misa wiedergefunden, und kurz nach dem Taifun war er seinem Sohn vorgestellt worden.
Als Jon und Misa von ihrer Hochzeitsreise, bei der Tolo selbstverständlich mit von der Partie war, nach Australien zurückkehrten, erfuhren sie, dass Marcus Fishers Leiche in Apia geborgen und rechtsgültig identifiziert worden war. Nach dem Gesetz ging Fishers riesiges Vermögen nun auf seinen Stiefsohn Jon über, den er als Kind offiziell adoptiert hatte. Zu seinen Besitztümern gehörten ein elegantes Herrenhaus außerhalb von Melbourne sowie ein Stadthaus und ein Bürogebäude einschließlich einer Schifffahrtsgesellschaft. Hinzu kamen Vieh- und Schaffarmen sowohl in Victoria als auch in Neusüdwales und Zuckerrohrplantagen in Queensland.
Zuerst wollte Jon mit Fishers Vermögen nichts zu tun haben. Der Mann hatte seine Mutter Caroline zu ihren Lebzeiten dermaßen misshandelt, dass er sie in die Alkoholabhängigkeit und beinahe in den Wahnsinn getrieben hatte. »Misa, ich will von dem Geld und dem Eigentum dieses Mannes nichts haben«, erklärte er, als er die Auflistung von Fishers Besitztümern erhielt. »Bislang bin ich mit meinen eigenen Handelsaktivitäten gut ausgekommen. Auch wenn wir keineswegs reich sind, kann ich Gott sei Dank für dich und Tolo doch sehr gut allein sorgen.«
Misa hatte allerdings taktvoll darauf hingewiesen, dass Jon nicht nur Vermögen, sondern auch Verpflichtungen geerbt hätte. »Werden auf diesen Zuckerrohrplantagen nicht immer noch Polynesier eingesetzt?«, erkundigte sie sich. »Ich frage mich, ob sie auch weiterhin mit der Peitsche zu härterer Arbeit angetrieben werden. Du als Eigentümer, Jon, könntest dafür sorgen, dass sie anständig behandelt werden, ebenso wie die Aborigines-Viehaufseher auf den Farmen.«
Jon, der die überraschend pragmatische Einstellung seiner jungen Frau rasch zu schätzen gelernt hatte, hörte ihr aufmerksam zu.
»Du solltest auch bedenken, dass Tolo als halber Samoaner in diesem Land eines Tages auf sich selbst gestellt sein wird«, fuhr sie fort. Je reicher er ist, desto weniger Vorurteilen wird er begegnen, könnte ich mir vorstellen. Meinst du nicht? Sieh den Reichtum, den du von Marcus Fisher geerbt hast, doch einfach als Sicherheit für deinen Sohn an.«
Schließlich hatte Jon sich der Logik seiner Frau angeschlossen, denn derlei Vorurteile waren weit verbreitet. Auch wenn ihm von Anfang an bewusst gewesen war, dass er durch seine Vermählung mit einer dunkelhäutigen Frau gegen die australischen Sitten verstieß, war er doch entsetzt darüber, mit welcher Schärfe und in welchem Ausmaß ihr der Hass entgegenschlug.
Weniger erstaunt hätte es ihn, wenn Misa eine richtige Blackfellow-Frau, eine Aborigine gewesen wäre. Unter der weißen australischen Bevölkerung herrschte die Annahme, dass es sich bei den Ureinwohnern um eine aussterbende Rasse handele — eine Spezies, mehr Tier als Mensch, die dazu bestimmt sei, im Konkurrenzkampf mit der voll entwickelten weißen Rasse allmählich zu verschwinden. Jon musste aber die Erfahrung machen, dass viele seiner Landsleute braunhäutigen Menschen anderer Rassen — also auch Samoanern und sämtlichen Einwohnern Asiens — ähnliche Vorurteile entgegen brachten.
Allerdings hätte er nie erwartet, dass seine eigenen Freunde seine Familie meiden würden. Zunächst hatte er in dem großen Haus gewohnt, wo seine arme, trunksüchtige Mutter in ihren Wahnvorstellungen den See vor dem Haus mit weißen Schwänen bevölkert hatte. Mit dem Versuch, seine Frau und seinen Sohn in Melbournes feine Gesellschaft einzuführen, war er gänzlich gescheitert. Oft hätte er am liebsten ein Gewehr genommen und den Leuten, die sich in der Öffentlichkeit mit ihm unterhielten, seine Einladungen aber ignorierten, ihr blasiertes, angespanntes kleines Lächeln aus dem Gesicht geschossen.
Als Thomas in die Schule kam und als Halbblut verspottet wurde, trennte Jon sich endgültig von der Melbourner Gesellschaft. Er nahm den Jungen aus der Schule und stellte Privatlehrer für ihn an. Diese Lösung bekam Tolo sehr gut, denn dadurch blieb ihm viel mehr Zeit, mit seinem Vater die Gegend zu erkunden. Besonders gefiel ihm der See vor dem Haus, auf dem im Gedenken an Caroline nun tatsächlich Schwäne schwammen.
Doch schließlich entschied Jon sich dafür, Melbourne gänzlich den Rücken zu kehren. Er zog mit seiner Familie auf die schönste seiner Viehfarmen, wo es sowohl seiner Frau als auch seinem Sohn gut gefiel. Der ausgedehnte Besitz lag nah genug an Melbourne, sodass Jon regelmäßig in die Stadt fahren und sich um seine florierenden Geschäfte kümmern konnte. Da seine Frau und sein Sohn sich in ihrem neuen Zuhause sehr wohl fühlten, unternahm er bald auch größere Reisen, bis nach Sydney oder Queensland.
Auch bei den zahlreichen Debatten zu der Frage, welche Anstrengungen zu unternehmen seien, um die einzelnen australischen Staaten zu einem Staatenbund zu vereinigen, meldete Jon sich immer häufiger zu Wort. Ein solcher Zusammenschluss würde Auswirkungen auf den gesamten Subkontinent und darüber hinaus auf das gesamte britische Empire haben. Jon konnte nicht nachvollziehen, dass dieselben Männer, die in der öffentlichen Diskussion zu einer Sache von solcher Tragweite seiner Meinung große Aufmerksamkeit schenkten, ihn und seine Familie bei sich zu Hause zum Dinner nicht haben wollten. Damit wurde ihm gleich in doppelter Hinsicht eine Lektion zuteil: sowohl zur Macht des Reichtums als auch zu Irrationalität und Pharisäertum.
In jener Nacht, als Tolo und seine Mutter mit den Viehaufsehern und ihren Familien unter dem sternklaren Himmel zusammensaßen, den Mythen des alten Aborigine lauschten und in das flackernde Lagerfeuer sahen, befand Jon sich in Sydney und beteiligte sich an der Vorbereitung eines Abkommens der Australian Federation Leagues, die im November 1896 in Bathurst in der Nähe von Sydney zusammenkommen sollten.
In der »Caroline-Station«, wie Jon und Misa den ausgedehnten Landbesitz nordwestlich von Melbourne zu Ehren von Jons Mutter genannt hatten, ließ Misa bei den Angestellten keinen Zweifel aufkommen, dass bei Abwesenheit des Herrn die Anweisungen der Herrin zu befolgen waren. Misa war es in ihrer ruhigen, sicheren Art auf Anhieb gelungen, sich Autorität zu verschaffen. Für alles, was die Rinder und die Schafe anging, trug der Oberaufseher Colbee die Hauptverantwortung. Misa mischte sich in sein Fachgebiet nur selten ein, und wenn, dann nur als interessierte Beobachterin. Und gewöhnlich geschah auch das nur, weil Tolo darauf bestand.
Für einen Jungen kurz nach der Pubertät war es ein wundervolles Leben. Tolo jedenfalls war damit zufrieden, und Melbourne konnte ihm gestohlen bleiben. Hier gab es genug Wasser, in dem man schwimmen oder über das man Steine hüpfen lassen konnte. Außerdem gab es genug Pferde und interessante Strecken querfeldein über das Weideland, das irgendwann in Wald überging. Man konnte die unterschiedlichsten Echsen-Sorten verfolgen und fangen. Und hin und wieder beteiligte Tolo sich an einer lebhaften Jagd der unternehmungslustigen Jungen, wenn sie bei einem morgendlichen Ausflug auf die Gräben und Furchen eines nachtaktiven Wombats stießen. In den Waldgebieten suchte er nach Tigerottern, die so giftig waren, dass ein einmaliges Melken ausreichte, um mit dem Gift einhundertachtzehn Schafe zu töten. Dieses Wissen, das Tolo aus einem Buch in der Bibliothek seines Vaters hatte, teilte er sofort mit seinen Aborigine- Freunden, erntete aber nur leere Blicke. Die Aborigines hätten zu dieser Information höchstens zu sagen gehabt, dass die Tigerotter weit mehr als einhundertachtzehn Schafe töten kann.
Mit seinem derzeitigen Hauslehrer, einem Engländer namens Dane De Lausenette, kam Tolo bestens zurecht. Dane war in eine verarmte Familie hineingeboren worden, behauptete aber stolz, dass sein französischer Name mit William dem Eroberer 1066 nach England gekommen sei und sich seither in ungebrochener Linie fortgesetzt habe. Er war ein schlanker, gutaussehender Mann Mitte zwanzig. Als er zu Beginn seiner Tätigkeit auf der »Caroline-Station« festgestellt hatte, dass Jon Mason häufig abwesend sein würde, hatte er sich intime Augenblicke mit der schönen braunhäutigen Hausherrin ausgemalt. Doch war er bei seinem einzigen Vorstoß, mit Misa zu flirten, so kalt und endgültig abgewiesen worden, dass er keinen weiteren Versuch mehr wagte.
Dane ließ sich seine Abfuhr bei Misa jedoch nicht allzu sehr zu Herzen gehen, denn schließlich lebten auf der Farm noch andere weibliche Wesen. Zugegeben, sie hatten eine dunklere Hautfarbe und gröbere Gesichtzüge, aber es waren allemal Frauen. In letzter Zeit hatte er Daringa seine Aufmerksamkeit geschenkt. Nicht etwa, weil er sie jünger und attraktiver fand, sondern weil sie schneller zur Hand war. Tolo hatte es ihm leicht gemacht durch seine Frage, ob er ihm helfen würde, Daringa das Lesen beizubringen.
Mancherorts wurde allen Ernstes behauptet, die Aborigines würden ihre Unterlegenheit dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie nie irgendeine Form von Alkohol ersonnen hätten. Gelehrte Männer schrieben, die Zivilisation habe begonnen, als die Sippen der Jäger und Sammler lernten, Getreide zu fermentieren, um daraus alkoholische Getränke herzustellen, und als sie sesshaft wurden und Getreide anbauten, um einen ständigen Nachschub an Bier zur Verfügung zu haben. Nach dieser Auffassung waren die Aborigines nicht zivilisiert. Da sie die alkoholischen Getränke der Weißen nicht gewöhnt waren, fielen sie ihnen rasch zum Opfer.
Dane De Lausenette kostete es nur ein wenig Wein, um Daringa zum Kichern zu bringen, und schon bettelte sie um mehr. Und kaum hatte sie ein wenig mehr getrunken, war sie auch schon bereit, sich auszuziehen. Nach dem ersten Mal legte sie sich bedenkenlos immer wieder zu Dane, sobald er ihr nur ein, zwei Gläschen von dem köstlichen Wein anbot, der sie so glücklich stimmte und ihr das Gefühl vermittelte, voller Geister zu sein. Daringa hatte nur einmal in der Woche Gelegenheit zu diesem Rendezvous, und es wurde von Mal zu Mal gefährlicher, weil ihr verändertes Verhalten den anderen bereits auffiel.
Als erster wurde ein junger Viehaufseher namens Bennelong argwöhnisch, dem Daringa versprochen war. Sie wollte plötzlich nicht mehr mit ihm in den Wald gehen und die Spiele spielen, die einander versprochenen Männern und Frauen erlaubt waren. Stattdessen wurde er von Daringa nur noch verspottet, was den jungen Mann überraschte und verdross.
Auch Tolo verbrachte weniger Zeit mit Daringa, bis Misa ihn eines Tages fragte: »Warum gibst du Daringa keinen Unterricht mehr?«
»Sie meint, sie hätte genug gelernt«, erwiderte Tolo. »Sie sagt, sie hat kein Interesse daran, etwas über Weiße zu lesen, die weit weg wohnen.«
An dem Morgen, nachdem Jon und seine Mutter am Lagerfeuer gesessen und den Geschichten des Alten zugehört hatten, lag Daringa zufrieden im losen Stroh auf dem Heuboden eines Viehstalls. Die Hände hielt sie hinter dem Kopf verschränkt und kaute auf einem trockenen Halm. Bald wäre Dane bei ihr, und dann würden diese sonderbaren Empfindungen wieder beginnen. Schuldgefühle hatte sie keine. Sie bedauerte nur, dass sie sich auf dem Heuboden verstecken musste, um mit dem Mann ihrer Wahl die Liebe zu genießen.
Kurz darauf hörte sie von unten Geräusche und verharrte in gespannter Erwartung. Sobald das Gesicht des Privatlehrers beim Hochklettern auf der Leiter zu sehen war, stützte sie sich auf den Ellbogen und lächelte.
Dane hielt sich nicht lange mit Einleitungen auf, was Daringa allerdings nur recht war. Kaum hatte der starke Engländer sich neben sie ins Stroh gelegt, war ihr Körper nur allzu bereit, ihn aufzunehmen.
Es war ein energisches gegenseitiges Geben und Nehmen, sodass am Ende beide schwer atmeten, als Dane auf dem Rücken neben Daringa lag.
»Ein Geist ist in mich eingedrungen«, sagte sie.
De Lausenette war mit den Überzeugungen der Aborigines noch nicht so vertraut wie Misa und Tolo. »Was ich in dich hineingegeben habe, war kein Geist«, sagte er mit breitem Grinsen.
»Ich meine damit«, erklärte sie ihm behutsam, »dass ein Geist in mich eingedrungen ist, um die Gestalt eines Kindes anzunehmen. Wie du siehst, wirst du mich also heiraten müssen.«
»Verflucht«, entfuhr es Dane, der sich sofort aufsetzte und seine Kleidung zurechtzog.
»Aber das ist doch gut«, sagte sie. »Ich würde nur gern wissen, ob unser Kind ein Geist des Wassers oder vielleicht der eines Kängurus ist.«
De Lausenette hatte sich wieder gefasst und lachte. »Sieh mal, Mädchen«, sagte er. »Wie viele Blackfellows könnten ebenfalls der Vater deines Kindes sein?«
Daringa sah ihn erstaunt an und verzog schmollend das Gesicht. »Keine Blackfellows. Nur du.«
»Nie im Leben, verdammt noch mal«, entgegnete Dane. »Hör zu, Daringa, du weißt doch selbst, dass du puren Blödsinn redest. Ich, dich heiraten? Ausgeschlossen.«
Zum ersten Mal verspürte Daringa Angst. Für sie war es etwas Schönes und Natürliches, dass in ihrem Leib ein Kind heranwuchs — völlig im Einklang mit der großen Einheit. Auf diese Weise akzeptierten die Menschen ihres Volkes den Willen der Geister.
Nun wurde es Zeit, zu heiraten, denn das Geist-Kind in ihr war mit Hilfe dieses weißen Mannes entstanden, und seine Verantwortung war sonnenklar.
»Aber ich werde Schande über mich bringen«, sagte sie, »wenn du, der du mir dabei geholfen hast, die Geister zu rufen, nicht der Vater wirst.«
»Sieh mal, Daringa«, begann Dane, »für dieses kleine Problem gibt es eine ganz einfache Lösung. Du sagst, du hast dieses Herumgeknutsche mit keinem der Blackfellows gemacht?«
»Nein«, warf sie ärgerlich ein.
»Dann geh zu diesem jungen Schwarzen, wie heißt er noch gleich? Bennelong. Er hat Verlangen nach dir. Das hast du mir selbst erzählt. Gib dich ihm hin, und dann ist das Kind seines. Siehst du, wie einfach das geht?«
Daringa runzelte die Stirn. »Ich werde die Geister nicht belügen.«
»Du belügst damit doch nicht die Geister, sondern nur Bennelong.«
»Die Geister würden mich verfluchen, mich und das Kind.« Sie hob das Kinn und sagte mit fester Stimme. »Wenn ich das der Herrin und meinem Vater erzähle, werden sie schon dafür sorgen, dass du dich dem Willen der Geister beugst.«
»Jetzt hör mir mal gut zu«, erwiderte Dane wütend, »du wirst nicht darüber sprechen, mit niemandem. Wir haben es beide gewollt. Du hast mir gesagt, du würdest es für dich behalten, weil dein Vater ganz und gar nicht damit einverstanden wäre.«
»Das war, bevor das Geist-Kind in mich eindrang«, erklärte sie. »Du willst mich also nicht heiraten?«
»Nein, verdammt noch mal«, fauchte Dane. »Komm endlich zur Vernunft, Mädchen.«
Daringa sprang auf und zog ihr Kleid herunter. »Ich gehe jetzt zur Herrin und erzähle es ihr«, sagte sie.
Dane hielt sie am Bein fest und zog sie zu sich auf den Boden. »Das wirst du nicht tun«, zischte er ihr zu.
Daringa war erstaunlich stark. Sie entwand sich seinem Griff, richtete sich auf und rannte zur Leiter, die an der Kante des Heubodens lehnte. Dane sprang auf und wollte nach ihr greifen, rutschte aber auf dem losen Stroh aus und fiel der Länge nach hin. Mit seinem ganzen Gewicht traf er so unglücklich auf die Rückseite ihrer Beine, dass sie nach vorn über die Kante geschleudert wurde. Daringa stieß einen entsetzten Schrei aus und stürzte kopfüber in die Tiefe. De Lausenette vernahm einen lauten Aufprall. Danach war alles völlig still. Er spähte vom Heuboden hinab und sah, dass Daringa auf der Seite lag und ihr Hals merkwürdig verdreht war. Ihre Beine zuckten noch krampfhaft, wie bei einem Huhn, dem man das Genick gebrochen hat. Und dann bewegte sie sich nicht mehr.
Dane wusste, dass Daringa tot war. Sein einziger Gedanke war, den Stall zu verlassen, bevor jemand kam. Im Moment tat es ihm um das Mädchen nicht einmal leid. Durch ihren Tod hatte das schwierige Problem sich gelöst, überlegte er kalt. Immerhin konnte er sich glücklich schätzen, bei einem der reichsten Männer Australiens eine Anstellung als Hauslehrer gefunden zu haben, und seine ehrgeizigen Pläne reichten noch viel weiter. Er hatte hart gearbeitet, um zu Jon Mason eine gute Beziehung aufzubauen, und durch Daringas Ankündigung ihrer Schwangerschaft war sowohl diese Beziehung als auch sein erhoffter beruflicher Aufstieg in Masons Unternehmen ernsthaft gefährdet. Nun musste er zusehen, dass er unbemerkt aus dem Stall kam. Und dann musste er so tun, als habe er Daringa nicht mehr gesehen, seit er sie das letzte Mal gemeinsam mit Tolo im Lesen unterrichtet hatte.
Er hastete die Leiter hinab und musste über Daringas nackte schwarze Beine steigen. Ihr einfaches Hemd war so weit hochgerutscht, dass ihre Schenkel entblößt waren. Er wich ihr aus und eilte zur Tür, änderte aber seine Absicht und blickte zur Rückseite des Stalls, wo eine kleinere Tür zu einem Pferch führte. Dort in der geöffneten Tür stand ein etwa zehnjähriger Aborigine-Junge, der mit weit aufgerissenen Augen auf Daringas reglose Gestalt starrte.
»Sie ist gestürzt«, sagte Dane. »Es war ein Unfall. Ich bin gerade in dem Augenblick in den Stall gekommen, als sie herunterfiel.«
Der Junge sah Dane an, und in seinem Blick lag tiefste Verachtung. Dane erkannte, dass der Junge alles wusste. Er musste beobachtet haben, wie Daringa vom Heuboden gestürzt und Dane anschließend die Leiter heruntergeklettert war. Dane drehte sich um und rannte zur vorderen Tür. Draußen im Hof war niemand. Er lief ins Haus und eilte auf sein Zimmer.
Ihm war klar, dass er sich nun von seinen Hoffnungen auf eine wichtige Position in Jon Masons Geschäftsimperium verabschieden konnte. Ihm blieb nur noch eine Chance: zu fliehen und Australien hinter sich zu lassen. Zuerst müsste er nach Melbourne und dort auf ein Schiff. Bis Mason aus Sydney zurückkehrte, blieb ihm zum Glück noch reichlich Zeit. Und über Land nach Melbourne zu gelangen, wäre keine allzu große Schwierigkeit. Er überlegte, ein Pferd zu nehmen, hielt es dann aber für zu riskant, noch einmal zu den Stallungen zu gehen. Der Aborigine-Junge hatte vermutlich längst die Nachricht von Daringas Tod verbreitet und überall herumposaunt, unter welchen Umständen sie ums Leben gekommen war.
Dane nahm nur das Allernotwendigste mit. Den größten Teil seiner Kleidung und seine australische Gesteinssammlung ließ er zurück und steckte nur seine Ersparnisse in die kleine Reisetasche. Durch eine Hintertür huschte er aus dem Haus und glaubte, niemand habe ihn gesehen. Um möglichst unbemerkt zu bleiben, rannte er in gebeugter Haltung auf eine Baumgruppe zu und watete durch einen Bach in den dichten Wald. Eine Zeitlang würde er erst einmal querfeldein gehen, denn auf der Straße nach Melbourne wäre es für ihn viel zu gefährlich. Wie leicht könnten die Aborigines von der »Caroline-Station« ihn auf ihren Pferden einholen.
Allerdings wusste Dane nicht, dass Tolo gesehen hatte, wie er ins Haus eilte. Der Junge war unterwegs zum Zimmer seines Hauslehrers und wollte ihn fragen, ob er Lust hätte, mit ihm an den kleinen Fluss zum Schwimmen zu gehen. Als Tolo sah, wie De Lausenette mit gepackten Sachen in aller Eile das Haus verließ, folgte er ihm verblüfft und neugierig.
Der Busch schreckte Tolo nicht. Er hatte schon oft, sei es allein oder in Begleitung der Aborigine-Jungen, viele Meilen darin zurückgelegt. Für ihn war diese merkwürdige Sache nur ein Spiel. Er stellte sich vor, er wäre ein Aborigine-Fährtensucher, der einem entflohenen Verbrecher folgt. Wahrscheinlich würde Dane sich sowieso nicht weit in das Waldgebiet hineinwagen, da er alles andere als ein Buschmann war.
Als die Nacht hereinbrach und De Lausenette sich zum Schlafen unter einen hohen Baum setzte und den Rücken anlehnte, suchte auch Tolo sich einen geeigneten Baum in der Nähe, der den Blicken des ahnungslosen Hauslehrers verborgen blieb.
Tolo kletterte hinauf, machte es sich in einer Astgabel bequem und schlief beinahe sofort ein.
Colbee hatte mehrere Kinder von drei verschiedenen Frauen, Daringa aber war seine Jüngste. Da ihn die Geister aus der Traumzeit zuletzt mit ihr gesegnet hatten, war sie für ihn von besonderem Wert. Als er sie nun wie einen toten Vogel, dem man als Sonntagsbraten den Hals umgedreht hatte, auf dem schmutzigen Stallboden liegen sah, empfand er eine abgrundtiefe Traurigkeit.
Er wandte sich zu dem Jungen, der ihn hergeholt hatte, und schickte ihn fort. Dann stand er lange reglos und allein neben dem leblosen Körper. Schließlich setzte er sich und verschränkte die Beine so, dass seine Knie beinahe Daringas Leiche berührten.
Der schmerzliche Ausdruck auf Colbees Gesicht verschwand. Seine Züge wurden undurchdringlich, und er verdrehte die Augen, die plötzlich glasig wirkten. Die Geräusche von draußen — das Brüllen einer Kuh und das Krähen eines Hahnes — hörte Colbee nicht mehr. Er versank tief und immer tiefer und wurde zu reinem Geist und purer Trauer, und an einem Ort völliger Dunkelheit und Wärme suchte er nach Antworten.
Der Junge, der Colbee geholt hatte, konnte das Geschehene nicht für sich behalten. Als nächstes machte er sich auf die Suche nach Bennelong, Daringas Verlobtem, berichtete ihm alles und rannte hinter dem jungen Mann her zum Stall. Bennelong blieb an der halbgeöffneten Tür stehen und blickte hinein auf Daringas Leiche und auf Colbee, der noch in tiefer Versunkenheit dasaß.
Bennelong verlangte es danach, zu Daringa zu gehen. Aber er hatte von Kindheit an gelernt, die Meditation eines alten Mannes zu respektieren. Wenn einer der Alten reglos und in sich selbst versunken dasaß, durfte er nicht gestört werden, denn er konzentrierte seine Gedanken darauf, die Miwi, die Macht, anzurufen. Die Miwi war in der Magengrube angesiedelt, und mit der Miwi konnte der Wiringin, der »weise Mann«, seinen Körper verlassen und Dinge wahrnehmen, die sich weit entfernt von ihm abspielten.
Fast eine volle Stunde stand Bennelong in der offenen Tür, während Colbee regungslos am Boden saß. In der Zwischenzeit hatten Fliegen die Feuchtigkeit von den Lippen des toten Mädchens gesaugt, und der Gestank ihrer Exkremente, die sie bei ihren letzten Zuckungen ausgeschieden hatte, erfüllte die Luft. Als Colbee sich endlich bewegte und von weit her in seinen Körper zurückkehrte, trat Bennelong zu ihm und kniete sich neben Daringa. Mit den Fingerspitzen schloss er ihr die Augen. Dann schaute er Colbee an.
»Hast du etwas gesehen?«, fragte er.
»Er flieht durch den Busch«, sagte Colbee. Er zeigte in Richtung Melbourne. »Da lang.«
»Ihn zu verfolgen, steht mir zu«, sagte Bennelong.
Colbee nickte.
»Soll ich dir helfen, sie wegzutragen?«, fragte Bennelong.
»Nein. Sie ist meine Tochter«, antwortete Colbee.
Bennelong überließ es dem Vater, sich zu der Toten zu beugen und sie aufzuheben, und schritt erhobenen Hauptes hinaus. Er wandte sich seiner Hütte zu, die auch Daringas Hütte hätte werden sollen. Seine wertvolle Habe hielt er ganz unten in einer alten Truhe versteckt, wo sie gut geschützt war: Emufedern und Strähnen von menschlichem Haar. Nachdem er alles sorgfältig auf den Tisch gelegt hatte, setzte er sich, nahm sein Messer und machte vorsichtig einen flachen Schnitt in die Innenseite seines Ellbogens. Er ließ sein reichlich fließendes, nach Kupfer riechendes Blut in eine Schüssel rinnen. Bevor er genug hatte, wurde es ihm ein wenig schwindelig, aber er nahm es als Zeichen, dass die Geister zu ihm sprachen.
Mit dem Menschenhaar band er die Emufedern zusammen und verwendete sein Blut als Bindemittel, das zu einer klebrigen Masse trocknete. Zwei runde, gewölbte, fast identische Gegenstände nahmen Gestalt an. Es waren Kadaitcha-Schuhe, Geisterschuhe, die allerdings eher wie Fußspangen aussahen, da sie keinen genauen Abdruck auf dem weichen Boden hinterließen.
In seinem Stamm kannte nur Bennelong das Geheimnis, diese Schuhe anzufertigen. Nur er allein war von den Ältesten und den Geistern zum Kadaitcha-Mann auserkoren worden, um mit jedem abzurechnen, der das Stammesrecht brach. Bennelongs Pflicht als Kadaitcha war es, Übeltäter zu bestrafen. War das Vergehen schwer genug, konnte es mit dem Tod bestraft werden.
Bis spät in die Nacht arbeitete er an den magischen Schuhen. Er hatte keine Eile. Die Geister — und die beinahe unheimliche Fähigkeit der Aborigines, einer Spur zu folgen — würden ihn unfehlbar zu dem Mann führen, der Daringa getötet hatte. Die Schuhe würden ihn vor dem Gesetz der Weißen schützen, denn sie würden keine Fährten hinterlassen, nicht die geringste Spur von Bennelongs Rache. Im ersten Morgengrauen machte er sich mit den Schuhen an seinen Füßen auf den Weg.
Colbee wusste von Bennelongs Aufbruch, ohne dass er es mit seinen Augen gesehen hätte. In Gemeinschaft mit den Geistern hatte er die ganze Nacht neben der Leiche seiner Tochter gesessen. Während der langen Nacht erschien es ihm nur recht und billig, dass Bennelong die Kadaitcha-Schuhe anfertigte.
Im Morgengrauen aber machten die Geister der Wut und der Trauer denen der Vorsicht Platz. Einen Weißen zu töten, war eine ernste Angelegenheit. Selbst wenn Bennelong durch die Kadaitcha-Schuhe keine Spuren hinterließ und unsichtbar blieb, waren die Weißen doch nicht dumm. Der Verdacht würde zuerst auf Daringas männliche Verwandte fallen und dann auf den Mann, dem sie versprochen war. Wenn Bennelong den weißen Hauslehrer tötete, würde das ernste Auswirkungen auf alle Aborigines haben, die auf »Caroline-Station« arbeiteten. Jon Mason war ein guter und fairer Mann. Aber selbst er würde nicht einfach hinnehmen können, dass ein Weißer durch Blackfellows getötet wurde.
Dane De Lausenette kam nicht besonders rasch vorwärts. Kurz nach Tagesanbruch war er in ein Gebiet mit dichtem Gestrüpp eingedrungen und musste sich äußerst vorsichtig bewegen, damit seine Kleidung und seine Haut nicht von den langen, starren Dornen aufgerissen wurden. Er hielt es für sicher genug, bald nach Osten abzubiegen und dem Weg nach Melbourne zu folgen.
Zunächst aber setzte er sich, um ein wenig auszuruhen. Plötzlich hörte er das Knacken eines Zweiges hinter sich, und sein Herz begann wie wild zu hämmern. Er zog die Pistole aus dem Gürtel und wartete, bis das Geräusch sich wiederholte. Doch dieses Mal war es noch viel näher. Dane drehte sich um, folgte vorsichtig seiner eigenen Fährte ein Stück zurück und verbarg sich hinter einem hohen Baum. Als Tolo spurenlesend mit gebeugtem Kopf vor ihm auftauchte, trat er aus seinem Versteck.
»Zum Teufel, Junge, was hast du hier zu suchen?«, herrschte er ihn an.
Tolo warf ihm einen finsteren Blick zu, weil er entdeckt worden war, spielte sein Spiel aber weiter. »Ich frage Sie, Sir, wohin wollen Sie so eilig?«
»Das geht dich nichts an«, sagte Dane und gab sich möglichst unbekümmert. »Aber wenn du es unbedingt wissen willst: Ich bin unterwegs nach Süden, ähm, um ein ganz bestimmtes Aborigine-Dorf zu finden, von dem ich gehört habe. Die Sitten und Gebräuche der Dorfbewohner unterscheiden sich angeblich ein wenig von dem, was wir auf der Farm erleben, und da bin ich neugierig geworden.«
»Dann ist das die verkehrte Richtung«, entgegnete Tolo. »Gestern Abend, etwa zwei Stunden vor Sonnenuntergang, haben Sie sich genau nach Westen gewandt. Und da gibt es auf hundert Meilen kein Dorf. Selbst für die Aborigines ist es da draußen zu trocken.«
De Lausenette war wütend, weil der Junge ihn entlarvt hatte. »Weshalb bist du mir gefolgt?«, fragte er.
»Um zu sehen, wo Sie hin wollen. Sollen wir jetzt wieder umkehren?«
Sowohl an Tolos einfacher Frage als auch an seinem offenen Blick erkannte Dane, dass der Junge keine Ahnung von Daringas Tod hatte. »Ich finde, du solltest auf jeden Fall zurück nach Hause gehen«, sagte er.
»Und wenn Sie sich wieder verlaufen?«
De Lausenette zuckte mit den Schultern und sah hinauf zur Sonne. Natürlich war es dumm von ihm gewesen. Aber nun, da er wieder bei klarem Verstand war, könnte er sich leicht nach Osten halten und würde schon irgendwann auf die Straße nach Melbourne stoßen. Doch dann wurde ihm bewusst, dass Tolo bei seiner Rückkehr jedem erzählen konnte, welche Richtung sein Hauslehrer eingeschlagen hatte. »Wenn ich es mir genau überlege, Tolo, wäre es tatsächlich das Beste, du würdest bei mir bleiben und mich auf die Hauptstraße führen. Wenn wir erst auf der Straße sind, triffst du bestimmt jemanden, der dich mitnimmt und nach Hause bringt.«
»Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie an irgendeinem Aborigine-Dorf interessiert sind«, sagte Tolo. »Das passt einfach nicht zu Ihnen.« Er hielt inne, musterte eindringlich seinen Hauslehrer und versuchte, in seiner Miene zu lesen. »Sie wollen vor irgendetwas weglaufen, stimmt’s? Wovor? Und warum?«
Die richtige Vermutung des Jungen hatte De Lausenette etwas aus dem Gleichgewicht gebracht, und er war einen Moment lang sprachlos. »Das ist eine Sache für Erwachsene«, erwiderte er schließlich.
»Ist es, weil Sie Daringa auf dem Heuboden besprungen haben?«, forschte Tolo.
Verblüfft fragte Dane: »Woher weißt du das?«
»Keine Sorge«, sagte Tolo, »wir haben es niemandem erzählt.«
»Was heißt wir?«
»Canby und ich«, antwortete Tolo.
»Ein Junge, der etwas jünger ist als du?«
Tolo nickte.
»Du verfluchter kleiner Bastard«, entfuhr es Dane. »Du hast heimlich zugeschaut!«
Tolo errötete und senkte den Blick. »Tut mir leid«, sagte er. »Ich habe nur zweimal zugesehen.«
»Verdammt«, fluchte Dane.
»Canby hat gesagt, Bennelong wäre bestimmt ziemlich wütend. Fliehen Sie vor Bennelong?«
»Ganz bestimmt nicht!«, erwiderte Dane hasserfüllt. »Was sollte ich von dem wohl zu befürchten haben?«
»Er ist ein Kadaitcha. Wenn er Sie schnappen will, kann er das jederzeit tun. Und Sie würden ihn noch nicht einmal zu Gesicht bekommen, es sei denn, er will es.«
»Hör auf mit diesem Aborigine-Quatsch«, befahl Dane verächtlich. »Also gut, gehen wir.«
»Hier lang«, sagte Tolo.
So verblüfft, wie Tolo zunächst über das Umherwandern seines Hauslehrers war, so überrascht war er nun über die Richtigkeit seiner Vermutung, dass De Lausenette vor irgendetwas floh. Dagegen überraschte es ihn keineswegs, dass mitten im Busch, noch bevor sie eine Meile in östlicher Richtung gegangen waren, Bennelong wie aus dem Nichts auftauchte und sich De Lausenette in den Weg stellte.
Die Hand des Hauslehrers griff nach seiner Pistole. Bennelong aber bewegte sich mit der Schnelligkeit einer zustoßenden Tigerotter und schlug mit der scharfen Spitze seines Speers, seiner Nulla Nulla, De Lausenette die Pistole aus der Hand. Dieser hob die Hand ruckartig zum Mund, da aus der Schnittwunde das Blut quoll.
Bennelong sprach mit tonloser Stimme, sodass es Tolo eiskalt über den Rücken lief: »Du hast getötet.«
»Es war ein Unfall«, sagte Dane. »Sie ist gestürzt.«
Nun wusste Tolo, dass Daringa tot war, und er versank in einer Woge von Traurigkeit. Er wusste auch, dass der Mann, der ihren Tod verursacht hatte, bestraft werden musste. Der Gott, von dem seine Mutter ihm erzählt hatte, forderte, dass der Gerechtigkeit Auge um Auge Genüge getan werden musste. Die Geister der Aborigines lehrten ebenfalls, dass Blut nach Blut schrie.
»Der Junge Canby hat gesehen, wie du sie hinabgestoßen hast«, sagte Bennelong. Er holte aus, stieß den Speer gegen Danes Brust und hielt, als die scharfe Eisenspitze das Hemd des Hauslehrers bereits durchbohrt hatte, im letzten Moment in seiner Bewegung inne. »Ich kann dich auf diese Weise töten: statt mit einem einzigen Stoß mit vielen kleinen Einschnitten, damit dein Blut nur langsam aus deinem Körper fließt.«
»Ich habe dir doch gesagt, Bennelong, dass es ein Unfall war«, rief De Lausenette. »Es war nicht meine Absicht, sie hinunterzustoßen.«
»Hast du versucht, sie mit Gewalt zu nehmen, und wollte sie dir entkommen?“, fragte Bennelong.
»Er hat sie besprungen«, sagte Tolo.
Bennelong sah den Jungen an. »Das hat Canby auch gesagt. Dann ist es also wahr?«
»Ja«, gab Dane zu und überlegte fieberhaft. »Ich wollte sie heiraten. Sie erwartete ein Kind.«
Ein Ausdruck tiefsten Schmerzes huschte über Bennelongs Gesicht. »Ich könnte dich auch mit einem Pfeil töten«, sagte er in dieser tonlosen Stimme. »Aber das ginge viel zu schnell. Vielleicht werde ich dich mit der Schlange in den Tod singen, damit du so langsam stirbst wie vom Biss der Tigerotter. Zuerst wirst du merken, wie deine Beine taub werden, und dann dauert es noch etwa drei bis vier Minuten, bis der Tod eintritt. Doch auch auf diese Weise bist du viel zu schnell tot, und ich will, dass du so langsam und qualvoll wie möglich stirbst.«
De Lausenette sah sich verzweifelt um. Seine Pistole lag drei Meter entfernt auf dem Boden. Eine andere Waffe hatte er nicht.
»Das Beste ist sicher immer noch der Tod der zehntausend Wunden«, sagte Bennelong und stieß mit dem Speer so geschickt zu, dass er De Lausenette nur einen winzigen Schnitt am Unterarm beibrachte. Der Hauslehrer zuckte vor dem scharfen Eisen zurück und machte einen Satz nach hinten. Dann versuchte er zu fliehen, rannte aber direkt in die Arme von Colbee, der eben in diesem Augenblick aufgetaucht war.
»Gott sei Dank, dass du hier bist«, keuchte Dane erleichtert, denn er verkannte seine Lage. »Colbee, dieser Wahnsinnige versucht, mich zu töten.«
»Dazu hat er auch allen Grund«, erwiderte Colbee. »Aber du wirst leben — fürs Erste.«
»Ich bestehe auf meinem Recht«, sagte Bennelong.
Colbee hob die Rechte. In seiner Hand war ein leuchtend weißes Objekt zu sehen. Tolo erkannte es als einen Knochen, wusste zu dieser Zeit aber noch nicht, dass es ein polierter und geschärfter menschlicher Oberschenkelknochen war.
»Deine Art lässt Beweismittel für das Gesetz der Weißen zurück, mein Sohn«, sagte Colbee zu Bennelong. Er hob den Knochen und deutete damit auf De Lausenette.
Bennelong ließ seine Waffe sinken. »So sei es. Ich beuge mich dir, Colbee.«
»Du lässt also nicht zu, dass er mich tötet?«, fragte Dane erstaunt.
»Nein«, sagte Colbee. »Deine Strafe kommt aus einer anderen Quelle, bis zu deren Ursprung das Wissen der Weißen nicht reicht.«
Als Colbee mit sanfter, leiser Stimme einen Singsang anstimmte unter gleichzeitigen Drohgebärden mit dem Knochen in De Lausenettes Richtung, beobachtete Tolo, wie die Verwunderung auf der Miene seines Hauslehrers allmählich großer Erleichterung wich. Der Engländer wäre um ein Haar durch Bennelongs Hand gestorben, und nun war diese Gefahr vorbei. Stattdessen sang der ältere Aborigine und fuchtelte mit dem Knochen vor De Lausenettes Gesicht herum.
Das Ganze dauerte etwa fünf Minuten, und Tolo schaute wie gebannt zu. Der Klang von Colbees Stimme und die Worte in der Tolo bekannten Sprache ließen keinen Zweifel daran, dass etwas sehr Ernstes vor sich ging — zumindest in der Vorstellung von Colbee und Bennelong. Dann war es vorüber.
»Bring den Jungen zurück zur Farm«, befahl Colbee dem Hauslehrer.
»Er kennt den Weg nicht«, erklärte Tolo. »Er hat sich unterwegs schon verlaufen.«
»Dann bringe du ihn zurück, Junge«, erwiderte Colbee.
»Ich kann nicht zurückgehen«, sagte De Lausenette. »Wenn Mr Mason davon erfährt . . . «
»Er braucht nichts davon zu wissen«, meinte Colbee. »Bist du damit einverstanden, junger Herr, dass diese Sache am besten unter uns bleibt?«
»Ich glaube, ja«, räumte Tolo ein. »Aber hat Mr De Lausenette nicht etwas Schreckliches getan?«
»Lass die Geister das entscheiden«, sagte Colbee.
»Gut, Colbee, wenn du das sagst«, willigte Tolo ein. »Darf ich mit meiner Mutter darüber reden? Sie macht sich sicher Sorgen, weil ich die ganze Nacht weg war.«
»Wir werden ihr sagen, du warst bei mir«, versicherte ihm Colbee. »Wenn du dich beeilst und den direkten Weg nimmst, statt so wie dieser da im Halbkreis zu gehen, kannst du noch im Hellen zu Hause sein.«
Zurück auf der Farm, fand er Misa tatsächlich höchst besorgt vor. Sie hatte die Viehaufseher nach ihrem Sohn ausgesandt und war drauf und dran, einen Boten zur nächsten Viehfarm zu schicken und um Hilfe zu bitten, als Tolo und sein Hauslehrer aus Richtung Wald und Melbourne die Straße entlangkamen.
Tolos und Danes übereinstimmende Erklärung, sie hätten sich gemeinsam mit dem alten Colbee spontan zu einem Ausflug in die Natur entschlossen, klang einsichtig. Misa gab sich jedoch erst dann zufrieden, als Colbee persönlich bei ihr erschien und erklärte, er habe Canby damit beauftragt, der Herrin eine Nachricht zukommen zu lassen. Doch habe dieser unbeholfene, träge Junge seinen Auftrag sogleich vergessen. Misa wusste, wie nachlässig die Aborigines sein konnten, und musste lachen.
»In Zukunft kommst du persönlich zu mir«, wies Misa ihren Sohn an, »und berichtest mir von deinen Plänen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie besorgt ich war. Und du, Colbee, wie konntest du so rasch nach dem Tod deiner Tochter einfach in den Wald gehen?« Sofort hielt sie sich erschrocken die Hand vor den Mund, denn Daringas Tod hatte sich ereignet, während Tolo und der Hauslehrer abwesend waren.
»Ist schon in Ordnung, Mutter«, sagte Tolo, »wir wissen Bescheid. Colbee hat es uns erzählt. Er ist in den Busch gegangen, um mit den Geistern zu kommunizieren, weil er so traurig war.«
Dane De Lausenette zog sich auf sein Zimmer zurück. Er war ziemlich verwirrt. Seltsam, dass er so ungeschoren davonkommen sollte, aber diese Blackfellows hatten nun einmal eine merkwürdige Einstellung zum Leben. Der Zauber oder Fluch, den Colbee ihm im Wald auferlegt hatte, bekümmerte ihn weiter nicht. Von den Geschichten der Aborigines über Zaubereien hatte er sich nie beeindrucken lassen. Er kleidete sich rasch aus und fiel erschöpft ins Bett.
Als Dane an einem neuen Morgen erwachte und alles offenbar wieder seinen normalen Gang ging, seufzte er erleichtert auf. Wenn er in Ruhe darüber nachdachte, war er doch recht dumm gewesen, von der Mason-Farm fortzulaufen. Seine Flucht war es, mit der er die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und Verdacht erregt hatte. Je länger Dane darüber nachdachte, desto mehr kam er zu der Überzeugung, dass er trotz des Zeugen, des Aborigine-Jungen Canby, bei seiner Behauptung hätte bleiben können: Daringas Tod war ein Unfall gewesen. Und das stimmte ja auch. Zugegeben, seine Treffen mit Daringa hätte er nicht leugnen können, da sowohl Tolo als auch der Aborigine-Junge sie zusammen gesehen hatten. Aber mit Daringas Tod war es etwas ganz Anderes. Kein weißer Justizbeamter oder Geschworener hätte zu dem Schluss kommen können, dass ihr Tod etwas anderes war als ein Unfall. Man hätte ihm nicht einmal nachweisen können, dass er irgendetwas damit zu tun hatte — nicht, wenn die Anklage sich lediglich auf die Aussage eines Aborigine- Jungen stützte.
De Lausenette war immer noch aufgewühlt, aber auch sehr erleichtert. Er machte sich klar, wie dumm er gehandelt und was für ein Riesenglück er doch gehabt hatte. Aus welchen Gründen auch immer, jedenfalls hatte Colbee sich dazu entschlossen, Jon Mason nichts von dieser Angelegenheit zu erzählen. Für ihn war das ein großer Vorteil. Jeder kannte Colbee als vertrauenswürdigen Mann, auf dessen Wort man sich verlassen konnte. Somit war Danes Position auf der Mason-Farm nach wie vor sicher. Und von nun an würde er bei jedem Schritt sorgfältig darauf achten, dass es auch so bliebe. Seine Zukunft war ihm zu wertvoll, als dass er sie fortan wegen eines kurzen galanten Abenteuers aufs Spiel setzen würde.
An diesem Vormittag verwandte er mehr Zeit als sonst auf Tolos Unterricht und war fest entschlossen, mit allem so fortzufahren, als sei nichts geschehen.
Am kommenden Morgen jedoch erwachte Dane mit einem vagen, aber hartnäckigen Schmerz in den Unterschenkeln. Am Nachmittag hatte er sich bis in die Oberschenkel ausgebreitet. Danes Beine waren wie betäubt, und gleichzeitig erlitt er Qualen, als rinne Feuer durch jede einzelne Vene und sämtliche winzigen Kapillargefäße. Am Ende des zweiten Tages musste er sich ins Bett legen, da er sich vor Magenkrämpfen krümmte.
Misa war zutiefst beunruhigt und schickte einen der Aborigines nach dem Arzt, der von einer Farm zur anderen reiste, obwohl sie genau wusste, dass es einige Tage dauern würde, bis er hier wäre. In der Zwischenzeit tat sie, was sie konnte, und verabreichte dem Hauslehrer verschiedene Arzneien aus dem Medizinschränkchen.
Doch es half alles nichts. De Lausenette verbrachte — seit Beginn der Schmerzen in seinen Unterschenkeln, auf die Colbees weißer Knochen zuerst gezeigt hatte — eine qualvolle Woche und starb nach einem furchtbaren Todeskampf.
Tolo hatte versprochen, von den Ereignissen im Busch nichts zu erzählen. Nach dem, was er aus Büchern, von Dane und vom Zuhören bei Gesprächen anderer Weißer gelernt hatte, war der Zauber der Aborigines nichts als Unwissenheit und Aberglaube. Und doch war De Lausenette qualvoll gestorben, so wie Colbee es vorausgesagt hatte. Natürlich gab es viele Krankheiten, besonders in diesem Teil der Welt, für die die Ärzte noch keine Behandlungsmethoden kannten. Und auch De Lausenettes Tod konnte gut dazugerechnet werden. Aber Tolo hatte mit eigenen Augen gesehen, wie Colbee um De Lausenette herumgestelzt war und in seinem Singsang den Tod des Weißen prophezeit hatte. In den folgenden Tagen befragte Tolo immer wieder verschiedene Aborigines, einschließlich seines Freundes Canby, erhielt aber nur vage Antworten über die Macht der Geister.
Eines Abends, kurz bevor sein Vater zurückkehren sollte, fragte Tolo seine Mutter: »Die Aborigines sind schon interessante Leute, nicht?«
»Ja, mein Schatz«, sagte Misa
»Hat unser Volk an Geister geglaubt, bevor die Weißen nach Samoa kamen?«, fragte er.
»Sie haben die alten Götter angebetet«, entgegnete Misa, »bis die guten Missionare kamen und ihnen die Wahrheit erzählten.«
»Wie sollen wir wissen, was die Wahrheit ist, Mutter?«
»Oh, so schwerwiegende Fragen bei einem so jungen Menschen«, sagte Misa liebevoll. »In der Bibliothek stehen dicke Bücher, die sich mit derlei tiefgreifenden Gedanken befassen. Die Bände sind fast so groß wie du, mein Sohn. Aber wenn du daraus lernen willst, kannst du ja versuchen, sie zu stemmen, oder?«
2
Ägypten und der Sudan: Oktober 1896
Die Darb El-Gallaba, die Straße der Händler, erhob sich aus dem engen Niltal und führte in die Nubische Wüste des nördlichen Sudan. Der Wechsel kam so plötzlich, dass Lieutenant Slone Vincent Shannon innerlich nicht darauf vorbereitet war. Er hockte etwas unsicher auf seinem Kamel und betrachtete die Umgebung, während er mit seinem Trupp aus der lieblichen, grünen und pflanzenreichen Uferzone völlig unvermittelt auf die verdorrte, kahle Kalksteinschicht der Wüste traf, wo Sand und Fels die starken Strahlen der äquatorialen Oktobersonne reflektierten. Mit zusammengekniffenen Augen blickte er zurück zu der Stadt in der Nähe des zweiten Nilkatarakts, die sie vor kurzem verlassen hatten. Wadi Haifa war nicht mehr zu sehen.
Noch eine Meile weiter, und Slone musste schon ganz genau hinsehen, um zwischen den Felsen, die die Grenzen der schmalen, fruchtbaren Uferzone markierten, überhaupt noch ein Anzeichen des großen afrikanischen Flusses zu entdecken. Anzeichen gab es schon, die aber nur für geübte Blicke zu erkennen waren. Entlang der alten Straße sah er hintereinander Hunderte von kleinen Steinhaufen, die über die Jahrhunderte Steinchen für Steinchen von Reisenden errichtet worden waren, als sie aus der Wüste zurückkehrten. Auf diese Weise hatten sie ihren Göttern dafür gedankt, dass sie dem gesegneten Nil wieder näher kamen.
Slone aber kam nicht zurück, sondern entfernte sich in Richtung Südost immer weiter von dem Fluss durch die endlose Einöde des Sudans.
Neben ihm ritt Lieutenant Percy Girouard, der befehlshabende Offizier des Pionierkorps, zu dem auch Slone gehörte. Percy war Slones Vorgesetzter und auch älter als er, denn er hatte bereits seinen einundzwanzigsten Geburtstag hinter sich, während Slone nicht einmal neunzehn war. Beide trugen die Uniform der britischen Wüstenarmee: schwarze, kniehohe Stiefel, die von einheimischen Dienern allabendlich blankpoliert wurden, nach unten enger zulaufende Khakihosen, die in den Stiefeln steckten, eine Tunika mit engem Stehkragen, der mit den Rang- und Dienstabzeichen geschmückt war, und den Tropenhelm, der für jeden Weißen in Afrika zum Schutz vor der Sonne unerlässlich war.
Beide Offiziere waren der Queen treu ergeben, auch wenn sie auf verschiedenen, durch riesige Ozeane voneinander getrennten Kontinenten das Licht der Welt erblickt hatten. Girouard, ein Frankokanadier, war Absolvent des Royal Military College in Kingston, Ontario. Slone Shannon, der nach zweijähriger Intensivausbildung frisch vom British Royal Military College in Sandhurst kam, war Australier.
Slones Vater, Colonel Adam Shannon, hatte sich in den Maori-Kriegen in Neuseeland ausgezeichnet und später aktiv daran beteiligt, die überhandnehmende Seeräuberei im Chinesischen Meer einzudämmen. Der ältere Shannon, ein echter Kriegsheld und zweifacher Träger des Viktoriakreuzes, hatte seinen Abschied aus der Neuseeland-Miliz genommen und sich mit seiner Frau Emily außerhalb von Brisbane in Queensland angesiedelt.
Von seinem Vater hatte Slone das extrem jugendliche Aussehen geerbt, weshalb man ihn auf der Militärakademie in Sandhurst oft als »Baby-Face« bezeichnet hatte. Solange es sich nur um harmlose Witzeleien handelte, ließ er sie geduldig über sich ergehen. Doch wenn der Spott allzu gehässig wurde, mussten die Söhne Alt-Englands die Erfahrung machen, dass der jungenhaft aussehende Kolonist von Down Under sich durchaus in einem Kampf zu behaupten wusste. In seinen knapp einen Meter achtzig vereinte Slone eine gebündelte Muskelkraft mit erstaunlicher Reaktionsfähigkeit.
Der ausgebildete Ingenieur besaß über sein Wissensgebiet hinaus noch genug andere Interessen. Von dem Augenblick an, als er seinen Fuß in der von Alexander dem Großen gegründeten Hafenstadt auf ägyptischen Boden gesetzt hatte, schickte er seinen Eltern einen unaufhörlichen Strom von Briefen, in denen er alle Aspekte dieses Landes beschrieb. Die Landschaft reichte in ihrer Vielfalt von einer an Tausendundeine Nacht erinnernden Üppigkeit bis hin zu einer Trockenheit, bei der er sich in den heimatlichen australischen Busch versetzt fühlte.
Nachdem Slone Alexandria verlassen hatte, war er durch das geschäftige Kairo gestreift und dann den Nil hinaufgefahren bis zu den Gräbern der alten ägyptischen Könige und Königinnen. Während der Reise hatte er über Büchern gehockt, die er sich in Kairo gekauft hatte, und wusste inzwischen sehr viel mehr über die Geschichte von Ober- und Unterägypten sowie über den Sudan als irgendjemand sonst in seinem Trupp. Sogar mehr als Percy Girouard, der wenig Interesse an Geschichte zeigte und alles so nahm, wie es kam. Slone wusste auch mehr als der grauhaarige Sergeant, der bereits seit Jahren hier stationiert war und die Organisation für den Kamelritt des Trupps durchgeführt hatte. Und er wusste auch mehr als die einheimischen ägyptischen Soldaten, die die Arbeit und die Wache übernahmen.
Nördlich der Stadt Khartum im Sudan verläuft der Nil durch die von der Sonne versengte Nubische Wüste in weiten Biegungen, was auf der Landkarte wie der von zittriger Hand geschriebene Buchstabe S aussieht. An sechs Stellen fließt der große Fluss durch Granit-Verengungen, die berühmten Nilkatarakte, an denen er deutlich schneller wird.
Während der gesamten überlieferten Geschichte haben die Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen gegen die natürlichen Hindernisse dieser Katarakte und der Wüste angekämpft, um von Ägypten aus nach Süden reisen zu können. Den Einen ging es um das kohlensaure Natron, eine Substanz, die in alter Zeit für die Einbalsamierung der Pharaonen benötigt wurde. Andere ließen sich von dem Gold verlocken, das angeblich im Land Punt — das war der ägyptische Name für die Länder östlich des Sudans — zu finden war. Wieder andere betrachteten den Sudan als reiche Quelle an Sklaven. Während Slone Shannon und sein Trupp südwärts ritten, kamen sie an Tausenden von kleinen Kieshaufen vorbei, den Überresten der Feuerstellen, in denen die Sklavenkarawanen ihr Brot gebacken hatten.
In den letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts regierten in Ägypten die Briten, und der Sirdar, der Oberbefehlshaber der ägyptischen Armee, war Horatio Herbert Kitchener. Er war ein tatkräftiger, ehrgeiziger Mann, dem viele seiner Offizierskollegen nur Verachtung schenkten. Kitchener führte soeben eine Armee in den Sudan, in »das Land der Geister«, um ein altes Unrecht wiedergutzumachen: das Martyrium seines Helden, General Charles George Gordon, vom 26. Januar 1885. Der nach seiner Unterdrückung des Taiping-Aufstandes in den 1860er Jahren als »Chinese« Gordon bekannte General war bei der Eroberung und Zerstörung Khartums durch fanatische Moslems, Anhänger des Mahdi, des »Rechtgeleiteten«, Herrscher des Sudans, erschlagen worden.
Der Mahdi selbst hatte Gordon auch nicht lange überlebt, sondern war im Juni 1885 gestorben. Sein Königreich war unter die starke Hand seines Nachfolgers Abdallahi Ibn Muhammad gefallen, bekannt als der Kalif. Und dieser Mann war nun Kitcheners Gegner. Seit zehn Jahren brannte das Feuer der Rache in Kitchener, und nun war sein Ziel, die Befreiung des Sudans, zum Greifen nahe.
Im Oktober 1896 war Kitcheners Vorhut mit Flussbooten bis nach Merowe gelangt, das fast genau auf halber Höhe der S-Biegungen des Nils und nah genug an Abu Hamed lag, dass man diese Stadt zwischen dem vierten und fünften Katarakt von dort aus angreifen konnte. Abu Hamed war von den Streitkräften des Kalifen besetzt. Um die Merowe-Einheit zu vergrößern, hatte Kitchener beschlossen, dem schlangenförmigen Verlauf des Nils den Rücken zu kehren und die Hauptstreitmacht seiner Armee — Männer, Pferde, Kamele, Kanonen, Wagen, Nahrung und Ausrüstung — quer durch die Nubische Wüste zu bringen. Und zwar per Eisenbahn, die von Wadi Haifa nach Abu Hamed gebaut werden sollte, am oberen Ende der zweiten großen Biegung des Nils.
Der Auftrag für Lieutenant Girouards kleine Gruppe bestand darin, die Vorarbeiten für eine spätere, umfangreichere Vermessung der Eisenbahnstrecke zu leisten. Mit dem Bau sollte im Januar 1897 begonnen werden. Ziel war es, die Armee mit der Eisenbahn in die Nähe von Abu Hamed zu befördern, während die Stadt gleichzeitig von den Streitkräften angegriffen werden sollte, die von Merowe aus nilaufwärts fuhren.
Wäre Abu Hamed erst erobert, brauchten mit der zu bauenden Eisenbahn nur noch der fünfte und der sechste Katarakt sowie ein paar zusätzliche Meilen durch die glühend heiße Wüste überwunden zu werden, bis Kitchener sein endgültiges Ziel erreicht hätte: Omdurman, die neue Hauptstadt des Derwisch-Reiches des Kalifen, die jenseits der Ruinen von Khartum am anderen Ufer des Nils lag.
Eine Eisenbahn durch die Wüste zu bauen, wo die Temperaturen an den Hundstagen im Sommer auf zweiundfünfzig Grad Celsius stiegen, war eine beinahe unlösbare Aufgabe. Kitchener war daher weitgehend von seinen Mitarbeitern abhängig, sorgsam ausgewählten jungen Subalternoffizieren, die gleichzeitig als Ingenieure tätig waren. Dazu zählten auch Slone und Percy. Ebenso wie diese beiden Lieutenants kamen viele von ihnen aus weit entlegenen Orten des britischen Empires. Bekannt wurde diese Ingenieurgruppe als »Kitchener’s Boys.« Der Sirdar ließ ihnen besondere Aufmerksamkeit zukommen und gab ihnen immer wieder Gelegenheit, sich in der Schlacht auszuzeichnen, indem er sie bei ausbrechenden Gefechten sofort an die Front rief. Girouard beispielsweise hatte im vergangenen Monat während der Besetzung von Dongola, weiter unterhalb von Merowe, den Orden für besondere Dienste verliehen bekommen.
Nun ritten Slone und Percy Girouard Seite an Seite auf der uralten Handelsstraße die parallelen Kamelspuren entlang. Vor ihnen war nur der Staub zu sehen, den der ägyptische Kundschafter mit seinem Kamel aufwirbelte, sowie die über dem Sand schwebende flimmernde Hitze.
Von Anfang an, seit Slone das britische Kanonenboot in Wadi Haifa verlassen hatte, kamen die beiden jungen Offiziere gut miteinander aus. Girouard war ein dunkler Typ wie seine französischen Vorfahren. Er hatte tiefliegende, dunkle Augen und volle, sinnliche Lippen. Er war etwas kleiner als Slone, hatte aber einen breiteren Brustkorb. Gewöhnlich war er unbeschwert und gelassen. In der Wüste bestand er nicht auf strenger militärischer Höflichkeit, obwohl beide sich stets bewusst waren, wer von ihnen das Kommando führte. Percys einnehmendes Wesen machte ihn für Slone zu einem angenehmen Begleiter. Girouard hatte ihm sogar bereits geholfen, indem er ihm eine besondere Creme anbot, die er in Kairo gekauft hatte, um sich damit vor der Sonne zu schützen. Da Slone hellere Haut als Percy hatte, war die Creme für ihn geradezu ein Lebensretter.
Slone warf Girouard einen verstohlenen Seitenblick zu und bemerkte, dass dieser trotz der Hitze und des strapaziösen Ritts recht entspannt wirkte. Der Ritt auf einem Kamel war irgendwie vergleichbar mit dem Segeln in einem kleinen Boot auf kabbeliger See. Einige der Männer wurden von dem ruckartigen Schwanken förmlich seekrank. Abgesehen von dem Gefühl, er würde jeden Augenblick aus dem Sattel rutschen, hatte Slone gegen diese Art der Fortbewegung nichts einzuwenden. Aufmerksam hörte er Percy zu, der die Winter in Ontario mit ihrem herrlichen Schnee, der klirrenden Kälte, gemütlichen Kaminfeuern und heißem Apfelwein beschrieb.
Die bloße Erwähnung von Flüssigkeit löste bei Slone großen Durst aus. Um seine Gedanken vom Wasser abzulenken, hob er den Kopf und spähte zum Horizont. Seinen Blicken boten sich kahle, zerklüftete Sandsteinfelsen, die sich nach Westen hin erstreckten. Weit entfernt zur Rechten erhob sich eine Windhose: Wie bei einem wilden Schleiertanz wirbelte eine verschwommene Staubwolke deutlich sichtbar bis in große Höhen.
Vielleicht spürte Girouard, dass er Slones Aufmerksamkeit verlor, jedenfalls wechselte er das Thema. »Sie sind ein Glückspilz, Shannon«, sagte er. »Wenn Sie sich nicht vor der Pflicht drücken und sich nichts zuschulden kommen lassen, werden Sie bald merken, dass Sie in der besten Einheit der gesamten Armee gelandet sind. Um Ruhm und Vermögen zu erlangen, haben Sie nirgendwo bessere Chancen.«
Slone lachte. »Um ehrlich zu sein, Sir, habe ich mir um meine Zukunft noch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Ich muss zuerst zusehen, dass ich mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehe und mich im wirklichen Leben zurechtfinde.«
»Ja natürlich«, sagte Girouard, »aber das geht schnell. Sie werden sehen, Shannon, der Sirdar ist ein anständiger Kerl, ein sehr anständiger Kerl. Wenn die Zeit reif ist und er den Kalifen in die Enge getrieben hat, werden Sie nicht auf der Strecke bleiben. Der Sirdar wird schon dafür sorgen, dass jeder von uns eine ehrliche Chance bekommt.«
Slone nickte. Er hatte sich schon oft gefragt, wie er im Einsatz reagieren würde. Die Ausbildung mit ihren vorgetäuschten Kämpfen war eine Sache. Über ein offenes Feld in die Gesichter von Männern zu blicken, die einen unbedingt töten wollen, war eine ganz andere.
Sie kamen an einem ausgeblichenen Skelett vorüber, das halb vom Sand zugeweht war. »Das arme Tier«, sagte Girouard und schüttelte bedauernd den Kopf. Noch bevor die sengende Sonne rasch hinter den Horizont sank, hatten sie noch weitere Skelette gesehen. Selbst Kamele, diese am besten an das Wüstenklima angepassten Tiere, waren nur eine Tagesreise vom Nil entfernt verdurstet. Je weiter die kleine Einheit nach Süden kam, desto häufiger würden sie auf Zeugnisse vergangener Not treffen. Als sie einen besonders anstrengenden Aufstieg zu einem Hügel geschafft hatten, fanden sie sogar aufeinandergeschichtete Skelette.
»Gütiger Gott«, entfuhr es Slone. »Wo sollen wir bloß das Wasser für die Lokomotiven hernehmen, sofern uns der Bau einer Eisenbahnlinie durch dieses Ödland überhaupt gelingt?«
»Brunnen«, antwortete Girouard.
»Brunnen? Hier?«
»Keine Angst. Wir finden Wasser«, sagte der Kanadier fröhlich. »Kitchener hat immer Glück. Der Sirdar sagt, wenn ein General kein Glück mehr hat, gehört er zum alten Eisen.«