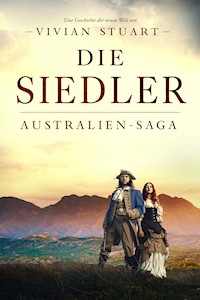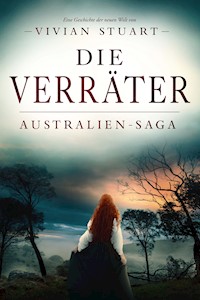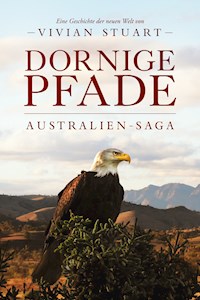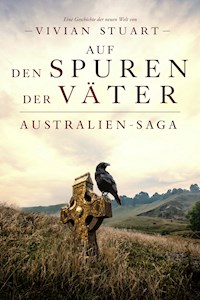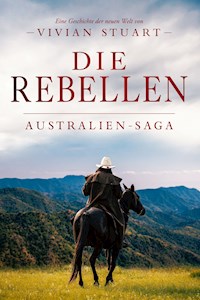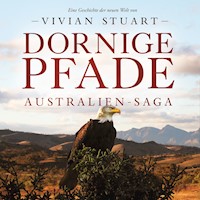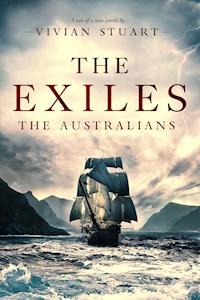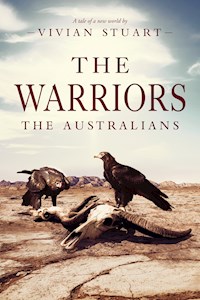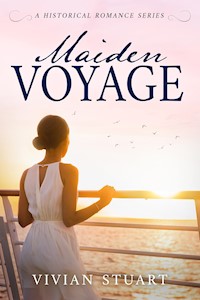Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Ende des 19. Jahrhunderts rückt näher. Große Schiffe fahren von Australien aus über die Weltmeere: Handelsschiffe und Kriegsschiffe mit Männern, die den ersten Siedlern an Mut und Leidenschaft nicht nachstehen. Familien wie die Broomes lassen Australien an Macht und Glanz gewinnen und wagen ehrgeizige Blicke in eine große Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Seefahrer
Die Seefahrer – Australien-Saga 10
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1988
© Deutsch: Jentas ehf 2022
Serie: Australien-Saga
Titel: Die Seefahrer
Teil: 10
Originaltitel: The Seafarers
Übersetzung : Jentas ehf
ISBN: 978-9979-64-320-3
Anmerkung des Autors
An Bord der Cutty Sark, einem der letzten großen reinrassigen Klipper, hat es nie einen Maat namens Samuel Gordon gegeben. Von den Reisen dieses Schiffes gibt es detaillierte Berichte, die für dieses Buch in manchen Fällen in der Zeit versetzt sind, damit sie sich besser in den Rahmen dieser erfundenen Geschichte einfügen. Einige der beschriebenen Szenen haben sich in Wirklichkeit nicht auf der Cutty Sark, sondern auf anderen Schiffen zugetragen. Der Autor nimmt sich diese dichterische Freiheit, um in seinem Buch den Lebensstil zu verdeutlichen, den das Segeln auf einem Klipper mit sich bringt. Die Cutty Sark als Inbegriff dieser schnittigen Segelschiffe scheint ihm für diesen Zweck gut geeignet.
Prolog
22. November 1869
Jock Willis’ Lächeln blieb hinter seinem buschigen weißen Bart und seinem dichten Schnurrbart versteckt, doch sein Blick und die geröteten Wangen verrieten deutlich seine Zufriedenheit. Der stämmige Schotte trug einen dunklen Frack, eine helle Weste, ein strahlend weißes Leinenhemd und den ausgeblichenen Filzzylinder, der ihm den Spitznamen »Old White Hat« eingebracht hatte. Er stand im Bug des Schiffes, seines Schiffes, eine Hand in der Hosentasche, und betrachtete die in großer Zahl erschienenen Bewohner von Dumbarton, die erwartungsvoll nach oben schauten. Sie drängten sich auf der gesamten Konstruktionsplattform, die nun als Tribüne für die Schiffstaufe diente. Trotz des kalten schottischen Winters waren sie an die Küste gekommen, um Zeuge dieser altehrwürdigen Zeremonie zu werden, derentwegen Jock extra die Reise aus London auf sich genommen hatte. Ihm gehörte die Werft, und seiner Ansicht nach war das vom Stapel zu lassende Schiff sein bisher bestes.
Ein Stapellauf zog immer viele Leute an, aber nicht so viele wie dieser. Bereits seit Jahrhunderten wurden im Leven-River, kurz vor der Mündung in den Clyde, Schiffe vom Stapel gelassen. Der Doppelgipfel des Felsens von Dumbarton hatte seit jeher als stummer Zeuge darüber gewacht, wie römische Galeeren, mittelalterliche Galeonen und stattliche Ostindienfahrer ankamen oder ausliefen. Und in jüngerer Zeit waren von Dumbarton aus die am Clyde gebauten eleganten, flachen Doppelschaufelrad-Dampfer in See gestochen, die rasch und unbemerkt die Marineblockade der Nordstaaten von Amerika durchbrachen, um in die Häfen der kampfbereiten Konföderierten zu gelangen.
Die Männer von Dumbarton arbeiteten als Zimmerleute, Schmierer, Schreiner, Kalfaterer, Takler und Festmacher. Der Schiffsbau lag ihnen im Blut, und selbstverständlich waren alle, die beim Bau dieses neuen Schiffs mitgewirkt hatten, nun zur Stelle. Schließlich handelte es sich nicht um ein x-beliebiges Schiff. Schlank sah es aus und anmutig und wirkte auf seinem Bett aus Kielblöcken so geschmeidig wie ein Seeotter.
Es war ein Klipper. Stück für Stück war es aus dem Wirrwarr von Holz und Eisen entstanden, deren Reste noch überall auf der Werft verstreut lagen. Ausschließlich Eiche, Metall und Teak hatte man zu seinem Bau verwendet. Weichholz wie in Amerika, wo Eiche knapp war, kam für dieses Schiff nicht infrage. Old Jock hatte darauf bestanden, dass nur die besten Materialien Verwendung fanden: Eiche aus dem Forest of Dean in Gloustershire und aus dem New Forest of Hampshire.
Durch Letzteren war einst ein Admiral im Ruhestand, die Taschen voller Eicheln, gewandert und hatte die Samen in die Erde gesteckt, damit den Engländern das haltbare Eichenholz nie ausgehen möge.
Auch wenn dringende Geschäfte Old Jock in London festgehalten hatten, waren seine Wünsche bis ins kleinste Detail ausgeführt worden. Dafür hatte Kapitän George Moodie gesorgt, der die Ehre besaß, mit diesem Schiff in See zu stechen.
Old Jock war Geschäftsmann, und zwar ein guter. Da er schon als kleiner Junge zur See fuhr, hatte er früh ein hartes Leben kennengelernt. Er arbeitete sich bis zum Kapitän hoch und segelte auf großen Schiffen in die fernen Häfen dieser Welt. Die Jahre auf See hatten ihn stark und weise gemacht. Er gab nie ein überflüssiges Pfund aus, aber er war fair. Nie verließ ein Schiff von John Willis & Son den Hafen, ohne dass Old White Hat, Old Jock, am Kai stand, seinen Zylinder zog und rief: »Lebt wohl, Jungs.«
Als wahrer Sohn Schottlands vereinte er vielerlei Begabungen in sich: Seefahrer, Geschäftsmann und Familienvater. Und tief im Herzen war er auch ein Dichter — oder doch zumindest ein Liebhaber der Dichtkunst. Unter seinem Filzhut fand sich für jede Gelegenheit und für jede Stimmung der passende Vers. Als ihm einmal sein junger Konstrukteur Hercules Linton eine Materialliste für den Klipper erstellt hatte, zitierte Old Jock Verse von Longfellow:
Das Bauholz wähle mit Bedacht,
damit nichts morsch ist, gib gut acht,
denn nur, was völlig fehlerfrei,
ein Teil bei diesem Schiffsbau sei.
Selbstverständlich hatte der amerikanische Dichter sich von einem Klipper inspirieren lassen, den der beste Handwerker Bostons, Donald McKay, gebaut hatte. Seine Flying Cloud hielt auch jetzt noch den Rekord für eine Tagesfahrt mit unglaublichen dreihundertvierundsiebzig Meilen bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fünfzehn Knoten.
Dieser Umstand hatte maßgeblich zu Old Jocks Entscheidung beigetragen, einen Klipper zu bauen, der aus starken Eisenspanten und -streben im Verbund mit bester englischer Eiche bestand. Old Jock verfügte über ein gutes Gedächtnis und eine gehörige Portion Nationalstolz. Im allgemeinen Bewusstsein galt Donald McKay als Amerikaner, und diese Schmach wurde nur wenig gemildert durch die Tatsache, dass dieses amerikanische Schiffsbaugenie eigentlich ein Schotte war, denn schließlich war er auf Nova Scotia geboren. Außerdem wurde es Zeit, diesen emporgekommenen ehemaligen Kolonisten zu zeigen, wer immer noch die Meere beherrschte.
Schlimm genug, dass McKays Boston-Klipper sämtliche Geschwindigkeitsrekorde für ihre Überfahrten hielten. Noch schlimmer war jedoch die Erinnerung an den August 1850, auch wenn seitdem bereits etliche Jahre vergangen waren. Damals hatte die amerikanische Oriental vom Hongkonger Hafen aus London in genau neunzig Tagen erreicht. Tee aus China herüberzubringen oblag schließlich der britischen Handelsmarine. Dass ein amerikanisches Schiff mit der ersten Fracht der neuen Ernte im Londoner Hafen einlief und die höchsten Gewinne erzielte, traf den sparsamen, patriotisch gesinnten Old Jock mitten ins Herz.
Aber auch gegen einen anderen Rivalen hegte Old Jock einen geheimen Groll — und der war jüngeren Datums. Der britische Eigner George Thompson war mit seinem neuesten Klipper, der Thermopylae, die im vergangenen Jahr vom Stapel gelaufen war, geradezu anmaßend aufgetreten. Vielleicht stimmte es sogar, dass die Thermopylae derzeit das schnellste Schiff auf See war, doch hatte sie den Beweis dafür noch nicht angetreten. Und bevor sie anfing, neue Rekorde aufzustellen, wäre ihr Konkurrenz gewiss. Ihre erste Überfahrt von China zurück nach Hause hatte genau einundneunzig Tage gedauert.
Jock blickte auf die Teakplanken unter seinen Füßen. Sein ausgezeichnetes Schiff würde diese Zeit unterbieten. Da war er sich völlig sicher. Sein neues Schiff unter Captain George Moodie würde den goldenen Hahn vom Großmast der Thermopylae stürzen, und dann könnte alle Welt sehen, wer der Stolz der Meere war.
An Zweiflern mangelte es nicht, die Jocks Entscheidung infrage stellten, einen Klipper statt eines weiteren Dampfschiffs zu bauen. Doch Jock musste kein Hellseher sein, um zu wissen, dass Dampfschiffe für die Überfahrt nach Australien oder in den Fernen Osten nicht ausreichend Kohle bunkern konnten. Und er hatte nicht den Wunsch, auf das Wohlwollen irgendwelcher entlegener Kohlenstationen angewiesen zu sein, die von Gott weiß wem betrieben wurden. Immer noch transportierten große Segelschiffe Tee aus China und Wolle aus Australien und Neuseeland. Bis durch die Öffnung des Suezkanals die derzeitige Situation sich änderte, hätte sein neues Schiff sich bereits ausgezahlt und sogar einen ordentlichen Gewinn abgeworfen. Davon war Jock fest überzeugt.
Auf lange Sicht würde der Kanal sich natürlich auf die Schifffahrt auswirken, aber in absehbarer Zukunft mussten die Tee- und Wollklipper mit ihren Segeltuchwolken noch das Kap der Guten Hoffnung umschiffen und diesen stets stürmischen Teil des Ozeans zwischen dem neununddreißigsten und dem fünfzigsten Breitengrad befahren, der bei allen Seglern als »Roaring Forties« berüchtigt war.
Auf der Heimfahrt waren sie dann der endlosen, hohen Dünung des südlichen Ozeans ausgesetzt, wo die Graubärte vor Kap Horn hoch aufwogten, sich zu Wellenkämmen von über fünfzig Fuß auftürmten und jedes Schiff zum Schlingern brachten.
Auf solchen Meeren wäre dieses Schiff in seinem Element. Die Winde, die von Westen kommend um die ganze Welt bliesen, würden sich in den gut dreitausend Quadratmetern Segeltuch versammeln und sich in die treibende Kraft von dreitausend Pferdestärken verwandeln. Dieses Schiff würde die von Gott geschaffene saubere Luft nicht mit dem Gestank des Kohlenqualms verpesten. Nur das Rauschen des Windes in der Takelage und das Zischen des Schaums beim Durchschneiden der Wogen wären die Begleiter des über zweihundertzwölf Fuß langen Schiffs. Es bräuchte keinen Kampf gegen die See zu führen, sie nicht mit Schlägen traktieren oder nach unten drücken, denn es würde nicht über, sondern durch die Wellen gleiten.
Ein lauter Ruf zog Jocks Aufmerksamkeit auf sich. Weiter vorn im Bug stand der junge Hercules Linton, der Schiffskonstrukteur, und schwenkte seinen Zylinder. Neben ihm stand der Chefkonstruktionszeichner John Rennie, der Captain Moodie die Hand auf die Schulter gelegt hatte. Jock nahm die Hand aus der Tasche und winkte zurück.
Moodie brüllte unter Zuhilfenahme eines Messingsprachrohrs einen Befehl an die Arbeiter unten. Entlang der Helling machten die Handwerker sich mit ihren Vorschlaghämmern bereit. Bei Moodies nächstem Zuruf hoben die Männer ihre Werkzeuge, und auf seinen letzten lauten Befehl hin schlugen sie mit den Hämmern gegen die Spreizhölzer, die den relativ leichten Schiffsrumpf von der eingefetteten Helling fernhielten.
Das Klopfen der schweren Hämmer hallte von den Hügeln wider und wurde zu einem donnernden Stakkato. Beim Dröhnen der Hämmer war kaum zu hören, wie eine Flasche bester Wein an dem elegant überstehenden Vordersteven zersplitterte. Jocks ältere Tochter hatte die Flasche beim ersten Schwung zerbrochen, und als das Schiff sich knarrend zu bewegen begann, rief sie mit lauter Stimme: »Ich taufe dich auf den Namen Cutty Sark.«
Mit dem Heck zuerst glitt sie erst langsam, dann immer schneller hinab und durchschnitt schließlich die Wasser des Leven, die von allen Seiten hoch aufspritzten. Freudenrufe erklangen. Als der Rumpf vom Wasser umspült wurde, kurz aufhüpfte und dann sanft weitertrieb, atmete Jock erleichtert aus. Die Kupferverkleidung wurde bis auf wenige Fuß vom Wasser verdeckt. Kupfer war furchtbar kostspielig, aber die einzige Möglichkeit, um ein Schiff vor dem raschen Überkrusten mit Entenmuscheln zu bewahren.
Jock sah sich um und schaute in die lächelnden Gesichter der winkenden Honoratioren im Bug. Nur ein Gesicht fehlte.
Er musste schreien, um die Dudelsackspieler am Ufer zu übertönen. »Wo ist der junge Sam?«
Die Cutty Sark glitt weiter, während die von ihrem Stapellauf verursachten Wellen sich zum Ufer hin ausbreiteten. Der Mann neben ihm deutete zum Fuß des Bugspriets. Jock folgte mit den Blicken seinem ausgestreckten Zeigefinger und sah, wie der Sohn seiner Nichte, der vierzehnjährige Samuel Gordon, gefährlich an den Kettenwanten baumelte und eine Hand nach der junonischen Galionsfigur ausstreckte, die aus dem äußersten Ende des geneigten Bugs hervorragte.
Während der Bauzeit des Klippers hatte Sam Gordon ganze Arbeit geleistet, wie ein Erwachsener. Sam war ein hübscher Junge und recht groß für sein Alter. Sein noch im Wachstum befindlicher Körper war schlank und hatte geschmeidige Muskeln; sein wilder Haarwust wirkte wie schottisches Stroh. Seit Sams zehntem Geburtstag verband Old Jock große Hoffnungen mit dem Jungen. John Willis & Son war ein Familienunternehmen, das Jock von seinem Vater übernommen hatte, und eines Tages würde es für den jungen Sam eine verantwortungsvolle Stelle darin geben.
»Was macht der Junge denn da?«, fragte jemand.
Durch Old Jocks unter seinem Bart verstecktes Lächeln wurden seine roten Wangen faltig, und seine Augen kniffen sich zusammen. Sam war taktvoll darauf bedacht, nicht die entblößten Brüste der Galionsfigur zu berühren. Die Beine hatte er an den Ketten festgehakt und hing jetzt mit dem Kopf nach unten. Dann ergriff Sam das Handgelenk der Galionsfigur am linken ausgestreckten Arm.
Natürlich gab es auch dafür die passenden Verse. Als Old Jock seinen Großneffen bei seinem Vorhaben beobachtete, hallte der vertraute schottische Dialekt in seinem Kopf wider. Schottlands ureigenster Dichter Bobby Burns hatte eine alte Legende aufgegriffen und sie zu rhythmischen Versen versponnen: Die Geschichte von Tarn O’Shanter, der, vom guten schottischen Whiskey leicht benebelt, ein betörendes Wesen tanzen sieht, das nur mit einem kurzen Hemd bekleidet ist: einem »Cutty Sark«.
Nicht jedermann war klar, dass Old Jock den Namen für seinen außergewöhnlichen Klipper aus Burns Gedicht übernommen hatte — oder wenigstens war ihnen der Zusammenhang nicht aufgefallen. Und nicht jeder, der den jungen Sam Gordon so gefährlich an den Bugsprietwanten baumeln sah, erkannte die Bedeutung dessen, was er dort tat. Der Junge zwängte der üppigen Galionsfigur ein an einem Ende ausgefranstes Stück Tau in die Linke.
Old Jock lachte so schallend, dass der Mann neben ihm erschrak. »Gut gemacht, mein Junge!«
Sam Gordon hörte ihn, und nachdem er sich wieder hochgezogen hatte, winkte er grinsend. Gleichzeitig wurde die Cutty mit heftigem Ruck Richtung Dock geschoben, wo in den folgenden Wochen die hochragenden Spieren angebracht und zehn Meilen laufendes und stehendes Gut an seinem Platz befestigt würde.
Jock musste wieder an das Gedicht denken: an den Aufschrei des Von der aufreizend bekleideten Hexe bezauberten Tarn O’Shanter und an die anschließende Jagd, bei der die Tarn nacheilende schöne junge Hexe, die schnell war wie der Wind, ihm so nahekam, dass sie seinem Pferd den Schweif ausriss. Das einem Pferdeschwanz ähnelnde ausgefranste Tau war ein Symbol für Geschwindigkeit, für die Schnelligkeit einer rasenden Hexe. Sam Gordon hatte dem Schiff die Rasanz jener Hexe übertragen, indem er der Galionsfigur der Cutty das Symbol in die Hand drückte.
Hilfreiche Hände zogen Sam zurück an Deck, und Jock bahnte sich seinen Weg durch die Honoratioren, um dem Jungen zu gratulieren.
»Onkel Jock«, sagte Sam mit vor Aufregung gerötetem Gesicht, »ich muss einfach mit ihr fahren!«
Old Jock lachte in sich hinein. In dem Jungen fand er sich selbst wieder, so wie er früher einmal war. Er mochte die vergangenen Jahre gar nicht zählen. Als er zum ersten Mal zur See fuhr, war er sogar noch jünger gewesen als Sam jetzt. Und damals herrschten viel primitivere Verhältnisse an Bord eines Schiffes als heute. Für fünfzig Schilling im Monat hatte er gearbeitet und sich von Schiffszwieback, breiigen Suppen, zerbrochenen Kräckern und Pökelfleisch ernährt.
Seine Anfangszeit auf einem britischen Schiff verbrachte er überwiegend auf einer eisbedeckten Rahe. Mit gefrorenen Fingern und aufgeplatzten Nägeln stand er hundert Fuß über einem stampfenden, schräg liegenden Deck auf einem schwankenden Tau. Höchstwahrscheinlich würde sein Großneffe bald dieselben Erfahrungen machen, denn die großen Schiffe mussten immer noch das stürmische Kap Horn umschiffen. Und die Männer an Bord mussten immer noch in dem eisigen Weißwasser arbeiten, das über die Decks wirbelte. Sie mussten auf der Back leben, die häufig so stark überspült wurde, dass das Wasser um ihre Kojen spritzte. Nie waren sie richtig trocken, nie wirklich ausgeruht und hatten aus Schlafmangel ständig tiefe Ringe unter den Augen.
Einen kurzen Augenblick lang beneidete er den Jungen. Sam würde hören, wie die Segel donnernd im Wind knallten, und er würde die Geschwindigkeit spüren, wenn ein guter Kapitän das Schiff so hart am Wind führte, dass die Leereling die Wasseroberfläche berührte.
»Du brauchst eine Ausrüstung«, sagte Old Jock.
»Ich habe von meinem Lohn etwas gespart«, erwiderte Sam spontan.
Jock machte eine abweisende Handbewegung.
»Kommt nicht infrage«, sagte er. »Die bekommst du als kleines Geschenk von deinem Onkel.« Der Junge begann zu stammeln, doch Jock schnitt ihm das Wort ab. »Spar dein hart verdientes Geld, mein Junge.«
»Du meinst, ich darf also wirklich auf das Schiff, Onkel Jock?«
»Captain Moodie wird dir alles beibringen. Natürlich nur, wenn deine Ma und dein Pa nichts dagegen haben. Und glaub bloß nicht, das wäre Vetternwirtschaft oder ich täte dir einen Gefallen. Moodie ist ein harter Brocken, und du musst schon ordentlich zupacken, um ihn zufriedenzustellen.«
»Ich werde mich gewiss tüchtig anstrengen, Onkel Jock«, sagte Sam.
Old Jocks Lächeln schwand. Ausdruck und Benehmen des jungen Samuel waren durch besonders vornehme Schulen und vorwiegend weibliche Gesellschaft geprägt worden, vielleicht schon viel zu stark. Er war ein gut aussehender Bursche, sauber angezogen und sympathisch, aber womöglich ein wenig zu weich für die See. Nicht von seinem Körperbau her, Gott bewahre, aber was sein Temperament anging. Vermutlich würden die anderen Besatzungsmitglieder ihn hänseln. Schließlich arbeiteten auf einem Klipper auch reichlich Trunkenbolde, flüchtige Verbrecher und gewaltsam angeheuerte Landratten — ein wilder Haufen also, in dem sich nur ein paar wenige erfahrene Seeleute fanden. Aber gut, dieser Bursche würde seinen Weg schon gehen.
Jock legte dem Jungen liebevoll die Hand auf das wirre strohfarbene Haar.
Ja, dieser Junge wird sich bewähren, dachte er, wie auch seine Vorfahren in der Vergangenheit sich bewähren mussten.
Und wenn es denn Gottes Wille war, würde er zum Mann heranwachsen und vielleicht eines Tages das Steuer eines Klippers von John Willis & Son übernehmen.
22. Januar 1879
Der noch unerfahrene Lieutenant Jon Fisher empfand sein Offiziersdasein im Dienste Ihrer Majestät in der Kolonie Natal als durchaus angenehm. Natürlich schien die Sonne in Südostafrika oft unerträglich heiß, war das Klima entsetzlich trocken und der von Lord Chelmsfords Armee aufgewirbelte Staub manchmal ein geradezu erstickendes Miasma. Die Landschaft aber zeigte sich in erhabener Pracht.
Gemeinsam mit zwanzig frisch eingezogenen Rekruten war Jon aus England gekommen und erst vor wenigen Wochen zu seinem Regiment gestoßen. Die Strecke von der Küste des Indischen Ozeans aus ins Landesinnere hatte er in angenehmer Gesellschaft von zwei australischen Landsleuten zurückgelegt, die mit ihrer Wagenkolonne die Armee mit Nachschub versorgten. Kurz bevor die Armee bei Rorke’s Drift den Buffalo River überschritt, hatten sie sie eingeholt, und sogleich war Jon dem Vierundzwanzigsten Infanterieregiment innerhalb des Zweiten Bataillons zugeteilt worden.
Inzwischen befand sich das Feldlager der fünf Kompanien des Ersten Bataillons und der einen Kompanie des Zweiten Bataillons, zu der Jon gehörte, mehr oder weniger zufällig verteilt an den Hängen eines braunen, grasbedeckten Berges mit dem Namen Isandhlwana.
Der Morgen dieses 22. Januars war wie der erste Tag der Schöpfung: dichte Nebel über dem Tiefland, ein kobaltblauer Himmel, ein leichter Wind und eine wärmende Sonne. Der Blechbecher voll chinesischem Tee in Jons Händen, mit dem die australischen Armeelieferanten sie von ihrer langen Wagenkolonne aus versorgt hatten, strahlte Wärme ab.
Rings um ihn her frühstückten in aller Ruhe seine Offizierskollegen. Der General, Lord Chelmsford, hielt sich nicht im Lager auf. Bereits vor Sonnenaufgang war er mit einem Teil seiner Streitkräfte aufgebrochen, um einem Spähtrupp Verstärkung zu bringen. Zu Jons Verwunderung hatte Chelmsford seine Armee, bestehend aus einer fünftausendköpfigen regulären britischen Streitmacht und etwa achttausend Mann zwangsweise rekrutierter einheimischer Hilfstruppen, kurz vor der Überquerung des Buffalo River aufgeteilt. Und nicht etwa in zwei, sondern in drei Kolonnen. Um diese unorthodoxe Entscheidung ging es nun bei dem Wortgeplänkel unter dem Vorzeit der Offiziersmesse. Die Offiziere, allesamt gute Soldaten, hielten sich zwar mit der Kritik an ihrem Vorgesetzten zurück. Die Zivilisten Andy Melgund und Harry Ryan aber nahmen mit der den Kolonisten eigenen Frechheit weit weniger Rücksicht auf den Ruf des guten Generals.
»Der hält sich wohl für General Robert E. Lee, dass er angesichts des Feindes seine Streitkräfte aufspaltet, wie?«, fragte Harry Ryan.
»Und dieses Feldlager«, bemerkte Andy Melgund. »Sieh dir das nur an! Ich bin weiß Gott kein militärisches Genie, aber ich hielte es für angebracht, wenigstens eine Wagenburg zu bauen und die Jungs vielleicht ein paar Schützengräben ausheben zu lassen.«
»Also wirklich«, sagte ein geschniegelter Unteroffizier, »vor welchem Feind sollten wir uns wohl schützen? Vor den Schwarzen mit ihren Speeren? Ich glaube kaum, dass dieser Cetshwayo seine Männer in eine britische Feuerlinie führen wird. Was können diese Wilden gegen eine moderne Armee mit Martini-Henry-Karabinern denn schon ausrichten?«
Melgund warf Ryan einen amüsierten Blick zu.
»Solche Bemerkungen habe ich schon einmal gehört«, sagte er, »über die Maori in Neuseeland. Auch die wurden als Wilde bezeichnet. Doch diese Hitzköpfe haben eine Menge Blut vergossen, bis unsere sogenannten modernen Armeen sie ein wenig abkühlen konnten.«
Jon hörte nur mit halbem Ohr zu. Er war ein kräftig gebauter Bursche mittlerer Größe mit gut geformten Beinen und breiten Schultern. Außerdem hatte er ein so markantes Gesicht, dass er trotz seines jugendlichen Alters von neunzehn Jahren bereits die Aufmerksamkeit so mancher jungen Dame auf sich gezogen hatte. In seiner sorgfältig gebügelten Uniform sah er aus wie ein Soldat auf einem Rekrutierungsplakat. Der Staub hatte seinem roten Rock nicht allzu viel anhaben können. Gurt und Degenkoppel glänzten hell in der frühen Morgensonne, und sein korkgefütterter Tropenhelm, dessen Form einem Kohlenschütter glich, war leicht nach hinten geschoben und gab den Blick auf ausdrucksvolle blaue Augen unter einer breiten, geschwungenen Stirn frei.
Vor ihm lag ausgedörrtes, unfruchtbares Land, das jenseits einer Senke in eine lange, flache Kammlinie überging, an deren Ende sich weithin sichtbar eine hohe Felsformation erhob. Hinter dem Lager stieg der Isandhlwana sanft bis zum Gipfel an. Bei diesem Anblick überkam ihn ein Gefühl unermesslicher Weite, eine leise Ahnung, wie tief und breit der afrikanische Kontinent war und welch eine Dürre nördlich von ihnen herrschen mochte.
»Die sind irgendwo da draußen«, sagte Harry Ryan.
»Die Söhne von Old Shaka«, fügte Melgund hinzu. Er hob seinen Becher und sah über den Rand hinweg zu dem Offizier, der die Kampffähigkeit der Zulu infrage gestellt hatte. »Sie kämpfen ausgezeichnet. Wenn sie kommen, tauchen sie wie eine schwarze Todeswolke auf. Man hört sie schon, bevor man sie überhaupt sieht. Sie schlagen alle gleichzeitig auf ihre Schilde und stimmen einen Singsang an, der sich anhört wie leises Donnergrollen oder wie ein weit entfernter Zug, der auf einer Steigung allmählich in Fahrt kommt.«
»So ein leeres, raues Land«, bemerkte der Offizier.
»Leer ist es wegen der Zulu, wegen Shaka. Bei seiner Eroberung hat er das Land entvölkert«, entgegnete Ryan.
»Sieh an, wir haben es mit einem Kolonisten zu tun, der sich mit der Geschichte der afrikanischen Ureinwohner beschäftigt hat«, sagte der Offizier.
»Das könnte sich bezahlt machen«, entgegnete Ryan kühl. »Immer gut zu wissen, worauf man sich einlässt. Auf einen Kampf? Fragen Sie diejenigen, die Shaka vertrieben hat. Es heißt: Wenn ein Mann bei seinen Feinden bekannt ist, verfügt er über großes Ansehen, und das kann man von diesem Zulu allemal behaupten. Immerhin war einer der von Shaka vertriebenen Zulu-Häuptlinge Mzilikazi. Hunderttausende hat Shaka getötet, um in Matabeleland ein neues Königreich zu errichten.«
»Wir haben es hier aber nicht mit einem Zulu-Übermenschen zu tun«, sagte der Offizier.
»Nein«, erwiderte Ryan. »Sie werden Cetshwayo gegenüberstehen. Und der tötet jeden, der ihn schief ansieht. Er wird Sie mit zwanzig Impi angreifen, von dem jedes zweitausend Krieger zählt, also mit insgesamt vierzigtausend Mann.«
»Ich bekomme Bauchweh von dieser fröhlichen Unterhaltung«, sagte der Offizier und stellte seinen Teller beiseite.
Klirrendes Pferdegeschirr und rumpelnde Räder ließen Jon aufmerken, und er sah, wie ein Munitionswagen an ihnen vorbeifuhr. Dahinter entdeckte er inmitten eines kleinen Trupps berittener Offiziere Colonel A. W. Durnford, der die Krempe seines unvorschriftsmäßigen Hutes hochgeschlagen hatte. Durnford, dem Lord Chelmsford den Befehl über das Feldlager übertragen hatte, strahlte eine solche Selbstsicherheit aus, dass Jon nicht länger an Harry Ryans pessimistische Einschätzung glaubte. Die Vorstellung, nur mit Speer und Schild bewaffnete Eingeborene könnten es wagen, eintausendsechshundert britischen Soldaten und zweitausendfünfhundert Afrikanern gegenüberzutreten, fiel auch Jon schwer.
Ein Stück weiter den Abhang hinab stellten die Soldaten sich allmählich hinter den dampfenden Kesseln auf, um ihr morgendliches Porridge in Empfang zu nehmen. Obwohl Jon erst seit Kurzem dabei war, erkannte er die meisten aus seiner Truppe. Er war stolz darauf, wie sie ihn trotz seiner mangelnden Erfahrung gleich akzeptiert hatten. Viele von ihnen waren doppelt so alt wie er — kampferprobte Soldaten, die bereits im Krimkrieg und in Indien gedient hatten. Männer, die schon »im Dienst der Königin« gestanden hatten, lange bevor der Colonel, Jons Großvater, dafür gesorgt hatte, dass er in der Militärakademie in Sandhurst aufgenommen wurde, aus der die meisten jungen Offiziere für die weitgespannten Kolonialarmeen hervorgingen.
Während seines achtjährigen Aufenthalts in England hatte sein häufig provinzielles Denken sich gewandelt. Er war Australier, auf dem Papier und auch in seinem Herzen. Ohne sich arrogant zu geben, war er in seinen Ansichten kosmopolitischer als beispielsweise Harry Ryan oder Andy Melgund und erst recht als sein Stiefvater Marcus Fisher, an dessen Namen er sich stets mit leichter Abneigung erinnerte. Auch wenn Marcus Fisher auf eine kurze militärische Laufbahn zurückblicken konnte, hatte Jon sich zweifellos nicht wegen seines Stiefvaters für das Soldatenleben entschieden, denn Fishers Militärdienst war von Schande überschattet und mit dem Makel der Feigheit behaftet. Fisher war zwar zu einem vermögenden und politisch einflussreichen Mann geworden, hatte es aber nie vermocht, Jons Bewunderung zu erringen. In Australien hätte Jon ein bequemes, sorgloses Leben führen und sich dieses von Marcus Fisher finanzieren lassen können, aber er wollte von ihm nichts annehmen. Bei der Armee war er vollkommen zufrieden. Im Dienste der Krone würde er sich einen Namen machen.
Dem Nahen der Zulu sah er mit einer Mischung aus Besorgnis und freudiger Erwartung entgegen. Schließlich musste ein junger Offizier Kampferfahrungen sammeln, den Rauch der Gewehre einatmen, tapfer kämpfen und, falls der Feind die begehrte Gelegenheit dazu bot, sich möglichst vor den anderen auszeichnen. Wie Harry Ryan gesagt hatte, wird ein Krieger nicht nur an der Anzahl der getöteten Gegner gemessen, sondern am Können und an der Tapferkeit seiner gefallenen Feinde.
Jon betete beinahe darum, die Zulu mögen mutige Krieger sein und zu Tausenden auf sie einstürmen, damit er sich — so Gott will — auszeichnen könnte und sich ihm daraufhin zahlreiche Türen öffnen würden.
Beim ersten Mal nahm außer Jon niemand im Lager das Geräusch wahr. Es klang wie ein sehr weit entfernter Donner und ließ rasch wieder nach. Die Soldaten standen immer noch Schlange und warteten auf ihr Frühstück. In dem offenen Zelt der Offiziersmesse saßen die Männer in Ruhe beim Essen.
Als das Geräusch sich wiederholte und, offenbar ohne aus einer bestimmten Richtung zu kommen, von dem hügeligen Gelände aufstieg, neigte Jon den Kopf zur Seite und dachte an Harry Ryans Worte. Es klang tatsächlich wie ein ferner Zug, der sich bergauf mühte, und wurde einmal etwas leiser und einmal etwas lauter. Inzwischen hörten es auch andere, und ein leises Gemurmel erhob sich, gefolgt von einem vielstimmigen »Psst!«
Ein anderes, näheres Geräusch erregte nun Jons Aufmerksamkeit, und plötzlich tauchte hinter einer kleinen Anhöhe ein rot uniformierter Reiter auf, der seinem Pferd die Sporen gab, dass der Staub unter den Hufen des vor Anstrengung schäumenden Tieres stark aufwirbelte. Als die Männer sich dem Reiter zuwandten, fuchtelte er wild mit dem Arm und rief ihnen etwas zu, das sie auf die große Entfernung nicht verstehen konnten.
Jons Herzschlag setzte aus, denn er vernahm als Erster die Bedeutung seiner Rufe.
»Aha«, sagte Harry Ryan und beendete in Ruhe sein Frühstück, »wenn man vom Teufel spricht.«
Der eindringliche, silberhelle Ton des Signalhorns versetzte schlagartig das gesamte Lager in Bewegung. Die Männer ergriffen Ausrüstung und Waffen, stülpten sich ihre Helme über und reihten sich akkurat in dem ihnen zugewiesenen Regiment ein. Offiziere und Sergeants brüllten Befehle.
»Hör zu, Jon, alter Junge«, sagte ein Offizier und fasste ihn am Ellbogen, »kannst du nicht einen oder zwei Soldaten dazu abkommandieren, aufs Essen aufzupassen, bis wir wieder zurück sind? Ich hab nämlich noch nicht zu Ende gefrühstückt.«
»Vielleicht werden Sie Ihre Mahlzeiten eine Zeit lang auf der Flucht einnehmen müssen«, warf Andy Melgund ein.
»Wohl kaum«, antwortete der Offizier. »Wir hatten diese Hast bei einem falschen Alarm schon mehrmals.«
Im nächsten Moment war der Mann verschwunden. Und nachdem Jon rasch einen Soldaten der Verpflegungsstelle beauftragt hatte, das Zelt der Offiziersmesse zu bewachen, eilte er zu seiner eigenen Kompanie. Während er den Hügel hinabtrabte, nahm er die sich ihm bietende Szenerie in sich auf.
Für Jon, für den es sich um den ersten Kampfeinsatz handelte, war der Aufmarsch der königlichen Streitkräfte ein großartiger Anblick: eine Mannschaft von Rotröcken neben der anderen, durch die sich die Linie der Gurte und Degenkoppeln wie ein glänzender weißer Querstrich zog; aufgereihte weiße Helme und geschulterte Gewehre — so ordentlich und gerade wie ein neu errichteter Zaun. Das ferne Geräusch, dieser sich langsam nähernde, schnaufende Zug, war verstummt.
Kaum hatte Jon seine Position eingenommen und seine Ausrüstung überprüft, zeigte sich der Feind so urplötzlich, dass sein Herz fast aussetzte. Hinter der entfernten Senke sprangen Gestalten auf, als kämen sie buchstäblich aus dem Boden geschossen. Noch außerhalb der Reichweite der Martini-Henrys der ersten britischen Reihen hatten sie sich zu einer geraden, schwarzen Linie aufgestellt.
»Interessante Kerle«, sagte Captain Harper Bell, Jons direkter Vorgesetzter und Indienveteran. Vom Alter her hätte er Jons Vater sein können.
Sie waren wirklich interessant, um nicht zu sagen faszinierend. Die Zulukrieger hatten offenbar alle dieselbe Größe und trugen Schilde, die sich durch verschiedene Muster voneinander abhoben. Vom Knie bis zum Knöchel war ihre schwarze Haut durch eine Art Federgamaschen bedeckt.
»Die werden sich für uns in Szene setzen und sich in Positur werfen«, sagte Bell, »um uns ihre Stärke zu beweisen.«
In diesem Moment begannen die Zulu, alle im gleichen Rhythmus auf ihre Schilde zu schlagen. Über dem trockenen Gras, das die auf den Angriff wartenden Rotröcke von der plötzlich hochgeschwappten, schwarzen Welle trennte, breitete sich ein tiefes Summen aus. Die schwarzen Krieger sprangen nach vorn und schwangen drohend ihre kurzen, mit Eisenspitzen versehenen Speere, die Zulu-Assegai, die angeblich von dem mächtigen Shaka für den Nahkampf entwickelt worden waren.
»Sie formieren den Stierkopf«, sagte Bell. »Sie provozieren uns und wollen uns dazu bewegen, den Kopf anzugreifen, damit die Stierhörner uns an beiden Flanken treffen können. Wie Sie sehen, lässt ihre Taktik sich gut voraussagen. Die kleine Streitmacht vorn bildet den Kopf eines kämpfenden Stieres. Da und dort«, er deutete zu beiden Seiten des Lagers, »sind gleich starke, größere Einheiten platziert — die Hörner. Hinter dem Kopf verbirgt sich die kampfstärkste Truppe, der Brustkorb, und dahinter befindet sich die Verstärkung, die Lenden. Die Zulu wollen, dass wir unsere gesamte Aufmerksamkeit auf den Kopf richten und dagegen anstürmen. Sobald wir uns darauf einlassen, umschlössen die Hörner uns sofort von beiden Seiten, während die Hauptstreitmacht über die Gefallenen des Kopfs hinweg vorrücken würde.«
Auch wenn Colonel Durnford im Augenblick nicht zu sehen war, herrschte vorbildliche Disziplin. Die Reihen der Rotröcke gingen rasch in Stellung und bildeten ihre übliche Kampfformation. Jons Kompanie hatte im rechten Winkel zu den Mannschaften, die den bereits zu sehenden Zulu gegenüberstanden, ihre Gefechtsformation eingenommen.
Da sich Jons Blicken auf dem abschüssigen Hang vor ihm nur das von der Sonne versengte, vertrocknete Gras darbot, war er sogar ein wenig enttäuscht.
Mit einem kehligen Summen, einem Singsang, der wie der falsch ausgesprochene, ständig wiederholte Stammesname klang, griff der Stierkopf an. Leichtfüßig und scheinbar mühelos ergossen die schwarzen Krieger sich über das Gelände, das die beiden Armeen voneinander trennte. Als die Zulu auf knapp hundert Meter herangekommen waren, ließen die Rotröcke ihre Martini-Henry-Gewehre sprechen. Die vorderste Reihe feuerte und kniete nieder, um nachzuladen, während die Reihe dahinter über ihre Köpfe hinweg schoss. Eine große Anzahl der Zulukrieger starb, und in der schwarzen Welle, die sich in Richtung Lager ergoss, klafften für kurze Zeit weite Lücken. Doch aus der Schlucht, die den Feind verbarg, quollen immer noch Hunderte von Kriegern hervor. Ihre weißen Federgamaschen, die einen starken Kontrast zu der schwarzen glänzenden Haut bildeten, blitzten in der Sonne auf.
Jon machte sich schon Sorgen, dass seine Kompanie womöglich keine Chance bekäme, auch nur einen einzigen Schuss abzugeben. Die schwarzen Horden strömten weiter vor und starben, denn sobald sie in die Schussweite der treffsicheren Mannschaftsschützen kamen, türmte sich Leiche auf Leiche. In diesem Augenblick tauchten auch an Jons Frontabschnitt Zulukrieger auf, und plötzlich gab es mehr Ziele als Gewehre. Mit ohrenbetäubendem Lärm krachten die Waffen seiner Kompanie in gemeinsamen Salven. Die Stierhörner schlossen sich um die Flanken. Schwefelgestank lag in der Luft, das Donnern der Gewehre und das kehlige Summen der rasch dahineilenden Krieger, die nun zu Tausenden von drei Seiten auf die britischen Mannschaften zuhielten.
Jon hörte hinter sich das Geklirr von Ausrüstung und sah sich um. Ein Offizier brachte einheimische Hilfstruppen in Stellung, um die hinteren Reihen der Mannschaften zu verstärken, die dem Angriff des Stierkopfs ausgesetzt waren.
»Munition!«, brüllte ein Sergeant.
Captain Bell stand in Jons Nähe.
»Wo bleiben die verdammten Kerle mit der Munition?«, schrie Bell.
Die Zulukrieger sprangen über die Haufen der Toten. Bevor das vernichtende Feuer der Kompanie die Tapfersten unter ihnen niedermähte, sobald sie nah genug herangekommen waren, konnte Jon erkennen, dass sie Halsketten aus Muscheln und Zähnen sowie seltsame kleine, an Kronen erinnernde Reifen auf dem Kopf trugen. Er sah ihre verzerrten, schreienden Münder und ihre glänzenden weißen Zähne. Ein Assegai flog auf sie zu, und unmittelbar vor ihm schrie ein Mann vor Überraschung und Schmerz laut auf und krümmte sich, da ihm der entsetzliche Speer tief in den Magen gedrungen war. Jon zielte mit seinem Revolver, schoss durch die Lücke in der Linie vor ihm und sah, wie ein Zulukrieger getroffen zu Boden sank. Vage kam ihm zu Bewusstsein, dass er soeben einen Menschen getötet hatte.
»Wo bleibt die verfluchte Munition?«, brüllte ein Sergeant.
Die Munition war nicht vergeudet worden. Soweit Jon es beurteilen konnte, hatte man sogar erstaunlich viele Treffer erzielt. Die Zulukrieger waren einfach zu zahlreich. Sie kamen zu Tausenden. Wie viele genau, hatte Harry Ryan gesagt? Vierzigtausend? Zwanzig Impi? Jon kam es vor, als ergieße sich über die Hälfte davon in Richtung seiner Kompanie. Captain Bell brüllte ihm etwas ins Ohr, und er zuckte zusammen.
»Fisher, nach hinten! Sehen Sie nach, was die verdammte Munition aufhält.«
Jon rannte durch ein scheinbares Chaos, das in Wirklichkeit aber aus gut koordinierter Aktivität bestand. Die Kompanien — schwarze wie weiße — wurden in vorteilhaftere Stellungen verschoben. Ihm gelang es, einen kurzen Blick auf Colonel Durnford zu werfen, der auf seinem prachtvollen Pferd saß und eine Pistole in der Hand hielt. Hinter dem Colonel hatte der Stierkopf die heftige Feuerlinie durchbrochen und zu der rotberockten Mannschaft aufgeschlossen.
Jon hörte den Todesschrei eines Sterbenden. Dichter Pulverrauch lag über der gesamten Szenerie. Er stieß mit voller Wucht gegen einen Sergeant, der Befehle brüllte, hielt aber nicht inne, um sich bei dem fluchenden Mann zu entschuldigen, sondern rannte weiter. Aus einiger Entfernung hörte er ein Signalhorn, das im allgemeinen Tumult jedoch völlig unterging. Jon rannte an dem Wagen des Chirurgen vorbei, um den eine Menge Verwundeter lag. Er trat in eine Pfütze, dass das Blut nur so aufspritzte, fand sein Gleichgewicht wieder und rannte weiter.
Als er endlich am Munitionswagen angelangt war, blieb er schlitternd stehen. Eine Reihe wütender, fluchender Männer schrie den Sergeant auf dem Wagen an, er solle sich beeilen, die verdammten Formalitäten vergessen und eine Kiste Munition herunterwerfen.
»Die Munition ist Eigentum der Krone«, schrie der für die Ausrüstung zuständige Sergeant zurück, wie Jon ungläubig staunend vernahm. »Nur wer dazu befugt ist, bekommt die Munition.«
Während die wütenden Männer näher zu dem Wagen vorrückten, entdeckte Jon knapp hundert Meter weiter die Fahrzeuge der australischen Armeelieferanten. Er erkannte, dass eines davon ein Munitionswagen war, und rannte darauf zu. Anstatt sich seinen Weg durch die aufgebrachte Menge zu bahnen, würde er auf diese Weise Zeit sparen.
Doch noch bevor er Ryans Wagen erreicht hatte, waren hinter ihm nur noch vereinzelte Gewehrschüsse zu hören. Er sah sich kurz um und traute seinen Augen nicht. Die Zulu hatten die ersten Stellungen bereits überrannt und durchbrachen die Gefechtsformationen. Als Jon an dem Wagen ankam, sah er, dass Harry Ryan auf dem Kutschbock saß und das Ochsengespann antrieb.
»Harry!«, rief er.
Ryan zog an den Zügeln.
»Munition«, rief Jon außer Atem.
»Der für die Ausrüstung zuständige Sergeant muss noch genug haben«, sagte Ryan.
»Munition her, verdammt noch mal«, schrie Jon und zerrte an der Plane am Wagenende.
Andy Melgund trat neben ihn und half ihm, die Plane zu öffnen. Für den Transport war die Munition in stabile Kisten gepackt, deren fest geschlossene Deckel jeweils mit Stahlbändern verstärkt waren.
Jon versuchte, eine der Kisten zu öffnen und riss sich fast den Fingernagel ab.
»Du bist etwas spät dran«, rief Harry Ryan vom Vordersitz.
»Helft mir«, sagte Jon. »Helft mir, die Kisten zu tragen ...«
»Sieh dich doch um, Mann«, erwiderte Melgund.
»So viel zu unseren edlen schwarzen Verbündeten«, bemerkte Ryan.
Ein Teil der Gefechtsformation, die von einheimischen Hilfstruppen gebildet worden war, hatte sich aufgelöst. Die Zulukrieger drangen in die nunmehr aufgebrochenen Formationen ein und stießen mit ihren kurzen Speeren wirkungsvoll zu. Jon warf einen kurzen Blick zu der Stellung hinüber, die seine eigene Kompanie bezogen hatte, und erkannte verzweifelt, dass nur noch wenige Gewehrmündungen aufblitzten. Seine Leute hatten keine Munition mehr. Mit Bajonetten versuchten sie, im Nahkampf die Assegai abzuwehren.
»Los schnell, Mann«, schrie Jon, der sich immer noch abmühte, eine der Munitionskisten zu öffnen.
Die Welle des schwarzen Todes flutete bereits die sich auflösenden britischen Linien, und das gesamte Lager bestand nur noch aus Kampfgetümmel. Dichte Staub- und Rauchwolken nahmen Jon die Sicht.
»Es wird Zeit, Lieutenant, dass wir Vernunft walten lassen, anstatt den Helden zu spielen, und so schnell wie möglich von hier verschwinden«, sagte Harry Ryan.
»Wie kannst du zu einem solchen Zeitpunkt nur daran denken, deine kostbaren Waren zu retten?«, rief Jon verzweifelt.
»Ehrlich gesagt, ist mir mehr daran gelegen, meine kostbare Haut zu retten«, rief Ryan zurück. »Und mit dem Wagen kommen wir schneller voran als zu Fuß. Willst du mit?«
»Ich muss zurück«, sagte Jon, packte eine der schweren Kisten und taumelte los. Melgund schob Jon die Kiste von der Schulter, sodass sie unversehrt auf den Boden krachte.
»Sei vernünftig, Mann«, rief Ryan. »Das hat Chelmsford zu verantworten, nicht du. Chelmsford hat das verbockt, als er seine Streitkräfte angesichts einer vierzigtausend Mann starken Armee aufgespalten hat.«
»Meine Kompanie ...« Jon war völlig außer sich.
»Deine Männer sind tot, oder sie sterben gerade«, sagte Melgund. »Für dich wird es noch genügend Gelegenheiten geben, dich dem alten Cetshwayo zu stellen.«
Jon bückte sich und wollte die Munitionskiste anheben. Die Schreie der Sterbenden gellten ihm in den Ohren, und das Siegesgebrüll der Zulu schmerzte ihn mindestens ebenso. Er bemerkte nicht, dass Melgund ausholte. Und er spürte auch nicht, als dessen Faust an seinem Kinn landete. Er hörte nur ein lautes Dröhnen, und dann wurde ihm schwarz vor Augen.
Von fern vernahm Jon ein dumpfes Dröhnen und versuchte, sich zu bewegen, aber sofort begann es fürchterlich in seinem Kopf zu hämmern.
Er öffnete die Augen. Er befand sich in einem Wagen, in dem er auf einem Haufen übereinandergestapelter Munitionskisten auf- und abgeworfen wurde. Nachdem er sich den schmerzenden Schädel und seinen Kiefer befühlt hatte, kroch er nach vorn. Der Wagen fuhr über unebenes Gelände, und das Gespann der sechs paarweise angejochten Ochsen trottete ziemlich schnell voran. Auf dem Kutschbock saßen Harry Ryan und Andy Melgund. Letzterer hielt ein Gewehr umklammert.
»Willkommen zurück, alter Junge«, sagte Ryan.
»Falls du leichte Kopfschmerzen hast«, meinte Melgund, »solltest du dich glücklich schätzen, dass du überhaupt noch einen Kopf hast, der dir wehtun kann.«
»Wo sind wir?«, fragte Jon.
»Seit drei Stunden unterwegs zum Buffalo River«, sagte Ryan, »und gebe Gott, dass sich dort ein paar Rotröcke aufhalten und die Zulu abfangen, die uns zweifellos auf den Fersen sind.«
»Meine Männer ...«
»Jon«, sagte Melgund, »sie sind tot.«
»Oh mein Gott, etwa alle?«
»Alle. Von einem Hügel aus konnten wir einen letzten Blick zurückwerfen. Die Zulu haben alles geplündert. Wenn du ihnen das nächste Mal begegnest, besitzen sie bestimmt eine Menge Gewehre.«
»Wirklich alle?« Jon wiederholte seine Frage, weil er es einfach nicht glauben konnte.
»Da sind sie schon«, sagte Melgund. Er stand auf und sah über die Wagenplane hinweg. »Sie kommen gerade über die Anhöhe. Mindestens hundert, und sie bewegen sich ziemlich schnell.«
»Ich würde ein ganzes Dutzend dieser verdammten Kühe gegen ein schnelles Pferd tauschen«, sagte Ryan.
»Gegen drei schnelle Pferde, bitte«, erwiderte Melgund. »Wenn du diesen Kühen gut zuredest, fangen sie vielleicht tatsächlich an zu rasen.«
»Bestimmt nicht«, antwortete Ryan.
»Wenn ich das richtig in Erinnerung habe«, sagte Melgund, »ist der Fluss gleich hinter der nächsten Anhöhe. Vielleicht sollten wir zu Fuß hinrennen?«
»Ein Zulukrieger kann an einem Tag fünfzig Meilen zu Fuß zurücklegen und sich unmittelbar danach an einer Kampfhandlung beteiligen«, erwiderte Ryan mit zusammengepressten Lippen. Dazu fiel Melgund nichts ein.
»Der für die Ausrüstung zuständige Sergeant wollte die Munition nicht hergeben«, sagte Jon, der sich an die jüngsten Ereignisse erinnerte.
»Man wird ein Bergungsteam zum Isandhlwana schicken, um die Messingkisten zu holen«, sagte Ryan. »Und irgendwer wird für jede Patrone und jede Hülse Rechenschaft ablegen müssen.«
»Sie hätten die Stellung halten können«, sagte Jon, »wenn sie nur genug Munition gehabt hätten.«
»Cetshwayo hat nicht einmal seine Hauptstreitmacht bemüht«, sagte Ryan. »Der Brustkorb des Stiers war gar nicht im Einsatz. Ohne die Aufspaltung der Streitkräfte durch Chelmsford hätten seine dreizehntausend Mann die Stellung vielleicht halten können — falls die einheimischen Hilfstruppen nicht abgefallen wären.«
»Da ist er!«, rief Melgund, als der Wagen den Kamm erreicht hatte und der Buffalo River unten am Fuße des Hügels sichtbar wurde.
»Au verdammt«, sagte Ryan. »Cetshwayo hat seine Streitkräfte ebenfalls aufgeteilt.«
Am gegenüberliegenden Ufer des Flusses, hinter der Furt, wurde eine mit Staketen befestigte Stellung von einer Horde Zulukrieger bestürmt. Eines der Nebengebäude stand in Flammen. Das Krachen vereinzelter Gewehrschüsse drang an ihre Ohren.
»Wir können den Fluss überqueren und uns an ihnen vorbeischleichen«, schlug Melgund vor.
»Schleichen? Mit einem halben Dutzend Ochsen und einem Wagen mit quietschenden Rädern?«
»Man kann ja wenigstens darüber reden«, sagte Melgund.
»Da!« Jon zeigte auf den Fluss.
Eine kleine Einheit Berittener preschte am gegenüberliegenden Ufer des Buffalo River entlang. Sobald die Reiter in Reichweite des befestigten Gebäudes waren, sah man die weißen Rauchschwaden ihrer Gewehre, und etwa eine Sekunde später hörte man den Knall.
»Keine Sorge, Kameraden«, sagte Ryan. »Die tapferen Blaujacken Ihrer Majestät eilen uns zu Hilfe. Sieht ganz nach Marinebrigade aus.«
Der schwerbeladene Wagen hielt über den holprigen Pfad auf den Fluss zu.
»Der Haufen hinter uns holt auf«, rief Melgund.
»Vielleicht könntest du nach hinten krabbeln und auf sie losballern?«, fragte Ryan.
»Ich bin nicht gerade ein großartiger Schütze, aber ich werd’s versuchen.«
»Lassen Sie mich das machen.« Jon nahm das Gewehr, kroch rasch ans hintere Ende des Wagens und öffnete die Plane.
Die Zulu rannten scheinbar unermüdlich mit geschmeidigen Bewegungen hinter ihnen her, und schon bald hatten sie den Wagen eingeholt. Er zielte auf den Anführer, einen großen, muskulösen Krieger. Jon sah, wie er unmittelbar in eine Kugel lief und das Leben aus seinem Körper wich. In kurzen Abständen gab er vier weitere Schüsse ab und lud schnell und geschickt nach. Schon im nächsten Augenblick drangen die Ochsen laut platschend in die Furt, während die Verfolger außerhalb der Reichweite des Gewehrs zurückblieben.
Spritzend bahnte der Wagen sich seinen Weg durch das Wasser. Als die Ochsen sich jedoch ans andere Ufer mühten, blieb das eine Hinterrad mit einem heftigen Ruck in einem Felsspalt stecken. Jon hörte das Krachen zersplitternder Speichen und musste sich festhalten, um nicht gegen die Wagenplane geschleudert zu werden.
»Vielleicht können wir den Jungs Ihrer Majestät ein paar Pferde abschwatzen«, sagte Ryan, als Jon hinten vom Wagen sprang und sich davon überzeugte, dass ihre Verfolger nicht bereits den Fluss durchquerten. Er watete die letzten Schritte durch das flache Wasser zum Ufer.
»Wo wir gerade davon sprechen«, sagte Melgund und deutete auf einige Reiter, die von den qualmenden Staketen her auf sie zugeprescht kamen.
»Heda, ahoi!«, rief Ryan ihnen zu, und dann an seine Freunde gewandt: »Die sind von einem britischen Schiff.«
Unmittelbar vor dem schnaufenden Ochsengespann brachte ein überraschend adrett aussehender Marineoffizier, der die Abzeichen eines Fähnrichs trug, sein Pferd zum Stehen.
»Sind Sie von Lord Chelmsford gekommen?«, fragte er mit unverkennbar schottischem Akzent.
»Vermutlich ist Lord Chelmsford inzwischen tot«, erwiderte Ryan, »ebenso wie seine Leute, die er am Isandhlwana geopfert hat.«
»Was soll das heißen?«, fragte der junge Fähnrich.
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, junger Mann«, sagte Ryan, »werde ich Ihre Fragen später beantworten.«
Er deutete mit dem Kopf ans andere Ufer. Die Zulukrieger strömten schweigend in die Furt. Außer ihren Gesichtern blieben sie hinter den Schilden völlig versteckt und hielten die Assegai kampfbereit.
Der junge Fähnrich gab lautstark einige Befehle, woraufhin die Männer seiner kleinen Streitmacht vom Pferd sprangen und in Stellung gingen. Sogleich färbten die Wasser des Buffalo River sich rot, und die Zulukrieger brachen unter den gut gezielten Schüssen der Marineeinheit zusammen. Jon ging ebenfalls in Stellung, mit ausreichend Munition neben sich, und feuerte im Knien. Die im Fluss gestürzten Zulu wurden ständig durch neue ersetzt, die den Abhang herabsprangen. Zu Dutzenden starben sie im seichten Wasser, aber die Lücken wurden stets aufgefüllt.
»Herr Admiral«, sagte Harry Ryan und tippte den jungen Fähnrich auf die Schulter, »vielleicht sollten wir in Erwägung ziehen abzuhauen. Drei ihrer Pferde könnten jeweils zwei Leute tragen.«
»Die Überlegung hat nur einen Haken«, erwiderte der Fähnrich. »Auf dem Ritt hierher sind uns schätzungsweise dreihundert dieser Kerle nachgejagt.«
»Und jetzt befinden sie sich zwischen uns und dem Land im Osten?«, fragte Ryan.
»Ich nehme an, sie sind höchstens zehn Minuten von hier entfernt.«
»Inzwischen nicht mehr, Sir«, sagte ein Seemann und streckte den Arm aus.
Aus dem spärlichen Uferbewuchs brach schweigend eine Reihe Zulukrieger hervor und rannte auf die kleine Gruppe am Ufer zu. Die Krieger, die immer noch versuchten, den Fluss zu durchwaten, stießen einen Freudenschrei aus.
»Im Wechsel, Männer, Feuerlinie zur anderen Seite aufbauen«, befahl der Fähnrich.
Die Hälfte der Seeleute drehte sich um und fing an, auf die Zulustreitmacht am Ufer zu schießen, die sie nun in die Enge getrieben hatte. Das Gewehrfeuer forderte seinen Tribut, aber die Zulu kamen näher. Etwa ein halbes Dutzend von ihnen — ihre Assegai ragten hinter den Schilden hervor — hatte die Gruppe erreicht. Ohne Befehle abzuwarten, sprangen die Seeleute den Angreifern mit ihren Bajonetten entgegen.
Der junge Fähnrich, der kraftvoll und gewandt sein Entermesser einsetzte, führte sie an. Drei Zulu waren der gebogenen Klinge des Fähnrichs bereits zum Opfer gefallen, aber sogleich drang erneut ein halbes Dutzend Krieger auf ihn ein. Jon hob sein Gewehr, und ohne auf die sich durchs Wasser nähernden Feinde zu achten, dezimierte er ihre Überzahl.
»Tja, Gentlemen, jetzt sind wir dran«, sagte Ryan.
Ihnen blieb keine Zeit nachzuladen. Jon leerte die Trommel seines Revolvers, warf ihn auf den Boden und sprang mit ausgestrecktem Bajonett auf die Beine. Blitzschnell führte er es hinter einen Schild und spürte, wie der kalte Stahl in menschliches Fleisch drang. Gerade noch rechtzeitig, um einen Assegai-Stoß abzuwehren, riss er die Waffe zurück. Neben ihm ächzte Andy Melgund wie vor Anstrengung, doch aus dem Augenwinkel heraus sah Jon, wie er stürzte und ihm aus einer klaffenden Bauchwunde das Blut schoss. Mit einem wütenden Hieb seines Gewehrkolbens tötete Jon den Krieger, der den Assegai gegen Melgund geführt hatte.
Der junge Fähnrich bewegte sich rückwärts auf Jon zu. Sie waren von Zulu umringt. Rücken an Rücken kämpften sie weiter, der Fähnrich mit seinem Entermesser, Jon mit seinem aufgepflanzten Bajonett. Mindestens fünf der Seeleute und Melgund lagen am Boden. Harry Ryan hatte mit den übrigen Seeleuten ein kleines Karree gebildet.
»Ich würde gern wissen, mit wem ich hier gleich sterben werde«, rief Jon, während er einem Zulukrieger das Bajonett aus der Brust riss.
»Samuel Gordon, zu Ihren Diensten, Sir«, sagte der Fähnrich.
»Ist mir ein Vergnügen, Mr Gordon«, sagte Jon.
Er fand sich mit der bitteren Wahrheit ab und wollte so viele Zulu wie möglich mit in den Tod nehmen. Das Bajonett hatte er immer verabscheut. Er hielt es für eine unmenschliche Waffe und wusste tief im Innern, dass es sich von einem Zulu-Assegai gar nicht so sehr unterschied. Bei dem Gedanken, dass der spitze Stahl bald in seinen eigenen Körper dringen würde, zog sich ihm alles zusammen.
Vor Anstrengung und von dem Schweiß, der ihm in die Augen rann, war seine Sicht getrübt. Ein Assegai prallte an seinem Helm ab, der zu Boden flog. Nun war sein Kopf völlig ungeschützt. Flüchtig bemerkte er die blendende Sonne, die gnadenlose Hitze. Er stieß und hieb wie wild um sich. Die Klinge seines Bajonetts schlitzte einem jungen, gut aussehenden Zulu die Kehle auf. Blut spritzte auf seinen Waffenrock und färbte ihn in einem anderen Rot. Jon war sich bewusst, dass der Tod näherrückte, und er bildete sich ein, die Gewehre seiner Kompanie zu hören — den beruhigenden, todbringenden, scharfen Knall der Gewehre.
Ein kräftiger Zulu im besten Mannesalter stürzte sich auf ihn und rannte blindlings in sein Bajonett. Die Klinge war bis in den Knochen eingedrungen und steckte fest. Jon zog, stellte den Fuß auf die Rippen des Gefallenen und stieß sich ab. Ohne Waffe war er hilflos. Das Krachen der Gewehre kam näher, und als er aufsah, bemerkte er, dass die restlichen Zulukrieger zum Fluss rannten. Gleichzeitig preschte eine ganze Kompanie der Natal Light Horse, eine Bureneinheit, das Ufer herab und verbreitete Tod und Schrecken.
Andy Melgund war tot. Über Harry Ryans Brust verlief ein tiefer Schnitt von einem Assegai. Jon zog seine Jacke aus, die mit Zulublut getränkt war, und warf sie in den Fluss. Er sah ihr nach, wie sie noch lange an der Oberfläche trieb.
Benjamin Disraeli, der Premierminister des Kabinetts Ihrer Majestät, stand vor dem Parlament und ließ den Kopf hängen. Die Nachrichten aus der Kolonie, der Natal-Provinz in Südostafrika, waren das Zünglein an der Waage, die zu seinen Ungunsten ausschlug und die ohnehin unsichere Regierung endgültig ins Wanken brachte.
»Wer sind diese Zulu?«, fragte er, und seine sonst so kraftvolle Stimme klang so gedämpft, dass die Hinterbänkler Schwierigkeiten hatten, ihn zu verstehen. »Wer sind diese bemerkenswerten Menschen, die unsere Bischöfe bekehren und die an diesem Tag einer großen Dynastie ein Ende gesetzt haben?«
1
Das Haus der De Hartogs stand auf einer kleinen Anhöhe am Stadtrand von Pietermaritzburg mit Blick auf ein ungewöhnlich zerklüftetes Tal. Es war ein afrikanisches Haus, ein flaches, verschachteltes Gebäude mit Terrakotta-Dachziegeln, die den weiten Weg vom Mittelmeer um das Kap der Guten Hoffnung herum im Laderaum eines Segelschiffs zurückgelegt hatten. Geschützte Höfe gehörten ebenso dazu wie breite, luftige und gegen die brennende afrikanische Sonne überdachte Veranden mit verschwenderisch blühenden Pflanzen.
Auf einer dieser Veranden saß Jon Fisher in einem bequemen Korbsessel und blickte in einen kunstvoll angelegten, üppigen Garten, in dem riesige rote Blüten einen fast sinnlichen Eindruck auf den Betrachter machten.
Jon hob sein linkes Bein. Als der Kampf am Ufer des Buffalo River beendet war, hatte er sich zuerst um die anderen gekümmert: um Harry Ryan mit seinem tiefen Assegai-Schnitt über der Brust, um den toten Andy Melgund und um die verletzten Seeleute.
Erst als ein großer, blonder Burenoffizier sich in einer etwas schroffen Art nach seinem Befinden erkundigte, hatte er überhaupt bemerkt, dass er selbst auch verwundet war — sogar zweifach.
Eine Speerspitze war wenige Zentimeter über dem Knie in seinen Schenkel gedrungen, und eine weitere hatte von hinten seine linke Schulter aufgeschlitzt. Beide Wunden hatten sich nicht infiziert, sondern heilten gut.
Plötzlich hörte er Schritte und sah, wie der junge Burenoffizier — inzwischen in Zivilkleidung — mit einem Tablett um die Ecke bog, auf dem eine Flasche englischer Gin und ein Krug Wasser standen.
»Die Sonne hat gute Heilkräfte«, sagte Dirk De Hartog.
»Dieser friedliche, schöne Ort ist ebenfalls sehr erholsam«, erwiderte Jon.
Dirk setzte das Tablett auf einem Tisch ab, schüttete Gin in die Gläser, gab ein paar Spritzer Zitrone hinzu und füllte das Ganze mit Wasser auf.
»Aber das hier«, sagte er, »ist die beste Medizin.«
»Ein Bure, der englischen Gin trinkt.«
»Auf die Engländer«, sagte Dirk und trank, »und auf das Getränk, das die Eroberung aller fernen, tropischen Gebiete erst möglich gemacht hat.«
Jon schmeckte der scharfe Gin mit Wasser und Zitronensaft ausgezeichnet, und er sagte genießerisch: »Aaaah.«
»Wenn die britischen Generäle ebenso exzellent wären wie ihr Gin ...«
»Sprechen Sie von jemandem, den ich kenne?«, fragte Jon mit gequältem Lächeln.
»Jetzt, wo er gewonnen hat, wird er im britischen Königreichs als Held gefeiert«, sagte Dirk, »und ich zitiere: Er hat einen glorreichen Sieg errungen.«
»Ich nehme an, Sie werden mir, wann immer Sie es für angebracht halten, ausführlicher darüber berichten.«
»Mit über viertausend Gewehren und zusätzlich mit schwerer Artillerie hat er den alten Cetshwayo bei Ulandi in die Enge getrieben.«
»Wirklich glorreich«, bemerkte Jon. »Kanonen gegen Assegai.« Er zuckte mit den Schultern. »Nicht dass es mir um Cetshwayo und die Zulu besonders leidtäte.«
»Das glaube ich Ihnen gern. Sie haben durch Ihre Verletzungen genug unter ihnen gelitten.«
Jons Miene wurde ernst.
»Hören Sie, De Hartog«, sagte er, »ich habe mich bisher noch nicht richtig bei Ihnen bedankt. Gut, dass Sie im letzten Moment aufgetaucht sind und meine blutüberströmten Knochen mitgenommen haben, damit ich mich in einer so angenehmen Gesellschaft und Umgebung auskurieren konnte.«
Dirk winkte lässig ab, und Jon vernahm eine andere Stimme: »Du könntest wenigstens so viel Anstand haben, eine so hübsche Dankesrede zu würdigen.« Es war Dirks Schwester Anna De Hartog. Keiner der beiden Männer hatte sie kommen hören.
Dirk grinste. »Da es hier nur wenige akzeptable junge Gentlemen gibt, hätte Anna mir nie vergeben, wenn ich Sie nicht hergebracht hätte.«
Anna errötete. Sie war groß, trug das hellblonde Haar auf dem wohlgeformten Kopf hoch aufgesteckt, und ihre Augen leuchteten so blau wie der afrikanische Himmel. Obwohl sie aus einer Familie der Voortrekker stammte, sprach sie sehr gut englisch, und ihr feingliedriger Körper zeugte von guter Herkunft.
»Ach, sei still«, sagte sie, setzte sich neben Jon und schenkte ihm ein Lächeln, während ihre Wangen immer noch glühten.
»Auf meine reizende Krankenschwester«, sagte Jon und hob sein Glas. »Ihr gilt dieser Toast und meine unendliche Dankbarkeit.«
»Ihre Heilkunst hat sie an Rindern und Ziegen erprobt«, sagte Dirk.
Jan De Hartog, der Vater dieser zwei gut aussehenden jungen Menschen, war unter Andries Pretorius mit dem ersten Treck nach Natal gekommen. Er wollte sich an der Rache für das Massaker an Piet Retief und sechzig Siedlern beteiligen, die den Versuch gemacht hatten, im Zululand eine burische Siedlung zu gründen.
Jon hatte sich höflich und diskret nach Jan De Hartog erkundigt, was allerdings nur zu der Andeutung geführt hatte, dass der alte Herr sein heimatliches Tiefland in Westeuropa wohl nicht ganz freiwillig verlassen hatte. Wie man sah, war er seit seiner Ankunft 1838 in der britischen Kolonie Natal recht erfolgreich gewesen. Der Grund und Boden der Familie De Hartog erstreckte sich bis weit über das gewundene Tal hinaus, das man von dem großen Haus aus überblicken konnte.
Außerdem hatte Dirk durchblicken lassen, dass es über die Landwirtschaft hinaus noch weitere Geschäftsaktivitäten gäbe. Beide Geschwister hatten englisch geführte Schulen besucht, was für Buren eher ungewöhnlich war. Und dass diese Entscheidung nicht der Liebe ihres Vaters für die Briten entstammte, war Jon durchaus klar.
An seine ersten Tage im Hause der De Hartogs hatte Jon nur eine ziemlich vage Erinnerung. Für einen Verwundeten war es eine schwierige Reise vom Buffalo River hierher, und sowohl er als auch Harry Ryan hatten sie vor Schmerz und Fieber halb betäubt zurückgelegt. Wie er sich erinnerte, war Annas ernstes, makelloses Gesicht, diese kobaltblauen Augen, ihre natürlich glühenden Wangen und ihr Lächeln das Erste, was er in diesem Hause gesehen hatte.
»Ich bin froh«, sagte Jon und sah Anna an, »wenn das stimmt und bei einem britischen Offizier dieselbe Behandlung anschlägt wie bei einer Kuh oder einer Ziege.«
»Mein Bruder gibt sich gern als enfant terrible«, sagte Anna. »Manchmal sogar mit großem Erfolg.«
Dirk mischte zwei weitere Drinks, sah seine Schwester fragend an und erhielt als Antwort ein Nicken.
»Ihr Freund ist in die Stadt gefahren«, sagte Anna. »Er ist nicht gerade der geduldige Kranke.«
»Harry ist eher der ruhelose Typ«, entgegnete Jon.
»Besser gesagt, ein komischer Kauz.« Dirk reichte eines der Gläser seiner Schwester und behielt das andere für sich. Jon saß immer noch bei seinem ersten Glas. »Beschwört durch sein Reden fast einen Sturm herauf und sagt eigentlich gar nichts.«
»Er hat bei Rorke’s Drift einen Menschen verloren, der ihm so nahestand wie ein Bruder«, sagte Jon. »Andy Melgund und Harry waren beide Waisen, die ein Australier bei sich aufgenommen hat. Ursprünglich stammt Harry aus Neuseeland. Seine Familie wurde von den Maori getötet.«
»Wie schrecklich«, entfuhr es Anna.
»Ich finde, Ryan hat in Afrika ziemlichen Erfolg gehabt«, sagte Dirk.
Jon nickte zustimmend. »Offenbar hat er Talent zum Geschäftsmann.«
»Maultiere, Ochsen, Nahrungsmittel, Munition«, sagte Dirk. »Bei der britischen Armee findet so etwas gewinnbringenden Absatz.«
»Irgendwer muss schließlich dafür sorgen«, machte Anna einen schwachen Versuch zu seiner Verteidigung. »Er scheint immerhin eine sehr gute Erziehung zu haben.«
»Um all das erlebt zu haben, worüber er redet, kommt er mir ein wenig zu jung vor«, erklärte Dirk. »Zur See ist er auch schon gefahren? Wie er behauptet, war er Erster Maat auf einem Klipper.«
»Jedenfalls verdanke ich Ryan und Melgund mein Leben«, sagte Jon.
Die genauen Umstände wollte er den De Hartogs jedoch nicht erzählen, denn seine Militärkarriere war praktisch beendet. Er hatte in Anwesenheit des Feindes seine Kompanie verlassen. Um zu beweisen, unter welchen Umständen das geschehen war, hatte er nur sein Wort und das von Harry Ryan.
Doch was ihn beschäftigte, war nicht die Möglichkeit, von anderen als Feigling bezeichnet zu werden. Er empfand eher ein bedrückendes Schuldgefühl, da er meinte, er hätte eigentlich mit Captain Bell und seinen Männern in den Tod gehen müssen. Jon glaubte, ein wirklich guter Offizier hätte eine Möglichkeit gefunden, die Kompanie rechtzeitig mit Munition zu versorgen. Er aber hatte versagt. Für ihn würde es keine Auszeichnung geben. Keine Türen würden sich aufgrund seiner Leistung am Isandhlwana für ihn öffnen.
»Ich werde Sie jetzt der Gesellschaft Ihrer Krankenschwester überlassen«, sagte Dirk und trank seinen Gin aus.
Nachdem er gegangen war, saß Anna eine Weile schweigend da. Dann sah sie Jon durch ihre dichten, dunklen Wimpern an.
»Ich habe so ein Gefühl, dass Sie uns bald verlassen werden.«
»Ja, das muss ich wohl.«
»Ihre Einheit wird neu zusammengestellt und durch Rekruten aus England verstärkt.«
»Ja.«
»Werden Sie zu ihr zurückkehren?«
Er seufzte. Früher oder später musste er sich ja doch mit diesem Thema auseinandersetzen. »Ich habe daran gedacht, nach Hause zurückzugehen.«
Auch wenn Anna versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, konnte sie ihre Bestürzung nicht verbergen. »Nach Australien?«
»Ich habe meine Mutter schon jahrelang nicht mehr gesehen.«
»Jon, Sie hätten das Geschehen bei Isandhlwana nicht verhindern können«, sagte sie.
Ihre Worte trafen ihn bis ins Innerste und weckten erneut seine Schuldgefühle. Wütend wandte er sich ab und sah, wie Dirk zu den Ställen ging.
»Mr Ryan erzählte mir, dass Sie keine Chance hatten, weil die Stellungen bereits genommen und alle Soldaten entweder tot waren oder gerade starben. Er sagte auch, dass man Sie trotzdem erst bewusstlos schlagen musste.«
Jon wollte nicht darüber reden.
»Harry hat mich gefragt, ob ich nicht sein Geschäftspartner werden möchte«, antwortete er.
Anna erhob sich rasch. Jon sprang ebenfalls auf und sah ihr ins Gesicht. Ihm war nicht entgangen, dass sie ihn liebgewonnen hatte.
»Anna«, sagte er, »ich muss gehen.«
»Dann gehen Sie!«, fuhr sie ihn an. »Und zwar schnell.«
Mit schwingenden Röcken drehte sie sich auf dem Absatz um, rannte beinahe über die Veranda und verschwand in der Tür. Jon stand mit hängenden Schultern da. Er hatte ihr und Dirk sehr viel zu verdanken. Doch trotz all seiner Dankbarkeit war er nicht bereit, sich einer Frau zu erklären, nicht einmal einer so reizenden wie Anna De Hartog. Er spürte eine gewisse Rastlosigkeit in sich und wusste, er würde sich auf einem Grundbesitz in Südostafrika — was sich, wie Dirk ihm versichert hatte, durchaus arrangieren ließ — nur eingesperrt fühlen.
Ähnlich wie bei Harry Ryan lagen zu viele ungeklärte Dinge in seiner Vergangenheit. Bei Ryan war es der Alptraum, dass er mit angesehen hatte, wie seine Familie von den Maori abgeschlachtet worden war. Und Jon hatte sein eigenes Kreuz zu tragen — die Erinnerung daran, wie er hilflos dastand, während seine Männer und seine Offizierskollegen starben. Außerdem gab es da noch seine Mutter. Er wusste, dass ihre Ehe mit Marcus Fisher nicht gerade glücklich verlaufen war. Da Jon bei seinen Männern nun einmal versagt hatte, könnte er das vielleicht wettmachen, indem er seiner Mutter ein wenig Trost und Freude schenkte.
Als Harry Ryan aus Pietermaritzburg zurückkam, lag Jon noch immer wach. Er hörte, wie Ryan den Nebenraum betrat und leise fluchend über etwas stolperte. Dann klopfte es an der Verbindungstür.
»Bist du wach?«, fragte Ryan.
»Jetzt ja«, sagte Jon.
Trotz der späten Stunde wirkte Ryan recht munter. Sein Blick verriet, dass er zu viel Alkohol zu sich genommen hatte. Mit einem Grinsen kam er an Jons Bett und setzte sich aufs Fußende. Seine Trauer über Andy Melgund hatte er nie gezeigt — höchstens, indem er noch mehr trank als sonst oder hin und wieder in tiefste Trübsal verfiel. Im Augenblick jedoch war er fröhlich.