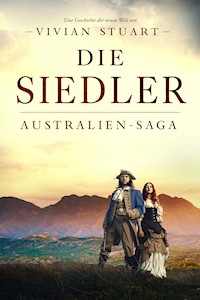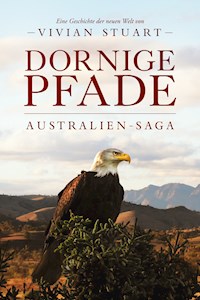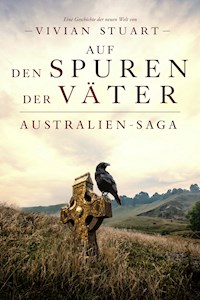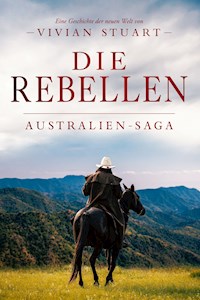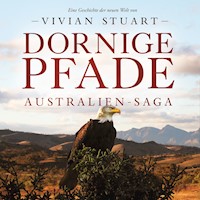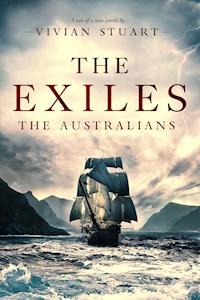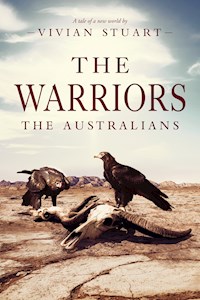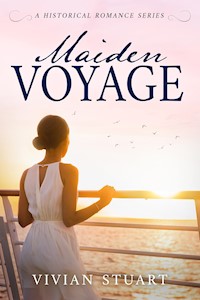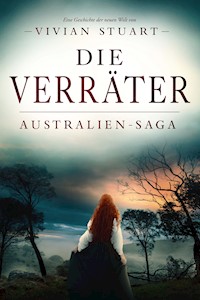
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Sie waren Rebellen und Ausgestoßene, die um die halbe Welt flohen, um das raue australische Ödland zu besiedeln. Jahrzehnte später, bereichert durch Liebe und gestärkt durch Tragödien, hatten sie die Wildnis in fruchtbares Land und sich selbst in Australier verwandelt. Eine neue Generation ist in der ehemaligen Strafkolonie Australien herangewachsen. Allmählich wird das ferne Land auch zum Ziel der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Jenny Broome, die als junge Verbannte in die Kolonie kam, muss sich nach dem Tod ihres Mannes Johnny allein zurechtfinden. Ihre Trauer um den Verstorbenen lässt sie jeden Gedanken an einen anderen Mann aus ihrem Herzen verbannen. So bleibt sie allein zurück, denn ihr Sohn Justin hat das Seefahrerblut des Vaters geerbt. Der dritte Band der großen Australien-Saga
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Verräter
Die Verräter – Australien-Saga 3
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1981
© Deutsch: Jentas A/S 2021
Serie: Australien-Saga
Titel: Die Verräter
Teil: 3
Originaltitel: The Traitors
Übersetzung : Jentas A/S
ISBN: 978-87-428-2040-7
Prolog
Abigail Tempest beobachtete angespannt, wie ihr Vater das Pferd bestieg und davonritt. Sie blickte ihm nach, bis er nicht mehr zu sehen war, hielt ihre Stirn an die Fensterscheibe gepreßt und sagte: »Papa ist fort, Rick. Ich hatte so gehofft, daß er bleiben würde ... er hatte es mir versprochen.«
Ihr Bruder Richard trat hinter sie. Er trug seine Marineuniform, und die weißen Streifen auf seinem Jackenärmel verrieten, daß er schon nach zwei Jahren zum Fähnrich befördert worden war. Er war siebzehn Jahre alt, nur ein Jahr älter als Abigail, aber er war mehr als einen Kopf größer als sie und glaubte von sich, sehr viel mehr von der Welt zu verstehen als sie.
Er war bemüht, sich sein Gefühl der Überlegenheit nicht anmerken zu lassen, und entgegnete: »Du verstehst das eben nicht, Abby. Papa konnte diese Einladung von Lord Ashton nicht abschlagen. Er ist Konteradmiral und hat Papa schon viele Dienste erwiesen. Und außerdem —«
»Er ist ein ehemaliger Konteradmiral, Rick«, erwiderte Abigail. »Und der arme Papa braucht jetzt auch niemanden mehr, der ihm bei seiner Karriere in der Marine unter die Arme greift, oder?«
»Das stimmt schon«, gab ihr Bruder zu, »aber ich kann seine Hilfe gut brauchen. Er hat dafür gesorgt, daß ich jetzt auf der Seahorse diene. Es ist eine Zweiundvierzig-Kanonen-Fregatte.«
»Jetzt im Krieg hättest du doch keine Schwierigkeiten gehabt, selber eine Koje zu finden«, meinte Abigail.
Sie wandte sich zu ihm um, und Richard war entsetzt, wie traurig sie aussah. Sie war hübsch und talentiert, dachte er, hatte eine schöne Singstimme und spielte gut Klavier. In ihrem Alter sollte sie ein sorgloses Leben führen können und viele Verehrer haben, aber statt dessen ... Er seufzte und ergriff ihre Hand, und sie fuhr fort: »Sie werden nach dem Essen wieder spielen, Rick — das machen sie immer, und die Einsätze sind so hoch, daß Papa sich das eigentlich gar nicht leisten kann.«
»Er könnte ja gewinnen«, meinte Rick kleinlaut.
Als Antwort deutete Abigail auf das spärlich möblierte Zimmer. »Siehst du nicht ... bist du denn blind? Die Bilder sind weg, Großvaters Bücher und Mamas geliebtes Porzellan auch — du warst zwei Jahre lang von zu Hause weg, Rick, aber du merkst doch bestimmt den Unterschied.«
»Mir ist aufgefallen, daß nur noch drei Pferde im Stall stehen«, gab Richard zu, »und daß die Kutsche weg ist. Aber —«
»Alles ist verkauft worden«, sagte Abigail. »Erst vor drei Wochen waren drei Gerichtsdiener hier und haben Mamas Klavier abgeholt. Mister Madron war zu Gericht gegangen, damit er endlich das Geld kriegt, das Papa ihm schuldet.«
»Madron? Ist das der Lebensmittelkaufmann?«
»Sein Sohn Reuben. Der alte Tobias Madron hat sich zur Ruhe gesetzt. Reuben behauptet, daß Papa mit der Zahlung des Pferde- und Viehfutters ein Jahr im Rückstand ist.« Abigail schüttelte verzweifelt den Kopf und fuhr leise fort: »Anfang des Monats hat Papa die beiden letzten Farmen verkauft, und die drei Pferde, die im Stall stehen, bekommen nichts mehr zu fressen außer Heu.«
»Aber ... Papa hat doch jetzt keine Schulden mehr, oder? Wenn er die Farmen verkauft hat, ist doch sicher alles zurückgezahlt?«
Abigails Unterlippe zitterte, und sie nahm sich zusammen, um weitersprechen zu können. »Er hat immer noch Spielschulden. Ich weiß aber nicht wie hoch, er sagt ja nichts Genaues. Rick, aber du hast noch nicht das Schlimmste gehört.«
»Noch nicht? Dann sag es mir doch, um Gottes willen!«
Sie zögerte und schaute ihn unsicher an. »Hat Papa nichts erwähnt? Hat er dir nicht seine — seine Zukunftspläne angedeutet?«
»Nein«, sagte ihr Bruder. »Verdammt noch mal, Abby, ich bin doch erst gestern nachmittag hier angekommen. Wir haben kaum miteinander gesprochen — er hat sich nach meiner Zeit auf See erkundigt, und ich habe ihm natürlich etwas darüber erzählt. Viel mehr Zeit hatten wir nicht, und ich war todmüde. Aber ... nun, er hat natürlich etwas von Mama gesagt. Wie tapfer sie am Ende war, und wie sehr er sie vermißt. Und das tut er wirklich, Abby ... Er hatte Tränen in den Augen, als er von ihr sprach.« »Das weiß ich«, sagte Abigail unglücklich. Sie ging zum offenen Kamin, stocherte in der Glut und legte ein Scheit Holz nach. »Wir vermissen sie alle, Rick. Es wäre ... ach, es wäre alles anders gekommen, wenn Mama noch leben würde! Papa hörte auf sie. Er machte das, was sie für richtig hielt. Auf mich hört er nicht. Er sagt, ich sei noch ein Kind.«
»Und das bist du nicht?« fragte Richard scherzhaft. Aber sein Versuch, sie aufzuheitern, mißlang. Abigail schüttelte den Kopf.
»Nein«, entgegnete sie. »Ich bin kein Kind mehr. Unter den gegebenen Umständen kann ich mir das gar nicht leisten. Papa ist nicht mehr der, der er mal war, Rick. Seit der schlimmen Kopfverletzung in der Schlacht von Kopenhagen hat er sich sehr verändert, und es wird immer noch schlimmer. Als Mama noch lebte, nahm er sich ihr zuliebe zusammen. Er hat auch damals schon zu viel getrunken und mit seinen Freunden um Geld gespielt, aber nicht so — nicht ganz so viel.
Als der Waffenstillstand mit Frankreich vorbei war, hoffte er, daß die Admiralität seine Dienste wieder brauchen würde. Aber obwohl er sich sehr darum bemühte, wurde ihm kein Kommando über ein Schiff mehr angeboten.«
»Weil er ein kranker Mann ist«, warf Richard ein. Er setzte sich zu ihr ans Feuer. »Erzähl weiter, Abby. Du hast seine Zukunftspläne erwähnt.«
Abigail antwortete nicht. Sie starrte ins Feuer und versuchte, ihre Tränen vor ihrem Bruder zu verbergen. Seine Kehle war wie zugeschnürt, er kniete sich neben sie und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Erzähl mir bitte alles, Abby«, bat er sie leise. »Ich muß es doch wissen, selbst wenn Papa es nicht vermocht hat, sich mir anzuvertrauen. Welche Pläne hat er denn?«
Sie versuchte, ganz ruhig zu sprechen. »Er will sich als Freier Siedler in Botany Bay niederlassen und Lucy und mich mitnehmen. Um dort — ein neues Leben anzufangen, wie er sagt. Um dich braucht er sich ja nicht mehr zu sorgen. Er will dieses Haus verkaufen — alles, was wir noch haben —, um das Geld für unsere Überfahrt zusammenzubekommen.«
Richard starrte sie ungläubig an.
»Botany Bay? Aber das ist doch eine Strafkolonie! Und es ist am anderen Ende der Welt! Das ist ... um Gottes willen, Abby, wer hat ihn bloß darauf gebracht? Hat er ... hat er den Verstand verloren?«
»Manchmal glaube ich das wirklich«, gab Abigail zu. Sie wischte sich die Tränen ab und sagte: »Er hat sich so sehr verändert, Rick, aber ... vielleicht hat ihn ein Offizier darauf gebracht, der drüben lebt und gerade auf Heimaturlaub hier ist. Es ist Major Joseph Foveaux vom Neusüdwales-Korps — er lebt als Gast bei den Fawcetts in Lynton Manor. Und«, fügte sie hinzu, »ich glaube, daß er auch heute abend bei Lord Ashton eingeladen ist — ich habe gehört, daß er ein sehr guter Kartenspieler ist. Papa hat ihn in den letzten Wochen oft getroffen und spricht mit ihm den Plan gründlich durch.«
»Aber es ist doch eine Strafkolonie«, wiederholte Richard verständnislos. »Was für ein neues Leben könnte man denn dort aufbauen?«
»Anscheinend ein sehr gutes, wenn man Major Foveaux Glauben schenken soll«, antwortete Abigail. »Er scheint dort drüben ein Vermögen gemacht zu haben. Zuerst in Australien selbst, wo er zweitausend Morgen Land besitzt, und dann auf einer Insel, die neunhundert Meilen weit entfernt von Australien liegt — sie heißt Norfolk. Er erzählte Papa, daß die aufsässigsten und schwierigsten Sträflinge dort hingeschickt werden — die einen Umsturz planen oder zu fliehen versuchen.«
»Und dahin will Papa gehen?«
»Nein, nicht nach Norfolk — nach Sydney. Offenbar bekommen dort Freie Siedler so viel Land, wie sie nur haben wollen, zugesprochen, zu einem lächerlichen Preis, und Sträflinge erledigen alle schweren Arbeiten, wenn man für Kost und Logis sorgt.«
Die Geschwister blickten schweigend ins Feuer. Schließlich fragte Richard: »Möchtest du dorthin, Abby?«
»Ach, Rick, natürlich will ich nicht dorthin!« antwortete Abigail unglücklich. »Hier ist meine Heimat — ich habe mein ganzes bisheriges Leben hier verbracht und unsere kleine Schwester Lucy auch. Ich habe geradezu Angst davor, England zu verlassen! Und außerdem soll Neusüdwales ein schrecklicher Ort sein. Es muß dort dunkelhäutige Wilde geben, von den schlimmsten Verbrechern Englands mal ganz abgesehen, und das muß ganz einfach wahr sein, da nicht einmal Major Foveaux das abstreitet.« Sie zitterte. »Und, Rick, dieser gräßliche Captain Bligh von der Bounty ist der Gouverneur ... stell dir das einmal vor!«
»Papa bewundert Captain Bligh, Abby«, meinte Richard. »Er hat uns doch ein paarmal erzählt, daß sich Captain Bligh in der Schlacht von Kopenhagen als ein wahrer Held erwiesen hat. Selbst Lord Nelson war dieser Ansicht. Er —« Abigail seufzte. »Ich habe ja nicht gesagt, daß ich nicht gehen werde, Richard ... nur, daß ich es nicht möchte. Aber wenn ich dem armen Papa helfen kann, dann darf ich nicht an mich denken. Wenn er sich wirklich entschließt, dort ein neues Leben aufzubauen, dann müssen Lucy und ich ihn begleiten. Außerdem«, fügte sie niedergeschlagen hinzu, »haben wir auch gar keine andere Wahl, oder?«
Das ist wahr, dachte. Richard. Wenn ihr Vater tatsächlich den Entschluß gefaßt hatte, England zu verlassen, konnten die beiden Mädchen nicht alleine hier Zurückbleiben. Und er konnte sie von seinem schmalen Fähnrichsold auch nicht unterstützen.
Als ob sie seine Gedanken erraten hätte, sagte Abigail leise: »Du brauchst dir keine Gedanken um uns zu machen, Rick. Du hast vollauf genug mit deiner Karriere zu tun.« Sie brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Lieber Rick, ich bin so froh, daß du wieder da bist! Und es erleichtert mich sehr, daß ich mit jemandem sprechen kann — jemand, der meine Sorgen um Papa versteht. Lucy ist ja noch ein halbes Kind, mit der kann ich natürlich nicht so sprechen wie mit dir. Und sie ist so sensibel, und betet Papa an. Sie —«
»Das hast du auch getan, Abby«, erinnerte ihr Bruder.
»Ja«, gab sie mit kalter Stimme zu. »Das habe ich getan.«
Richard sagte hilflos: »Ich wünschte, ich könnte dir etwas helfen, ich ... wann will Papa denn aus wandern? Oder weiß er es selbst noch nicht genau?«
»Doch, es steht schon alles fest. Vor einer Woche hat er mir gesagt, daß er für uns drei und Jethro eine Überfahrt an Bord der Mysore gebucht hat. Es ist ein Vierhundert-Tonnen-Ostindienfahrer, und der Kapitän, ein Mann namens Duncan, hat ihm versichert, daß es eine schnelle Überfahrt sein wird. Aber« — Abigail zuckte mit den Schultern — »auch wenn es schnell geht, dauert die Fahrt nach Sydney ein halbes Jahr lang, oder?«
Richard nickte. »Ich glaube, ja. Nur wenige Schiffe schaffen es in kürzerer Zeit.« Die Mysore war wahrscheinlich ein Sträflingstransporter, der ein paar zahlende Passagiere mitnahm. Wenigstens war es sicher, daß auf einem Sträflingstransporter ein Arzt mitfuhr, der dafür sorgen mußte, daß die Sträflinge ausreichend ernährt und gut behandelt wurden, denn die Bedingungen hatten sich in den letzten Jahren sehr gebessert.
»Wann soll die Mysore denn auslaufen, Abby? Und weißt du, von welchem Hafen es losgeht?«
»In drei bis vier Wochen, glaube ich«, antwortete sie. »Das Schiff liegt schon in Plymouth — wenigstens ist die Fahrt bis dorthin nicht weit.« Nach einer Pause ergriff sie wieder das Wort: »Ich kann einfach nicht glauben, daß Papa England im tiefsten Herzen verlassen will oder daß er dieses Haus verkaufen möchte. Er ist genauso wie wir hier aufgewachsen, und ich weiß, daß er es genauso liebt wie wir. In Neusüdwales wird es für uns so anders sein. Ich —« Sie zögerte und schaute ihn unsicher an, weil sie nicht wußte, ob sie ihm noch mehr anvertrauen könnte.
Richard errötete. »Du kannst mir vertrauen, Abby«, versicherte er ihr. »Ich erzähle niemandem etwas von diesem Gespräch — am allerwenigsten Papa.«
Sie fuhr erleichtert fort: »Wie ich schon gesagt habe, hat Papa all seine Informationen von diesem Major Foveaux, der sehr begeistert von den Möglichkeiten erzählt, die Sydney bietet. Aber ich ... ich habe mich bei einer Frau erkundigt, Rick — und ganz wie ich befürchtet habe, fiel ihr Bericht sehr viel weniger positiv aus als der des Offiziers. Dadurch erfuhr ich von den dunkelhäutigen Eingeborenen — es scheint, daß sie abgelegene Farmen überfallen und unvorstellbar grausam plündern, brandschatzen und morden.«
Richard schaute seine Schwester ungläubig an. »Eine Frau hat dir das erzählt? Aber wo, um alles in der Welt, bist du einer Frau begegnet, die etwas über Sydney weiß?«
Abigail lächelte. »Ach, ganz in der Nähe, und es war wirklich ein Zufall ... Es ist eine Mary Briant, eine Witwe und so etwas wie eine Berühmtheit. Ich hörte von ihr und fuhr einfach hin und —«
»War diese Misses Briant ein Sträfling?« unterbrach Richard sie mißtrauisch.
»Ja, aber sie ist trotzdem eine sehr respektable Frau, wirklich, und sie ist längst vom König begnadigt worden. Sie hat mir erzählt, daß sie mit einer kleinen Gruppe von Sträflingen in einem offenen Kutter nach Timor geflohen ist. Die arme Frau ... sie hat auf der Fahrt von Timor nach England ihre beiden kleinen Kinder und ihren Mann verloren.«
Richard schlug sich überrascht auf den Schenkel. »Das ist eine Heldin! Ich erinnere mich an die Geschichte — es ist schon vierzehn oder fünfzehn Jahre her. Diese unglaubliche Flucht in dem offenen Kutter ereignete sich während der Regierungszeit von Gouverneur Phillip. Seitdem haben sich die Bedingungen geändert, und ich bin ganz sicher, daß jemand wie Captain Bligh alles dafür tut, daß sich die Lebensbedingungen dort verbessern, denn immer mehr Freie Siedler wandern nach Sydney aus.«
»Vielleicht stimmt das, Rick«, meinte seine Schwester, »aber ich möchte noch jemand anderes befragen — Misses Briant hat mir ihren Namen genannt. Eine Misses Pendeen, die die Frau des Vikars in Bodmin ist. Sie ist Bischof Marchants Tochter, und sie kam erst vor kurzer Zeit aus Sydney zurück. Sie —«
»Dann war sie wenigstens kein Sträfling«, meinte Richard erleichtert. Abigail erinnerte sich daran, daß Mary Briant nebenbei erzählt hatte, daß die Tochter des Bischofs ebenso wie sie selbst vom König begnadigt worden war ... , aber sie hatte das schon damals nicht ganz glauben können und angenommen, daß die Frau sich nicht richtig erinnert hatte. Der alte Bischof Marchant war zwar schon lange tot, als sie noch ein kleines Kind gewesen war, aber es wurde noch mit großem Respekt und viel Liebe von ihm erzählt. Man konnte sich kaum vorstellen, daß seine Tochter, die jetzt die Frau eines Vikars war, einmal als Sträfling nach Neusüdwales geschickt worden sein sollte.
Sie schüttelte den Kopf und antwortete mit überzeugter Stimme: »Nein — nein, natürlich nicht, deshalb will ich sie ja auch sehen. Kommst du mit, Rick? Kannst du dir nicht etwas ausdenken, dann stellt Papa keine Fragen, wenn wir zusammen das Haus verlassen.«
Er lächelte sie an. »Ich komme mit«, versprach er ihr, »wenn es dir so viel bedeutet, meine liebe Abby.« Während er sprach fiel ihm ein, daß er seine gesamte Familie vielleicht nie wiedersehen würde, wenn sie nach .Neusüdwales auswanderte. Er spürte einen Stich in seinem Herzen, und als er seine Blicke über die kahlen Wände und die leeren Bücherregale im Zimmer schweifen ließ; ging er zum erstenmal kritisch mit seinem Vater zu Gericht. Wie Abby und die kleine Lucy hatte auch er seine Eltern geradezu angebetet, aber jetzt ...
»Vielleicht«, meinte er, »vielleicht macht Papa heute abend einen großen Gewinn, und wir können all unsere Ängste vergessen.«
»Darum bete ich schon die ganze Zeit«, gestand Abigail. Sie vermied seinen Blick, und zwei rote Flecken brannten auf ihren Wangen. »Ich weiß, man sollte Gott nicht um solche — solche weltlichen Dinge bitten, aber ich bitte jeden Abend in meinem Nachtgebet darum, Rick. Ich flehe Gott an, daß Papa genug gewinnt, damit wir hierbleiben können und« — sie schaute ihn an — »ich habe auch lange darum gebetet, daß du gesund zu uns zurückkommst. Gott hat diesen Wunsch erfüllt, aber bei dem anderen bin ich mir nicht so sicher.«
Richard drückte seiner Schwester die Hand. »Ist es nicht Zeit zum Abendessen? Komm, wir suchen Lucy und machen uns eine schöne Zeit zusammen ... wir tun einfach diesen einen Abend lang so, als ob noch alles beim alten ist!« Nach einem späten und ausgedehnten Abendessen im Pengallon-House wurde mit dem Lu-Spiel begonnen, und schon nach ein paar Runden einigten sich alle Mitspieler auf Major Foveaux’ Vorschlag, daß der Verlierer jeweils den Einsatz in der Kasse verdoppeln müsse.
Jetzt dämmerte der Morgen, die Kerzen waren heruntergebrannt und es war klar, daß Edmund Tempest wieder einmal eine große Geldsumme verloren hatte. Drei weitere rote Spielmarken landeten im Pool. Mit starrem Gesichtsausdruck schob Foveaux sie ordentlich übereinander. Tempest sagte leise: »Ihr Spiel!«
Ein Diener brachte die heiße Schokolade herein, die der Admiral bestellt hatte, aber er winkte ihn ungeduldig weg und schaute keinen Augenblick lang vom Spieltisch auf. Foveaux spielte die Pikdame, doch Tempest hatte ein As. Als er seinen Herzkönig spielte, merkte er, daß sein Gegner nichts auf der Hand hatte. Er nutzte die Lage und nahm die nächste Karte vom Stapel.
»Herz ist Trumpf, Joseph«, sagte er mit rauher Stimme und ließ seine Hand sinken. »Sie haben keinen Stich.«
»Augenblick mal!« rief Joseph Foveaux aus. »Die Karte, die Sie gerade aufgedeckt haben, die Herz Neun, habe ich eben abgelegt. Die haben Sie heimlich auf den Boden fallen lassen. Bei Gott —« er sprach alle am Tisch an — »hat niemand von Ihnen das gesehen? Das müssen Sie doch gesehen haben!«
Die anderen schüttelten schweigend den Kopf. Lord Ashton zögerte und war hin und her gerissen zwischen seinem Sinn für Gerechtigkeit und seiner Abneigung gegen den Emporkömmling Foveaux. Wenn er jetzt etwas sagen würde, wäre Edmund Tempests Ruin nicht mehr abzuwenden, dessen war er sich voll bewußt. Er war sich nicht ganz sicher, welche Karte tatsächlich zu Boden gefallen war. Nach Foveaux’ Ausruf entschloß er sich, so wie die anderen zu schweigen. »Zum Teufel mit Ihnen, Tempest!« rief der Neusüdwales-Korpsoffizier mit verzerrtem Gesicht aus. »Sie haben versucht, mich zu betrügen!«
Bevor Tempest etwas erwidern konnte, mischte sich der Admiral ein. »Ich verbitte mir, daß Sie in meinem Haus eine für alle Beteiligten unangenehme Szene machen«, warnte er die beiden kalt. »Major Foveaux, ich bitte darum, daß Sie sofort gehen, Sir. Teilen Sie den Pool untereinander auf und ersparen Sie uns diese unangenehmen Anschuldigungen. Das Spiel ist beendet.«
»Wie Sie wünschen, Sir«, zischte Foveaux mit kalter Wut. Er nahm seine Spielmarken, tauschte sie in Geld ein und fügte mit leiser Stimme hinzu: »Sie werden noch von mir hören, Tempest, merken Sie sich das!«
»Meine Sekundanten werden Ihre Vorschläge anhören«, entgegnete Edmund Tempest. »Sie —« Aber der Admiral unterbrach auch ihn. Die Fawcetts verabschiedeten sich. Sir Christopher Tremayne schüttelte die Hand des Gastgebers mit ungewöhnlicher Wärme und folgte ihnen, und Tempest ging hinterher, als Lord Ashton ihn zurückrief. »Er hatte recht, oder, Edmund?« fragte der General mit eiskalter Stimme. Als der jüngere Mann den Versuch machte, ihm Sand in die Augen zu streuen, fügte er hinzu: »Ich sah die Karte, die auf den Boden gefallen ist.«
»Ich schwöre Ihnen ... mein Glück kam gerade zurück, ich hatte die besten Karten ... ich hätte gewonnen, glauben Sie mir —«
»Sie sind in diesem Haus nicht mehr willkommen, Edmund. Und auch nicht in irgendeinem Haus in der Nachbarschaft. Foveaux wird reden, und ganz bestimmt Arnold Fawcett auch.«
»Aber, Sir ... so hören Sie mich doch bitte an.« Tempests hochrotes Gesicht war inzwischen blaß geworden. Er zitterte, und der Admiral konnte ihm ansehen, daß er sich unendlich schämte. »Ich bitte Sie, Sir ... ich spreche die Wahrheit. Ich sah die Karte zwar fallen, und fühlte mich versucht, aber ich —« »Ersparen Sie mir Ihre Entschuldigungen, Edmund«, bat ihn Lord Ashton. Er richtete sich zu seiner vollen, beeindruckenden Größe auf und versuchte nicht einmal, den Abscheu zu verbergen, den er empfand. »Sie planen, nach Neusüdwales auszuwandern, oder? Stimmt es, daß Sie bereits für sich und Ihre beiden Töchter die Überfahrt gebucht haben?«
Tempest nickte. »Ja, auf dem Ostindienfahrer Mysore, der von Plymouth absegelt, aber —«
»Dann ist der beste Rat, den ich Ihnen geben kann, daß Sie sofort an Bord gehen und so schnell wie möglich aus dieser Gegend hier verschwinden. Ich werde mich um Ihren Jungen kümmern. Und, um Gottes willen, Mann«, — der Admiral sprach jetzt leiser und flehender — »machen Sie doch etwas aus Ihrem Leben, wenn Sie in Botany Bay ankommen, damit Ihre zwei kleinen Töchter sich nicht ihres Vaters schämen müssen.«
»Ich ... ich werde tun, was Sie sagen, Sir«, versprach Edmund Tempest. »Aber mein Haus — ich muß es verkaufen, und —«
»Ich werde meine Rechtsanwälte beauftragen, das für Sie abzuwickeln. Wenn Sie vor Kaufabschluß das Land verlassen, werde ich Ihnen die Verkaufsurkunde nachschicken lassen.« Der Admiral drehte sich um und fühlte, wie ihm Tränen in die Augen stiegen. Was war das für eine traurige Geschichte ... Edmund war als junger Offizier der Stolz der Marine gewesen, und er war ihm damals wie ein Sohn gewesen. Aber jetzt ... »Gehen Sie mir aus den Augen«, bat er ihn mit rauher Stimme.
Als er seine Gefühle wieder unter Kontrolle hatte und sich umwandte, war Edmund Tempest verschwunden.
1
Eine Stunde vor Sonnenaufgang saß Captain William Bligh, der Gouverneur der Strafkolonie Neusüdwales am frühen Morgen des 28. Juli 1808 bereits an seinem Schreibtisch. Post aus England, die am vorhergehenden Abend vom Kapitän des Sträflingstransporters Duke of Portland abgeliefert worden war, lag in einem sauberen Stapel auf seinem Schreibtisch, aber der Gouverneur blickte nur kurz auf die Siegel und auf die Handschriften, um zu wissen, von wem die Briefe stammten.
Ihm war klar, daß die Nachrichten veraltet waren, denn die Duke of Portland hatte lange für die Überfahrt gebraucht. Aber der Kapitän John Spence hatte alle einhundertneunundachtzig weiblichen Sträflinge nicht nur lebendig, sondern auch in sehr guter Verfassung abgeliefert, und das war, weiß Gott, sehr viel wert. Fast jedes Transportschiff verlor einige seiner unfreiwilligen Passagiere während der langen Überfahrt nach Botany Bay.
Die Regierung in der Heimat wählte die Menschen, die in die Verbannung geschickt wurden, noch immer nicht danach aus, ob sie als zukünftige Siedler oder Arbeiter der neuen Kolonie nützlich sein konnten. Das einzige Ziel der Regierung schien immer noch zu sein, Englands Gefängnisse von Dieben und Prostituierten und Irlands Gefängnisse von Rebellen zu räumen. Schon seine Amtsvorgänger hatten wie er zu erreichen versucht, daß nur geeignete Sträflinge in die Kolonie geschickt würden, waren aber genauso wie er mit ihren Bitten auf taube Ohren gestoßen.
Die Bitten waren einfach ignoriert worden, ebenso wie die noch dringenderen Bitten um die Zuteilung eines Regiments von Marineinfanteristen, das das völlig korrupte Neusüdwales-Korps ersetzen sollte. Als Grund dafür wurde mit schöner Regelmäßigkeit der Krieg mit Frankreich angegeben ... Das war ja schließlich auch ein Grund. Vielleicht wären an Bord der Mysore — deren Ankunft die Signalflaggen auf dem Südkap gestern abend angekündigt hatten — die Siedler, die Captain Bligh erwartete, und nicht nur der Abschaum aus den Gefängnissen von Großbritannien.
William Bligh seufzte auf, und es war ihm bewußt, daß er mit nichts rechnen konnte. Er schob Staatssekretär Windhams Briefe zur Seite und griff nach dem Papier, auf das sein eigener Sekretär das Ergebnis der letzten Volkszählung niedergeschrieben hatte.
Die Bevölkerung in Neusüdwales war inzwischen auf siebentausendfünfhundertzweiundsechzig Einwohner angewachsen. Über tausend Menschen davon waren Freie Siedler oder begnadigte ehemalige Sträflinge, die inzwischen ihr eigenes Land bestellten und weitgehend von ihren eigenen Erzeugnissen leben konnten, vorausgesetzt, daß keine Dürre oder keine plötzliche Überschwemmung sie in wenigen Tagen um die Frucht ihrer Arbeit brachte.
Diese Menschen waren das Herzblut der Kolonie. Er hatte das von Anfang an so gesehen und ihnen in jeder Hinsicht Unterstützung und Ermutigung gewährt, trotz des erbitterten Widerstandes der Korps-Offiziere, die alles daransetzten, sich auf Kosten der Siedler zu bereichern.
Das Neusüdwales-Korps stellte das größte Hindernis für eine positive Entwicklung der jungen Kolonie dar, die ihm anvertraut war. Schon vor fünfzehn Jahren, noch unter der Regierungszeit des ersten Gouverneurs Phillip hatte sich das Korps den nicht gerade schmeichelhaften Namen »Rum-Korps« eingehandelt.
Seine beiden Amtsvorgänger, John Hunter und Phillip King, hatten wegen der gefährlichen und undurchsichtigen Machenschaften der Korps-Offiziere ihren Posten verloren. Besonders einer, John MacArthur, der inzwischen pensioniert und der reichste Farmer der Kolonie war, konnte noch nie bei seinen halblegalen Handelsgeschäften erwischt werden. Allen Offizieren waren große Ländereien zugesprochen worden, die von Sträflingen ohne Lohn bearbeitet wurden, und alle hatten sich intensiv in Handelsgeschäfte gestürzt — Handelsgeschäfte, die hauptsächlich aus dem Import und Tauschgeschäften mit Rum bestanden. Den einfachen Soldaten und den Sträflingen blieb ebenso wie den Freien Siedlern nichts anderes übrig, als den Rum als Währung der Kolonie anzusehen. Der Arbeitslohn wurde mit Rum bezahlt, Lebensmittel wurden gegen Rum eingetauscht, und MacArthur und seine Mitoffiziere hatten sich eine goldene Nase an ihrem Rum-Monopol verdient.
Bligh war mit dem ausdrücklichen Auftrag zum Gouverneur ernannt worden, dieses Monopol zu brechen und eine stabile Währung einzuführen, aber ... Herrgott noch mal, das würde seine Zeit brauchen! In Sydney hatten bei seiner Ankunft praktisch anarchistische Zustände geherrscht, der arme Phillip King war ein gebrochener und verbitterter Mann gewesen, der sich pausenlos über die verbrecherischen Praktiken des Neusüdwales-Korps beschwert hatte, der ihm aber keinen Hinweis hatte geben können, wie die Situation gebessert oder die Macht des Rum-Korps gebrochen werden könnte. Und es gab einfach keinen legalen Weg, um diese Leute kurzfristig loszuwerden ... Sie machten der Uniform, die sie trugen, ganz und gar keine Ehre!
Captain Bligh war sich seiner Hilflosigkeit bewußt. Er stand auf und ging zum offenen Fenster hinüber, atmete tief durch und beobachtete, wie die Sonne aufging.
Er hatte alle Rechte bekommen, Macht auszuüben, aber keine Mittel, sie auch durchzudrücken. Aber Gott wußte, daß er alles versucht hatte, die ihm gestellten Ziele zu erreichen. Er hatte mit Unterstützung und Zustimmung der Freien Siedler die englische Währung eingeführt, Festpreise für Grundnahrungsmittel festgesetzt, jegliche private Alkoholeinfuhr verboten, fünfzig Alkoholausschanklizenzen eingezogen und Bürger mit gutem Leumund in den zivilen Magistrat eingesetzt. Ständig hatten die Schwarzbrenner versucht, ihm Steine in den Weg zu legen. John MacArthur war als Besitzer von fünftausend Morgen ausgezeichneten Weidelandes, mit seinen importierten Schafherden und den neunzig Arbeitern, die er auf seinen zwei großen Farmbetrieben beschäftigte, ein machtvoller Gegner.
MacArthur kannte darüber hinaus keine Skrupel und war klug und beweglich in der Verfolgung seiner Ziele. Er brach das Recht, ohne mit der Wimper zu zucken, und der Kommandant des Neusüdwales-Korps, Major Johnstone, stand vollkommen unter seinem Einfluß.
Aber ... der Gouverneur ballte die Fäuste. MacArthur war nicht unfehlbar. Kein Mann war unfehlbar, und früher oder später würde auch er einen Fehler machen. Dann wäre endlich der Zeitpunkt gekommen, zu handeln, und Gott war sein Zeuge, daß er diesem Mann gegenüber keine Gnade walten lassen würde. Es klopfte an der Tür.
William Bligh setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch.
»Guten Morgen, Sir.« Sein Sekretär, Edmund Griffin, schaute ihn aufmerksam und hilfsbereit wie immer über den papierbedeckten Tisch hinweg an. Griffin war ein loyaler, hart arbeitender junger Mann, der seine kürzliche Beförderung zum Staatssekretär der Kolonie wirklich verdient hatte, und Gouverneur Bligh erwiderte lächelnd seinen Gruß.
»Nun?« fragte er. »Was gibt es, Edmund?«
»Ich möchte mich für die frühe Störung Ihrer Exzellenz entschuldigen«, sagte der Sekretär, »aber Mister Atkins ist hier und —«
»Zu dieser Stunde?« rief der Gouverneur aus.
»Er sagt, daß es dringend ist, Sir. Der Rechtsanwalt, Mister Crossley, ist auch dabei.«
»Was wollen die denn, verdammt noch mal!« Bligh war wirklich überrascht. Richter Atkins gehörte nicht zu den Frühaufstehern, aber er hatte Crossley bei sich, und dessen Gewohnheiten kannte Bligh nicht. George Crossley war ein ehemaliger Königlicher Rechtsanwalt, der wegen Meineides in die Verbannung geschickt und kurz nach seiner Ankunft in Sydney von Gouverneur King begnadigt worden war. Er machte sich dann nützlich, indem er ihn in rechtlichen Fragen beriet. Er war ein durchtriebener, intelligenter kleiner Kerl, der sich in allen Tricks der Jurisprudenz auskannte, und Atkins — der nicht halb soviel davon verstand — hatte sich kürzlich um seine Mithilfe bemüht, in der Hoffnung, MacArthur endlich sein kriminelles Handwerk legen zu können.
Schließlich meinte der Sekretär: »Mister Atkins ließ verlauten, daß die beiden sich die ganze Nacht über beraten haben, Sir.« Er räusperte sich und fuhr fort: »Beide sehen auch so aus, als ob das — als ob das stimmt. Wenn es Eurer Exzellenz recht ist, bringe ich den beiden gern eine Tasse Kaffee. Das heißt, wenn —«
»Ja, tun Sie das, Edmund. Aber ich trinke Tee, wie üblich. Kümmern Sie sich darum, sobald Sie die beiden hereingebeten haben.«
»Sehr gut, Sir.«
»Ist irgend jemand der Mysore entgegengefahren?« fragte Bligh.
»Jawohl, Captain Hawley, Sir«, versicherte ihm Griffin. Er warf einen leicht vorwurfsvollen Blick auf den Poststapel auf dem Schreibtisch des Gouverneurs, rückte zwei Stühle für die Besucher zurecht und kündigte sie dem Gouverneur verspätet mit der Formalität an, auf die er Wert legte.
Hinter dem dicklichen, unbeholfenen Richter kam der schlanke, ordentlich gekleidete begnadigte Rechtsanwalt herein, der den Gouverneur geradezu unterwürfig begrüßte. Bligh bedeutete ihnen kurzangebunden, sich hinzusetzen. Atkins’ Augen waren rot umrändert, er hatte einen schwarzen Stoppelbart, und seine Kleidung war zerknautscht — er sah genauso aus wie jemand, der die Nacht durchgesoffen hat —, aber sein Gefährte war ganz im Gegensatz dazu gut angezogen und hatte frisch rasierte Wangen.
Als der Diener ein Tablett mit Kaffee und Tee hereinbrachte, dachte der Gouverneur, daß Richard Atkins nur selten ganz nüchtern war — eine traurige Tatsache, an der man ihm nicht allein die Schuld zuschieben konnte.
Als William Bligh jetzt zuschaute, wie er sich mit zitternder Hand eine Tasse Kaffee eingoß, fühlte er sowohl Mitleid wie auch Wut in sich aufsteigen. Es war ihm bewußt, daß Atkins’ langjähriger, erfolgloser Kampf mit John MacArthur ihn schließlich gebrochen und ihn zum Trinker gemacht hatte. Ihre Auseinandersetzungen gingen auf die Zeit zurück, als beide in Parramatta stationiert gewesen waren. Seitdem hatte MacArthur noch hinterhältiger als bislang versucht, Atkins schlechtzumachen und ihn seines Amtes zu entheben. Das hatte er zwar nicht erreicht, aber der arme Teufel hatte während der letzten Jahre von Phillip Kings Regierungszeit als Gouverneur allen Mut verloren. Immer wieder hatten MacArthur und seine Leute seine Integrität in Frage gestellt, immer wieder waren alle seine Versuche, den Gegner zu besiegen, erfolglos gewesen, aber ... Der Gouverneur schaute Atkins’ Begleiter forschend an. Seit der Ankunft von Crossley hatte Richard Atkins offensichtlich neuen Mut gefaßt, den Kampf fortzusetzen. Crossley war zweifellos ein windiger Geselle, aber er war ein erstklassiger Rechtsanwalt, er war scharfsinnig und kannte keine Skrupel ... Also tatsächlich genau der richtige Mann, um den Kampf gegen MacArthur mit einiger Hoffnung auf Erfolg anzugehen.
Als sein Tablett mit dem silbernen Teetopf hereingebracht wurde, schenkte sich Bligh eine Tasse ein, antwortete zerstreut auf Atkins’ dahingemurmelte Platitüden und studierte weiter das Gesicht des Mannes, auf den er seine Hoffnung setzte.
Ursprünglich hatte der Gouverneur ihn für über vierzig gehalten, aber dann hatte er seinen Papieren entnommen, daß er erst dreiunddreißig Jahre alt gewesen war, als er wegen Meineides aus der Anwaltschaft ausgeschlossen worden war.
Er war also nicht gerade der ideale Mann, den man sich vorstellen konnte, um die Kolonie von Betrügereien und Korruption zu befreien, dachte Bligh zynisch. Aber genausowenig war Atkins ein idealer Mann ... und er hatte keine Wahl, das hatte er inzwischen schon gelernt.
Als Crossley den forschenden Blick des Gouverneurs auf sich ruhen fühlte, lächelte er nervös und berührte Atkins am Arm, als ob er ihn an den Grund ihres frühen Hierseins erinnern wollte. Der Richter setzte seine Tasse ab und sah wie eine Eule aus, als er ernsthaft verkündete: »Wir sind der Meinung, Sir, daß Mister MacArthur und Captain Abbott gegen den Erlaß Gouverneur Kings verstoßen haben, Destillierapparate in der Kolonie einzuführen, Sir.«
»Das heißt Apparaturen, die dazu dienen, auf ungesetzliche Weise Alkohol herzustellen, Eure Exzellenz«, fügte Crossley hinzu.
»Zum Teufel noch mal!« rief der Gouverneur ungeduldig aus. »Ich weiß, daß die verdammten Destillierapparate hier angekommen sind! Der Kapitän des Schiffes hat mich, ganz wie es sich gehört, davon informiert, daß er sie an Bord hatte. Ich ordnete an, daß Doktor Harris sie konfiszieren sollte, und verlangte eine Erklärung von den Männern, an die die Apparate ausgeliefert werden sollten. Auf die Erklärung hätte ich allerdings verzichten können. Abbott behauptete, daß er von nichts eine Ahnung gehabt habe, daß er sie nicht bestellt habe und stimmte sofort mit meinem Vorschlag überein, sie den Herstellern zurückzuschicken.« Er machte eine wegwerfende Geste mit seinen Händen. »Ich zweifle nicht daran, daß Abbott oder MacArthur oder beide zusammen diese Apparate in der Hoffnung bestellt haben, sie unbemerkt ins Land einzuschleusen ... aber wie, zum Teufel, soll ich diesen Verdacht beweisen? Sagen Sie mir das!«
»Eure Exzellenz«, begann Crossley gewandt. »Es gibt eine — äh — neue Entwicklung, die ein vollkommen anderes Licht auf die Angelegenheit wirft, wie Mister Atkins Ihnen bestätigen wird.« Er wandte sich erwartungsvoll an den Richter, der sich räusperte und mit der Erklärung fortfuhr.
»Es ist nämlich so, Sir, daß Doktor Harris Mister MacArthur erlaubt hat, die beiden Kupferkessel, die zu den Destillierapparaten gehören, aus der Lagerhalle zu seiner Farm in Parramatta zu bringen.«
Der Gouverneur pfiff leise vor sich hin.
»Ja, Sir, das stimmt. MacArthur hat nämlich behauptet, daß die Kessel mit den Arzneimitteln gefüllt seien, die er aus England bestellt hat.«
»Und Harris ist dieser Geschichte aufgesessen?«
»Scheinbar ja. Allerdings ... das heißt, Sir —« Atkins wechselte einen bedeutungsvollen Blick mit seinem Begleiter. »Crossley ist vor kurzem über die — äh — Tatsache gestolpert, daß MacArthur ein Stück seines Besitzes schon Harris übergeben hat und —«
Er zögerte, als ob er davor zurückschrecken würde, seine Gedanken in Worte zu fassen, aber Crossley kannte solche Bedenken nicht und fuhr an seiner Stelle fort: »Ich bin der Meinung, Sir, daß Doktor Harris das Lager gewechselt hat. Ich glaube nicht, daß Eure Exzellenz in irgendeinem Bereich auf seine Unterstützung hoffen können, Sir, der sich mit einem Interessengebiet Mister MacArthurs überschneidet.«
Warum mußten sich Rechtsanwälte immer so geschraubt ausdrücken, dachte der Gouverneur ... Früher war Harris Gouverneur Kings Mann gewesen, hatte ihm durch dick und dünn zur Seite gestanden, und war für seine Loyalität bekannt gewesen. Seine Ernennung zum Marineoffizier war auf Kings Empfehlung hin geschehen. Er selbst hatte den ehemaligen Assistenten des Schiffsarztes zwar nie besonders leiden können, aber ... Crossley schaute ihn selbstbewußt über den Schreibtisch hinweg an und sagte: »Man darf auch nicht zuviel Gewicht auf diese Geschichte legen, Sir, Mister MacArthur hat, wie wir alle wissen, auch in der Vergangenheit nie Schwierigkeiten gehabt, Leute, die gegen ihn waren, zu bestechen.«
Der Gouverneur griff nach Papier und Federhalter, schrieb schnell etwas auf, las es durch und reichte es dann Crossley.
»Damit ist die Angelegenheit erledigt, finden Sie nicht? Es ist eine schriftliche Aufforderung, daß Harris die Kupferkessel zurückverlangen und sie mit dem Rest der verdammten Apparatur Captain Spence von der Duke of Portland übergeben soll.«
»Sehr gut formuliert, Sir«, stimmte der Rechtsanwalt zu. Er reichte das Papier dem Richter und fragte leise, während Atkins las: »Was soll geschehen, wenn Doktor Harris Ihren Befehl nicht ausführt, Sir?«
»Dann«, polterte Bligh, »wird dem gottverdammten Kerl die Leitung des Hafenzollamtes entzogen! Wenn wir jemals die Einfuhr von illegalem Alkohol stoppen wollen, ist es notwendig, daß wenigstens der Leiter des Zollamtes ein ehrlicher und zuverlässiger Mann ist. Und, bei Gott, vor allen Dingen einer, der sich nicht von den Schurken schmieren läßt, die ständig unsere Gesetze unterlaufen!« Er zog die Stirn in Falten und fuhr nach einer Pause fort: »Wenn Sie mit Ihren Anschuldigungen gegen Doktor Harris richtig liegen, Mister Crossley, dann — der Teufel soll ihn holen! Dann wird er fristlos entlassen.«
»Eure Exzellenz können sicher sein, daß diese Geschichte stimmt«, antwortete Crossley mit fester Stimme. »Wenn diese beiden Kessel sich nicht bereits auf Mister MacArthurs Farm in Parramatta befinden, dann sind sie gerade auf dem Weg dorthin. Und Mister MacArthur wird einfach behaupten, daß er Doktor Harris’ Erlaubnis für den Transport eingeholt hat.«
»Aber nicht meine, verdammt noch mal!« schimpfte Bligh. Zweifellos hatte Harris seine Autorität mißbraucht, aber hatte er mehr als das getan? Hatte MacArthur ihn tatsächlich zu dieser krummen Geschichte überreden können? Und wenn das stimmte, wo sollte er einen ehrlichen Mann finden, um ihn zu ersetzen, einen Mann, der nicht bestochen werden konnte? Plötzlich fiel ihm Robert Campbell ein, und er fühlte sich gleich erleichtert. Campbell und sein Neffe — der ebenfalls Robert hieß — waren Freie Siedler, beide waren sehr begüterte Männer, und sie waren selbst an diesem korrupten Ort für faire und ehrliche Geschäftspraktiken bekannt.
William Bligh wandte sich an Crossley.
»Können Sie mir bitte noch einmal das Papier herüberreichen.«
»Aber selbstverständlich, Sir.« Der Rechtsanwalt nahm das Papier aus Atkins’ unsicheren Händen entgegen, reichte es dem Gouverneur und fragte: »Soll ich es persönlich Doktor Harris überbringen, Sir? Es wäre für mich keine große Mühe.«
Bligh zögerte und schüttelte dann den Kopf. »Nein. Griffin soll es tun ... oder vielleicht Gore, als Kommandant der Feldgendarmerie. Das gäbe der ganzen Angelegenheit einen offiziellen Anstrich, oder? Ich möchte verhindern, daß Harris behaupten kann, daß er meine Nachricht nicht erhalten hat.«
Er stand auf und wollte damit andeuten, daß er das Gespräch für beendet hielt, aber Richard Atkins, der in brütendem Schweigen versunken gewesen war, rappelte sich aus seiner Apathie auf und bemerkte geheimnisvoll: »William Gore muß sehr vorsichtig behandelt werden, Gouverneur. Wir müssen wirklich sehr vorsichtig mit ihm umgehen.«
»Gore? Großer Gott!« Der Gouverneur starrte ihn überrascht an. Abgesehen von Andrew Hawley, seinem Helfer aus der königlichen Marine, war William Gore der beste Offizier, den er hatte. Er war mutig, ein guter Arbeiter und so ehrlich, wie ein Mensch nur sein konnte. Er erledigte seine Pflichten auf vorbildliche Weise und mit einer Unparteilichkeit, die ihm großen Respekt verschaffte. Das Amt des Kommandanten der Feldgendarmerie war nicht gerade eine dankbare Aufgabe, es wurde schlecht bezahlt und war zeitweise richtiggehend lästig, da es auch die Oberaufsicht über das Gefängnis und sämtliche Gendarmen der Kolonie beinhaltete, zusätzlich zu der großen Belastung der Arbeit bei Gericht. Blighs Lippen wurden schmal. »Was meinen Sie ganz genau, Mister Atkins?« fragte er geradeheraus. »Sie wollen mir doch nicht etwa sagen, daß Gore das Lager gewechselt hat?«
»Nein, selbstverständlich nicht«, versicherte ihm der Richter. »Ganz im Gegenteil. Gore ist ein ausgezeichneter Offizier mit hohem Pflichtbewußtsein, der sich der auf ihm ruhenden Verantwortung voll bewußt ist. Die Offiziere vom Rum-Korps haben natürlich versucht, ihn auf ihre Seite zu ziehen — aber ohne jeden Erfolg.« Er machte eine bedeutungsvolle Pause.
»Bitte fahren Sie fort«, bat Bligh ihn ungeduldig.
»Sie erinnern sich doch zweifellos daran, Sir, daß Gore vor ein paar Wochen die Entlassung des Oberaufsehers im Gefängnis beantragt hat. Und zwar wegen schlechter Behandlung der Gefangenen und allgemeiner Verkommenheit?«
Der Gouverneur zog die Stirn kraus. »Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Ich habe ihn entlassen.«
Atkins lächelte säuerlich. »Als Reaktion darauf wird der arme Gore jetzt nach Strich und Faden diskreditiert. Machays Geliebte hat gegen ihn eine Anzeige wegen Diebstahls erhoben, sie behauptet, daß er ihr irgendein Schmuckstück gestohlen habe. Diese offensichtlich an den Haaren herbeigezogene Geschichte entbehrt zwar jeder Glaubwürdigkeit, es muß ihr aber dennoch nachgegangen werden. Ich erwähne das nur, weil — nun, um eine ernsthafte Warnung auszusprechen, denn inzwischen gibt es schon eine zweite Anzeige gegen ihn. Simeon Lords Partner, James Underwood, hat Gore beschuldigt, daß er eine Unterschrift gefälscht habe.«
Bligh fluchte. »Nun, diese Anschuldigung ist ja geradezu lächerlich! Sie werden dieser Sache doch nicht etwa nachgehen, oder?«
»Es ist ein Protokoll aufgenommen worden«, antwortete der Richter zögernd. »Und jetzt muß ich Aussagen aufnehmen, aber —«
Crossley schaltete sich in das Gespräch ein. »Beide Anklagen sind geradezu lächerlich, Sir, aber meiner Meinung nach sollten sie nicht — äh — einfach vom Tisch gewischt werden. Es scheint mir in Mister Gores Interesse zu liegen, wenn diese Fälle ordentlich vor Gericht kommen und widerlegt werden.« Er sprach weiter, bis der Gouverneur schließlich überzeugt war.
»Sind Sie sicher, daß Gore seine Unschuld beweisen kann?« fragte er, und beide Männer nickten überzeugt mit dem Kopf.
»Vorausgesetzt, Sir«, fügte Crossley vorsichtig hinzu, »daß nicht alle Schöffen von der — äh — Militärfraktion sind. Eure Exzellenz verfügen über die Macht, dafür zu sorgen, daß es nicht so ist ... im Interesse der Gerechtigkeit.«
Der Gouverneur sah nachdenklich aus, antwortete aber nicht, und zu seiner Erleichterung verabschiedeten sich die beiden Besucher.
Sein Sekretär Edmund Griffin kam herein. Bligh gab ihm den Brief, den er an Doktor Harris adressiert hatte, und bat ihn, ihm eine Empfangsbestätigung zurückzubringen. Griffin zögerte und schaute unsicher auf den Brief. »Wünschen Sie, daß ich ihn sofort hinbringe?«
»Jawohl«, antwortete Bligh. »Lesen Sie den Brief selbst, Edmund — und achten Sie gut auf Harris’ Miene, wenn er ihn liest!«
Als er wieder allein war, öffnete er als erstes einen Brief seiner Frau.
Er vermißte Betsy sehr. In den fünfundzwanzig Jahren seiner Ehe hatte er sie viel zu oft allein lassen müssen. Selbst während der fünf Jahre, in denen die Marine ihn auf halben Sold gesetzt hatte, war er zur See gefahren, bis ihm das Kommando über die Bounty gegeben worden war. Und das Ende dieser unglückseligen Fahrt nach Otaheite war die Meuterei der Mannschaft gewesen. Die unglücklichen Erinnerungen an diese Zeit suchten ihn oft noch heim, und es nützte ihm gar nichts, daß das Kriegsgericht ihn offiziell von jeglicher Schuld freigesprochen hatte.
Seine Frau Betsy hatte ihm in dieser schweren Zeit unerschütterlich zur Seite gestanden ... Sie hatte nie den Glauben an ihn verloren und ihn immer in jeglicher Hinsicht unterstützt. Er bedauerte immer wieder, daß sie ihn wegen ihrer zarten Gesundheit nicht nach Sydney hatte begleiten können. Seine Tochter Mary gab sich zwar alle Mühe, ihre Mutter zu ersetzen, aber die Krankheit ihres Mannes ging natürlich vor ... Er faltete den Brief seiner Frau auf und las zuerst ungläubig und dann voller Entsetzen die Anschuldigungen, die sie gegen seine beiden Amtsvorgänger erhob. Sie behauptete allen Ernstes, daß seine beiden Vorgänger sich jetzt von England aus im illegalen Rumhandel mit Neusüdwales engagierten.
William Bligh sprang auf und ging erregt im Zimmer auf und ab. Als es leise an der Tür klopfte, empfand er es als große Erleichterung und ging seiner Tochter entgegen.
Mary Putland war eine zierlich gebaute, sehr hübsche junge Frau, die ihrer Mutter ähnlich sah. Aber sie hatte sein Temperament geerbt, und als er sich zu ihr hinunterbeugte, um ihr einen Kuß zu geben, hielt sie ihn von sich weg und bat, ohne sich bei dem üblichen belanglosen Austausch von Höflichkeiten aufzuhalten, um seine ungeteilte Aufmerksamkeit.
»Edmund Griffin wollte um jeden Preis verhindern, daß ich dich störe, Papa«, begann sie ärgerlich, »aber die Angelegenheit ist sehr wichtig. Du kannst mir doch sicher trotzdem fünf Minuten von deiner Zeit schenken, oder?«
»Aber selbstverständlich, mein liebes Kind«, versicherte ihr Vater. »Du weißt doch, daß ich immer Zeit für dich habe.« Er bot ihr einen Stuhl an, aber sie schüttelte voller Ungeduld ihren Kopf.
»Es ist wegen Charles, Papa ... der Arme hat schon wieder einen Blutsturz gehabt. Einen wirklich schweren, und es kam so plötzlich, daß ich ... « Tränen traten ihr in die blauen Augen. »Papa, ich habe nach Doktor Redfern gesandt.«
Sie wußte, daß ihr Vater die Wahl dieses Arztes nicht befürwortete. Aber Bligh nahm sich zusammen, als er sah, daß seine arme Tochter sehr verängstigt war. Die Blutstürze ihres Gatten traten jetzt sehr viel häufiger und schwerer auf als früher, und Bligh wollte ihr keine zusätzlichen Schwierigkeiten bereiten, obwohl er tatsächlich Dr. Redfern nicht leiden konnte, der früher in eine Meuterei verwickelt gewesen, vom Kriegsgericht schuldig gesprochen und als Sträfling nach Neusüdwales transportiert worden war.
Bevor er etwas sagen konnte, meinte Mary: »Es wird behauptet, daß der junge Doktor Redfern bei weitem der beste Arzt in der Kolonie ist. Doktor Jamieson hat dem armen Charles nicht helfen können, das weißt du genausogut wie ich. Er gibt ihm Opiate, weiter nichts, und Charles leidet so sehr. Ich kann nicht einfach daneben stehen und nichts tun, Papa.«
»Selbstverständlich nicht. Ich kann dich verstehen, meine Liebe.« Bligh legte ihr einen Arm um die schmalen Schultern und zog sie an sich. »Du kannst dir natürlich jeden Arzt holen, den du willst. Ich werde keinen Einspruch erheben.«
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küßte ihn auf die Wange. »Oh, danke, Papa ... Ich gehe jetzt schnell zu Charles zurück und warte bei ihm auf Doktor Redfern. Ich hatte nur das Gefühl, daß ich dich davon informieren sollte.« Ihr Blick fiel auf die Briefe, die auf dem Schreibtisch lagen. »Post ... ist ein Brief von Mama dabei?«
Ihr Vater zögerte und nickte dann mit dem Kopf.
»Ja, aber außer vielen Grüßen an dich und Charles steht wohl nichts in dem Brief, was dich interessieren würde.«
Mary fragte nicht nach. Sie küßte ihn noch einmal und verließ dann eilig das Zimmer. Als der Gouverneur gerade anfing, den langen Brief von Sir Joseph Banks zu lesen, kam sein Sekretär mit wütendem Gesichtsausdruck herein.
»Nun?« fragte Bligh und ahnte schon, was er erfahren würde. »Wollen Sie mir sagen, daß sich Doktor Harris meinem Befehl widersetzt?«
Edmund Griffin nickte mit dem Kopf. »Er besteht darauf, daß er in seiner Funktion als Leiter des Hafenzollamtes vollkommen richtig gehandelt hat und läßt Ihnen ausrichten, daß es ihm nicht notwendig erscheint, die Kupferkessel von Mister MacArthur zurückzufordern, die er für dessen rechtmäßiges Eigentum hält. Und außerdem weigerte er sich, die Empfangsbestätigung für Ihren Brief zu unterschreiben, Sir.«
»Das hat er tatsächlich gewagt?« Gouverneur Bligh griff nach Papier und Federhalter. »Aber diesen Befehl wird er nicht so leicht vom Tisch wischen können! Liefern Sie ihm dieses Schreiben sofort ab ... es ist seine Entlassung. Ich werde Mister Campbell an seiner Stelle mit dem Amt betrauen. Und seine erste offizielle Pflicht wird die Einziehung dieser verdammten Destillierapparate sein! Sie sollen auf der Duke of Portland nach England zurückgebracht werden, ich werde Mister Campbell persönlich über diese ganze Geschichte informieren. Bitten Sie ihn zu einem Gespräch ins Regierungsgebäude, noch bevor ich nach Parramatta aufbreche. Ach ja ... ich nehme an, Sie haben für meine Begleitung gesorgt?«
»Ja, Sir, die Männer stehen bereit. Es sind sechs berittene Kavalleristen.« Der Sekretär lächelte zufrieden. »Sie werden mit diesen Begleitern zufrieden sein. Alle Männer haben sich freiwillig gemeldet!«
»Gut«, stimmte der Gouverneur zu. »Sorgen Sie bitte dafür, daß sie etwas zu trinken bekommen. Ist Captain Hawley auch dabei?«
Edmund Griffin schüttelte den Kopf. »Nein, Sir, er ist dem Schiff entgegengefahren, das gerade angekommen ist. Aber ich glaube, daß ich seinen Kutter bei der Einfahrt in den Hafen gesehen habe — ich hatte kein Fernglas bei mir, deshalb bin ich nicht ganz sicher. Es kann aber sein, daß er schon bald zurücksein wird, Sir.«
»Gut, wenn er rechtzeitig zurückkommt, laden Sie ihn in meinem Namen zum Mittagessen ein. Meine Tochter wird auch dabei sein. Sie wartet auf Doktor Redfern.« Als er den überraschten Blick des Sekretärs bemerkte, fügte er hinzu: »Ich bin damit einverstanden, Edmund.«
»Sir«, sagte Griffin steif und zog sich zurück.
Als er wieder allein war, fühlte sich Gouverneur Bligh etwas besser und las den Brief von Sir Joseph Banks. Der Außenminister William Windham hatte offensichtlich seinen Maßnahmen, dem Tauschhandel mit dem Alkohol in der Kolonie ein Ende zu bereiten, zugestimmt.
Es klopfte. »Das Essen ist serviert, Sir«, kündigte ein Diener an. Der Gouverneur erhob sich und unterdrückte einen Seufzer. Der halbe Tag war erst um, aber er fühlte sich unbeschreiblich müde und wünschte nicht zum erstenmal seit seiner Ankunft in Neusüdwales, daß er wieder das Kommando über eines der Königlichen Schiffe hätte. Auf dem Achterdeck hatte er sich nicht einmal in schwierigen Situationen so verletzlich oder so machtlos gefühlt, wie hier.
Als ihm sein Sekretär die Ankunft von Captain Hawley mitteilte, fühlte er sich etwas besser. Der hochgewachsene Marineinfanterist wartete schon im Speiseraum auf ihn. Hawley war wirklich ein guter Mann, auf dessen Loyalität er sich verlassen konnte. Der Gouverneur begrüßte ihn freundlich und wies dem Neuankömmling einen Platz am Tisch zu.
Nachdem die Suppe serviert worden war und die üblichen belanglosen Freundlichkeiten ausgetauscht worden waren, fragte Bligh: »Nun, was gibt es von der Mysore zu berichten, Hawley? Hat sie die Freien Siedler an Bord, die wir erwarten?«
»Ja, Sir, und hundertundzwanzig Sträflinge — davon sind achtzehn Frauen«, antwortete der Marineinfanterist. Er betonte, daß alle in guter gesundheitlicher Verfassung seien und daß — statt der üblichen Diebe und Vagabunden aus den großen Städten — die Mehrzahl der Sträflinge Fischer, Landarbeiter oder Bergarbeiter seien. Ein Mann, der seine Familie mitgebracht hatte, war sogar ein Dachdeckermeister. »Es sind Leute vom Land, Sir ... das ist selten, und der Kapitän hatte sich während der Überfahrt nicht über sie zu beklagen.«
»Das ist ja ausgezeichnet!« rief der Gouverneur aus. »Könnte es sein, daß das eine Änderung der Regierungspolitik anzeigt? Werden uns von jetzt an endlich erfahrene Handwerker und Bauern geschickt, die wir so dringend benötigen?«
»Ich fürchte, Sir«, gab Andrew Hawley zurück, »daß es sich da um einen reinen Zufall handelt.«
William Bligh fluchte leise. »Das kann natürlich auch sein, Captain Hawley.« Ohne jeden Appetit nahm er sich etwas Fleisch von der Platte, die ihm der Diener anbot. »Aber ... was ist mit den Freien Siedlern? Sind Sie genauso zufrieden mit ihnen wie mit den Sträflingen?«
Zu seiner Überraschung bemerkte er, wie Hawleys Gesicht rot wurde. »Es ist ein Missionar dabei, Pfarrer Caleb Boskenna mit seiner Frau, Sir, ein Schreiner und ein Schneider mit ihren Familien, und ein alleinstehender Schäfer. Diese Leute machen uns bestimmt keine Probleme, aber —« er zögerte und Bligh fragte: »Nun? Irgend etwas muß doch los sein?«
Andrew Hawley nickte.
»Es sind zwei junge Schwestern darunter, Sir, deren Vater während der Überfahrt gestorben ist — er hat sich wohl selbst das Leben genommen. Er war ein Marineoffizier, der in der Schlacht von Kopenhagen schwer verletzt worden ist und ... nun, soweit ich das richtig verstanden habe, war Captain Duncan geradezu erleichtert, den schwierigen Passagier auf diese Weise loszuwerden. Aber ... der unglückliche Mensch hat viele Tiere in Kapstadt gekauft, hauptsächlich Schafe, aber auch ein paar gute Pferde. Er wollte sich hier als Freier Siedler niederlassen.«
»Wir können die Tiere ja für die Regierungsfarmen kaufen«, meinte der Gouverneur. »Das stellt kein großes Problem dar. Aber was soll mit den beiden jungen Waisen geschehen? Haben Sie mit den Mädchen gesprochen?«
»Ja, selbstverständlich, Sir. Die ältere der beiden jungen Mädchen, die siebzehn Jahre alt ist, Sir, sagte mir, daß es ihr fester Entschluß ist, die Tiere ihres Vaters zu behalten und seine Wünsche auszuführen. Sie ist ... « Andrew Hawley lächelte. »Miß Abigail Tempest ist eine sehr mutige und energische junge Dame, und soweit ich verstanden habe, will sie ... «
»Tempest?« unterbrach ihn Bligh. »Großer Gott ... und ihr Vater wurde in Kopenhagen verwundet, sagen Sie? Hieß er Edmund Tempest?«
»Ich glaube ja, Sir. Kannten Sie ihn?«
»Selbstverständlich. Er war der Erste Offizier auf der Monarch und übernahm das Kommando über das Schiff, nachdem Captain Mosse in der Schlacht getötet worden war. Nachdem er verletzt worden war, löste ich ihn ab, und das Schiff fuhr unter meinem Kommando nach England zurück. Ich fürchtete, Tempest nicht lebendig nach Hause zurückzubringen — er war sehr schwer verwundet. Aber jetzt, da der arme Mensch tot ist ... und auch noch durch eigene Hand, großer Gott!«
Der Gouverneur war tief bewegt.
»Ich werde für seine Kinder alles tun, was in meiner Macht steht. Aber ich fürchte, daß sie nach Hause zurückgeschickt werden müssen. Haben Sie die beiden Mädchen mit an Land gebracht?«
Andrew Hawley schüttelte den Kopf.
»Ich dachte, es sei besser, zuerst für Unterkünfte für sie zu sorgen, Sir. Auf dem Schiff geht es ihnen gut. Pfarrer Boskenna und seine Frau haben sich seit dem Tod ihres Vaters sehr um die beiden gekümmert, und der Schiffsarzt hat mir versichert, daß —«
»Sie werden im Regierungsgebäude wohnen«, entschied Captain Bligh. »Aber ich muß jetzt gleich zur Parade nach Parramatta! Wann, glauben Sie, daß die Mysore im Hafen ankern wird?«
»Ich nehme an, heute abend noch, aber spät.«
Der Gouverneur stand auf und schob seinen unberührten Teller beiseite.
»Ich habe keine Zeit, zum Schiff hinzufahren — ich muß vor Einbruch der Dunkelheit in Parramatta sein. Sie werden sich um diese armen Kinder kümmern müssen, Hawley. Bringen Sie sie an Land, sobald das Schiff vor Anker gegangen ist, ich werde meiner Tochter den Besuch ankündigen.«
Sein Sekretär erschien in der Eßzimmertür. »Was gibt’s, Edmund? Ich bin schon auf dem Weg.«
»Eure Exzellenz wollten Mister Campbell sehen —« sagte Griffin, und Bligh fluchte leise.
»In der Tat, das stimmt. Nun, die Zeit muß ich mir einfach nehmen. Ich nehme an, daß Sie meinen — äh — den Brief Doktor Harris überbracht haben?«
»Selbstverständlich, Sir.« Der jüngere Mann erlaubte sich ein leises Lächeln. »Und der Brief ist nicht gut aufgenommen worden, Sir.«
»Ausgezeichnet!« rief der Gouverneur aus. »Wir haben direkt ins Hornissennest gestochen, nehme ich an.« Er zuckte mit den Schultern. »Nun, zum Teufel mit ihnen!« Er legte Andrew Hawley kurz die Hand auf seine breiten Schultern und verließ das Zimmer.
2
Die Sonne versank in einem Meer von rotem Gold hinter den bewaldeten Hügel, als die Mysore endlich in Sydney Cove vor Anker ging. Die weiblichen Passagiere, sowohl die Sträflinge als auch die freien, hatten fast den ganzen Tag an Deck verbracht und sich an der herrlichen Aussicht erfreut.
Die mit Lehm bemalten Eingeborenen hatten in ihren Kanus am Anfang für viel Aufregung gesorgt, aber jetzt richtete sich die Aufmerksamkeit aller Frauen mehr auf die Stadt, die ihre Heimat sein würde — für die Sträflingsfrauen sehr wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens.
»Nich grad ’ne große Stadt, oder«, bemerkte eine stämmige Hebamme namens Kate Lamerton, nachdem sie die Reihen der weißbemalten Holzhäuser und die wenigen größeren Steingebäude einer genauen Inspektion unterzogen hatte. »Aber sieht ziemlich sauber aus, find ich, und die Windmühlen sind ja richtig hübsch. Ach da ... is’ das nich’ ’n Glockenturm — oder isses ’ne Kirche? Miß Abigail, Ihre Augen sind doch besser als meine. Können Sie’s sehen?«
Abigail schüttelte den Kopf und kämpfte gegen ein Gefühl bitterer Enttäuschung an. Waren sie dafür um die halbe Welt gefahren? Mochte die Stadt auch sauber aussehen, wie Kate meinte, so war sie in erster Linie doch primitiv gebaut, und die reinen Zweckbauten sahen so aus, als würden sie beim ersten Unwetter Zusammenstürzen.
Das Regierungsgebäude war das einzige zweistöckige Haus weit und breit ...
»Und das da drüben muß das Gefängnis sein«, meinte Kate und deutete auf ein großes Gebäude, das halb verborgen hinter einer hohen Mauer lag, die einen quadratischen Hof einschloß. »Da kommen wir rein, wenn wir uns was zuschulden kommen lassen. Das seh ich, ehrlich gesagt, gar nich’ gern, meine Liebe. Das Gefängnis in Plymouth war schon schlimm genug!«
Abigail drückte der Frau die abgearbeitete Hand. Kate Lamerton war für sieben Jahre in die Verbannung geschickt worden. Sie sprach nie von ihrer Vergangenheit und erwähnte mit keinem Wort das Verbrechen, dessen sie schuldig gesprochen worden war. Sie beklagte sich nie über ihr Schicksal und hatte schon bald die Anerkennung des Kapitäns und des Schiffsarztes gewonnen, weil sie mit großer Aufopferung die Kranken pflegte.
Und viele hatten ihre Hilfe nötig gehabt, dachte Abigail ... Unter anderem ihre zarte kleine Schwester Lucy. Lucy hatte zwischen Rio de Janeiro und Kapstadt hohes Fieber gehabt, und nur Kates selbstlose Pflege hatte sie gerettet. Und dann ... sie hielt den Atem an und war immer noch unfähig, ruhig an das zu denken, was dann geschehen war. Nach dem unverständlichen Selbstmord ihres Vaters hatte sich die Hebamme liebevoll um die beiden Mädchen gekümmert, sie und der junge Assistent des Schiffsarztes, Titus Penhaligon. Die beiden hatten sich sehr viel liebevoller und verständnisvoller um die Schwester gekümmert als der Mann, den ihr Vater als Vormund bestimmt hatte.
Abigail zitterte in der warmen Dämmerung. Warum, fragte sie sich bitter, hatte ihr Vater ausgerechnet Pfarrer Caleb Boskenna und seine scharfzüngige Frau dazu bestimmt, sich um die Angelegenheit der Waisen zu kümmern? Und es gab keinen Zweifel daran, daß er es so gewollt hatte. Er hatte seinen Letzten Willen klar in einem Brief formuliert — einem Brief, den er geschrieben hatte, kurz bevor er sich mit einer Pistole erschossen hatte.
Kate Lamerton rief aus: »Schaun Sie mal da, Miss Abigail — ich glaub, es kommt noch ’n Boot zu uns! Es sitzen lauter Soldaten drin.«
Es war das zweite Boot, das auf die Mysore zusteuerte, seit sie Anker geworfen hatte. Mit dem ersten war der hochgewachsenen Marineinfanterist an Bord gekommen, der dem Schiff schon gestern abend einen Besuch abgestattet hatte, als es noch außerhalb des Hafenbeckens lag. Diesmal hatte er sich gleich mit den Boskennas in deren Kabine zurückgezogen. Abigail vermutete, daß sich das Gespräch um ihre und Lucys Zukunft drehte.
Sie hatte ihm vielleicht etwas zu offen ihre Pläne und Absichten kundgetan, als er sie beim ersten Besuch darüber befragt hatte. Sie hatte ihm ihren festen Entschluß mitgeteilt, das Stück Land zu bebauen, das ihr Vater hier in der Kolonie beantragt hatte. Aber Mr. Boskenna hatte sich sehr bald in das Gespräch eingeschaltet und den Marineinfanteristen auf die Seite gezogen, um ihn darüber zu informieren, daß er nach dem Letzten Willen des Vaters der Vormund der beiden Mädchen sei.
Als sie in Plymouth an Bord gegangen waren, hatten die Boskennas jedem, der es hören wollte, erzählt, daß sie auf dem Weg nach Neuseeland seien, um die Eingeborenen dort zum christlichen Glauben zu bekehren. Deshalb fand Abigail es merkwürdig, daß sich Pfarrer Boskenna ohne jedes Zögern dazu bereit erklärt hatte, die Vormundschaft über sie und ihre kleine Schwester zu übernehmen. Denn um diese Aufgabe tatsächlich erfüllen zu können, mußte er seine Reise nach Neuseeland auf unbestimmte Zeit verschieben — aber darüber schien er sich keinerlei Sorgen zu machen. Eher das Gegenteil schien der Fall zu sein. Sowohl er als auch seine Frau schienen mit dem neuen Ziel ihrer Reise ganz einverstanden zu sein und überhörten Abigails Versuche, sie davon zu überzeugen, daß sie sich durchaus in der Lage fühlte, allein für sich und ihre Schwester zu sorgen.
»Ihr zwei seid noch Kinder«, meinte der Missionar darauf, »und Sydney ist eine Strafkolonie. Es wäre der Gipfel an Unverantwortlichkeit, euch beide hier allein zu lassen, Abigail.«
»Ich würde lieber nach England zurückfahren, Abby«, hatte ihre kleine Schwester Lucy schluchzend gesagt. »Ganz bestimmt — selbst wenn wir dort betteln müßten! Und es bedeutet mir nichts, daß Mister Boskenna ein Pfarrer ist — er ist ein böser Mann, und ich hasse ihn! Bitte, Abby, schick sie weg — nach Neuseeland, oder wo immer auch sie hinwollten. Wir brauchen sie nicht ... Kate kann für uns sorgen. Sie möchte es außerdem, und Jethro auch. Es ginge uns sehr gut mit den beiden.«
Aber Kate kam als Aufsichtsperson für den Pfarrer überhaupt nicht in Frage. Sie war ein Sträfling, und Jethro Crowan, der Schafhirte, war ein des Lesens und Schreibens unkundiger Tölpel, der auf keinen Fall eine so schwere Verantwortung tragen konnte.
»Es sind lauter Offiziere, Miss Abigail«, sagte Kate und deutete auf das herannahende Boot. »Was, glauben Sie, daß die hier wollen?«
Abigail wischte die Tränen fort. »Ich weiß es nicht«, gab sie zu und meinte dann: »Vielleicht ist es die Gesundheitspolizei.«
»Nun, wir sind doch gesund genug«, sagte Kate mit ruhigem Stolz. »Der Kapitän und der junge Doktor Penhaligon hätten dafür ’ne Auszeichnung verdient. Kein einziger Fall von Skorbut an Bord, und niemand hat Fieber — die Offiziere werden nich’ viel zu meckern haben, selbst wenn sie möchten.« Abigail lächelte. Es stimmte, Captain Duncan war ein sehr freundlicher Mann. Er hatte die Sträflinge gut behandelt, jedem, der sich gut führte, sehr bald die Fesseln abnehmen lassen und ihnen so oft wie möglich den freien Zugang zum Deck erlaubt. Chrissie Trevemper, die Frau des Schreiners Robert Trevemper, stand in Abigails Nähe, hob ihren kleinen Sohn hoch und rief: »Den kleinen Holzhäusern nach zu urteilen, gibts ja mehr als genug Arbeit hier für meinen Rob, meinen Sie nich’ auch, Miss Abigail? Das kann man wohl kaum ’ne Stadt nennen, oder?«