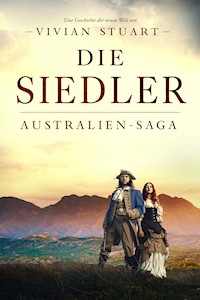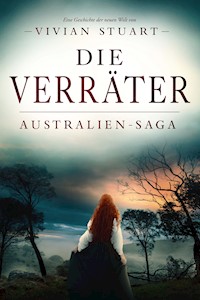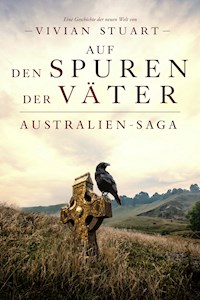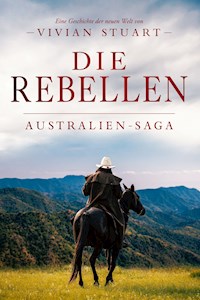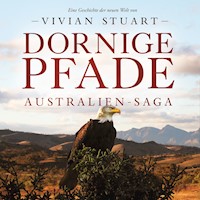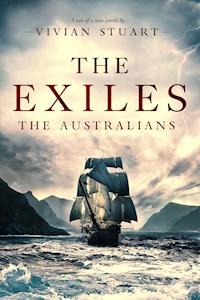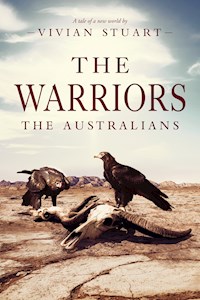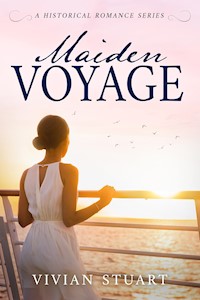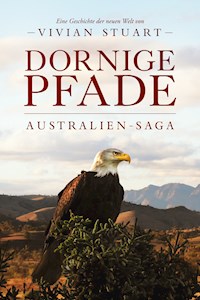
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Australien im 19. Jahrhundert: Der Ire Michael Cadogan ist vor Jahren fälschlicherweise wegen Hochverrats verurteilt worden und fristet sein Dasein in den Strafkolonien. Sein einziger Gedanke: Rache an denen, die ihn gedemütigt haben. Er weiß nicht, dass der englische König dem Gnadengesuch seiner Familie bereits zugestimmt hat. Als er seine Fluchtpläne in die Tat umsetzt, bringt er sich in große Gefahr …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dornige Pfade
Dornige Pfade – Australien-Saga 8
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1986
© Deutsch: Jentas ehf 2022
Serie: Australien-Saga
Titel: Dornige Pfade
Teil: 8
Originaltitel: The Gallant
Übersetzung : Jentas ehf
ISBN: 978-9979-64-318-0
Prolog
Im September 1828 wurde die Pyramus, die sich auf dem Weg von Liverpool nach Sydney in Neusüdwales befand, von haushohen Wellen und einem orkanartigen Wind gnadenlos von ihrem Kurs ab- und auf die irische Küste zugetrieben.
Obwohl das Schiff solide gebaut war und nur ein Sturmsegel gesetzt hatte, kam es dem einzigen Passagier, der sich auf Deck befand, doch so vor, als ob es in diesen tosenden, entfesselten Elementen jederzeit sinken könne. Henry Osborne klammerte sich mit aller Kraft an der Reling auf der Wetterseite fest und bedauerte es, daß er einem Impuls nachgegeben und die Wärme und vergleichsweise Sicherheit der Kombüse verlassen hatte. Aber die verrauchte, stikkige Luft dort hatte ihm so zugesetzt, daß er sich nach einer frischen Brise gesehnt hatte.
An Deck hatte er sich gleich besser gefühlt. Aber jetzt würde er hierbleiben müssen, bis sich der Sturm etwas legte oder bis das verdammte Schiff unterging, denn jetzt das Deck noch einmal zu überqueren wäre einem Selbstmord gleichgekommen.
Die Pyramus war eine solide gebaute, seetüchtige Brigg unter dem Kommando eines erfahrenen Kapitäns, und bis der Sturm ausgebrochen war, hatte Henry Osborne keinen Grund gehabt, sich hinsichtlich des Schiffes die geringsten Sorgen zu machen. Henry klammerte sich mit aller Kraft an der Reling fest, als das Schiff in ein Wellental schoß und kurz darauf krachend eine Woge eiskalten Wassers das Deck überspülte.
Großer Gott, dachte Henry, bis auf die Haut durchnäßt und zitternd vor Kälte und Angst, warum hatte er diese Reise ans andere Ende der Welt nur angetreten? Welche verrückten Träume und Hoffnungen hatten ihn dazu gebracht, seine Farm bei Dromore in Irland zu verkaufen, um in Australien ein neues Leben als Siedler zu beginnen? Es stimmte, seine beiden älteren Brüder Alick und John waren als Schiffsärzte nach Australien gekommen und hatten sich dort niedergelassen. Sie hatten ihn gedrängt, es ihnen gleichzutun, und hatten ihm das Leben und die Möglichkeiten dort in verlockenden Farben geschildert. John hatte sich sechzig Meilen südlich von Sydney in Garden Hill niedergelassen, und Alick ganz in der Nähe, in Daisy Bank — und er selbst verfügte jetzt über das Kapital, um sich ebenfalls eine Farm auf dem fünften Kontinent zu kaufen. Er hatte die stolze Summe von tausend Pfund bei sich ... die Pyramus schoß wieder fast senkrecht in ein tiefes Wellental, und Henry schloß die Augen und hielt die Luft an.
Als die nächste Welle über das Deck gespült war, stöhnte er laut auf, und es war ihm ganz egal, ob einer der Matrosen ihn hören konnte oder nicht. Das schlimmste von allem war gewesen, dachte er unglücklich, daß er seine Verlobte hatte zurücklassen müssen, die wunderschöne Sarah Marshall. Ihre Eltern waren nicht bereit gewesen, sie ihm anzuvertrauen.
»Ihre Zukunft ist zu unsicher, lieber Henry«, hatte der alte Pfarrer von Dromore gesagt. »Unsere Tochter hat bis jetzt ein behütetes und sorgenfreies Leben führen können. Sie ist in keiner Weise auf das rauhe Leben in der Wildnis vorbereitet, das sie als Ihre Frau führen müßte. Einzig und allein aus diesem Grund bin ich gegen diese Verbindung.«
»Aber wir lieben uns, Sir«, hatte Henry protestiert. Ohne jeden Erfolg hatte er hinzugefügt, daß er nie daran gedacht hätte, seine heimatliche Farm zu verkaufen, wenn er auch nur einen Augenblick daran gezweifelt hätte, daß Sarah ihn würde begleiten dürfen.
»Sie hätten diese Möglichkeit aber erwägen müssen«, hatte Pfarrer Benjamin Marshall geantwortet, »und zwar, bevor Sie Ihr Land verkauften, lieber junger Mann — und bevor Sie den Plan zu emigrieren fest ins Auge faßten.«
Er hatte sich wirklich wie ein Idiot aufgeführt, sagte sich Henry bitter, erinnerte sich an Sarahs Tränen und an ihr verzweifeltes Gesicht beim Abschied. Sie hatten sich wortlos aneinandergeklammert, hatten nichts mehr zu sagen gewußt, und als er sich schließlich losgerissen hatte, um die Kutsche nach Liverpool zu besteigen, hatte sie geflüstert, daß sie auf ihn warten wollte, wie lange es auch dauern würde.
»Liebster Henry, schreib mir, wenn du dich in Neusüdwales niedergelassen hast. Ich komme, ich schwöre es dir — ganz egal, was meine Eltern dazu sagen oder wie lange es auch dauern mag!«
Er wollte ihr gern Glauben schenken, aber ... Sarah Marshall war ein schönes, sehr anziehendes Mädchen. Es gab noch und noch Männer, die sich für sie interessierten — junge Männer, die weit bessere Aussichten hatten als er. Da waren der Rechtsanwalt Patrick Hare und ein paar wohlhabende Farmer, die früher seine Freunde gewesen waren — Damien Hamilton, der entfernt mit Sarahs Mutter verwandt war, und, verdammt noch mal, Guy O’Regan, der sich jetzt sicher große Chancen bei Sarah ausrechnete.
Plötzlich krachte es laut, und er fuhr aus seinen Gedanken hoch. Henry sah entsetzt, wie der Vordermast splitterte, die Takelage herunterkrachte und das Sturmsegel in Fetzen wegflog.
Jetzt ging alles sehr schnell. Der Kapitän schrie seine Anweisungen, einer der Matrosen drückte Henry eine Axt in die Hand, und er schlug damit auf die Takelage ein. Am Ende ihrer Kräfte und in ständiger Gefahr, über Bord gespült zu werden, schafften es die Männer schließlich, den abgebrochenen Mast über die Reling ins schäumende Meer zu werfen. Die größte Gefahr war überstanden.
Henry richtete sich erschöpft auf, sein ganzer Körper schmerzte, und er hatte Blasen an den Händen. Der Kapitän klopfte ihm anerkennend auf die Schulter.
»Gute Arbeit, Mister«, sagte er, »vielen Dank für Ihre Hilfe.« Er fügte mit einem kleinen Lächeln hinzu: »Wir müssen in Belfast vor Anker gehen, um den Vordermast zu ersetzen. Ich fürchte, daß sich dadurch unsere Reise um acht bis zehn Tage verlängern wird ... Aber keiner von uns hat ja große Eile, oder?«
Er ging weiter, um die nötigen Anordnungen zu treffen. Henry starrte ihm nach, und es war ihm unmöglich, die volle Bedeutung seiner Worte zu ermessen. Dann dämmerte es ihm langsam, und er jubelte innerlich.
Eine Woche in Belfast — vielleicht sogar zehn Tage ... das reichte, um nach Dromore zurückzureiten und noch einmal bei Sarahs Vater um ihre Hand anzuhalten. Und wenn er immer noch gegen die geplante Verbindung war, dann hatten sie sogar Zeit, ohne seine Einwilligung zu heiraten.
Gott hatte seine Hand bestimmt im Spiel gehabt, und der tiefgläubige Pfarrer Benjamin Marshall würde bestimmt nicht abstreiten, daß Gott ihn und die Mannschaft der Pyramus aus diesem entsetzlichen Sturm gerettet hatte.
Die irische Küste war schon in Sicht, und Henry Osborne ging in seine Kabine, um sich trockene Kleider anzuziehen und dann in der Kombüse ein Glas Brandy zu trinken.
Sechzehn Stunden später lief die Pyramus in den Hafen von Belfast ein, und er sah die grauen Gebäude der Stadt, die er nicht so schnell wiederzusehen geglaubt hatte. Er ging sofort an Land, mietete sich ein Pferd und ritt auf der Straße in Richtung Dromore davon. Er ritt durch Lisburn und Lurgan, kam am Rand von Lough Neagh vorbei und gab seinem Pferd immer wieder die Sporen. Aber in Dungannon war das Tier völlig erschöpft, und da es stark zu regnen begonnen hatte, sprang er vor einem Gasthof in den Außenbezirken der Stadt ab.
Der Wirt, ein lebenslustiger, gastfreundlicher Mann, begrüßte ihn, setzte ihm ein gutes Essen vor und gab ihm ein bequemes Zimmer, in dem sich Henry zum ersten Mal seit Verlassen des Schiffes ausruhen konnte. Wieder war er bis auf die Haut durchnäßt, aber er hatte in der Satteltasche frische Kleider und freute sich darüber, daß er sich morgen ordentlich im Pfarrhaus würde zeigen können.
Glücklicherweise schien die Sonne am nächsten Tag. Er kleidete sich sorgfältig, nahm ein kräftiges Frühstück zu sich und machte sich auf die letzten zwanzig Meilen des Ritts. Seine immer noch nassen Sachen ließ er im Gasthof, und der Wirt versprach ihm, daß er sie auf dem Rückweg nach Belfast trocken und sauber vorfinden würde.
Am frühen Nachmittag kam Henry in Dromore an, und nachdem er das Mietpferd abgegeben hatte, klingelte er am Pfarrhaus. Zu seiner großen Freude öffnete ihm seine angebetete Sarah die Tür und sank völlig überrascht in seine Arme.
»Ach Henry — liebster Henry. Du bist wieder da!« rief Sarah weinend aus. »Ich bin ja so glücklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!«
Auch Henry hatte es die Sprache verschlagen, aber als Sarah ihn an der Hand ins Wohnzimmer führte, wo ihre beiden Eltern saßen, merkte er sofort, daß es sich um ein Mißverständnis handelte. Denn alle glaubten, daß er für immer zurückgekehrt sei.
»Also haben Sie doch den närrischen Plan aufgegeben, Sir, nach Neusüdwales auszuwandern«, sagte der alte Pfarrer und lächelte zufrieden. »Mein lieber Junge, das freut mich wirklich sehr!«
Henry schaute ihn ernst an. »Nein, Sir«, sagte er, »es ist ganz anders, als Sie denken. Mein Schiff mußte in Belfast vor Anker gehen, um einen Mast ersetzen zu lassen, der in einem fürchterlichen Sturm gebrochen war. Gott hat offenbar gewollt, daß ich noch einmal hier sein kann, Mr. Marshall, und —« Er zögerte und fuhr dann fort: »Sir, ich schwöre Ihnen, daß mich die Hand Gottes nach Irland zurückgebracht hat — um Sie noch einmal anzuflehen, mich Ihre Tochter Sarah heiraten zu lassen. Ich liebe sie, Sir, mehr als irgend etwas sonst in der Welt.«
Der Pfarrer schaute ihn unter zusammengezogenen Augenbrauen an. Dann wechselte er einen fragenden Blick mit seiner Frau.
»Also haben Sie fest vor, Ihre Reise fortzusetzen, sobald die Pyramus wieder seetüchtig ist?«
Henry nickte entschlossen.
»Ja, Sir, ich werde in spätestens zehn Tagen mit dem Schiff absegeln, und ich bitte Sie inständig, daß ich Sarah als meine Frau auf die Reise mitnehmen darf.«
»Schon in zehn Tagen, sagen Sie?« Wieder schaute Pfarrer Benjamin Marshall seine Frau an, und er sah deutlich, daß sie leicht mit dem Kopf nickte. Er seufzte schwer. »Dann haben wir ja nicht viel Zeit, um die Hochzeit vorzubereiten, oder? Aber ... « Er seufzte wieder, und Henry, der plötzlich begriff, daß seinem Glück nichts mehr im Wege stand, legte bewegt seinen Arm um Sarahs Schultern.
»Ich glaube«, sagte der Pfarrer, »daß wir es schaffen können und daß unter diesen besonderen Umständen die einmalige Verlesung des Aufgebots reichen wird. Ich werde sofort alles in die Wege leiten, und ich —« Er stand auf und streckte Henry die Hand entgegen. Der junge Mann schlug dankbar ein. »Vielen Dank, Mr. Marshall — vielen Dank. Ich werde mich Ihres Vertrauens nicht unwürdig erweisen, Sir, das versprech’ ich Ihnen.«
Sarahs Mutter lächelte ihm mit Tränen in den Augen zu.
»Es wird zwar nicht die unvergeßliche Hochzeit werden, die wir uns für unsere Tochter erhofft haben, Henry«, meinte sie. »Aber wenn es, wie es aussieht, Gottes Wille ist, dann schicken wir uns drein. Es grenzt ja wirklich an ein Wunder, daß Sie nach so kurzer Zeit wieder hier erscheinen konnten.« Sie erhob sich von ihrem Stuhl und umarmte Henry und ihre Tochter tief bewegt.
Die Hochzeit war der glücklichste Tag in Henrys bisherigem Leben. Außer Sarahs und seiner Familie und ihren Freunden nahmen alle Einwohner des kleinen Dorfes am Hochzeitsgottesdienst teil, und als er seine Braut am Arm ihres ältesten Bruders auf sich zukommen sah, fühlte sich Henry stolz und glücklich.
Er dachte, daß Sarah noch nie so schön und so begehrenswert wie heute ausgesehen hatte, und als sie ihn schüchtern anlächelte, glänzten ihre dunklen Augen hinter dem Brautschleier glücklich auf. Er nahm ihre Hand und drückte sie zärtlich, und der Pfarrer, der jetzt sein Schwiegervater wurde, begann den Hochzeitsgottesdienst zu zelebrieren.
Achtundvierzig Stunden später ging das jung verheiratete Paar an Bord der Pyramus und winkte seiner Familie und den Freunden vom Deck aus zu. Der Anker wurde gelichtet, und die lange Reise begann.
Frühling 1856
Der dreimastige Schnellsegler namens Spartan, der nach Melbourne und Sydney segeln sollte, lag am Landungssteg im Hafen von Liverpool, und eine lange Schlange von Passagieren wartete geduldig darauf, an Bord gehen zu dürfen.
Der erste fieberhafte Goldrausch auf den australischen Goldfeldern war vorbei, aber mehr als die Hälfte der Passagiere war auf dem Weg nach Victoria, um dort als Goldsucher ihr Glück zu machen. Die anderen waren arme irische Auswanderer, ganze Familien, die dem dauernden Hunger in der Heimat entkommen wollten und sich erhofften, in der neuen, aufstrebenden Kolonie Arbeit in der Landwirtschaft zu finden.
Sie schleppten alles, was sie besaßen, mit sich und brachen unter der Last fast zusammen. Aber langsam kamen sie dem Schiff näher, auf das sie alle Hoffnung setzten. Die Spartan war ein schönes, grün bemaltes Schiff, mit reich vergoldeten Verzierungen, das nach einem amerikanischen Entwurf erst vor einem Jahr in der berühmten Hood-Werft in Aberdeen gebaut worden war. Ein kleiner schwarzbärtiger Cockney sagte: »Es wird gesagt, daß so’n Schnellsegler nur sechzig Tage bis Melbourne braucht! Aber so was können ja nur die Amerikaner bauen — schade, was?«
Ein älterer Mann, der wie ein verhungerter Beamter aussah, räusperte sich und antwortete: »Das stimmt zwar, wir bauen die Schnellsegler noch nicht so lange wie die Amerikaner, aber es war ein Schotte namens MacKay, der diese Schiffe konstruiert hat. Er mußte sie in Boston bauen — vermutlich weil die britische Regierung ihm nicht das Geld zur Verfügung stellte, das er brauchte. Das ist mal wieder typisch!«
»Ganz genau!« stimmte der schwarzbärtige Mann zu. »Aber woher wissen Sie so viel über Schnellsegler? Sind Sie ein Seemann oder so was?«
Der andere lächelte säuerlich. »Nein, ich habe als Sekretär bei Pilkington und Wilson gearbeitet, das sind die Besitzer von diesem Schiff.« Er deutete auf die Spartan. »Aber ehrlich gesagt wollte ich mein Leben lang zur See gehen.«
»Nun, das holen Sie jetzt nach, oder?« fragte der Cockney. Er starrte seinen neuen, älteren Bekannten und dessen Frau und Kinder neugierig an. »Aber, wenn Sie mir verzeihen, mit so ’ner großen Familie wie Ihrer überlegt man sich’s zweimal, bevor man ’nen Job aufgibt, um sein Glück auf den Goldfeldern zu machen. Ich will Sie nicht beleidigen«, fügte er schnell hinzu. »Es kommt mir nur ein bißchen komisch vor.«
Der Sekretär seufzte. »Sie haben mich nicht beleidigt«, antwortete er lächelnd. »Ich werde mich in Australien beruflich verbessern ... das heißt also, daß ich bestimmt kein Goldgräber werde, Sir.«
»Wirklich nicht?«
Der kleine Mann schüttelte den Kopf. »Nein. Ich werde für einen der größten Landbesitzer in Neusüdwales arbeiten. Für Mr. Henry Osborne in Marshall Mount — ein feiner Herr, der vor ... ja, bald schon dreißig Jahren nach Australien ausgewandert ist. Es ist eine lange Geschichte, wie diese Verbindung zustande gekommen ist. Die erzähle ich Ihnen ein andermal. Jedenfalls sind meine beiden ältesten Söhne seit ein paar Jahren auch in Australien, und sie haben uns in jedem Brief gedrängt, doch auszuwandern. Sie haben uns Mr. Osbornes Besitz in den verlockendsten Farben geschildert. Also haben meine Frau und ich uns eines Tages gesagt, daß wir hinfahren, bevor wir zu alt sind. Als Sekretär wird man ja nicht reich, und wir dachten —«
Er wurde durch die Ankunft eines mit Gepäck hoch beladenen Karrens unterbrochen. Bald danach kamen ein paar Kutschen angerollt.
»Das sind die Passagiere erster Klasse«, sagte der Sekretär zu seinem Nachbarn.
»Ja, das seh’ ich auch. Ich hoffe nur, daß wir endlich an Bord gehen dürfen, wenn die feinen Leute erst mal oben sind. Ich hab’s satt, im Regen zu stehen.«
Er pfiff leise vor sich hin, als aus der letzten Kutsche eine schlanke, elegant gekleidete junge Frau ausstieg und sich dabei lächelnd von einem Schiffsoffizier helfen ließ, der herbeigeeilt war.
Selbst aus der Entfernung gesehen war sie wunderschön. Ein kleiner, blumenbedeckter Strohhut verbarg ihr dickes, schwarz gelocktes Haar nicht, und das Mädchen schaute mit seinem zart geschnittenen, schönen Gesicht offenbar besorgt zu den wartenden Zwischendeckpassagieren hinüber.
Der bärtige Cockney war ganz begeistert von ihr.
»Großer Gott!« rief er aus. »Das nenn’ ich echte Qualität — das nenn’ ich eine Lady! Sie kann meinetwegen alle Schirme haben, so eine zarte Person darf ja nicht naß werden! Ich frag’ mich bloß, wer sie ist.«
Diesmal konnte ihm der gut informierte Sekretär auch nicht weiterhelfen, aber eine dicke, in einen Wollschal gehüllte Frau trat neben ihn und sagte: »Ist aber nicht in Ordnung, daß Sie da so rüberstarren, Mister — wirklich nicht in Ordnung. Das ist Lady Kitty Cadogan vom Schloß Kilclare — Schloß Kilclare bei Wexford.«
»Von Wexford?« fragte der Cockney überrascht.
»Ganz genau! Wexford in Irland! Und ich muß es ja wissen, weil ich nämlich auch daher komme.«
»Wie heißt die junge Dame noch mal?« fragte der Mann überrascht.
Die Frau wiederholte folgsam: »Ca-do-gan. Und ihr Bruder wird auch gleich dasein — Patrick Cadogan. Er ist ihr Zwillingsbruder, und sie sind immer zusammen. Die beiden gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Da, schauen Sie mal!« Sie deutete auf einen großen, dunkelhaarigen jungen Mann, der genauso gut aussah wie seine Schwester. Er stieg aus der Kutsche aus, ging mit ruhigen Schritten hinter ihr her und holte sie vor der Gangway ein.
Lady Kitty Cadogan wandte sich um, schob den Schirm zur Seite, den ein Steward ihr hielt, und rannte durch den Regen auf die wartenden Zwischendeckpassagiere zu. Sie streckte ihre kleinen, in weißen Handschuhen steckenden Hände aus und begrüßte die jetzt strahlende dicke Frau.
»Ja endlich, Mary O’Hara! Wo, um alles in der Welt, haben Sie gesteckt? Ich habe ganz Liverpool nach Ihnen absuchen lassen. Sie haben mich doch nicht vergessen, oder?«
Mary O’Hara lief rot an und knickste ungeschickt. »Natürlich nicht, Mylady! Aber ich hab’ entfernte Verwandte hier — nun, ein alter Onkel starb, und ich hab’ Totenwache gehalten, und —«
Lady Kitty Cadogan unterbrach sie. »Nun gut, Mary — reden wir nicht mehr darüber. Es genügt, daß Sie jetzt da sind. Kommen Sie — lassen Sie uns an Bord gehen. Wir müssen uns beeilen, damit die anderen hier auch ins Trockene kommen!« Ihr bezauberndes Lächeln nahm die bis auf die Haut durchnäßten Wartenden sehr für die junge Frau ein. Lady Kitty streckte eine Hand aus, um Mary O’Hara ihr unförmiges Bündel tragen zu helfen, aber der schwarzbärtige Cockney war schneller als sie. Er ergriff das Bündel und warf es sich auf die Schulter.
»Erlauben Sie mir, Madam. Gehen Sie voraus, ich folge Ihnen.«
Sie dankte ihm und schien nicht zu hören, was die Frau des Sekretärs ihrem Mann zuflüsterte, als er ebenfalls helfen wollte.
»Bleib hier, Benjamin Doakes. Er darf sowieso nicht vor uns an Bord, das wirst du sehen.«
Sie behielt recht. Einer der Stewards nahm dem jungen Cockney das Bündel der Frau ab, und Lady Kitty Cadogan wurde mit einem Schirm zurück zur Gangway geleitet. Die stämmige Irin trottete freundlich hinter ihr her.
Sie gingen an Bord und verschwanden. Kurz darauf kamen die Zwischendeckpassagiere an die Reihe. Sie wurden zu ihren schwach beleuchteten, hölzernen Kojen geführt, die Frauen und die Kinder auf der Steuerbordseite, und die Männer auf der Backbordseite.
Zwei Decks über ihnen schauten sich Lady Kitty Cadogan und ihr Bruder Patrick in ihren aneinandergrenzenden, geräumigen und guteingerichteten Kabinen um.
»Wenn das Schiff wirklich so schnell segelt, wie es behauptet wurde«, meinte Patrick und setzte sich lächelnd auf einen Sessel, »dann fahren wir nicht schlecht, Kit, ganz und gar nicht schlecht.«
»Auf alle Fälle besser als der arme Michael«, erinnerte ihn Kitty mit leichter Bitterkeit. »Stell dir einmal vor, was es für ihn bedeutet haben muß, die Reise in Ketten gemacht zu haben! Und damals brauchten die Sträflingstransporter sechs bis sieben Monate, um Hobart zu erreichen.«
Ihr Bruder hörte zu lächeln auf. »Ich denke oft daran. Aber — Kit, ich mache mir Sorgen wegen Mary O’Hara. Wenn sie die Sache herumerzählt, dann —«
»Das wird sie nicht tun. Sie hat uns ihr Wort gegeben, Pat. Sie ist eine gute Seele und uns völlig ergeben — das weißt du so gut wie ich. Außerdem«, meinte Kitty voller Überzeugung, »ist sie meine Kammerzofe, und das heißt, daß sie eine eigene Kabine auf dem Zwischendeck hat. Sie ist nicht mit all den anderen Frauen in einem Raum zusammen — das will sie auch gar nicht.«
»Nun, hoffen wir, daß dein Vertrauen in sie gerechtfertigt ist. Denn wenn irgend jemand Verdacht schöpft, dann ...« Patrick brach seinen Satz ab, und Kitty beendete ihn.
»... dann säßen wir ernsthaft in der Tinte. Aber das haben wir immer gewußt, oder? Wir wissen, welches Risiko wir auf uns nehmen. Aber — ach, Pat, die Engländer haben ein kurzes Gedächtnis, besonders was die Vorgänge in Irland angeht. Und da die Berufung in letzter Instanz verworfen worden ist, haben wir ja keine andere Wahl.«
»Das stimmt«, meinte Patrick. »Verdammt noch mal, mir ist es egal, all das zu riskieren. Ich bin es Michael schuldig. Die Fahrt nach Australien ist das mindeste, was ich für ihn unternehmen kann. Aber ich wünschte, du hättest nicht darauf bestanden, mitzukommen, Kit. Ich wollte, du würdest es dir noch mal überlegen. Es ist immer noch genug Zeit, das Schiff zu verlassen, und du —«
»Wir haben immer alles zusammen gemacht«, antwortete Kitty entschieden. »Die Cadogans halten zusammen, und wenn einem von ihnen eine furchtbare Ungerechtigkeit zugestoßen ist, dann müssen die anderen alles daran setzen, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Und denk daran —« Sie nahm ihren kleinen Hut ab und warf den Kopf herum. »Ich bin zwar kein Mann, aber ich bin nicht umsonst als die wilde Kitty bekannt! Es gibt nicht viel, was du beherrschst und was ich nicht ebensogut oder sogar besser kann als du. Wir —« Es klopfte an die Tür, und sie brach ab. »Ja«, rief sie. »Wer ist da?«
Ein grauhaariger Steward betrat die Kabine und verbeugte sich.
»Entschuldigen Sie, Sir — Mylady. Der Kapitän läßt Ihnen ausrichten, daß er sich geehrt fühlen würde, wenn Sie mit ihm ein Glas Punsch im Salon trinken wollten, um Sie noch vor Antritt der Reise kennenzulernen.«
»Jetzt gleich?« fragte Patrick.
»Wenn es genehm ist, ja, Sir.«
Bruder und Schwester schauten sich an, und Patrick nickte. »Richten Sie Captain Bruce aus, daß meine Schwester und ich mit Vergnügen seiner Einladung Folge leisten werden.«
Der Steward verschwand, und die beiden schauten sich belustigt an.
»Wenn er eine Ahnung hätte, wer wir sind!« rief Kitty aus und kicherte los.
»Es erstaunt mich immer wieder, wieviel ein Adelstitel bewirkt«, bemerkte Patrick trocken. »Nun, dann machen wir eben die Bekanntschaft des Kapitäns und der anderen Passagiere, von denen wir in den nächsten zwei bis drei Monaten ziemlich viel sehen werden. Hast du vor, deinen komischen Hut wieder aufzusetzen?«
Kitty schüttelte den Kopf, und ihr Bruder legte ihr liebevoll den Arm um die Schultern.
»Dann nichts wie los, kleine Schwester, damit wir es sobald wie möglich hinter uns haben. Ab jetzt werden wir mehr als genug Gelegenheit haben, so zu tun, als seien wir respektable Leute, und ich bin sicher, daß diese Übung uns später in Sydney sehr von Nutzen sein wird.«
»Das hoffe ich auch«, meinte Kitty und hakte sich bei ihrem Bruder ein. »Wenn uns der Kapitän ein Glas — was noch mal? — ein Glas Punsch anbietet, dann trinken wir auf Michaels Wohl, oder? Aber in aller Stille natürlich.«
»Genau das machen wir«, antwortete Patrick. Er nahm ihre Hand, und sie verließen gemeinsam die Kabine.
ERSTER TEIL
Auf der Suche
1
Luke Murphy zügelte sein Pferd, beschattete seine Augen mit der Hand und blickte über die eingezäunten Weiden hinweg auf die entfernten Farmgebäude, die zum Besitz seines Schwiegervaters in Pengallon gehörten.
Man konnte es schon ein kleines Dorf nennen, was da im Lauf der Jahre alles an Arbeiterhütten, Scheunen, Ställen und Schuppen gebaut worden war. Jetzt war Pengallon die weitaus größte Schaf- und Rinderfarm am Macquarie in Neusüdwales. Auch das Wohnhaus war im Lauf der Zeit sehr vergrößert worden. Das schöne, weißgestrichene Haus hatte jetzt zwei Stockwerke, und vorn und hinten eine große, überdachte Veranda. Es gab Hütten für die Arbeiter und ihre Familien, Ställe für die Rinder und Schafe, eine Schmiede, eine Schreinerei und viele Scheunen, in denen von geschorener Wolle bis hin zum Futter alles aufgehoben werden konnte. Und am Rand der kleinen Ansiedlung stand auch sein eigenes Haus — Luke schaute zu dem freundlichen Gebäude hinüber, das halb von Gummibäumen verdeckt war. In den letzten vierzehn Monaten hatte er dort mit seiner jungen Frau Elizabeth, Rick Tempests einziger Tochter, gelebt, und ... er lächelte unwillkürlich. Diese vierzehn Monate waren die glücklichsten seines Lebens gewesen.
Elizabeth — die schöne, goldblonde Elizabeth mit der sanften Stimme — war alles, was er sich jemals von einer Frau erträumt hatte. Er betete sie an, und jetzt — er spürte, wie sich ihm die Kehle zuschnürte. Bald würde Elizabeth ihm das erste Kind schenken. Sie lebte nicht mehr in ihrem kleinen Haus. Vor einer Woche war sie auf das dringende Anraten ihrer Mutter in deren Haus gezogen, um dort im Schoße ihrer Familie ihr Kind zu gebären.
Luke hörte zu lächeln auf. Trotz all seiner Befürchtungen hatte er wie immer weitergearbeitet. Es waren immer noch zu wenig Farmarbeiter da, obwohl drei der älteren Männer vor ein paar Monaten nach erfolgloser Goldsuche zurückgekommen waren.
Wieder schnürte es Luke die Kehle zusammen. Er machte sich große Sorgen um Elizabeth, denn ihre Schwangerschaft war alles andere als leicht gewesen. Der Arzt, der erfahrene Dr. Morecombe aus Bathurst, hatte ihm angedeutet, daß die Geburt kompliziert werden könnte. Er hatte nicht alles verstanden, was Morecombe ihm erklärt hatte, aber Elizabeths Mutter hatte den Arzt nur zu gut verstanden und daraufhin fast ultimativ gefordert, daß die Geburt unter ihrem eigenen Dach stattfinden müsse.
»Du willst doch das Beste für sie, Luke«, hatte Katie Tempest gesagt. »Und ich möchte sie bei mir haben. Edmunds und ihre Geburt waren sehr schwierig, und ich habe zwei Babys verloren, wie du weißt. Ich möchte nicht, daß Elizabeth dasselbe passiert.«
»Großer Gott, nein!« hatte er schockiert geantwortet. »Natürlich nicht.«
Er wollte das Kind — sie beide wollten das Kind, aber ...
Elizabeth würde schon im Bett sein, wenn er ins Haus kam, aber sie könnten noch eine Stunde zusammen verbringen, während sie ihr Abendbrot aß. Dann würde ihre Mutter ihn nach Hause schicken, mit der Begründung, daß Elizabeth soviel Ruhe wie möglich bräuchte, um für die bevorstehende Geburt Kräfte zu sammeln.
Der Himmel wußte, daß er bei ihr sein wollte. Er wollte sie zärtlich in den Armen halten, während sie schlief. Er liebte sie so sehr, und er — ein Reiter kam auf ihn zu. Es war der taubstumme Dickon O’Shea.
Luke gab seinem Pferd die Sporen. Dickon O’Shea war der Neffe von Rick Tempest, ein warmherziger, auf sympathische Weise kindlich gebliebener Riese von einem Mann, der seit seiner Kindheit in Pengallon lebte. Trotz seines Handicaps gab es nichts, was Dickon nicht konnte. Er war ein guter Reiter, ein ausgezeichneter Viehzüchter und Hirte, er konnte gut schießen und verstand sich mit den ortsansässigen Einwohnern so gut, als wäre er bei ihnen aufgewachsen. Er hatte ein Eingeborenenmädchen zur Frau genommen, hatte sie aber nie mit nach Hause gebracht und war eines Tages zur großen Überraschung aller mit einem kleinen Jungen angekommen, der englisch sprach und ihn »Papa« und sich selbst Billy Joe nannte. Seitdem hatte Dikkon mit seinem Sohn in Pengallon gelebt, und der Junge — der jetzt ungefähr zehn Jahre alt war — würde bald ein so guter Arbeiter sein wie sein Vater.
Luke sah, daß Dickon allein war und es eilig hatte. Es mußte etwas mit Elizabeth zu tun haben, dachte er angstvoll — Mrs. Tempest hatte Dickon geschickt, um ihn zu holen. Oder vielleicht war schon alles vorbei — vielleicht war das Kind schon geboren, und Dr. Morecombes düstere Voraussagen hatten sich als gegenstandslos erwiesen!
»Dickon«, brachte er heraus, als der große Mann neben ihm sein Pferd zügelte. Er sprach deutlich, damit Dickon die Worte an seinen Lippen ablesen konnte. »Hat die Geburt angefangen?«
Dickon nickte. Und da er ihn offensichtlich zur Eile antrieb, mußte es einen Grund dafür geben.
Im Wohnzimmer warteten sein Schwiegervater und Edmund auf ihn. Der hochgewachsene, weißhaarige Rick Tempest begrüßte ihn mit aufmunterndem Lächeln und teilte ihm mit, daß Elizabeths Wehen um die Mittagszeit angefangen hatten.
»Ihre Mutter und die Hebamme sind oben«, fügte er hinzu. »Es wird am besten sein, wenn du hierbleibst, Luke. Du weißt ja, daß Erstgeburten oft sehr lange dauern. Aber ich habe Dickon gebeten, dich zu holen, weil ich dachte, daß du hier sein willst.« Er goß ein großes Glas voll Brandy ein, ignorierte Lukes abwehrendes Kopfschütteln und gab ihm das Glas in die Hand. »Trink es aus, mein Junge — es kann sein, daß es eine lange Nacht wird.«
Gehorsam trank Luke den Alkohol, und sein Schwiegervater setzte sich wieder. Er nahm die unterbrochene Unterhaltung mit seinem Sohn wieder auf.
»Ich hatte ein langes Gespräch mit Henry Osborne von Marshall Mount — wir haben nach der gesetzgebenden Ratsversammlung zusammen zu Abend gegessen.«
»Osborne?« fragte Edmund interessiert. »Ist das nicht dieser unglaubliche Mensch, der vor ein paar Jahren eine riesige Rinderherde durch die Wildnis bis nach Adelaide getrieben hat, wo wegen der langen Dürrezeit Hungersnot herrschte?«
Rick Tempest nickte. » Genau der ist es ... und es war eine ungeheuer abenteuerliche Reise, die über vier Monate dauerte. Als er schließlich dort ankam, konnte er sehr viel Geld für die Tiere verlangen. Damit hat er seinen Reichtum begründet. Heute ist er Anfang Fünfzig. Er besitzt mehr Land und größere Herden als ich, und er hat eine riesige Familie — ich glaube dreizehn Kinder, von denen allerdings ein paar gestorben sind. Aber ...« Er schwieg und schaute Edmund etwas vorwurfsvoll an. »Er hat Erben, Edmund. Deine Mutter und ich hoffen schon lange darauf, daß du dich verheiratest und uns Enkelkinder schenkst, aber das hast du Elizabeth und Luke überlassen, oder?«
Edmund wurde rot. »Dazu ist doch noch genug Zeit, Vater, oder etwa nicht? Ich —« Dickon kam herein, und Edmund erhob sich, um dem Neuankömmling ein Glas einzuschenken. »Luke, willst du auch noch etwas Brandy?« fragte er. »Das ist das richtige für jemanden, der drauf und dran ist, einen Nachkommen zu kriegen!«
Luke schüttelte den Kopf. Er trank nur selten Alkohol, und das randvolle Glas war mehr als genug für ihn gewesen. »Nein, danke«, sagte er. »Es geht mir gut.«
Edmund setzte sich wieder und meinte unzufrieden: »Glaubst du etwa, daß ich mehr Chancen habe, eine Frau zu finden, wenn ich mich in der Politik engagiere, Vater?« fragte er aggressiv.
»Ich glaube ganz einfach, daß du mehr Möglichkeiten hast, wenn du häufiger in Sydney bist und dort am gesellschaftlichen Leben teilnimmst«, antwortete sein Vater leicht verärgert. »Hast du nicht die bezaubernde kleine Jenny Broome verloren, weil du dich hier auf dem Land vergräbst?« Er seufzte und griff nach seiner Pfeife. »Ich war bei ihrer Hochzeit in Sydney eingeladen, Edmund. Du weißt natürlich, daß sie William De Lancey geheiratet hat?«
»Natürlich weiß ich das!« rief Edmund zu Lukes Überraschung wütend aus. »Zum Teufel noch mal, Vater, selbst wenn ich meine Zeit auf Bällen und Gartenfesten in Sydney verschwendet hätte, was für eine Chance hätte ich gegen den mit vielen Orden ausgezeichneten Helden von Balaclava gehabt? Jenny hat mich keines Blickes mehr gewürdigt, als Will De Lancey und ich vor ein paar Monaten gleichzeitig in Sydney waren!«
Luke starrte seinen Schwager verwundert an. Die Namen bedeuteten ihm nichts, und er versuchte, Edmunds Ärger zu beschwichtigen, indem er fragte: »Wer ist William De Lancey, Edmund? Ich nehme an, er ist mit Francis De Lancey verwandt, den ich am Turon getroffen habe, oder —«
Edmund nahm sich zusammen. »Es sind Brüder, Söhne von Richter De Lancey.«
Danach schwiegen die Männer und gingen ihren eigenen Gedanken nach. Plötzlich klopfte es an der Tür, und die Hebamme kam herein. Luke sprang auf.
»Ist alles vorbei, Mrs. Lee?« fragte er eilig.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Sie müssen nach Bathurst reiten und den Doktor holen, Mr. Murphy«, sagte sie nervös. »Ich kann nichts mehr für Ihre Frau tun. Die Arme ist völlig erschöpft, und ... es ist eine Steißgeburt. Es ist dringend nötig, daß der Doktor kommt.«
Luke bekam es mit der Angst zu tun. Er lief eilig zur Tür, aber Dickon war vor ihm dort und bedeutete ihm, daß er den Arzt holen würde. Luke wußte, daß niemand so schnell wie Dickon reiten konnte. Der große Mann würde schneller als er dort sein, aber ... trotzdem zögerte er.
»Es ist meine Aufgabe, den Arzt zu holen, Dickon«, sagte er deutlich. »Ich ... Elizabeth ist meine Frau, und —«
Die Hebamme sagte schnell: »Sie fragt nach Ihnen, Mr. Murphy, und Mrs. Tempest meint, daß es sie beruhigt, wenn Sie zu ihr gehen und eine Zeitlang neben ihr sitzen.«
»Ich kann zu ihr?« Dickon klopfte ihm mitfühlend auf die Schulter und war dann verschwunden. Rick Tempest flüsterte kurz mit der Hebamme und wandte sich dann an Luke.
»Ich schreibe Dickon ein paar Worte für den Arzt — du geh besser zu Elizabeth, lieber Luke. Und sag ihr — sag ihr, daß wir alle in Gedanken bei ihr sind.«
Luke hielt es nicht länger aus. Er stieg die schmale Holztreppe in den ersten Stock hinauf, und die Hebamme kam hinter ihm her.
»Leise, Mr. Murphy!« rief sie ihm nach. »Sie bekommt noch einen Schreck, wenn Sie so schnell zu ihr hineinstürmen. Die arme junge Frau ist zu Tode geängstigt.«
Luke verlangsamte seinen Schritt und kam sich wie ein dummer Tölpel vor. Er betrat das Zimmer seiner Frau auf Zehenspitzen und machte sich auf alles gefaßt. Aber Elizabeth lag sehr ruhig im großen Bett und hatte die Augen geschlossen. Ihr kleines Gesicht war von der großen Anstrengung gerötet. Ihre Mutter saß auf einem Stuhl neben dem Bett, und sie tupfte ihr den Schweiß von der Stirn, bevor sie Luke ihren Platz anbot.
»Liebe Elizabeth«, flüsterte sie. »Er ist da — Luke ist da.« Elizabeth öffnete die Augen, und Luke war entsetzt über den Schmerz, den er darin las. Aber sie schaffte es, ihn anzulächeln, und streckte eine Hand aus.
»Es dauert sehr lang, Luke. Ich weiß auch nicht, warum. Mrs. Lee sagt ... sie sagt, daß der Doktor mir bestimmt helfen kann.« Sie sprach leise und verzog das Gesicht, als wieder eine Wehe kam. »Ich ...« Sie biß sich auf die Unterlippe und unterdrückte einen Schrei. »Ich hoffe, daß es ... daß es bald vorbei ist.«
»Das hoffe ich auch, liebste Elizabeth.« Luke setzte sich nicht, sondern ließ sich neben dem Bett auf die Knie fallen. Er nahm ihre Hand und küßte sie. Er liebte sie so sehr, er hätte sofort seinen rechten Arm dafür hergegeben, wenn er ihr damit hätte helfen können, aber er konnte nichts für sie tun. »Dickon holt den Doktor — er wird bald hier sein, Elizabeth.«
Er wollte sie in die Arme nehmen, aber er sah, daß Katie Tempest den Kopf schüttelte. Deshalb beugte er sich vor und küßte sie vorsichtig auf die Wange. Mit Entsetzen spürte er, wie heiß sie sich anfühlte.
»Ich liebe dich, Darling«, sagte er mit rauher Stimme und fügte unglücklich hinzu: »Ich soll dir ausrichten, daß alle an dich denken — dein Vater, Edmund und natürlich auch Dickon.«
Aber Elizabeth hörte ihn nicht mehr. Sie lag mit geschlossenen Augen da, und ihre Mutter flüsterte: »Sie ist eingeschlafen, lieber Luke. Vielleicht kommt sie etwas zu Kräften, wenn sie schläft, bis der Doktor kommt.«
»Ja, das wird das beste sein.« Luke stand auf und legte ihre Hand vorsichtig auf das Bett zurück. Einen Augenblick lang schaute er auf das zerbrechliche, kleine Wesen hinunter, und es fiel ihm schwer, die lebendige, glückliche Elizabeth in ihm wiederzuerkennen, mit der er verheiratet war. Elizabeth war immer voller Pläne, konnte besser reiten als er und platzte vor Energie und Begeisterung. Sie hatten ein Kind gewollt, aber ... er hielt die Luft an, nicht zu diesem Preis, ganz bestimmt nicht zu diesem Preis.
»Wird es ihr wieder gutgehen?« fragte er leise. »Mrs. Tempest, wird Elizabeth wieder gesund?«
Katie Tempest führte ihn zur Tür. »Es wird alles gut werden, wenn der Doktor erst da ist, Luke. Aber es ist eine — nun, eine schwierige Geburt. Mrs. Lee hat ihr Bestes getan, sie — überlaß es jetzt uns. Wie gesagt, es wird Elizabeth helfen, wenn sie etwas Ruhe findet.«
»Ja, ich weiß, ich —« Luke schluckte und brachte kaum heraus, was er sagen wollte. »Elizabeth ist jedenfalls das wichtigste. Selbst wenn das Baby — wenn es sterben muß.« Er schwieg, und Katie Tempest nickte verständnisvoll.
»Ich verstehe dich gut, Luke. Versuch dir keine Sorgen zu machen, mein lieber Junge.« Bevor sie die Tür schloß, fügte sie hinzu: »Es gibt bald Essen. Du solltest etwas zu dir nehmen.« Sie schloß die Tür hinter sich. Luke lehnte sich an das Treppengeländer und lauschte. Aber kein einziges Geräusch kam aus Elizabeths Zimmer.
»Luke!« rief Edmund leise und kam die Treppe herauf. »Das Essen ist fertig. Vater hat gesagt, daß ich dich holen soll.«
»Ja, in Ordnung.« Luke folgte ihm ins Eßzimmer. Es war dunkel geworden, und die Lampen brannten schon. »Der Doktor — ist Dickon schon zurück?«
»Nein«, antwortete Rick Tempest kurz. Er schnitt mit einem Geschick, das lange Übung verriet, saftige Fleischscheiben von der Lammkeule ab. »Selbst Dickon kann nicht so schnell reiten, und Morecombe muß ja erst seine Sachen zusammenpacken. Sie brauchen bestimmt noch eine Stunde.« Er reichte ihm einen Teller. »Wie geht es Elizabeth?«
Luke nahm den Teller an und seufzte. »Ich weiß es nicht, Sir. Sie schien — ach Gott, die arme Elizabeth, sie schien völlig erschöpft zu sein. Mrs. Tempest sagte, daß sie schlafen soll, bis Dr. Morecombe kommt. Ich — ich hoffe, daß sie das kann.«
»Ja, das wäre gut.« Rick Tempest schnitt schweigend weiter Fleisch auf, und als er sich an den Tisch setzte, wechselte er ganz bewußt das Gesprächsthema. Luke hörte nicht zu. Nachdem, wie er glaubte, eine Ewigkeit vergangen war, hörte er Hufgetrappel vor dem Haus. Er schob seinen Teller zur Seite und sagte: »Jetzt sind sie da, Sir, Dickon und Dr. Morecombe.« Er lief zum Fenster und spähte in die Dunkelheit hinaus. »Ja, da ist die Kutsche vom Doktor, Gott sei Dank!« Ohne auf die beiden anderen zu warten, lief er zur Tür. »Ich lasse sie herein.«
Dr. Morecombe, ein dicklicher, rotgesichtiger Mann, begrüßte Luke sehr herzlich.
»Geht’s ihr nicht gut, unserer kleinen Elizabeth? Nun, machen Sie sich keine Sorgen, mein Junge — ich werde es schon zu einem guten Ende bringen. Ich hab’ ja vermutet, daß die Geburt nicht leicht werden würde. Ich hab’s Ihnen gesagt, oder?« Er setzte seinen Arztkoffer ab und zog entsetzlich langsam seine Jacke aus, bevor er Luke ins Haus folgte. In der Tür blieb er noch einmal stehen und winkte Dickon zu, der sein Pferd wegführte.
»Sie braucht dringend Ihre Hilfe, Doktor«, drängte Luke. »Sie —«
»Nun, nun«, versuchte der Arzt ihn zu beruhigen. »Hetzen Sie mich nicht, mein Junge. Ich bin so schnell wie möglich gekommen, und es war anstrengend bei dieser mörderischen Hitze. Sagen Sie der guten Mrs. Lee, daß ich da bin, und geben Sie in der Küche Bescheid, daß ich viel kochendes Wasser brauche, verstanden?« Er ging ins Eßzimmer und war zu Lukes Entsetzen zehn Minuten später immer noch dort.
Aber schließlich, als Lukes Geduldsfaden um ein Haar gerissen wäre, erhob sich der dicke Arzt, setzte das Glas Brandy ab, das Rick ihm angeboten hatte, und verkündete, daß er jetzt bereit für die Schlacht sei.
»Nehmen Sie sich zusammen, mein Junge«, riet er Luke nicht unfreundlich. »Ich weiß genau, daß auch das Vaterwerden beim ersten Mal nicht einfach ist. Beim dritten oder vierten Kind wird es Ihnen leichter fallen. Ich habe Hunderte von jungen Australiern auf die Welt gebracht, also versuchen Sie, sich zu entspannen, und überlassen Sie Ihre Frau mir, ja? Trinken Sie etwas — Mr. Tempest hat einen ausgezeichneten Brandy.«
Luke folgte beschämt seinem Rat. Als er an dem Glas nippte, das ihm sein Schwiegervater reichte, kam Dickon herein, legte ihm in wortloser Sympathie den Arm um die Schulter und setzte sich dann an den Tisch, um endlich sein Abendbrot zu sich zu nehmen.
Danach schleppte sich die Zeit dahin. Wie schon vorher sprachen Rick und Edmund über innenpolitische Probleme, aber jetzt tat Luke nicht einmal mehr so, als ob er zuhörte. Das halbleere Brandyglas vor sich, saß er auf seinem Stuhl, kämpfte gegen Angst und Verzweiflung an und horchte auf Babygeschrei — das Zeichen, daß Elizabeths Qualen beendet sein würden.
Aber es blieb still. Nach mehreren Stunden kam Katie Tempest herunter.
»Es geht langsam voran, Luke«, berichtete sie und war unfähig, ihre eigenen Befürchtungen zu verbergen. »Dr. Morecombe macht alles Menschenmögliche. Wir müssen Geduld haben.« Ein Mädchen brachte ihr eine Tasse Tee, aber sie trank kaum einen Schluck. Sie meinte: »Ich glaube, Mrs. Lee würde sich über eine Tasse Tee freuen« und ging mit einem Tablett wieder nach oben.
Irgendwann schlief Luke auf seinem Stuhl vor Erschöpfung ein. Als er erwachte, war es schon heller Tag, und Dr. Morecombe kam ins Zimmer.
Der dickliche kleine Arzt sah jetzt alles andere als frohlich aus. Er sagte mit rauher Stimme: »Ich bedaure es außerordentlich Ihnen sagen zu müssen, daß das Kind eine Totgeburt war und daß, obwohl ich alles getan habe, was in meiner Macht steht, nur ein Wunder das Leben der kleinen Elizabeth retten kann. Wunder geschehen hin und wieder, aber ...« Er unterbrach sich und schüttelte traurig den Kopf.
Luke starrte ihn entgeistert an und begriff erst nach und nach, was er gesagt hatte. Er konnte hinnehmen, daß sein erstes Kind tot zur Welt gekommen war, aber doch nicht, daß Elizabeth sterben sollte! Einen Augenblick lang konnte er nichts sagen, aber dann fragte er mit großer Bitterkeit: »Kann ich sie sehen?«
»Luke?« Der Arzt starrte ihn in seiner Erschöpfung an, ohne ihn recht zu erkennen. Dann nickte er. »Sie sind ihr Ehemann, natürlich können Sie zu ihr hinauf. Und Sie auch, Mr. Tempest ... die ganze Familie. Aber ich befürchte, sie wird sie nicht mehr erkennen. Sie — die arme junge Frau ist bewußtlos.«
Rick Tempest legte Luke einen Arm um die Schultern, und sie stiegen zusammen die schmale Treppe in den ersten Stock hinauf.
Wie schon zuvor lag Elizabeth ruhig in dem Himmelbett, dessen Vorhänge zugezogen waren, um das Tageslicht auszusperren. Und wie zuvor waren ihre Augen geschlossen. Aber dieses Mal öffneten sie sich nicht, als Luke sich neben das Bett kniete, und Luke wußte plötzlich, daß das Wunder, von dem Dr. Morecombe gesprochen hatte, nicht geschehen würde. Ihre Mutter weinte laut, und Rick Tempest beugte sich zu seiner Tochter hinunter und küßte sie auf die Stirn. Dann ging er zum Fenster und umarmte seine verzweifelte Frau.
Edmund und Dickon kamen kurz herein. Luke kniete am Bett und fühlte vor Fassungslosigkeit keinerlei Traurigkeit. Er hielt die Hand seiner Frau und betete inständig: »Rette sie, lieber Gott — ich bitte dich darum, sie zu retten! In deiner großen Güte und Milde, laß ein Wunder geschehen, laß sie leben! Nimm mein Leben, nicht ihres — ich würde gern für sie sterben! Elizabeth, Liebste, Süße, sprich mit mir — schau mich an! Ich liebe dich so sehr ...«
Aber es nützte alles nichts. Elizabeths kleine, von der vielen Arbeit rauhe Hand bewegte sich nicht, ihr Gesicht wirkte entspannt und entschlossen zugleich, und sie öffnete die Augen nicht mehr. Luke wußte nicht, wie lange er neben ihr gekniet hatte, aber irgendwann bat ihn Dr. Morecombe aufzustehen, und nach einer kurzen Untersuchung sagte er mit rauher Stimme: »Sie hat uns verlassen, mein Junge, Gott sei ihrer Seele gnädig. Gehen Sie jetzt besser nach unten.«