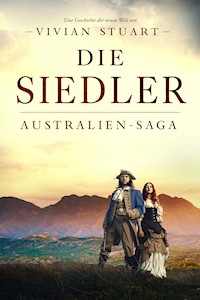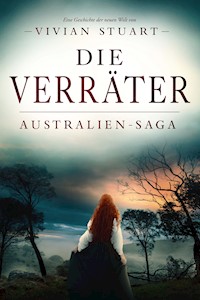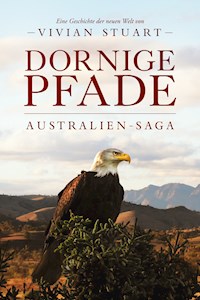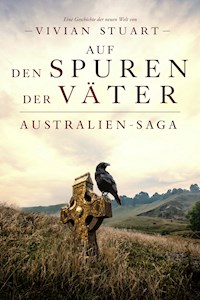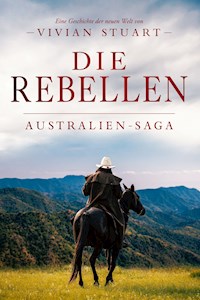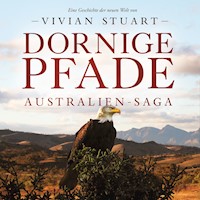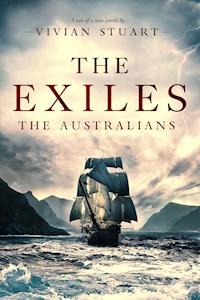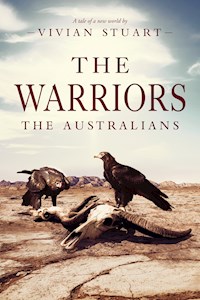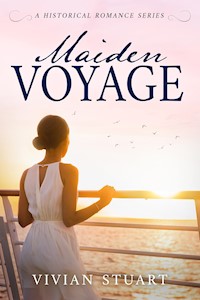Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
"Die Verbannten" ist der erste Teil der zwölfbändigen Australien-Saga von Vivian Stuart. Sie waren Rebellen und Ausgestoßene, die um die halbe Welt flohen, um das raue australische Ödland zu besiedeln. Jahrzehnte später, bereichert durch Liebe und gestärkt durch Tragödien, hatten sie die Wildnis in fruchtbares Land und sich selbst in Australier verwandelt. Sie verlassen ihre Heimat nicht freiwillig, sondern die Heimat hat sie verstoßen: In Australien sollen die Verbannten eine neue Kolonie gründen, im Namen seiner Majestät. Unter ihnen ist die junge Jenny Taggart, unschuldig verurteilt, die zu einer starken Frau mit unbeugsamem Lebenswillen heranwächst und dem Schicksal tapfer die Stirn bietet. Auf dem Schiff trifft sie Johnny Butcher, den Verbannten, der seine Freiheit mehr liebt als sein Leben. Gemeinsam segeln sie einer ungewissen Zukunft entgegen. Der erste Band der großen Australien-Saga
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Die Verbannten
Die Verbannten – Australien-Saga 1
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1979
© Deutsch: Jentas A/S 2021
Serie: Australien-Saga
Titel: Die Verbannten
Teil: 1
Originaltitel: The Exiles
Übersetzung : Jentas A/S
ISBN: 978-87-428-2036-0
Karte
Die Flotte segelte von Spithead am 13. Mai 1787
Teneriffa 3. Juni - Corpus Christi Festival 7. Juni
Am 10. Juni legte die Flotte nach Rio ab. - S.E. Trades an bord geholt am 7. Juli
Rio de Janeiro am 6. August - Die Offiziere wurde vom Governor unterhalten
Abgelegt nach Capetown am 4. September - Meuterei gegen Alexander am 6. Oktober
Die Flotte landete qm 14. Oktober in Capetown an.
Abgelegt am 12. November - Philip transferiert zum Versorgertrupp am 16. November
Die Flotte wurde kurz vor der Kergueleri Insel aufgeteilt am 13. Dezember 1787
Die Rute der Flotte ist wie folgt markier: -------
1. Division sichtet Van Diemens Land am 2. Januar 1788
Verheerende Stürme am 17. Januar - Phillips Geschwader in der Botany Bay am 18. Januar
2. Division sichtet Festland am 19. Januar
2. Division wird geleitet von H.M.S. Sirius erreicht Botany Bay 20. Januar
Phillip am Hafen von Jackson am 21. Januar 1788
Ankunft des Laperiouse Geschwader in Botany Bay am 24. Januar
Phillip in der Bucht von Sydney am 25. Januar 1788
Flagge gehisst und Land eingenommen. Die Flotte liegt vor Anker am 26. Januar
Die Flotte im Hafen markiert wie folgt:
1
Der Morgen des 29. September 1781 stieg grau und bedeckt herauf. Nebelschwaden zogen über die flache Landschaft um den Marktflecken Milton Overblow. Aber als die Sonne aufging und den Nebel golden färbte, belebten sich bald alle Straßen, auf denen die Landbevölkerung auf Fuhrwerken, zu Pferd oder zu Fuß der Stadt zustrebte. Heute war Michaelsmesse, auf der nur Pferde und Schafe verkauft wurden.
Auf der Straße von Overdale ging es nur langsam voran. Aber die Farmer und Kleinbauern freuten sich das ganze Jahr über auf die Michaelsmesse. Festtäglich herausgeputzt, zügelten sie ihre Ungeduld, da sie wußten, daß die Marktbuden und die Schenken offen bleiben würden, bis alle Besucher ihr Geld ausgegeben hätten.
Die Reiter aber, die vom Rittergut Overdale herüberkamen, waren nicht bereit, sich aufhalten zu lassen. Angeführt vom Rittergutsbesitzer Lord Braxton preschten sie im Galopp in eine Schafherde hinein und scheuchten sie und zwei dahinziehende Familien mit Verachtung in die Büsche abseits der Straße.
Der Lord war alles andere als beliebt bei der Bevölkerung. Zum einen stammte er nicht aus dieser Gegend. Zum anderen waren sein Besitz und sein Titel vergleichsweise jungen Datums — ein Verdienst seiner Marinezeit in Nordamerika, wo er sich mehr darum gekümmert hatte, Reichtümer anzuhäufen, als für sein Land Schlachten gegen die französischen und amerikanischen Einwanderer zu führen.
Dennoch hatte er sich unter Admiral Rodney genug Auszeichnungen erworben, um in den Adelsstand erhoben zu werden. Und jetzt, im Ruhestand, hatte Lord Baxton das Rittergut Overdale gekauft und es irgendwie bewerkstelligt, zum Vorsitzenden des Gerichts berufen zu werden.
Wäre das alles gewesen, so hätte die Bevölkerung das sicher hingenommen, so wie sie andere Widrigkeiten des Lebens wie harte Winter und ständig ansteigende Steuern geduldig ertrug. Auch die strengen Urteile, die Braxton über kleine Missetäter fällte und selbst die Arroganz, mit der er sozial Schlechtergestellte bedachte, hätten nichts weiter als ihre unausgesprochene Ablehnung hervorgerufen.
Aber der Mann war überaus geizig und hatte kürzlich unter Berufung auf das Bodenrecht Räumungsklagen gegen mehrere seiner Pächter erhoben. Mit Hilfe eines alten Gesetzes aus der Tudor-Zeit, das nie aufgehoben worden war, pochte er auf eine gewisse Wirtschaftsführung seiner Pächter und kassierte bei geringen Übertretungen deren privaten kleinen Landbesitz.
Der Haß gegen den neuen Lord wuchs. Ein paar junge Hitzköpfe erwogen, die Zäune abzureißen, die er hatte errichten lassen, und einige dachten sogar daran, dem verhaßten Gutsbesitzer Gewalt anzutun. Doch der alte Pastor Simeon Akeroyd hatte sein möglichstes getan, um sie davon abzuhalten und ihnen die unvermeidlichen Konsequenzen vor Augen zu führen, aber die meisten jungen Männer waren zu wütend, um auf ihn zu hören. Erst vor einer Woche hatten sie tatsächlich zwei Zäune um Lord Baxtons Besitz eingerissen und das Holz gestohlen.
Der alte Pastor seufzte. Da er tätliche Auseinandersetzungen befürchtete, war er im Morgengrauen zum Rittergut hinübergeritten und hatte sich der Gruppe des Lords angeschlossen, um entstehende Streitigkeiten mit den empörten Kleinpächtern schlichten zu können.
Lord Braxton hatte ihn nicht einmal eines Grußes gewürdigt. Er hatte außer seinem Rechtsanwalt Thomas Slater seinen rauhbeinigen Gutsverwalter Ned Waite und seinen Reitknecht Gunner O’Keefe bei sich, ohne den er nur selten die schützenden Mauern seines Anwesens verließ. Der Gutsverwalter deutete nach vorn.
»Der Kerl da, Mylord«, sagte er, »das is Taggart. Der lebt westlich vom Kirby Ödland.«
Auf dem Fuhrwerk, das von zwei buntgeschmückten kräftigen Pferden gezogen wurde, saßen ein Mann und eine Frau, die ein Kind zwischen sich auf dem Kutschbock hatten. Drei junge angehalfterte Arbeitspferde, die offenbar auf der Messe verkauft werden sollten, liefen hinter dem Fuhrwerk her.
Lord Braxton fragte: »Züchtet er Pferde, dieser Taggart?«
»Ja, gute Pferde sogar«, meinte der Rechtsanwalt. »Und er verkauft sie auch zu guten Preisen.«
Ned Waite warf mit bösartigem Unterton in seiner rauhen Stimme ein: »Er läßt se auf’m Ödland grasen, Mylord.«
Das Kirby-Ödland grenzte westlich an die Ländereien des Rittergutes an. Es war gutes Grasland, auf das seit altersher alle Bewohner von Kirby ihr Vieh zum Weiden trieben. Und es war auch der letzte Streitapfel zwischen Braxton und seinen Pächtern. Dort waren seine neuaufgerichteten Zäune über Nacht verschwunden.
»Sie nehmen doch nicht an, Mylord«, schaltete sich der Pastor als hochgeachtetes Haupt seiner Gemeinde ein, »daß Angus Taggart etwas mit der unglücklichen Geschichte zu tun hat?«
»Das nennen Sie eine unglückliche Geschichte, Pastor? Es war blanker Diebstahl, weiter nichts! Ich habe das verdammte Recht, das Viehzeug der Kleinpächter von meinem Weideland fernzuhalten, außer sie zahlen was dafür. Stimmt’s, Slater?«
Der Rechtsanwalt stimmte eilfertig zu. Lord Braxton unterbrach ihn unwirsch und wandte sich an den Pastor.
»Warum sind Sie so sicher, daß dieser Taggart nichts damit zu tun hat? Er braucht doch Weideland für seine Pferde, oder? Und zwar mehr als andere, da er doch züchtet!«
Das stimmt, dachte Pastor Simeon Akeroyd traurig. Er stammelte vor Aufregung: »Aber Angus Taggart ist ein rechtschaffener Mann, Mylord, er bricht keine Gesetze. Er würde nichts hinter Ihrem Rücken tun. Er hat seinen Stolz, wie jeder gute Schotte.«
»Wir werden ja sehen, wie stolz er ist, wenn er seinem Ankläger gegenübersteht. Was meinst du, Waite?«
»Ja, Mylord. Ich hab’ ihn erkannt. Ich könnt’s glatt beschwören.«
»Dann halt ihn an!« befahl sein Dienstherr. »Ich will mit ihm reden. Aber provozier ihn nicht. Und keine Drohungen!«
»Sehr wohl, Mylord.«
Der Pastor beobachtete, wie Ned Waite den Wunsch seines Herrn für seine Verhältnisse freundlich ausrichtete, denn Angus Taggart brachte sein Pferdefuhrwerk gleich am Straßenrand zum Stehen, übergab seiner Frau die Zügel und ging den Reitern entgegen.
Er war ein hochgewachsener, kräftiger Mann Mitte dreißig, mit einem wettergegerbten Gesicht und freundlichen, blauen Augen. Er trug eine braune, handgewebte Jacke und Reithosen. Sein rotes Haar war hinten zu einem ordentlichen Zopf geflochten. Auf einen Wink seines Herrn hin kam Ned Waite, der beim Fuhrwerk stehengeblieben war, mitten durch eine blökende Schafherde zu ihm zurück.
»Sie wünschen mich zu sprechen, Mylord?« fragte Taggart. Er sprach ruhig wie ein Mann, der ein reines Gewissen hat und der eine offensichtlich unerwartete Vorladung nicht zu fürchten braucht. Als er den alten Pastor erkannte, grüßte er ihn freundlich.
»Sie heißen Taggart, ist das richtig?« fuhr ihn Lord Braxton barsch an.
»Jawohl. Ich bin einer von Ihrer Lordschaft Pächtern.«
»Das ist mir klar... auch die Tatsache, daß Sie Pferde züchten, die Sie auf meinem Land grasen lassen. Ist das richtig?«
Angus Taggart starrte den Frager an, seine Augen wirkten zuerst alarmiert und dann vorsichtig. »Ich lasse meine Tiere auf dem Ödland grasen, Sir, das von altersher jedermann zur Verfügung steht —«
Lord Braxton unterbrach ihn. »Außer, wenn das Weideland ordentlich eingezäunt ist. Dann nämlich verfällt dieses Recht. Stimmt’s, Rechtsanwalt Slater?«
Bevor dieser die Rechtslage bekräftigen konnte, fuhr Braxton hitzig fort: »Und ich habe alles getan, was das Gesetz erfordert. Ich habe Zäune aufrichten lassen, die über Nacht von feigen Lumpen eingerissen wurden.«
»Ich hab’ davon gehört. Aber die Bauern benötigen das Weideland dringend. Ohne das Ödland wären viele ruiniert! «
»Und Sie auch, stimmt’s?« fragte Lord Braxton listig.
»Jawohl«, gab Taggart ohne Zögern zu. »Mein Pachtland ist zum großen Teil moorig. Mein Ackerland bringt gerade so viel Getreide ein, um die Zuchttiere durch den Winter zu bringen.« Er deutete auf seine drei jungen Pferde. »Für die reicht das Futter nicht. Deshalb verkauf ich sie auf der Messe.«
Braxton lachte auf. »Mein Verwalter Waite sagt, daß Sie meine Zäune abgerissen haben. Stimmt’s, Waite?«
Der Gutsverwalter nickte mit seinem kurzgeschorenen Kopf. »Jawoll, Mylord, wir ham ihn gesehn, O’Keefe und ich. Wie er die Zaunpfosten ausgegraben und sie auf sein Wagen geladen hat.«
Taggart schaute sie entsetzt an. »Ihr könnt mich nicht gesehn haben — ich war ja nicht dabei! Du lügst, Gunner — das weißt du selbst.« Er wandte sich verzweifelt an den Pastor. »Sir, wollen Sie sich nicht für mich verbürgen?«
Der alte Pastor tat sein Bestes und wiederholte die Vorzüge von Taggarts Charakter. Gleichzeitig brach Waite in einen Schwall von Anschuldigungen aus. Daß sie an den Haaren herbeigezogen waren, begriff jeder, der O’Keefe grinsen sah, und Taggart unterbrach den Gutsverwalter schließlich mit fester Stimme und sagte: »Sie haben keine Beweise, Mylord. Ihr Wort steht gegen meines. Ich hab’ erst hinterher von der ganzen Sache erfahren. Ich war sogar dagegen, als der Plan aufkam und —« Er unterbrach sich, aber es war zu spät. Er hatte mehr verraten, als er beabsichtigt hatte.
»Dann kennen Sie die Missetäter?« fragte Braxton kalt.
»Nicht mit Sicherheit, Mylord. Wirklich, ich —«
»Sie wären gut beraten, sie beim Namen zu nennen«, schaltete sich Rechtsanwalt Slater ein. »Falls Ihre Lordschaft Ihnen glauben soll, daß Sie nicht die Hand im Spiel hatten.«
»Ich kann sie nicht nennen, Sir«, sagte Taggart und preßte die Lippen aufeinander.
»Sie können nicht ... oder wollen nicht, Mann?« forderte ihn Lord Braxton heraus.
»Dann will ich es nicht, wenn’s beliebt«, entgegnete der Schotte trotzig. »Nehmen Sie uns dieses Weideland ab, dann wird keiner von uns den Pachtzins zahlen können.«
Bei diesem Geständnis merkte Lord Braxton auf. »Sie können sofort aufhören zu zahlen, Taggart. Kündigen Sie ihm, Slater! Er soll innerhalb einer Woche von meinem Land verschwinden — verstanden?«
»Er hat ein Vierteljahr Kündigungsfrist«, murmelte der Rechtsanwalt.
Taggart wurde blaß und protestierte: »Ich habe einen einjährigen Pachtvertrag, Mylord.«
»Sieh mal einer an! Und was zahlen Sie?«
»Hundertzwanzig Schilling für das Land, und vierzig für das Haus, Mylord.«
»Wenig genug.« Braxton wandte sich an den Anwalt, dem die ganze Szene sichtlich unangenehm war. »Slater, ist es nicht meine Pflicht zu überprüfen, daß er so gut wie möglich wirtschaftet?«
»Ja, das ist eine Bedingung für seinen Pachtvertrag«, bestätigte der Anwalt. »Allerdings —«
»Danke, das reicht. Sehr gut, Taggart ... Sie werden in Zukunft zehn Morgen Weizen anbauen.«
Taggart protestierte. »Auf meinem Land wächst kein Weizen. Der Teil, der nicht moorig ist, ist viel zu steinig. Und meine Pferde —«
»Ach ja, Ihre Pferde. Trotz des Diebstahls meiner Zäune will ich nicht zu hart mit Ihnen verfahren. Wenn Ihre Pferde gut sind, kauf’ ich sie Ihnen ab. Davon können Sie dann Saatgut und die nötigen Geräte anschaffen.«
Die Schafherde war inzwischen vorübergezogen, und die Straße war frei. Taggarts hübsche blonde Frau drückte ihre Tochter an sich, als wäre sie in Gefahr, und schaute angespannt herüber. Braxton grüßte sie knapp und befahl Taggart: »Binden Sie die Pferde los! Ich möchte sicher sein, daß sie ganz gesund sind.«
Sie waren nicht reinrassig, aber sonst einwandfrei. Braxton galt als ein guter Pferdekenner, und man sah ihm an, daß er mit den drei jungen Pferden sehr zufrieden war.
»Können sie schon im Geschirr gehn?« fragte er. Taggart schwieg in seiner ohnmächtigen Wut. »Und vor dem Pflug? Lauter, Mann, ich kann Sie nicht verstehn!«
»Der Wallach schon, die anderen noch nicht ...« Taggarts Gesicht war jetzt weiß, und seine Hände zitterten. Der alte Pastor, der wußte, daß er nicht viel zu seiner Verteidigung hatte beitragen können, stieg von seinem Pferd ab und ging steif zum Fuhrwerk hinüber, wo er für kurze Zeit außer Sicht- und Hörweite von Lord Braxton war.
Rachel Taggart begrüßte ihn bewegt. Zu ihrer kleinen Tochter sagte sie: »Jenny, vertrete dir etwas die Beine, bis wir weiterfahren. Aber geh nicht zu weit weg!« Jenny juchzte und sprang vom Wagen.
Rachel flüsterte: »Angus hat Schwierigkeiten, oder?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage, und Simeon Akeroyd klopfte ihr ungeschickt auf den Arm und mußte ihre Befürchtungen bestätigen.
Als er noch nach den richtigen Worten suchte, sagte sie heftig: »Sir, ich muß es ganz genau wissen, wie soll ich ihm sonst helfen können? Seine Lordschaft hat uns nicht deshalb angehalten, um Pferde zu kaufen — das hätte er auf der Messe tun können.«
Der Pastor berichtete ihr, worum es ging. Rachel sagte schnell: »Aber er kann doch nicht behaupten, daß Angus den Zaun abgerissen hat!«
»Nun ja, meine liebe Rachel, auf alle Fälle hat er gemerkt, daß Angus weiß, wer es getan hat. Und jetzt will er ihn zwingen, Namen zu nennen.«
»Was er nicht tun wird!«
»Bis jetzt hat er noch niemanden verraten. Aber ...« Er erzählte ihr den weiteren Verlauf des Gesprächs und sah, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich, als sie die Bedeutung dessen begriff, was er da sagte.
»Zehn Morgen Weizen, das ist, das ist —«
»— die Bedingung für den Pachtvertrag. Das heißt, daß Angus darauf eingehen muß, oder aber die Pacht verliert. Aber es ist ein Jahr lang Zeit. Vielleicht ist es bis dann möglich.«
»Nein.« Tränen stiegen Rachel in die Augen. »Nein, das ist unmöglich. Wir können bis zum Frühjahr unmöglich zehn Morgen roden und pflügen, und außerdem ist das Land zu steinig ... es wäre nichts als verlorene Müh’.«
»Es tut mir leid«, sagte der alte Pastor, »unendlich leid. Ich mache natürlich, was ich nur kann. Aber ich fürchte, der Lord wird nicht nachgeben. Außer natürlich —«
Sie erriet, was er dachte, und schüttelte den Kopf. »Angus wird seine Freunde nicht verraten, welchen Preis er auch immer dafür bezahlen muß!« Sie seufzte, strich ein paar blonde Locken aus der Stirn zurück und rief nach Jenny. Das kleine Mädchen kam angerannt.
»Geht’s weiter, Mama?« fragte es eifrig.
»Bald, mein Schatz«, sagte Rachel lächelnd. Der Pastor bewunderte ihre Haltung und ihren Mut. Er stieg vom Fuhrwerk und half Jenny hinauf. Beim Abschied versagte ihm die Stimme. Das waren anständige, rechtschaffene Leute, sie verdienten wirklich nicht, was Lord Braxton ihnen antat. Aber so etwas passierte im ganzen Land. Schafe brachten heutzutage mehr ein als Pächter, deren Pachtzins legal nicht erhöht werden konnte.
Als er Rachels Hand in der seinen hielt, wünschte sich Simeon Akeroyd inständig, daß er ihr mehr als nur vage Versprechungen machen könnte. Aber es war ihm bitter bewußt, daß er selbst weitgehend vom Wohlwollen des Rittergutsbesitzers abhing. Er konnte beten, sonst nichts ...
»Seine Lordschaft reitet weiter, Herr Pastor!« scholl Gunner O’Keefes rauhe Stimme herüber. »Sind Sie so gut und besteigen Sie Ihr Pferd!« Er warf ihm die Zügel zu und trabte, ohne ihm beim Aufsteigen behilflich zu sein, von dannen.
Der alte Pastor schwang sich steifbeinig in den Sattel. Dann drückte er seinem Pferd die Absätze in die Flanken und ritt hinter Lord Braxton her. Über die Schulter rief er den Taggarts »Gott sei mit euch« zu, das ihm aus vollem Herzen kam.
Angus Taggart band seine drei jungen Pferde schweigsam hinten am Fuhrwerk fest. Rachel spürte seine ohnmächtige Wut und sprach ihn deshalb noch nicht an. Sie sagte sanft zu Jenny: »Sei so lieb und frag deinem Papa kein Loch in den Bauch. Leg dich besser hinten in den Wagen — du bist früh aufgestanden und könntest ein bißchen Schlaf vertragen. Da, nimm meinen Schal und wickel dich damit ein.«
Jenny schaute sie mit erschrockenen Augen an, nahm aber gehorsam den Schal. »Aber wir fahren auf die Messe, ja, Mama?« fragte sie mit ängstlicher Stimme.
»Aber natürlich, mein Schatz«, versicherte Rachel, plötzlich sehr entschieden. Es könnte die letzte Messe sein, zu der sie jemals in Milton gehen würden, aber es bedürfte eines anderen Kerls als Lord Braxton, um sie von der heutigen Messe fernzuhalten. »Jetzt ab mit dir, und hör auf zu quengeln«, bat sie das Kind, »Papa kommt.«
Ihr Mann setzte sich neben sie und nahm die Zügel hoch. Sie waren fast schon eine Viertelstunde schweigend gefahren, als er wütend ausstieß: »Nun, hast du keine Fragen, Frau? Willst du nicht wissen, was Seine Lordschaft mir zu sagen hatte?«
»Ich warte darauf, daß du es mir genau dann erzählst, wenn du es mir erzählen willst«, meinte Rachel sanft.
»Du hoffst wohl drauf, daß sich meine Wut legt? Das wird sie nicht! Dieser gewissenlose Schuft Lord Braxton! Weißt du, womit er uns droht?«
»Ich weiß. Der Pastor hat’s mir gesagt.« Sie schaute ihrem Mann ins Gesicht. »Ich sagte ihm, daß du auf Drohungen nichts gibst. Daß du für dein Recht kämpfen würdest.«
»Und das werd’ ich auch, Frau! Nur über meine Leiche wird er uns aus unserer Heimat vertreiben, das schwör ich ... Ich hab’ mich auch geweigert, ihm die Pferde zu verkaufen.«
»Geweigert? Ach, Angus, war das klug? Wir wollen sie doch verkaufen — macht es dann was aus, wer sie kauft?«
»Natürlich nicht, aber nur bei der Versteigerung, für einen anständigen Preis. Er bot mir weniger als die Hälfte von dem, was sie wert sind, und Ned Waite behauptete, der Wallach wäre spatig. Du weißt, daß das nicht stimmt.«
»Er ist ein böser Mensch«, sagte sie. »Und Gunner O’Keefe auch.«
»Die haben das alles angezettelt«, knurrte Angus ungehalten. »Sie sagten Seiner Lordschaft, daß sie mich beim Diebstahl des Zaunes gesehn hätten! Ich wünschte jetzt, ich wär’ dabeigewesen, weil ich ja beschuldigt werde — und das sagte ich ihm auch.« Er schloß bitter: »Falls dort noch mehr Zäune errichtet werden, bin ich beim Abreißen das nächste Mal dabei!«
»Und ich werd’ dir helfen«, versprach Rachel.
Er schenkte ihr als Antwort sein langsames, warmherziges Lächeln. »Ich hab’ ihm die Namen der anderen nicht verraten. Deshalb droht er mir jetzt.«
Sie kamen in der Vorstadt an. Die Menschenmenge wurde immer dichter. Vom Messeplatz schallte Lärm herüber. Angus deutete mit seiner Peitsche auf eine bestimmte Stelle. »Jenny und du, steigt hier ab. Ihr könnt euch jetzt die Marktbuden anschaun. Ich geh’ mit den Pferden zur Versteigerung, die dürfte um halb vier, vier zu Ende sein. Ich treff’ euch dann genau hier wieder!«
»Und dann kaufst du Jenny noch einen Hut, du hast’s ihr versprochen. Wir suchen ihn vorher schon aus.«
»Und ich bezahl’ ihn vom Erlös des Pferdeverkaufs!« Angus lachte. Er hatte seine gute Laune wiedergefunden. »Und ich bau’ den Weizen an, auch wenn es mich umbringt. Braxton wird unser Land nicht bekommen!«
Jenny rieb sich den Schlaf aus den Augen und kletterte vom Fuhrwerk. In den Marktbuden waren allerlei verführerische Waren ausgebreitet. Jongleure und Akrobaten zeigten ihre Künste, auf den Drehorgeln hüpften kleine Affen herum, sogar ein Tanzbär drehte sich im Kreis.
Rachel ließ sich von der allgemeinen Aufregung anstekken, begrüßte alte Nachbarn und Kindheitsfreunde, die sie seit langem nicht mehr gesehen hatte, und ließ sich von Jennys guter Laune mitreißen. Zum Mittagessen kauften sie Ingwerbrot und ein paar Äpfel und kauten beim Herumlaufen auf dem Markt mit vollen Backen. Jenny brauchte lange, bis sie sich für einen Hut entscheiden konnte, aber dann wurde der schönste zurückgelegt, und sie wanderten mit schmerzenden Füßen weiter zwischen den Schaubuden umher, bis sich die allgemeine freudige Erregtheit langsam legte und sich die Menschenmenge allmählich verzog.
Sie kamen früh genug zum vereinbarten Treffplatz, aber Rachel sah erschrocken, daß Angus schon dort wartete. Als sie auf ihn zueilte, schaute er sie finster an. »Er hat die Pferde gekauft, alle drei, verdammt noch mal! Und für die Hälfte von dem, was sie wert waren. Das hier hab’ ich dafür gekriegt. « Er streckte seine Hand aus und ließ sie die Münzen zählen, die darin lagen.
Rachel stammelte: »Wie hat er sie für so wenig gekriegt?«
»Ned Waite war der einzige, der bei der Versteigerung darauf geboten hat.« Seine Stimme zitterte vor Anstrengung, seine Wut zu unterdrücken. »Sonst machte niemand den Mund auf. Dabei ging es vorher sehr lebhaft zu, bis eben meine Tiere dran waren.«
»Oh, Angus!« Sie schauten einander verzweifelt an und vergaßen das Kind für einen Augenblick.
»Wir fahren am besten heim«, sagte Angus schließlich. »Komm, Jenny!« Er versuchte, sie auf seine Schultern zu heben, aber das Mädchen wich ihm aus. In seinen Augen schimmerten Tränen. »Was tut dir denn weh, mein Küken? Ich wollte dich doch nur zum Wagen zurücktragen!«
»Aber mein Hut ...«, erinnerte Jenny ihren Vater.
Angus umarmte sie. »Aber natürlich sollst du ihn haben, mein Schatz.«
Jenny barg ihr tränennasses Gesicht an seiner Brust, und ihre Stimme klang gedämpft, als sie antwortete: »Er hat so schöne blaue Bänder!«
Angus blickte seine Frau über den Kopf des Kindes hinweg an und erklärte mit Nachdruck: »Er bringt mich nicht dazu, meiner Tochter gegenüber wortbrüchig zu werden. Ich kauf’ ihr diesen Hut, und wenn es das letzte ist, was ich jemals tu’.«
2
Der Sonntagshut war, wie sich herausstellen sollte, das letzte Geschenk, das Jenny von ihrem Vater bekam. Noch Jahre später, als sich das Stroh, aus dem er geflochten war, schon längst aufgelöst hatte, bewahrte sie das zerschlissene blaue Band als Talisman auf, der in ihr Erinnerungen an glücklichere Zeiten erweckte.
Sie wußte und verstand nur wenig von den Ereignissen, die zum Tode ihres Vaters geführt hatten. Er war bei jedem Wetter draußen, von frühmorgens bis spätabends, und rodete ein Stück Land von Buschwerk und Gestrüpp, damit er im kommenden Frühjahr zehn Morgen Weizen einsäen konnte. Manchmal halfen ein paar Nachbarn, aber meist nur die Mutter, soweit ihre Kräfte bei dieser harten Arbeit reichten. Nur als im Winter eine dicke Schneedecke das Land bedeckte, sah Jenny ihre Eltern häufiger, da sie in der Zeit das Haus nur verließen, um die Pferde zu füttern oder sich einen Weg zur Kirche zu bahnen. Die Mitternachtsmette und der Weihnachtsgottesdienst waren ihr wie lichterglänzende Feste in Erinnerung.
Als das Wetter milder wurde, war der Vater wieder draußen und rodete das letzte Stück, und Jenny erinnerte sich daran, wie stolz und glücklich er war, als er ihrer Mutter sagte, daß er das Stück Land jetzt pflügen könne. Zwei Wochen später begleiteten sie und ihre Mutter ihn im Fuhrwerk nach Milton, wo sie Säcke voll Saatgut kauften. Keiner sprach es aus, aber das Kind spürte an der Art, wie die Säcke sorgfältig in einem abschließbaren Schuppen untergebracht wurden, daß diese Anschaffung fast ihr gesamtes Bargeld verbraucht hatte ... Am selben Abend brachen die trächtigen Stuten aus, und als Angus spät nachts mit ihnen zurückkehrte, entdeckte er, daß das Schloß am Schuppen aufgebrochen, die Hälfte der Säcke aufgerissen und die übrigen in den Bach hinter der Pferdekoppel geworfen worden waren.
Sie retteten soviel wie möglich, aber es war wenig genug. Und das Gesicht ihres Vaters war wutverzerrt, als er die lehmverschmierte, schon keimende Saat in seinen kleinen Karren schaufelte und loszog, um das Feld damit einzusäen, das er unter so großen Mühen gerodet hatte. Aber ein Wunder geschah, und die Saat ging leuchtendgrün auf dem steinigen Acker auf.
Im Juni ließ Lord Braxton neue Zäune um das umstrittene Ödland herum errichten. Sie wurden eingerissen, wieder errichtet und noch einmal eingerissen. Beim letzten Mal war Angus mit dabei. Die Absicht wurde im kleinen Wirtshaus von Wrenkin Dale ganz offen besprochen.
Einmal kam Angus nach einem Wirtshausbesuch mit einem zugeschwollenen blauen Auge und aufgerissenen Handknöcheln nach Hause. Jenny bemerkte, daß ihre Mutter ihm keine Vorwürfe machte, als er erzählte, daß Ned Waite einen gebrochenen Unterkiefer davongetragen hätte und Gunner O’Keefe geflohen sei und daß sich die beiden bestimmt nie mehr im Wirtshaus blicken lassen würden.
Eine Zeitlang herrschte ein trügerischer Frieden. Die Zäune wurden nicht wieder aufgerichtet, und das Vieh der Kleinpächter graste frei auf der saftigen Weide. Aber dann folgte die Nacht, an die sich Jenny ihr Leben lang mit großem Entsetzen erinnern würde ... und sie kam ohne jede Vorwarnung. Jenny erwachte mit einem unguten Gefühl und ging im Dunkeln zum Fenster. Sie sah schattenhafte Gestalten, die sich flüsternd am Stall zu schaffen machten. Vor Angst wie gelähmt, blickte Jenny in die Nacht hinaus und sah, wie eine Fackel entzündet wurde, dann eine zweite und eine dritte aufflammte. Sie vernahm ein bellendes Gelächter und erkannte eine Stimme.
Gunner O’Keefe. Jenny rannte los und weckte ihre Eltern. Der Vater fuhr sofort in seine Hose und die Stiefel, aber bevor er den Hof erreichte, stand der kleine hölzerne Bau in hellen Flammen, und die Männer waren verschwunden. Das entfernte Hufgeklapper ihrer Pferde wurde von den prasselnden Flammen übertönt.
»Wasser!« schrie Angus rauh. »Alle Eimer voll! Ich muß die armen Pferde da rausholen, bevor sie ersticken!« Er riß sich das Hemd vom Leib und sprang in den brennenden Stall. Als Jenny und ihre Mutter Eimer in der Pferdetränke füllten, sahen sie, wie er keuchend mit einem der Arbeitspferde herauskam. Das entsetzte Tier wieherte laut, und Angus ließ es laufen und verschwand wieder im Rauch. Kurz danach stürzte das Stalldach ein, und glühende Funken stoben zum Himmel, als die Balken herunterkrachten.
Als Jenny mit einem Eimer Wasser angerannt kam, galoppierte ihr das zweite Arbeitspferd entgegen. Sie wartete auf ihren Vater, aber er tauchte nicht auf.
Nachbarn halfen den Brand zu löschen, und als das Feuer schließlich erstickt war, wagten sich zwei Männer in die rauchenden Überreste des Stalles. Nach langer Zeit trugen sie ein schwarz verbranntes Etwas heraus, das wie ein Balken aussah, tatsächlich aber Angus Taggarts lebloser Körper war.
Ein paar Tage später schritt Jenny, empfindungslos vor übergroßem Schmerz, an der Seite ihrer Mutter zum ausgehobenen Grab. Als der Sarg in die feuchte braune Erde gesenkt wurde, sah sie nichts als den schwarz verbrannten Balken vor sich. Selbst die mitfühlenden Worte des alten Pastors vermochten es nicht, sie aus ihrer Betäubung zu reißen. Als sich die Nachbarn später beim Leichenschmaus in der Küche versammelten, hoffte Jenny, die wortlos und unbewegt am Tisch saß, daß sie bald gehen würden.
Am nächsten Morgen vertraute ihr die Mutter ihre Pläne für die Zukunft an.
»Ich stelle einen Mann an, der das Land für uns bestellt«, sagte Rachel mit gefaßter Stimme. »Es gibt viele, die das für Kost und Logis und ein paar Schilling machen. Und das hätte dein Papa bestimmt so gewollt. Ich geb’ nicht so schnell auf, du kennst mich ja!« Rachel strich der kleinen Jenny zärtlich übers Haar. »Wir verkaufen alle Zuchttiere und schaffen uns statt dessen Schafe an ... Ich bin auf einer Schaffarm großgeworden, und ich trau’ mir zu, mit einer kleinen Herde fertig zu werden. Aber du mußt mir dabei helfen, ja?«
»Natürlich, Mama«, versprach Jenny.
Sie schmiedeten hoffnungsvolle Pläne, aber das war nur von kurzer Dauer. Die beiden Arbeitspferde, die Angus Taggart das Leben gekostet hatten, tauchten nie mehr auf. Auch die gründlichsten Nachforschungen ergaben nichts. Und der Verkauf der Zuchttiere brachte nicht entfernt so viel Geld ein, um die dringend notwendigen Arbeitspferde zu ersetzen und außerdem Schafe zu kaufen.
Aber es war erst der Besuch von Rechtsanwalt Slater, der all die mutigen Hoffnungen Rachels endgültig zerstörte. Er kam ohne jede Umschweife auf den Grund seines Erscheinens zu sprechen und hielt es nicht einmal für nötig, dabei vom Pferd abzusteigen.
»Der Pachtvertrag ist auf Ihren Mann ausgestellt, nicht auf Sie, Frau Taggart. Mit seinem Tod sind alle damit verbundenen Rechte auf Lord Braxton zurückgefallen, und Seine Lordschaft wünschen das Land selbst zu bebauen. Das alles ist natürlich ganz legal ...«
Rachel versuchte, etwas zu erwidern, brachte aber kein Wort heraus. Als der Rechtsanwalt das bemerkte, fuhr er etwas besänftigender fort: »Lord Braxton möchte Ihnen aber nicht unnötige Schwierigkeiten machen. Ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, daß Sie einen Monat lang Zeit haben, um den Hof zu räumen. Er wird eingerissen, heute in einem Monat — also ganz genau am dreizehnten Juli.«
»Und wenn ich nicht ausziehe?« fragte Rachel mit leiser Stimme. »Was dann, Mister Slater?«
»Dann wird das Haus zwangsgeräumt, und Ihre Habseligkeiten werden beschlagnahmt«, entgegnete er kühl und ritt grußlos von dannen.
Rachel ging blaß und zitternd ins Haus zurück. Sie setzte einen Hut auf, warf ein Umhängetuch um und machte sich auf den Weg zu ihren Nachbarn, um sich mit ihnen zu beraten.
Als sie spätnachts zurückkam, weckte sie Jenny, die auf dem Stuhl eingedöst war, und sagte mutig: »Ich habe einen Plan gefaßt, wach auf und hör gut zu! Wir gehn nach London. Dort gibt es für ehrliche Leute genug Arbeit. All die reichen Adeligen dort haben große Häuser und brauchen Dienstboten.«
»London?« wiederholte Jenny. »Aber London ist doch so weit weg, Mama!« Die Vorstellung entsetzte sie. »Wir kommen nie dorthin!«
»Doch, doch«, versicherte ihre Mutter.
»Können wir nicht lieber zu deiner Familie gehn? Das ist nicht so weit und —«
»Die haben schon genug Münder zu füttern, und es fällt ihnen schwer genug. Mein Vater und meine Brüder bewirtschaften die Farm, wir würden ihnen nur zur Last fallen, und das will ich nicht.«
»Ich will aber nicht hier weg«, flüsterte Jenny den Tränen nahe.
Ihre Mutter nahm sie zärtlich in den Arm. »Glaub mir, es bricht mir auch das Herz, unser Haus zu verlassen. Aber ohne deinen Papa wäre es sowieso nie mehr dasselbe hier, selbst wenn Seine Lordschaft uns hier leben ließe. Und wer weiß, vielleicht machen wir unser Glück in London!«
Durch ihre Zuversicht und ihre Entschiedenheit, das Beste aus der Situation zu machen, verflüchtigten sich Jennys Ängste allmählich, und sie begann, sich auf die bevorstehende Reise zu freuen. In den wenigen verbleibenden Wochen löste Rachel den Haushalt auf und verkaufte alles an Freunde und Nachbarn. Mit dem geringen Erlös erstand sie das Nötigste für die Reise. Feste Schuhe wurden angeschafft, Umhängetücher und für jeden ein neues Kleid, damit sie sauber und ordentlich wirken würden, wenn sie ihr Ziel erreicht hätten.
Beim Einkaufen machte Rachel die Bekanntschaft der Familie Hawley, die auf ähnliche Weise wie sie aus ihrer Heimat vertrieben wurde, und sie kamen überein, gemeinsam nach London zu gehen. Am Tag der Abreise waren Rachel und Jenny schon kurz nach Sonnenaufgang zum Aufbruch bereit. All ihre restliche Habe hatten sie zu ordentlichen Bündeln verschnürt. Am Tage vorher hatten sie sich überall verabschiedet, und nichts hielt sie mehr auf. Aber Rachel machte sich noch im Haus zu schaffen, bis Lord Braxtons Männer mit Äxten und schweren Hämmern erschienen, um mit dem Abriß des Hauses zu beginnen. Erst als sie dem gehaßten Ned Waite noch einmal abschätzig in die Augen gesehen hatte, faßte sie ihre Tochter an der Hand und verließ fluchtartig den Ort, der einmal ihr Zuhause gewesen war.
Als sie auf der Straße ein paar Meilen gewandert waren, trafen sie die Hawleys. Andrew, der einzige Sohn des Ehepaares, begrüßte sie zuerst. Er war ein hochaufgeschossener, kräftiger junger Mann, der gern und oft lachte, und seine Sanftheit strafte sein ruppiges Aussehen Lügen, was Jenny bald herausfand. Aber seine Erscheinung und seine offensichtliche Stärke beschützten die beiden Familien während der langen Reise vor allerlei Unbill, denn kein Strauchdieb verspürte Lust, sich mit so einem Bären von einem Mann anzulegen.
Obwohl er schon weit mehr als nur seinen Anteil an dem Gepäck trug, nahm er immer wieder einmal Jenny auf die Schultern und trug sie die letzten mühseligen Meilen, bevor sie eine Rast einlegten.
Die Hawleys besaßen nur wenig Geld, und Rachel, die selbst lieber weniger als mehr ausgab, erhob keinen Einspruch, als erwogen wurde, lieber unter freiem Himmel zu übernachten als eine Herberge zu suchen.
Als sie sich London näherten, wurde der Verkehr auf der Straße dichter. Die meisten Reisenden hatten ähnlich wie sie ihre Heimat verloren und wollten in London Arbeit suchen oder in die amerikanischen Kolonien auswandern. Da so viele unterwegs waren, wurde das Betteln um Nahrung immer schwieriger, und Andrew, der bislang keinerlei Zweifel gehegt hatte, eine gute Anstellung zu finden, wurde immer kleinlauter.
»Du wirst Arbeit finden, Andrew«, bestärkte Rachel ihn. »Ein kräftiger, anständiger Mann wie du — natürlich findest du was!«
Aber ihr eigener Mut sank, als die Frauen, die sie nur um Wasser baten, sie ärgerlich abwiesen. »Vielleicht sollten wir doch ein Schiff suchen, das uns über den Ozean bringt«, sagte sie vertraulich zu Jenny. »Wir sind jung und gesund, aber es scheint, als ob wir hier nicht erwünscht wären.«
Zu Jennys großer Erleichterung ließ sie diesen Plan aber fallen, als Andrew vorschlug, daß sie zusammenbleiben sollten, statt sich zu trennen, wenn sie die Stadt erreicht hätten. »Ich hab’ mich mit einem Mann aus London unterhalten, und er riet mir, es auf dem Fischmarkt in Billingsgate zu versuchen. Es sieht ganz so aus, als ob sie dort Träger brauchen, und er meinte, daß sie mich bei meiner Statur sofort nehmen würden. Wenn ich einigermaßen gut verdiene, dann werden Sie und Jenny nicht hungern müssen, das versprech’ ich Ihnen, Mistress Taggart.«
»Wir haben noch Ersparnisse«, antwortete Rachel dankbar. »Wenn wir zusammenbleiben, legen wir unser Geld zusammen.« Andrew war einverstanden. Er schwang Jenny auf seine breiten Schultern, jetzt wieder der glückliche, lachende Riese, den sie kennen und lieben gelernt hatte.
»Jenny und ich gehen zusammen. Sie hat versprochen, mich zu heiraten, wenn sie eine erwachsene Frau ist — das hast du doch, mein Schätzchen? Sag deiner Mama, daß du’s mir versprochen hast!«
Jenny klammerte sich an ihm fest, kicherte über die absurde Vorstellung und freute sich trotzdem darüber. »Ja, stimmt!« rief sie aus. »Ich heirate Andrew, wenn ich groß bin.«
»Da muß er sich noch ganz schön gedulden«, sagte Rachel schlicht, aber sie drückte Andrew dankbar die Hand.
So kamen sie, geschoben und gedrängelt von einer immer dichter werdenden Menschenmenge, langsam nach London hinein und erreichten den Fluß. Als sie die London Bridge überquerten, schaute Jenny neugierig in das schmutziggraue Wasser hinab und schrie beim Anblick dessen, was sie sah, entsetzt auf. Am Ufer festgemacht lagen verrottende, abgetakelte Schiffe. Gestank und Gezeter stieg aus ihnen auf.
»Mama!« rief sie aus. »Mama, was ist das? Können da Menschen drin sein, schreiende Menschen?«
Hinter ihr antwortete eine seltsam klingende Stimme: »Na klar sind da Kerle drin, Zuchthäusler, Tausende von Galgenvögeln.«
Jenny drehte sich um und sah, wie eine magere kleine Vogelscheuche von einem Mann in zerlumpten Kleidern sie mit hellen, vogelähnlichen Augen betrachtete. Rachel ging schneller, um ihn loszuwerden.
»Harns aber eilig, Maam! Ihr Mädel fragt mich was, ich antwort: Is das verkehrt?«
Rachel schämte sich und fragte: »Sagten Sie Zuchthäusler?«
»Woll, Maam«, bekräftigte der kleine Cockney. »Früher ab nach Amerika damit, um se loszusein. Bis die Siedler drüben sich beschwert ham. Jetzt wissen se nich, wohin damit, müssen ja irgendwo bleiben. Also stopfen se die Brüder in die Hulks da unten. Wenn se nich gehängt wern, nacher landen se da.«
»Ach so ... danke«, sagte Rachel. Sie nahm Jenny fest bei der Hand, ging schneller und hoffte, ihn abschütteln zu können, aber der komische kleine Kerl paßte seinen hinkenden Schritt dem ihren an.
»Sind se allein unterwegs, Sie und das Mädel?« fragte er.
»Nein, natürlich nicht.« Ein Stück weit vor ihnen konnte Rachel Andrews hohe Gestalt in der Menge ausmachen. Er nahm bestimmt an, daß Jenny und sie direkt hinter ihm folgten. Wenn sie die Hawleys jetzt aus den Augen verlöre, könnte sie sie nicht mehr finden, besonders, da es jetzt bald dunkel wurde. Sie versuchte, schneller voranzukommen, aber die Menge hinderte sie immer wieder daran.
»Is ja gut, ich seh’ Ihre Leut«, beschwichtigte der kleine Cockney. »Wo machen Se denn hin?«
»Zum Billingsgate Markt«, antwortete Rachel.
»Wolin malochen, was? Na, da gibt’s was. Und Sie, wolln Se auch, Mrs ...«
»Mistress Taggart.«
»Und ich heiß Watt Sparrow, zu Ihren Diensten!«
»Und ich bin Jenny, Mister Sparrow«, sagte Jenny freiwillig. Sie konnte diesen komischen Vogel gut leiden.
»Das is mal ’n echt schöner Name«, sagte Watt Sparrow. Er nahm Rachel die Gepäckbündel ab, bevor sie dagegen protestieren konnte, und als sie es dann doch noch tat, schüttelte er vorwurfsvoll seinen Kopf. »Ich versuch’ Ihnen doch nur zu helfen. Sie sind vom Land, kennen sich hier nich aus. Warum soll der alte Sparrow Ihnen nich ’n Weg nach Billingsgate zeigen dürfen?«
»Ja, da wollen unsre Freunde hin. Wie gesagt, wir sind zusammen unterwegs.«
»Das war mal so. Jetzt sind se weg.«
Als Rachel voller Panik nach ihnen Ausschau hielt, merkte sie, daß er recht hatte. Von Andrew Hawley war weit und breit nichts zu sehen, und wenn der kleine Mann sie nicht führte, hätte sie keine Ahnung, in welche Richtung es weiterging.
»Wieviel — wieviel verlangen Sie, um meine Freunde zu finden?« fragte sie unsicher.
»Nehm doch kein Penny von Ihnen, schöne Frau!« meinte Sparrow listig. »Los dann! Folgen Sie mir!«
Rachel versuchte ihr Bestes, aber da Jenny an ihr hing und die Menge sie immer wieder zum Anhalten zwang, gelang es ihr nicht. Eine Zeitlang konnte sie ihn noch sehen, aber dann verlor sie ihn genauso aus den Augen wie Andrew Hawley. Sie zögerte selbst jetzt noch zu glauben, daß sie einem Spitzbuben aufgesessen war. Jenny flüsterte ängstlich: »Mama, er ist weg!«
Rachel versuchte, das Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken. »Und er hat unsere Bündel ... die neuen Kleider. Aber wenigstens hat er meine Geldbörse nicht.« Der kleine Lederbeutel mit den verbliebenen Münzen hing ihr an einer Schnur befestigt um den Hals. Sie hatte ihn in den Ausschnitt ihres Kleides geschoben. Aber als sie jetzt danach fischte, kam nur die sauber abgetrennte Schnur zum Vorschein ... Sie hatte von dem Diebstahl nichts bemerkt. Es mußte Watt Sparrow gewesen sein.
Jenny streichelte ihre Hand. »Aber mein Bündel hat er nicht«, sagte sie tröstend. »Da ist mein Hut drin, der von Papa, und mein Umhängetuch«. Sie zog einen kleinen Geldbeutel heraus. »Und auch der Sixpence, den mir der alte Pastor beim Abschied geschenkt hat. Davon können wir ja was zum Essen kaufen.«
Rachel umarmte sie. »Das machen wir«, stimmte sie zu. »Aber ich fürchte, für ein Bett reicht es nicht. Wir müssen wieder im Freien schlafen.«
Sie kauften zwei Brötchen. Und als der gröbste Hunger gestillt war, legten sie sich in die Toreinfahrt eines verlassenen Hauses, wickelten sich in Jennys Umhängetuch und fielen erschöpft in Schlaf.
3
Eine durchdringende Stimme weckte sie auf. Instinktiv drückte Rachel Jenny an sich. Es war noch dunkel, und beim Licht einer Fackel, die ein Negerjunge trug, starrte sie die seltsamste Erscheinung an, die sie jemals gesehen hatte.
Die schreiende Person war, wie Rachel annahm, eine Frau, aber so groß und irgendwie gestaltlos, daß sie ihr wie eine Erscheinung vorkam. Ihre Kleidung war zwar elegant, aber verschmutzt, der Brokatrock war an ein paar Stellen zerrissen.
»Wer — wer sind Sie?« stieß Rachel hervor und setzte sich auf. »Was wollen Sie?«
Die alte Vettel antwortete nicht, sondern stieß statt dessen mit ihrem Schuh nach Jenny und bat sie aufzustehen, damit sie sie betrachten könne.
Jenny gehorchte, und Rachel sprang auf, um sie zu beschützen.
Sie rief: »Lassen Sie meine Tochter in Ruhe! Nicht anfassen, verstanden?«
»Ein reizloses kleines Ding«, meinte die Frau. Eine knochige, klauenartige Hand faßte nach Jennys Haar und drehte ihr Gesicht ins flackernde Licht der Fackel. »Aber sie ist gut gewachsen. Wir könnten was aus ihr machen. Ist sie eine Jungfrau?«
Rachel war außer sich. Sie pflanzte ihren eigenen, wohlgeformten Körper vor Jenny auf.
»Wir sind anständige Leute«, erklärte sie stolz. »Lassen Sie uns in Ruhe.«
Als die alte Frau ihren Yorkshire-Dialekt hörte, entspannte sich ihr verlebtes Gesicht, und sie brachte so etwas wie ein Lächeln zustande. »Sie sind vom Land?«
»Ja. Wir sind erst heute in London angekommen. Und hatten keine Unterkunft. Wir —«
»Und auch kein Geld, stimmt’s?«
»Das wurde uns gestohlen. Ein gräßlicher, humpelnder Kerl ließ mir keine Ruhe, bis ich ihn unsre Bündel tragen ließ, und dann haute er ab damit.«
»London ist ein Diebesnest«, meinte die Alte gleichgültig. Sie betrachtete Rachel prüfend von oben bis unten. »Ich komme auch vom Land, das hätten Sie nie gedacht, oder? Ist ja auch schon lang her, da war ich so klein wie die da.« Sie deutete auf Jenny. »Sie suchen Arbeit, stimmt’s?«
»Ja«, gab Rachel zu. Ihre Ängste hatten sich inzwischen gelegt. Die Alte war zwar gräßlich, aber sie war doch freundlich zu ihnen.
»Ich könnte vielleicht was für Sie tun. Hier ziehen sie zwar junge Mädchen vor, aber in Holborn würden Sie genug Kunden finden ... und ich würde für das Kind sorgen. Und Sie hätten ein Dach überm Kopf, bis Sie richtig im Geschäft sind.«
Als die seltsame Frau einen kleinen Imbiß vorschlug, willigte Rachel sogleich ein. Die Nacht auf dem harten Kopfsteinpflaster war kalt gewesen.
»Dann aber los«, drängte ihre neue Begleiterin. »Es ist noch was vom Abendessen übrig, und wir finden bestimmt einen guten Tropfen, um Sie aufzuwärmen.«
Sie ging los und stützte sich mit einer Hand auf die Schulter des Negerjungen. Jenny hielt Rachel zurück. »Ich mag sie nicht«, flüsterte sie.
»Aber sie hat uns was zu essen versprochen, und vielleicht können wir in ihrem Haus schlafen.«
»Ich bin wirklich hungrig«, gab Jenny zu.
»Ich auch. Und weißt du, wenn’s hell ist, können wir immer noch losgehn und die Hawleys suchen.«
Das Gebäude, in das die alte Frau sie führte, war weniger ein Wohnhaus als vielmehr eine Lagerhalle, aber es war warm dort und, zu Rachels Überraschung, auch einigermaßen sauber. Ein paar Möbelstücke standen herum, in einigen der Betten lagen zugedeckte schlafende Gestalten. Die meisten Betten waren leer. Auf den herrischen Ruf der Alten hin erhob sich nur ein dürres, pockennarbiges Mädchen.
»Wir haben neue Gäste, Patty, setz ihnen was zu essen vor.«
Das Mädchen gehorchte mürrisch und schweigsam, aber das Essen, das sie auf einem angeschlagenen Teller brachte, sah gut und appetitlich aus. Da sie kein Besteck hatte, um das kalte Fleisch kleinzuschneiden, riß sie es mit den Fingern auseinander und reichte es Jenny auf einer Scheibe frisch gebackenem Brot. Das Kind fiel ausgehungert darüber her, und die merkwürdige Gastgeberin lachte.
»Das kannst du gut vertragen, stimmt’s? Lang nur zu, Kleine. Es ist genug da.« Sie nahm eine Flasche vom Bord, füllte ein Glas und reichte es Rachel. »Da, trinken Sie das, das wärmt sie auf. Wie heißen Sie noch mal? Sollte ich besser wissen, wenn Sie zu unserer glücklichen Truppe gehören wollen.«
Rachel stellte sich noch einmal vor, trank vorsichtig einen Schluck und hustete los, als ihr der starke Alkohol in der Kehle brannte.
»Nur zu, runter damit!« drängte die Alte. »Macht nichts, wenn Sie’s nicht gewöhnt sind. Wird Ihnen guttun. Gin ist die beste Arznei, die’s überhaupt gibt.«
Ängstlich, ihre Wohltäterin zu verärgern, leerte Rachel mit Todesverachtung das ganze Glas. Aber die Wirkung war wunderbar. Sie fühlte sich warm, fast zum erstenmal, seit sie ihr Zuhause verlassen hatten, und schaute hoffnungsvoller in die Zukunft. »Sie sind so freundlich zu uns«, sagte sie dankbar. »Ich werde versuchen, Ihnen alles zurückzuzahlen. Wenn Sie eine Stelle — eine Stelle für mich finden, dann arbeite ich hart — ganz hart —« Sie schwankte.
Die Alte stand auf, packte Rachel fest am Arm und führte sie zu einem der freien Betten am anderen Ende des langen Raumes. Sie wünschte Jenny eine gute Nacht und wandte sich mit plötzlich harter Stimme an Rachel. »Und über Ihre Stelle unterhalten wir uns morgen.«
Kurz nach Tagesanbruch rüttelte Jenny ihre Mutter wach. Sie flüsterte zitternd: »Mama, schau mal da!«
Rachel stützte sich, noch leicht benebelt, auf einen Ellenbogen auf und sah, wie eine lange Schlange weiblicher Wesen langsam auf die alte Frau zuging, die wie eine Königin in ihrem Sessel thronte. Daneben stand ein Tisch, auf dem Münzen lagen. Immer mehr Münzen häuften sich auf. Die Alte zählte sie, schrieb etwas in ein Büchlein auf und legte dann widerwillig ein oder zwei Geldstücke in die ausgestreckte Hand zurück.
Viele der Mädchen waren erst zwischen acht und vierzehn Jahre alt, aber ihre Gesichter waren wie die ihrer Mütter grell geschminkt, die geduldig dabeistanden und abwarteten, bis die Reihe an sie käme. Alle waren seltsam elegant gekleidet, aber — wie die Alte auch — schmutzig und abgerissen, und die Kinder starrten todmüde und mit verschlossenem Gesichtsausdruck vor sich hin.
Rachel fühlte, wie ihr das Blut in den Adern fror. Mrs. Hawley hatte ihr zwar von Kinderprostitution in London erzählt, aber bis jetzt hatte sie das als ein halbes Märchen abgetan. Nun sah sie ihren Irrtum ein ... was für eine Närrin war sie doch gewesen, anzunehmen, daß eine Frau wie Mrs. Morgan Jenny und ihr aus reiner Freundlichkeit in der fremden Stadt helfen wollte! Konnte sie es wagen, einfach wegzugehen, wo sie doch das Entgelt für eine Übernachtung, das Essen und ... den Gin schuldete?
Die pockennarbige Patty, mit der sie noch am Vorabend bekannt gemacht worden war, näherte sich und sagte: »Ich hab’ Se beobachtet. Wußten wohl nich, wo Se hier gelandet sind, was, Missus Taggart?«
Rachel fuhr entsetzt zusammen. »Nein, nein, das schwör ich dir. Wir müssen hier weg —«
»Warten Se noch«, sagte das Mädchen. »Sie darf Se nich sehn. Wenn ich ihr die heiße Schokolade bring’, gieß’ ich ihr die Tasse auf ’n Schoß, und dann rennen Se los, wenn se grad nicht schaut. Aber gehn Se weit weg und kommen Se nie mehr hierher, sonst setzt’s was.«
»Aber du könntest Schwierigkeiten kriegen. Sie weiß bestimmt, daß du uns geholfen hast«, meinte Rachel. »Und —«
Patty schüttelte den Kopf. »Weiß se nich. Se glaubt, ich bin tolpatschig, und das bin ich auch, mit ihr. Und ich hab’ sowieso immer Ärger, also macht’s nix.«
»Warum bleibst du bei ihr? Warum, Patty?« Das Mädchen lachte. »Mei Mama hat mich ihr verscherbelt, als ich sieben war. Und sie zahlt gut. Ich krieg dreimal am Tag zu essen und muß nich auf den Strich. Zu häßlich, meint se. Kein schlechtes Leben, wenn man’s gewöhnt is!«
Ihre vertraulichen Mitteilungen wurden durch einen Ruf ihrer Herrin unterbrochen. »Se will ihre heiße Schokolade ... Gleich wenn se aufschreit, rennt los, aber schnell!«
Sie entkamen auf die Weise, wie es geplant gewesen war. Rachel und Jenny rannten, ohne zu wissen, wohin, durch ein Gewirr von Straßen, mit dem einzigen Ziel, sich so weit wie möglich von dem Haus zu entfernen, in dem sie die Nacht verbracht hatten. Schließlich blieben sie atemlos am Rand eines großen Marktplatzes stehen. Jenny zog die Nase wegen des merkwürdigen Geruches hoch und meinte: »Mama, ich glaub’, wir sind da. Das muß der Billingsgate Markt sein ... schau mal da drüben, die Männer tragen Fischkörbe auf dem Kopf!« Und wirklich, dort lief eine lange Reihe schwerbeladener Fischträger fast im Dauerlauf zwischen den Marktständen entlang.
»Vielleicht ist Andrew unter ihnen«, rief Jenny aus und tanzte vor freudiger Erwartung von einem Fuß auf den anderen. »Er ist ja so groß, da müssen wir ihn einfach sehn, Mama!«
»Ja, das stimmt«, sagte Rachel voller Hoffnung.
Aber weder ihre stundenlange Suche noch ihr eifriges Herumfragen führten zu irgendeiner Spur, wo sich die Hawleys aufhalten könnten. Schließlich wurden die Fischstandbesitzer ungeduldig und forderten sie barsch auf, sich endlich zu verziehen. Es wurde langsam dunkel. Sie waren müde und hungrig. Rachel war der Verzweiflung nahe, und Jenny weinte. Ein weißhaariger Obsthändler schenkte dem kleinen Mädchen eine Handvoll Früchte, die Druckstellen hatten. Als es dunkel wurde, gingen die beiden fort, aßen die Früchte und legten sich in irgendeiner geschützten Ecke auf den Pflastersteinen zum Schlafen hin. Am nächsten Morgen regnete es, und ihre Kleider waren durchnäßt. Sie setzten ihre Suche nach den Hawleys fort, und Rachel fragte ohne Erfolg nach Arbeit auf dem Fischmarkt. Der freundliche Obsthändler legte die Früchte, die er nicht mehr verkaufen konnte, ein paar bettelnden Kindern in die Hand, und hatte für Jenny nur noch zwei angefaulte Äpfel übrig, als sie sich schüchtern an ihn wandte. Als er die bittere Enttäuschung in ihren Augen sah, drückte er ihr einen Penny in die Hand.
Sie bedankte sich höflich, und er schüttelte traurig den Kopf. »Ihr seid vom Land, stimmt’s?« fragte er. »Hört auf meinen Rat und geht wieder zurück. London ist der falsche Platz für Leute wie euch.«
Als Jenny mit Rachel das Brot aß, das sie für den Penny gekauft hatten, drängte sie: »Können wir nicht zurück? Es ist so schrecklich hier!«
»Wir geben uns noch ein paar Tage Zeit, mein Schatz«, sagte Rachel tröstend. »Morgen such’ ich Arbeit als Dienstmagd in einem anständigen Viertel, wie ich es ursprünglich vorgehabt hatte.«
Als sie sich unter einem vorspringenden Dach zur Nachtruhe niederließen, tauchte eine alte Vettel auf und erhob keifend Anspruch auf diesen Platz. Aber Rachel wehrte sich verzweifelt, und die Alte mußte abziehen. Rachel schlief erschöpft ein und wachte erst von den entsetzten Schreien Jennys auf, die von der rachsüchtigen Alten aus den Armen ihrer Mutter gezerrt wurde. Rachel schlug mit all ihrer Kraft auf die zähe Alte ein und konnte sie schließlich vertreiben. Aber sie hatte Jennys Umhängetuch in dem Kampf ergattert.
Am nächsten Tag klopften sie sich so gut wie möglich den Staub von den Kleidern. Aber Rachels Suche nach Arbeit blieb genauso erfolglos wie die Suche nach den Hawleys. Sie sprach tapfer bei anständig aussehenden Häusern vor. Meistens konnte sie ihre Bitte um Arbeit nicht einmal äußern, sondern wurde von den Dienstboten gleich verjagt. Schließlich schleppte sich Rachel am Ende ihrer Kraft in einen Bäckerladen und legte die beiden letzten Pennys auf die Theke.
»Bitte — bitte, geben Sie uns so viel wie möglich dafür.«
Die Bäckerin, eine stämmige, rotbackige Frau mit schneeweißer Schürze, schaute sie kurz an und fragte dann leise: »Sind Sie aus Yorkshire?«
»Jawoll«, antwortete sie in ihrem heimatlichen Dialekt, »stimmt genau!«
»Und wenn ich’s recht versteh’, wünschten Sie, Sie wären wieder dort ... genau wie ich.« Die Frau unterdrückte einen Seufzer und setzte zum Weitersprechen an, aber ihr Mann kam, ganz mit Mehl bestäubt, aus der Backstube herein.
»Das ist das letzte Blech«, sagte er. »Ich wett’, wir verkaufen alles, wenn die Leut’ vom Spektakel zurückkommen. Toll, was das für’n Hunger macht, wenn man zuschaut, wie einer gehängt wird!« Er bemerkte Rachel und fragte mißtrauisch: »Schon wieder Bettler, Frau? Und du steckst ihnen was zu?«
Seine Frau schüttelte den Kopf. »Alles schon bezahlt«, sagte sie, nahm zwei Fleischpasteten vom Bord, einen Laib Brot und zwei kleine Apfelkuchen und wickelte alles ein.
Als Rachel sich bedanken wollte, legte sie einen Finger auf die Lippen. Der Mann knurrte etwas und ging zurück in die Backstube.
»Er meint es nicht so! Er wollte lieber dem Hängen zuschaun, als am heißen Ofen stehn ... aber wie er schon sagte, läuft das Geschäft danach so gut, und heut’ mußten sogar zwei Galgenvögel dran glauben.« Ein ungeduldiger Ruf ihres Mannes unterbrach sie. »Er will sein Essen«, entschuldigte sie sich. »Ich muß den Laden zuschließen.«
Wieder auf der Straße, suchte Rachel nach einem ruhigen Platz, wo sie wenigstens einen Teil der Backwaren zu sich nehmen konnten, die ihnen die Bäckersfrau so großzügig geschenkt hatte. Sie ließen sich auf einer Treppe nieder und machten sich heißhungrig darüber her. Gleichzeitig konnten sie die Menschenmenge überblicken, die jetzt von dem Spektakel zurückströmte.
»Mama, schau — da, wo die Leute sich vor dem Bäckerladen drängeln!« rief Jenny erregt. »Da ist Sparrow, er ist’s! ... und er klaut! Eben hat er einem Mann die Uhr aus der Tasche gezogen!«
Das Kind hatte recht. Der kleine Mann humpelte zwischen den Leuten herum und blieb nirgends länger stehn, als seine langen Finger für ihre Arbeit brauchten. Ein mieser Taschendieb, das war er, dachte Rachel angewidert.
»Ja, Jenny. Wir verfolgen ihn, und dann —« Sie biß sich auf die Lippen. Was sollten sie tun? Es mit Bitten versuchen, oder ihn geradeheraus des Diebstahls bezichtigen?
Sie sprangen auf und folgten ihm. Am Ende der schmalen Straße verschwand er in einem Wirtshaus. Rachel zögerte, der Mut verließ sie, aber Jenny trieb sie an. »Da drin kann er nicht weglaufen, Mama! Komm, wir gehn rein!«
Mit einem mulmigen Gefühl stieß Rachel die Tür zum Wirtshaus auf. In der Schankstube war es dunkel. Nur eine Kerze brannte an der Theke, hinter der eine gutaussehende Frau unbestimmten Alters stand und an einer Tonpfeife zog. Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah Rachel den Taschendieb ganz hinten im Raum an einem Tisch sitzen. Er hatte eine Sammlung kleiner Gegenstände vor sich ausgebreitet — die Beute vom Vormittag. Das Gesicht des Mannes, dem er das Diebesgut anzubieten schien, lag im Schatten.
Rachel konnte nur eine schwere goldene Uhrkette erkennen, die über die Brokatweste gespannt war. Sie nahm all ihren Mut zusammen, trat an den Tisch und brachte ihre Anschuldigung mit lauter Stimme hervor. Sparrow drehte sich um, schaute sie verdutzt an und lächelte dann, als er Jenny erkannte.
»Na so was, wenn das nich Misses Taggart is ... und Jenny! Das is ja ’ne Überraschung ... kann ich behilflich sein, Madam?«
Die Unverschämtheit dieser Frage machte Rachel blind vor Wut. Sie schrie fast: »Sie haben ausgenutzt, daß wir fremd hier sind, und all unsre Habe gestohlen! Und diese Uhr auch, erst vor ein paar Minuten, wir haben es gesehn!«
»Nun, nun, Misses Taggart«, beruhigte sie der Mann mit der Brokatweste mit freundlicher Stimme. »Etwas leiser, wenn ich bitten darf! Die Wände haben Ohren!« Sparrows Begleiter beugte sich vor, und sie sah zum erstenmal sein Gesicht. Es war glatt rasiert und fast engelhaft schön. Der Mann schaute sie mit freundlichen braunen Augen und offensichtlicher Sympathie an. »Ist das wahr, Sparrow«, fragte er den Taschendieb. »Hast du wirklich diese arme Frau und ihr Kind ausgeraubt?«
Sparrow verzog sein Gesicht, nickte aber schließlich. »Na ja, nur so, aus alter Gewohnheit ...«
Ein unförmiger Kerl mit einem Lederschurz legte dem kleinen Cockney seine Pratze auf die Schulter. »Ich denk’, du nimmst nur reiche Säcke aus«, grunzte er. »Aber wenn de dich an arme Kirchenmäuse ranmachst, dann kannste an meiner Faust riechen!«
Sparrows Begleiter schaltete sich ein. »Das klären wir schon«, meinte er friedlich. Er forderte Rachel auf, sich neben ihn zu setzen, und bestellte bei der Wirtin ein Glas Porterbier für sie. »Und Milch — ja, ein Glas Milch für das kleine Mädchen.« Rachels Wut ließ nach. Sie ließ das Porterbier unberührt vor sich stehen und saß schweigend da.
»Ich bin Dr. Fry«, stellte sich ihr Nachbar vor, der eine gepuderte Perücke trug. »Watt Sparrow wird sein Unrecht wiedergutmachen. Stimmt’s, Sparrow?«
»Wenn Sie meinen«, grunzte Sparrow. »Ihre Fähnchen können se eh wieder ham, die sind noch bei mir.«
»Und das Geld?«
»Hatten ja nur ’n paar Kröten. Nicht der Rede wert. Und —«, fügte er an.
»In meinem Geldbeutel waren fünfzehn Schilling«, unterbrach ihn Rachel.
»Stimmt das, Sparrow?« fragte ihn Dr. Fry streng.
»Na ja, wird schon so sein«, gab er zu. »Hab’s aber nich, außer, Sie kaufen mir die Silberuhr da ab.«
Dr. Fry nahm sie mit seinen dicklichen, gepflegten Händen hoch, schaute ins Uhrwerk, horchte daran und steckte sie dann in seine Tasche.
»Sehr gut«, sagte er. »Fünfzig Schilling. Aber die Hälfte bekommt Mistress Taggart!« Er schob jedem die Hälfte zu. »Aber jetzt los, und bring Mistress Taggarts Kleider her! Und nicht herumtrödeln, verstanden?«
Zu Rachels Überraschung stand der kleine Cockney ohne zu murren auf und verschwand. Ein Mann mit einem Buckel trat an den Tisch und reichte Jenny ein Glas Milch. »Mit schönem Gruß von der Kuh«, sagte er lächelnd und humpelte zur Theke zurück.
Dr. Fry warf Rachel und Jenny einen prüfenden Blick zu. Unaufgefordert erzählte Rachel ihm ihre bisherigen Erlebnisse. Dr. Fry nickte mitfühlend und sagte dann: »Und jetzt suchen Sie eine Anstellung, aber eine andere, als diese — diese Mistress Morgan Ihnen zu bieten hatte? Darf ich fragen, was Sie sich vorstellen?«
Rachel errötete. »Egal was, Sir, solang es respektabel und ehrlich dabei zugeht. Ich kann hart arbeiten. Ich wünsch’ mir Arbeit in einem Haushalt, wo ich und die Kleine auch wohnen können —«
»— um sie vor den Gefahren Londons zu schützen«, vollendete Dr. Fry ihren Satz. »Ein ehrbarer Wunsch. Ich hoffe, ich kann Ihnen behilflich sein —« Er rief nach der Wirtin.
Sie legte ihre Pfeife hin und kam an den Tisch. Sie hatte rötliches Haar und eine stattliche Figur. Als junges Mädchen hatte sie bestimmt gut ausgesehen.
»Ja, Doktor?« fragte sie kurz, aber freundlich und blickte Dr. Fry aufmerksam ins Gesicht.
»Das ist Doll Prunty, die Besitzerin von diesem Wirtshaus. Ihren Mann Nick haben Sie schon gesehn, er hat Jenny die Milch gebracht.« Er deutete zum Buckligen hinüber. »Und das ist Rachel Taggart, Doll — und die kleine Jenny. Mistress Taggart möchte im Haushalt arbeiten. Sie ist nach eigener Aussage eine ehrliche Frau vom Land und an harte Arbeit gewöhnt. Dafür möchte sie für sich und das Kind Kost und Logis, und, wie ich annehme, einen bescheidenen Lohn. Können Sie sie vielleicht brauchen?«
Mrs. Prunty ließ es sich durch den Kopf gehen. Sie stellte Rachel ein paar Fragen, unter anderem, welchen Lohn sie erwarte. Dann fragte sie Jenny: »Und du willst deiner Mama helfen, Schätzchen?«
Jenny machte einen Knicks, wie immer, wenn sie von Erwachsenen angesprochen wurde. »O ja, gern, Madam«, antwortete sie eifrig, »wenn Sie mich brauchen können.«
Der Knicks und die rasche Antwort vertrieben Doll Pruntys leichte Unschlüssigkeit. »Also abgemacht«, entschied sie kurz. »Sie können gleich morgen früh anfangen, und heut abend bekommen Sie schon was zu essen und ein Zimmer. — Es ist harte Arbeit«, sagte sie abschließend, »aber immer noch besser, als auf der Straße zu sitzen.« Sie eilte zur Theke zurück, wo lauthals nach Gin verlangt wurde.
Rachel bedankte sich mit feuchten Augen bei Dr. Fry, aber der untersetzte Mann stand auf und unterbrach sie. »Nichts zu danken! Ich bin froh, daß ich Ihnen und der Kleinen helfen konnte. Aber jetzt —« Er zog die gestohlene Uhr heraus, warf einen Blick darauf und schnalzte vor Ärger mit der Zunge, als er bemerkte, daß sie stehengeblieben war. »So ein Spitzbube! Aber ich bin sicher, daß er Ihnen die Kleider zurückbringt. Wenn nicht, knöpf ich ihn mir vor!« Er verabschiedete sich von Rachel und Jenny und verließ mit gemessenen Schritten das Lokal.
Doll Prunty kicherte trocken. »Tritt ganz schön herrschaftlich auf! Bei dem Beruf ...«
Rachel verstand gar nichts mehr. »Aber ist er denn kein Arzt, Missus Prunty? Sagte er nicht, er heiße Doktor Fry?«
»Ist sie nicht süß? — Er war mal einer, vor langer Zeit. Dann kam er mit dem Arzneimittelgesetz in Konflikt, und es wurde ihm die Lizenz entzogen. Jetzt ist er einer der größten Hehler von London.«
Rachel und Jenny starrten sie verständnislos an. Jenny fragte: »Mama, was ist das, ein Hehler?«
Doll Prunty brach in schallendes Gelächter aus. »Oje, ihr seid mir vielleicht zwei Unschuldslämmer! Ich seh’ schon, ich muß euch noch das eine oder andere beibringen ... aber wir brauchen nicht gleich heut abend damit anzufangen. Geht in die Küche und eßt, und dann zeig’ ich euch das Zimmer!«
Sie gehorchten dankbar. Es war das erste Mal, seit sie ihre Heimat verlassen hatten, daß sie ein sicheres Dach über dem Kopf hatten.
4
Rachel gewöhnte sich schnell an ihr neues Leben. Doch als sie in der dunklen Küche kochte, Böden schrubbte und die Gäste in der Wirtschaft bediente, wurde sie oft von Heimweh geplagt und wünschte sich sehnlichst, nach Yorkshire zurückkehren zu können.
Doch es gab auch ein paar Lichtblicke. Doll war eine harte Frau, die die Wirtschaft mit großer Strenge führte und nur wenigen ihre Freundschaft schenkte. Aber schon nach wenigen Wochen brachte sie ihre Zuneigung zu Jenny, ihr Mädchen für alles, sehr deutlich zum Ausdruck.
Rachel hatte von vornherein klargemacht, daß sie im Gegensatz zu den Dirnen, die unter den Gästen nach Kunden suchten, eine anständige Frau war. Und trotzdem war es immer wieder schwer, die plumpen Annäherungsversuche der angetrunkenen Männer abzuwehren.
Die Wirtschaft war ein regelmäßiger Treffpunkt für Diebe, Zuhälter und Hehler, und das erste, was Rachel von Doll lernte, war nichts von alledem zu sehen und zu hören, was um sie herum vorging. Rachel lernte aber auch, daß es einen Ehrenkodex unter den Dieben gab und strenge Verhaltensweisen, denen sich alle unterwarfen.