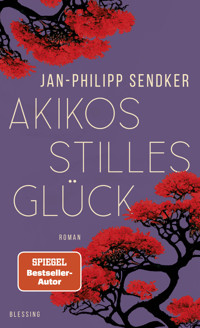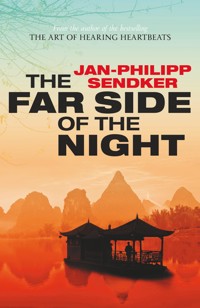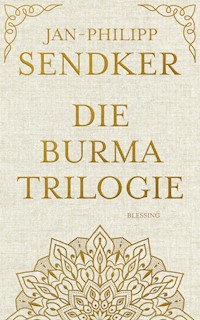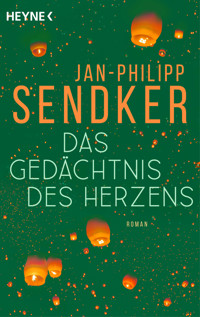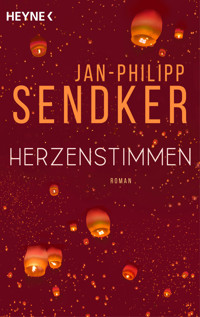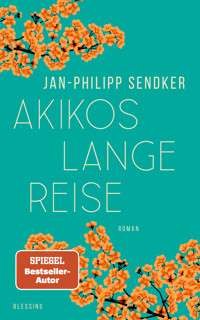
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Japan-Reihe
- Sprache: Deutsch
Über Einsamkeit, den Wunsch nach Selbstbestimmung und den Mut, sein Leben zu verändern
Akiko hat sich getraut, wovon andere in ihrer Firma kaum zu träumen wagen: Ihren sicheren und gut bezahlten Job zu kündigen. Seitdem ist sie frei - und erst einmal orientierungslos. Ihr einziger Freund, der Hikikomori Kento, ist zu sehr mit sich und seinen Ängsten beschäftigt, um ihr eine große Hilfe zu sein. Akiko macht sich allein auf die Suche nach ihrem Vater, der die Familie kurz nach ihrer Geburt verließ. Sie reist in das ländliche Japan, weit weg von der pulsierenden Großstadt Tokio. Hier lebt der Mann, den ihre verstorbene Mutter einst geliebt hat. Als Akiko vor ihm steht, erwartet sie zunächst eine bittere Enttäuschung: Nichts ist wie erhofft. Doch dann nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. Akikos Reise ist lang und voller Umwege, doch mit jedem Schritt, jeder neuen Herausforderung entdeckt sie etwas mehr von der Kraft, die in ihr steckt.
Ein kraftvoller Roman über eine Reise zu den eigenen Wurzeln, über Einsamkeit, Liebe und das stille Glück vom Autor des Weltbestseller Das Herzenhören.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Autor
Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre Amerika- und Asienkorrespondent des Stern. Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung Risse in der Großen Mauer. Nach dem Roman-Bestseller Das Herzenhören (2002) folgten Das Flüstern der Schatten (2007), Drachenspiele (2009), Herzenstimmen (2012), Am anderen Ende der Nacht (2016), Das Geheimnis des alten Mönches (2017), Das Gedächtnis des Herzens (2019), Die Rebellin und der Dieb (2021) und Akikos stilles Glück (2024). Seine Romane sind in mehr als 35 Sprachen übersetzt. Mit weltweit über 4 Millionen verkauften Büchern ist er einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren.
Das Buch
Stumm standen wir uns gegenüber. Mein Herz schlug heftig, ich spürte das Pochen bis in den Hals. Er machte keine Anstalten, etwas zu sagen oder mich hineinzubitten.
»Hallo«, sagte ich.
Er schwieg weiter. Ein leichter Wind fuhr durch das vertrocknete Gras und ließ es rascheln.
»Ich bin es: Akiko.«
Er presste die Lippen zusammen und zog seine schwarzen Augenbrauen hoch. »Akiko.«
»Ja.«
Der Mann, von dem ich glaubte, dass er mein Vater war, atmete tief ein und aus und gab ein lautes Stöhnen von sich. Dabei vermied er es, mich anzuschauen, sein Blick glitt über den Hof, als suche er etwas. »Akiko«, wiederholte er noch einmal, dabei jede Silbe betonend. »Was machst du hier?«
Akiko macht sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater – doch als sie vor ihm steht, erwartet sie eine bittere Enttäuschung: Nichts ist wie erhofft. Dann aber nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. Akikos Reise ist lang und voller Umwege, doch mit jedem Schritt, jeder neuen Herausforderung entdeckt sie etwas mehr von der Kraft, die in ihr steckt.
Ein gefühlvoller Roman über eine Reise zu den eigenen Wurzeln, über Einsamkeit, Liebe und das stille Glück.
JAN-PHILIPP SENDKER
AKIKOS
LANGE
REISE
Roman
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Jan-Philipp Sendker
Copyright © 2025 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: t. mutzenbach design, München
Umschlagabbildung: © shutterstock/alphabet
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30533-8V001
www.blessing-verlag.de
Für Theresa
Es war eine tiefe Dankbarkeit, die ich empfand.
Und ein stilles Glück.
Wir waren im Zug auf dem Rückweg nach Shimokitazawa, mit beiden Armen umklammerte ich den leeren Rucksack auf meinem Schoß. Noch vor wenigen Stunden hatte darin die Urne mit der Asche meiner Mutter gelegen.
Kento saß neben mir, schweigend schaute er aus dem gegenüberliegenden Fenster. An uns vorbei glitten die grauen Dächer von Tokios Vorstädten. Es war Sonntagvormittag, an jeder Station stiegen einige Fahrgäste zu, Kentos rechtes Bein begann zu wippen, erst ein wenig, dann heftiger, bis es sich plötzlich wieder beruhigte.
In den vergangenen Stunden hatten wir kaum ein Wort gewechselt, er hatte so gut wie nichts gesagt und auch nichts gefragt. Er war einfach für mich da gewesen. Ohne ihn hätte ich nicht die Kraft gehabt, die Asche meiner Mutter dem Pazifik zu übergeben. Nicht den Mut. Ohne ihn hätte ich die Urne vermutlich irgendwann wieder eingepackt und mit nach Hause genommen.
Mein leises »Danke« hatte er am Strand mit einem Nicken zur Kenntnis genommen. Ich hätte ihm gern gesagt, wie sehr er mir half, wie ich es zu schätzen wusste, dass er für mich an diesem Morgen seine Menschenscheu überwand, wie froh ich darüber war, fand aber nicht die richtigen Worte.
Mich überkam eine lähmende Müdigkeit. Mein Körper wurde schwerer, die Schultern sanken hinab, meinen Kopf konnte ich kaum noch halten, er neigte sich langsam zur Seite und fiel gegen Kentos Oberarm.
Sofort richtete ich mich auf.
Es dauerte nicht lange, und mein Kopf sackte nach vorn.
Sekunden später lehnte er wieder an Kentos Schulter.
Als gehöre er dorthin.
Mir fehlte die Kraft, ihn zu heben, und da ich von Kento kein Zeichen bekam, dass ihm die Berührung zu viel oder unangenehm war, blieb ich, an seine Schulter gelehnt, sitzen.
Es war das erste Mal, dass wir uns für mehr als ein paar flüchtige Sekunden berührten.
Mein Körper entspannte sich. Mir fielen die Augen zu.
Meine Gedanken flatterten wie ein aufgeschreckter Vogel, sie wollten sich nicht niederlassen, weder in der Welt der Wachen noch in der des Halbschlafs.
Das gleichmäßige Rattern der Schienen, die sich öffnenden und schließenden Türen an den Haltestellen, die Ansagen aus den Lautsprechern mischten sich mit dem Rauschen des Meeres, den sich brechenden Wellen am Strand von Tsujido, alles drang aus einer zunehmend größeren Entfernung zu mir …
Ich erwachte.
Ich nickte ein.
Ich erwachte.
Es war ein Tag des Abschieds.
Gleichzeitig könnte es der Beginn von etwas Neuem sein.
Kento hatte mich begleitet. Wir hatten Stunden miteinander verbracht. Nicht mitten in der Nacht wie sonst.
Am helllichten Tag.
Er fuhr zum ersten Mal seit Jahren wieder Bahn. Er saß in einem Waggon mit vielen Fremden, wo er sich sonst nicht einmal in ein Taxi traute.
Ich teilte mit ihm einen der wichtigsten Momente meines Lebens. Ausgerechnet ich, die in ihrem Leben nur ganz selten jemanden an ihrer Seite gehabt hatte, mit dem sie etwas teilen konnte.
Aus ihm könnte ein besonderer Freund werden.
Vielleicht.
Mit viel Geduld.
Unsere Wohnungen trennten nur wenige Hundert Meter. Wir könnten uns hin und wieder in einem Café treffen. Ins Kino gehen. Etwas zusammen essen. Ein wenig erzählen. Oder einfach zusammen schweigen. Nicht heute oder morgen natürlich, das war mir klar. Ein Mensch, der fast zehn Jahre mit so gut wie niemandem spricht und seine Wohnung nur im Schutze der Dunkelheit verlässt, wenn überhaupt, ändert sich nicht von einem Tag auf den anderen. Aber irgendwann vielleicht.
Warum nicht?
Das weißt du genau, sagte eine Stimme in mir, nicht laut und doch unüberhörbar.
Schon gut, es war ein Traum. Aber ein schöner.
Es tut dir nicht gut zu träumen, behauptete die Stimme. Nicht, wenn es Kento betrifft.
Meine Träume gehen dich nichts an, sie gehören mir, erwiderte ich. Doch ich wusste, dass sie recht hatte.
Kentos Bein wippte wieder, er rutschte auf seinem Sitz hin und her.
Sieben Stationen noch.
Mein Blick fiel auf den viereckigen blauen Himmel hinter dem geputzten Fenster, auf die leere Sitzbank mit dem sauberen Stoffbezug davor. Ihre Konturen verschwammen allmählich, wieder hörte ich Geräusche, die sich immer weiter entfernten, meine Augen wurden kleiner, die Stimme in mir leiser, bis sie verstummte.
Ruhig und ohne mich zu wehren, glitt ich hinüber in die Welt der Schlafenden.
1
Alle Augen waren auf mich gerichtet.
Meine auch.
Sie besonders.
Das laute Gewirr der Stimmen wich einer erwartungsvollen Ruhe. Ich räusperte mich unwillkürlich. Wochenlang hatte ich Zeit gehabt, mich auf diesen Moment vorzubereiten, nun wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Ein paar Sätze zum Abschied hatte ich gedacht, die können ja nicht so schwer sein.
Naoko nickte mir zu. Sie hatte diesen Abend für mich organisiert, so kurz vor dem Jahresende noch ein für alle passendes Datum gefunden, Geld für Geschenke eingesammelt, den Raum in diesem schönen Izakaya reserviert. Doch ihr Blick verunsicherte mich noch mehr. In ihm lag nicht nur Aufmunterung. Was mochte ihr durch den Kopf gehen?
Ich erhob mich und schaute in die vom Alkohol geröteten Gesichter meiner Kolleginnen und Kollegen. Alle zwölf Mitglieder unseres Teams waren gekommen, auch unser Abteilungsleiter Takahashi-san, selbst die hochschwangere Mio-san.
Sechs Jahre hatte ich mit ihnen ein Büro geteilt. Fünf Tage die Woche, fünfzig Wochen im Jahr. Mittags hatten wir oft zusammen gegessen, nach der Arbeit waren wir regelmäßig etwas trinken gegangen, wir hatten Geburtstagsfeste miteinander gefeiert, Jubiläen, die wiederkehrenden Abendessen zum Ende eines jeden Jahres.
Vor mir auf dem Tisch lagen ihre Geschenke. Ein Paris-Reiseführer. Gutscheine für das Musée Rodin und den Louvre. Ich hatte angekündigt, im Frühjahr nach Frankreich fahren zu wollen, und sie hatten sich Gedanken gemacht. Mein Blick fiel auf die kleine weiße Leinwand, auf die sie ihre Grüße und Wünsche zum Abschied geschrieben hatten, manche mit einem Smiley oder einem Herzchen verziert.
»Du warst eine tolle Kollegin. Danke.«
»Viel Glück und Erfolg, zu schade, dass du gehst.«
»Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!«
»Ich bewundere deinen Mut.«
»Du wirst mir fehlen.«
Und immer wieder: »Wir werden dich vermissen.«
»Vielen Dank«, hob ich an, räusperte mich noch einmal. »Vielen Dank Naoko, dass du diesen Abend organisiert hast. Vielen Dank euch allen für die vergangenen sechs Jahre. Es … es war eine gute Zeit. Ich … ähm … ich habe gern mit euch zusammengearbeitet. Es war bestimmt nicht immer leicht mit mir, aber ich habe mich bemüht, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Ich wollte eine gute Buchhalterin sein und eine gute Kollegin. Ich möchte euch aufrichtig um Entschuldigung bitten für all die Fälle, in denen mir das nicht gelang und ich euch zur Last gefallen bin oder zusätzliche Arbeit verursacht habe. Das war nicht meine Absicht.« Ich hielt inne, atmete einmal tief ein und aus, bevor ich fortfuhr. »Ihr wart immer für mich da, ich könnte mir keine besseren Kollegen vorstellen. Es tut mir leid, dass ich euch verlasse. Ich danke euch allen von Herzen für eure Hilfe und Unterstützung.« Ich log nicht, ganz ehrlich war ich auch nicht. Irgendetwas dazwischen. Ich verneigte mich vor ihnen. Für Sekunden blieb es still. Takahashi-san hob sein Bierglas. »Vielen Dank für deine Worte. Du warst eine sehr fleißige und zuverlässige Mitarbeiterin. Wir danken dir und wünschen dir für die Zukunft viel Glück und alles Gute! Kampai.«
»Kampai«, erwiderte die Runde, wir stießen an, ich setzte mich.
Im vergangenen Jahr war Yuriko-san in den Ruhestand gegangen. Da hatte es viele Tränen gegeben. Jetzt war es nur Naoko, die sich einmal durch das Gesicht wischte. Mir war nicht nach Weinen zumute. Ich fühlte mich leicht und beschwingt, wie ich es nicht von mir kannte. Morgen früh würde ich zum letzten Mal ins Büro kommen, meinen Schreibtisch aufräumen, meine wenigen persönlichen Sachen in eine kleine Kiste packen, mich noch einmal von allen verabschieden und gehen. Einfach gehen.
Mit meiner kleinen Rede war der offizielle Teil des Abschiedsessens beendet, bald darauf brachen die ersten Kolleginnen auf, eine halbe Stunde später waren wir nur noch zu fünft und überlegten, wo wir die After-Party feiern könnten. Takahashi-san schlug eine Karaokebar in Shinjuku vor, darauf hatten die anderen keine Lust. Sie einigten sich auf ein französisches Weinbistro in der Nähe, mir war es nicht so wichtig.
Takahashi-san lud uns zu einer teuren Flasche Rotwein von irgendeinem bekannten Château im Bordeaux ein. Er schenkte großzügig die Gläser voll und sah dabei sehr nachdenklich aus.
»Hast du gar keine Angst?«, fragte Eseru-san, mit der zusammen ich vor sechs Jahren in der Firma angefangen hatte.
»Eigentlich nicht.«
»Ich wüsste mit der vielen freien Zeit nichts anzufangen. Wenn wir im Büro sitzen, unsere Arbeit machen und genau wissen, was wir zu tun haben, wirst du morgens aufwachen und den ganzen Tag vor dir haben, allein und ohne Aufgabe. Was machst du dann?«
»Den Wecker ausstellen und ausschlafen.«
»Und dann?«
»Weiterschlafen.«
Sie lachten. »Und dann?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Wovon wirst du leben, wenn ich fragen darf?«
»Ersparnisse.« Es wäre mir unangenehm gewesen, ihnen von der Lebensversicherung meiner Mutter zu erzählen. »Ich habe Geld zur Seite gelegt. Wenn ich aufpasse, sparsam bin und etwas hinzuverdiene, sollte es zwei oder auch drei Jahre reichen.«
»Allein die Vorstellung, so in den Tag zu leben, schreckt mich.«
»Mich auch«, pflichtete Maho-san ihr bei. »Selbst wenn die Arbeit manchmal etwas viel ist, bin ich froh, dass ich sie habe. Nicht nur wegen des Geldes, auch wegen der Kollegen. Obwohl sie einem manchmal ganz schön auf die Nerven gehen können.« Sie warf einen Blick in die Runde, grinste, Naoko nickte heftig. »Den ganzen Tag allein zu Hause würde ich nicht aushalten. Du bist mutig.«
»Eine starke Frau«, fügte Naoko hinzu. Es klang freundlich und aufmunternd, trotzdem verunsicherte es mich ein wenig.
»Willst du wirklich ein Buch schreiben, wenn du aus Paris zurück bist?«, sagte Maho.
»Na ja, nicht gleich ein Buch«, wiegelte ich ab. »Ich möchte Geschichten schreiben. Das habe ich früher schon sehr gern gemacht. Dann schaue ich mal, was daraus wird.«
»Worüber?«
»Hm. Da bin ich mir noch nicht sicher. Es gibt da verschiedene Ideen.« Ich wusste, dass sie nicht verstanden, warum ich meine sichere und nicht schlecht bezahlte Stelle als Buchhalterin bei einer so renommierten Werbeagentur wie SunSun Agency aufgab, um ein »Büchlein«, wie es alle im Büro nannten, zu schreiben. Etwas, das ich ihrer Meinung nach ebenso gut an den Wochenenden machen könnte. Ich war eine Träumerin, die einer abstrusen Idee folgte, ohne an die Konsequenzen zu denken. In ihren Augen nahm ich mich zu wichtig.
Ich könnte ihnen jetzt sagen, dass es noch eine andere Akiko gab, von der sie nichts wussten, nicht einmal etwas ahnten, und deren Existenz ich selbst zwar nicht vergessen, aber während meines Studiums und der sechs Jahre, die ich als Buchhalterin gearbeitet habe, so gut es ging verdrängt hatte.
Eine Akiko, in deren Fantasie Steine sprachen, unfreundliche Busfahrer sich in Pflanzen verwandelten, Bäume die besten Freunde kleiner Mädchen sein konnten, Blitze nicht auf die Erde wollten, weil sie fürchteten, dort Schaden anzurichten. Eine Akiko, deren Vorstellungswelt groß und reich war und ihr Zuflucht und Trost bot. Eine Akiko, deren großer Traum es als Kind und Teenager gewesen war, Bücher zu schreiben.
Die Existenz dieser Akiko konnte ich nicht mehr länger leugnen, sie wollte ein anderes Leben.
»Hast du es schon einmal versucht?«
»Ähm … na ja, als Jugendliche habe ich oft kleine Geschichten geschrieben, aber nichts Längeres.«
»Woher weißt du dann, wie man es macht?«
»Das weiß ich nicht. Ich glaube, man beginnt einfach mit dem ersten Satz.«
Eseru und Maho wechselten irritierte Blicke und schwiegen betreten.
Takahashi-san schaute mich die ganze Zeit an, ohne sich an unserem Gespräch zu beteiligen. In seinem Blick lag eine Melancholie, die mir in Momenten, in denen er sich unbeobachtet fühlte, häufiger aufgefallen war. Seine Wangen waren gerötet, der Hals mit dunkelroten Flecken bedeckt, ein Zeichen, dass er viel getrunken hatte. »Ich werde dich vermissen«, erklärte er plötzlich in einem Ton, so traurig, dass er die anderen aufhorchen ließ.
Ich lächelte etwas verlegen.
»Ich sage das nicht nur so, ich meine es. Du bist…«, er suchte nach einem Wort, »nicht wie die anderen. Das habe ich vom ersten Tag an gewusst. Wenn ich könnte …« Er beendete den Satz nicht.
Wir warteten, unsicher, ob Takahashi-san noch etwas sagen wollte. Er beugte sich vor, seine geweitete Krawatte baumelte ihm wie ein Strick um den Hals, er öffnete den Mund, hob an, doch es kam kein Ton heraus. Er räusperte sich mehrmals, verschluckte sich fast.
Ich reichte ihm ein Glas Wasser. Er trank es halb leer und fiel erschöpft zurück in seinen Sessel.
Takahashi-san, Eseru und Maho verabschiedeten sich, die beiden nahmen ihren wankenden Chef in ihre Mitte und verschwanden im Labyrinth der Station. Naoko und ich blieben unschlüssig vor dem Bahnhof in Shibuya zurück. Auf einem riesigen Werbebildschirm an einer Fassade hinter ihr tauchte eine dampfende Kaffeetasse auf, Passanten drängten an uns vorbei, die Straßen waren noch immer voller Menschen. Vor einem Imbiss hatte sich eine lange Schlange gebildet, es roch nach frischen Taiyaki.
»Ich bin noch nicht müde. Du?«, fragte Naoko.
»Eigentlich nicht.«
»Was hältst du von einer kleinen After-After-Party?«
»Viel.«
Wir nahmen den Inokashira-Expresszug nach Shimokitazawa. Gleich um die Ecke des Bahnhofs lag eine Sake-Bar, die ich Naoko unbedingt zeigen wollte. Sie war zur Straße hin offen und bestand nur aus einem L-förmigen Tresen, an dem vielleicht ein gutes Dutzend Gäste Platz fand, wenn sie eng aneinander oder in zwei Reihen standen. Für den Winter hatte der Besitzer dicke, durchsichtige Plastikplanen an der Fassade angebracht, die den Raum etwas erweiterten und die Bar notdürftig vor der schlimmsten Kälte schützten. Ich schob die Plane zur Seite, dahinter lief ein Heizlüfter, es war angenehm warm. Wir gingen in die hintere Ecke, wo ich immer stand, wenn ich allein hier war, und bestellten zwei Sake. Der Wirt musterte Naoko neugierig, als müsse er überlegen, welcher Sake zu dieser späten Stunde zu uns passen mochte. Er stellte zwei Gläser auf den Tresen und schenkte aus einer großen Flasche ein, bis sie überliefen und sich die Untertassen bis zum Rand füllten.
»Aus Hokkaido«, sagte er, räumte die Flasche zurück in den Kühlschrank, drehte uns den Rücken zu und begann, Gläser abzuwaschen.
»Ist der immer so wortkarg?«, wunderte sich Naoko.
»Nicht immer. Wahrscheinlich schüchterst du ihn ein.«
»Ganz bestimmt.« Sie lachte, und wir stießen an. »Auf dich.«
»Auf uns.«
Der Sake war gut, frisch, nicht zu trocken, nicht zu süß, genau das Richtige für das Ende eines langen Abends. Naoko nickte anerkennend. Wir tranken beide gleich noch einen Schluck.
»Ich habe noch etwas für dich, nichts Besonderes«, sagte sie und gab mir die Papiertüte von Takashimaya, die sie den ganzen Abend mit sich herumgetragen hatte. Darin waren zwei Päckchen.
»Darf ich?«
»Ja.«
Vorsichtig öffnete ich die kunstvoll gebundene Schleife und wickelte das erste aus. In einem kleinen Karton lagen ein Notizbuch aus schwarzem Leder und ein außergewöhnlich schöner Kugelschreiber mit einer extra Mine. »Der … der ist wirklich ganz besonders«, sagte ich ein wenig verlegen. »Vielen Dank. Das war doch nicht nötig.«
»Wer Bücher schreiben möchte, muss sich auch Notizen machen, oder?«
»Das stimmt.« Ich packte das zweite Geschenk aus. Ein Buch von Haruki Murakami: »Von Beruf Schriftsteller« lautete der Titel.
»Ich dachte, ein paar Tipps von einem berühmten Kollegen können für den Anfang nicht schaden.« Sie grinste. »Ich habe ein wenig darin geblättert. Er war auch neunundzwanzig Jahre alt, als er seinen ersten Roman schrieb. Hat eines Tages einfach angefangen. Wie du. Und gleich irgendeinen Preis dafür bekommen.« Naoko nahm mir das Buch aus der Hand, schlug es auf und begann vorzulesen: »Aus meiner Sicht lässt sich von den meisten, wenn auch nicht von allen Schriftstellern kaum behaupten, sie verfügten über ein ausgeglichenes Wesen und eine gerechte Weltsicht. Nicht wenige von ihnen haben überdies einen sehr eigenen Charakter, der schwerlich als Gegenstand der Bewunderung geeignet scheint, und legen zudem seltsame Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen an den Tag.« Sie klappte es wieder zu und schaute mich an. »Das trifft auf dich ja schon zu, bevor du auch nur eine Zeile geschrieben hast.«
»Findest du?«
Naoko kicherte, ich nahm sie in den Arm. Als ich ihr das erste Mal von meiner Idee, zu kündigen und Geschichten zu schreiben, erzählte, hatte sie sich über mich lustig gemacht. Sie war voller Häme gewesen, wir hatten uns im Streit getrennt und darüber seitdem kein Wort mehr verloren. Umso mehr wusste ich die Umsicht zu schätzen, mit der sie die Geschenke ausgewählt hatte. »Danke. Das ist sehr lieb von dir. Jetzt muss ich doch noch weinen.« Mit einem Taschentuch wischte ich mir ein paar Tränen aus dem Gesicht. »Bist du nicht mehr wütend auf mich?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Es nützt ja nichts. Im neuen Jahr sitze ich ohne dich im Büro. So ist das eben.«
Der Anflug von Bitterkeit, der auf einmal wieder in ihrer Stimme lag, entging mir nicht. Naoko war meine beste, streng genommen meine einzige Freundin, sie zu enttäuschen, tat weh.
Ich wollte ihr etwas zurückgeben nach allem, was sie an diesem Abend für mich getan hatte, und verspürte das Bedürfnis, ihr von Kento zu erzählen.
Unsicher spielte ich mit meinem Glas. »Es gibt etwas, das ich dir schon seit Längerem erzählen möchte.«
Neugierig beugte sie sich zu mir.
»Da … da ist jemand, der mir etwas bedeutet.«
Sie schaute mich mit großen Augen an und verzog ihren Mund zu einem feinen Lächeln. »Das glaube ich jetzt nicht.«
»Doch.«
»Habe ich es mir doch gedacht. Schon länger?«
»Mmmh, seit ein paar Monaten.«
Naoko zog die Augenbrauen hoch und wartete, dass ich fortfuhr.
Aber Kentos und meine Geschichte war so kompliziert, dass ich auf einmal nicht wusste, wo ich anfangen sollte, was ich überhaupt sagen wollte.
»Und?«, fragte sie schließlich. »Verrätst du mir noch mehr über ihn, oder ist das alles, was ich erfahre?«
»Er heißt Kento.«
»Aha. Wie alt?«
»So alt wie ich.«
Sie nickte zustimmend. »Kommt er aus Tokio?«
»Aus Nara. Wir sind in der Junior High School drei Jahre in dieselbe Klasse gegangen. Im Sommer haben wir uns durch Zufall hier in Shimokita vor einem Konbini wiedergetroffen.«
»Sieht er gut aus?«
»Vielleicht … Ich glaube schon. Früher auf jeden Fall.«
»Auf welcher Universität war er?«
»Ich weiß nicht, ob er studiert hat.«
Naoko stutzte und überlegte. »Bei welcher Firma arbeitet er?«
»Bei keiner.«
»Ah, er ist Freiberufler.«
»So würde ich es nicht nennen.«
»Ist er ein Online-Investor? Ein Day-Trader oder so etwas?« Ihre Irritation nahm mit jeder meiner Antworten zu.
»Auch nicht.«
»Ich verstehe kein Wort. Was macht er denn?«
Ich überlegte. »Also … soweit ich weiß … macht er nicht so viel.«
»Ein verwöhntes Kind reicher Eltern.«
»Hm … das würde mich überraschen. Ich denke eher nicht.«
Sie lehnte sich zurück, musterte mich und zog ihre Stirn in Falten. »In dem Fall muss er doch irgendetwas machen, um Geld zu verdienen.«
»Ich glaube, er braucht nicht viel … Er … er ist den ganzen Tag in seiner Wohnung … und dort … also … ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher …«, erwiderte ich ausweichend.
»Jetzt sag nicht, er ist ein Hikikomori.«
Ich deutete ein zaghaftes Nicken an.
Naoko entfuhr ein nicht enden wollendes »Aaach«.
Abwartend nippte ich an meinem Sake.
»Ein Hikikomori? Wirklich?«
»Ja.«
»Das glaube ich nicht.« Sie presste die Lippen zusammen, schaute sich etwas verloren in der Bar um, als müsse sie sich vergewissern, wo sie war.
Ich nickte noch einmal, zweifelnd, ob es eine gute Idee gewesen war, ihr von Kento zu erzählen.
»Warst du schon einmal bei ihm zu Hause?«
Ich schüttelte vehement den Kopf.
»Aber habt ihr …« Naoko hob vielsagend die Augenbrauen.
»Natürlich nicht. So eine Art von Beziehung ist es nicht.« Die Vorstellung, mit Kento zu schlafen, war seltsam abwegig. Es kam mir gar nicht in den Sinn, wenn wir zusammen Zeit verbrachten.
»Mehr wie«, Naoko suchte nach einem passenden Vergleich, »Bruder und Schwester?«
»Auch nicht. Ganz anders.« Ich hatte kein Wort, keine Bezeichnung für die Beziehung mit Kento.
Vielleicht, dachte ich, war es gar nicht nötig für das, was uns verband, einen Namen zu finden. Warum sollte ich es unbedingt mit einem Label versehen. Wir waren Akiko und Kento. Punkt.
Naoko wartete auf eine Antwort.
»Ich kann es nicht beschreiben.«
Sie überlegte. »Ihr habt euch zufällig vor einem Konbini wiedergesehen?«
»Ja.«
»Ich dachte, Hikikomoris trauen sich nicht aus ihren Zimmern oder Wohnungen, sprechen mit niemandem und sehen keinen Menschen. Er geht vor die Tür?«
»Nicht oft und nur nachts.«
»Was ist mit ihm?«
»Was soll mit ihm sein?« Naokos Frage war berechtigt, trotzdem ärgerte sie mich – oder vielmehr der Ton, in dem sie sie stellte. Es klang in meinen Ohren, als wenn etwas mit Kento nicht stimmte.
»Ich meine, warum geht er nur nachts auf die Straße? Das ist ja nicht normal. Warum ist er Hikikomori geworden? Was ist sein Problem?«
Wie konnte ich ihr erklären, was ich selbst nicht genau verstand? Ich wusste nur, dass sich Kento vor neun oder zehn Jahren von der Welt zurückgezogen und keinen Kontakt mehr zu seiner Familie oder Freunden hatte.
»Das kann ich dir nicht sagen, ich weiß es selbst nicht.«
Naoko trank von ihrem Sake, schüttelte noch einmal den Kopf und seufzte tief. »Ach, Akiko … Hat er denn nichts von sich erzählt?«
»Er … also … er sagt nicht so viel.«
Sie seufzte gleich noch einmal. »Er spricht nicht?«
»Doch, schon, aber wenig.«
»In der Highschool hatten wir einen Jungen in der Klasse, er war der mit Abstand Schlaueste von uns allen. Ein Genie, ernsthaft. Wollte Mathematiker werden wie sein Vater. Der las Zahlen wie wir Bücher. Selbst die Lehrer kamen oft nicht mehr mit. Aber wenn ihn jemand von uns ansprach, wusste er nichts zu erwidern. Wenn ein Mädchen etwas zu ihm sagte, bekam er einen hochroten Kopf. Er konnte niemandem in die Augen sehen, Wenn wir mit ihm redeten, schaute er immer zu Boden. Wir nannten ihn Tomate. Irgendwann kam er nicht mehr zur Schule. Es hieß, er weigere sich, sein Zimmer zu verlassen. Selbst mit seinen Eltern sprach er kein Wort mehr. Wir haben ihn nie wiedergesehen.«
Ich überlegte. »Kento war so eine Art musikalisches Wunderkind, hat alle möglichen Klavierwettbewerbe gewonnen. Aus irgendeinem Grund hat er von einem Tag auf den anderen aufgehört. Aber er ist nicht, wie du dir einen Hikikomori vorstellst. Er ist irgendwie … anders. Ich weiß nicht, wie ich ihn dir beschreiben soll. Ich mochte ihn früher schon. Er war still, nicht so ein Angeber wie andere Jungs, immer hilfsbereit. Wenn jemand in der Schule seine Bento Box vergessen hatte, gab er ihm etwas zu essen ab, den Schwächeren half er bei den Hausaufgaben, wenn sie ihn darum baten. Sagte er mal etwas, hörten alle zu. Er war der erste Junge, der mich interessierte.« Wenn ich ganz ehrlich war, bisher auch der einzige, abgesehen vielleicht von Daisuke, mit dem ich zwei Jahre zusammen war, aber das sagte ich nicht.
»Und der einzige«, sagte Naoko und lächelte. »Er klingt sympathisch, wie du ihn beschreibst, aber ich meine, ganz im Ernst, was macht man mit einem Hikikomori?«
»Wir gehen spazieren.«
»Nachts? Spazieren?«
»Ja. Hin und wieder kaufen wir etwas in einem Konbini und setzen uns damit auf eine Bank, sonst machen wir eigentlich nichts. Er ist nicht gern unter Menschen.«
Sie trank von ihrem Sake und schaute mich ernst an. »Wie oft seht ihr euch?«
»Unregelmäßig. Manchmal zweimal in der Woche, manchmal alle zwei Wochen.« Das war weit übertrieben. Seit unserer Fahrt ans Meer vor zwei Monaten hatte ich kaum noch von ihm gehört. Meine gelegentlichen Nachrichten beantwortete er gar nicht oder nur mit wenigen Worten, nie mehr als mit einem Satz. Meine Frage, ob wir uns zu einem Spaziergang treffen wollten, hatte er ignoriert. Ich verstand nicht, warum er sich wieder so zurückzog, und machte mir Sorgen um ihn. Gerne hätte ich ihr davon erzählt, aber die Beziehung zu einem Menschen wie Kento war kompliziert, und ich fürchtete, es wäre von Naoko zu viel erwartet, sie zu verstehen.
»Wir sehen uns je nachdem«, behauptete ich.
»Je nachdem was?«
»Je nachdem, wie er sich fühlt.«
»Auch je nachdem, wie du dich fühlst?«
Noch einmal wiegte ich ausweichend den Kopf hin und her, ohne etwas zu erwidern. »Wir schreiben uns längere Nachrichten. Gelegentlich telefonieren wir oder verbringen ein bisschen Zeit auf Facetime miteinander. Manchmal liest er mir ein Haiku vor und schickt mir die Aufnahme.«
»Haikus? Im Ernst? Wer liest heute noch Haikus?«
»Mir gefallen sie.«
»Die habe ich zuletzt in der Schule gelesen. Ich erinnere nicht einen.«
»Ja, Schnecke,
besteig den Fuji, aber
langsam, langsam!«, zitierte ich den ersten, der mir in den Sinn kam.
Sie lächelte. »Schön. Ist das von ihm?«
»Aus einer alten Sammlung von Haikus, die er wiedergefunden hat.« Ich erinnerte einen zweiten:
»Diesen Weg
geht niemand
an diesem Herbstabend.«
»Auch schön.« Sie blickte mich fragend an. »Das genügt dir?«
»Ja.«
Sie verstand mich nicht, ich hatte es befürchtet und ärgerte mich, dass ich ihr so ausgiebig von Kento erzählt hatte.
»Ich dachte, du bist in ihn verliebt.«
»Das habe ich nie gesagt«, korrigierte ich sie. »Er bedeutet mir etwas, das ist nicht dasselbe. Es ist schön, dass es ihn gibt.«
»So wie mich?«
»So wie dich.«
Sie zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf. »Also, was Männer betrifft, verstehe ich dich wirklich nicht. Du siehst gut aus, du hast etwas Geheimnisvolles an dir, eine Ausstrahlung, die viele Männer reizen würde …«
»So ein Unsinn«, widersprach ich.
»Du könntest dir die Verehrer aussuchen, glaub mir, davon verstehe ich etwas«, fuhr sie unbeirrt fort, »und trotzdem bist du, seit ich dich kenne, allein. Und nun freundest du dich ausgerechnet mit einem Hikikomori an. Du bist mir ein Rätsel.«
Der Wirt fragte, ob wir noch einen Sake wollten, es wäre an der Zeit für eine letzte Bestellung. Naoko schaute auf die Uhr. »Ich fürchte, ich muss mich auf den Weg machen«, sagte sie. »Denn ich muss morgen früh um neun wieder im Büro sein.«
»Ich auch.«
»Um deine Sachen zu packen …«
Zu Hause machte ich alle Lichter an und ließ mich auf meinen Futon fallen. Ich betrachtete die Zimmerdecke und schaute mich in der Wohnung um. Seit die Urne meiner Mutter nicht mehr an ihrem Platz stand, war sie eine andere geworden. Fast zehn Jahre hatten meine Mutter und ich zusammen in diesen Zimmern verbracht, auch wenn es am Ende nur noch ihre sterblichen Überreste waren, mit denen ich sie teilte. Ihre Urne, der kleine Altar, das Foto von ihr hatten die Räume in einer Weise beherrscht, der ich mir nicht bewusst gewesen war. Erst jetzt, da auf der Kommode lediglich noch der Rahmen mit ihrem Bild stand, war sie zu meinem alleinigen Zuhause geworden.
Wenn meine Mutter nun als Geist erschien, was sie regelmäßig tat, kam sie zu Besuch, das war nicht mehr dasselbe. Dann saß sie mir beim Frühstück gegenüber oder leistete mir Gesellschaft, wenn ich Wäsche aufhängte und das Geschirr spülte. Irgendwann verabschiedete sie sich, und ich hatte die Wohnung wieder für mich allein.
Jetzt hätte ich mich gern noch ein wenig mit ihr unterhalten. Ich setzte mich an den Esstisch, öffnete eine Flasche ihres Lieblingsrotweins aus dem Languedoc und wartete. Ich wollte ihr gern noch von dem Abend erzählen. Wie es mich überrascht und erfreut hatte, dass alle meine Kolleginnen gekommen waren, was für schöne Geschenke sie mir zum Abschied gemacht hatten, welche Erleichterung ich verspürte, nur noch ein Mal ins Büro zu müssen. Ein Mal! Dass Naoko und ich uns versöhnt hatten.
Es war seltsam. Als meine Mutter noch lebte, hatte ich selten das Bedürfnis, ihr von meinen Tagen im Büro zu erzählen. Wir sprachen nicht viel miteinander und noch weniger über die wichtigen Dinge.
Nicht, weil wir uns nicht vertrauten oder gleichgültig waren. Schon als Kind wollte ich sie mit meinen Kümmernissen und Problemen nicht belästigen, als junge alleinerziehende Mutter und Besitzerin eines Sunakku hatte sie genug Sorgen. Und ich vermutete, ihr ging es genauso – auch sie wollte mich nicht belasten.
Seit sie mir nur noch als Geist begegnete, war es etwas anderes. Wir nahmen uns Zeit, sie hörte mir zu, mir tat es gut, ihr zu erzählen, was mich beschäftigte und sich in meinem Leben ereignete. Auch von Kento hatte ich ihr schon berichtet.
Ich will nicht sagen, dass sie mir näher war als zu ihren Lebzeiten, aber ich verspürte auch keine große Distanz.
In dieser Nacht wartete ich vergeblich auf sie. Das war eine Lehre aus den vergangenen zwei Monaten. Ich konnte ihr Erscheinen nicht erzwingen. Sie kam, wann immer sie wollte, blieb, so lange sie wollte. Sie war ein freier Geist.
Und wenn mir ihr Besuch einmal ungelegen kam, gab ich ihr das zu verstehen, und sie verschwand wieder, ohne zu klagen, ohne verärgert zu sein.
2
10 Uhr 23 … 10 Uhr 24 … 10 Uhr 25 … Auf dem Bett liegend, beobachtete ich die Anzeige meines Weckers. Ich zählte bis sechzig, mal etwas zu schnell, mal etwas zu langsam, nach einigen Versuchen entwickelte ich ein gutes Gespür dafür, wie lang eine Minute war. Auf die Sekunde genau traf ich 10:33, 34, 35.
Ich drehte mich auf den Rücken, betrachtete die Zimmerdecke, überlegte, was ich heute machen wollte.
Ich hatte Zeit.
Den ganzen Tag.
Und den nächsten.
Und den darauffolgenden.
Es gab niemanden mehr, der mir vorschrieb, wie ich sie zu verbringen hatte, was ich mit ihr anfangen sollte.
Sie gehörte mir. Ich konnte sie vergeuden oder nutzen. Totschlagen oder genießen.
Meine Zeit.
Zwei Wörter, die in meinem Kopf seltsam klangen. Als könnten sie miteinander nichts anfangen. Mehrmals wiederholte ich sie halblaut: Meine Zeit. Meine Zeit. Meine Zeit.
Wenn sie das erst jetzt war, wem hatte sie vorher gehört?
Fünf Tage die Woche, zehn, zwölf, auch vierzehn Stunden hatte ich im Büro verbracht, davor und danach eine halbe Stunde in völlig überfüllten Zügen. An den Wochenenden erholte ich mich, für größere Unternehmungen fehlte mir die Energie. Von meinen zwanzig Urlaubstagen ließ ich jedes Jahr eine Reihe ungenutzt verstreichen wie fast alle in unserer Abteilung.
Zeit, die nur mir gehörte, hatte ich zuletzt als Kind gehabt. Meine Mutter ging aus dem Haus, kurz nachdem ich aus der Schule kam, sie musste ihren Sunakku für die Nacht vorbereiten. Manchmal begleitete ich sie, erledigte dort meine Hausaufgaben, half ihr beim Saubermachen, an den meisten Tagen blieb ich jedoch zu Hause. Für Klavierstunden oder Tanzunterricht fehlte uns das Geld, möglicherweise hätte ich ohnehin kein Interesse gehabt, die Nachmittage und Abende verbrachte ich allein in unserer Wohnung. Wochen, Monate, Jahre, in denen die Zeit stillzustehen schien.
Ihrer Bedeutung war ich mir damals nicht bewusst. Sie war einfach da wie Luft zum Atmen, wie die Jahreszeiten, der Schnee im Winter, die feuchte Hitze im Sommer.
Nun hatte ich wieder Zeit und durfte mir aussuchen, was ich mit ihr anfangen wollte.
Was für ein Luxus, dachte ich. Vielleicht war Luxus das falsche Wort. Ein Privileg. Ein Geschenk, das sich nur wenige leisten konnten.
Neujahr verschlief ich komplett, auch danach verbrachte ich so viel Zeit im Bett wie nie zuvor in meinem Leben. Ich erwachte morgens gegen zehn, trank einen Becher warmes Wasser, legte mich wieder hin, schlief noch drei oder vier Stunden. Als müsste ich nachholen, was ich in den vergangenen sechs Jahren versäumt hatte. Ich dachte viel an meine Mutter. Nach ihren beiden Operationen hatte es Wochen gedauert, bis sie sich erholte. Sie war überzeugt, dass sie während der Narkose in einer anderen Welt gewesen war, die nicht mehr den Lebenden gehörte und noch nicht den Toten. Sie benötigte Zeit und Kraft, in die Realität, zu sich selbst und in ihren Körper zurückzukehren.
So ähnlich erging es mir auch. Während der sechs Jahre bei SunSun Agency war ich weit weg gewesen, nun bedurfte es Zeit, zurück zu mir zu finden.
Endlich konnte ich nicht nur an den Wochenenden in Ruhe frühstücken, ich trank Kaffee im Bett, aß einen Toast mit Marmelade dazu, trug bis Mittag meinen Hausanzug, es gab Tage, an denen ich nicht vor die Tür ging.
In meinem neuen Leben wollte ich möglichst wenige der Routinen und Gewohnheiten aus meinem alten.
Einmal stellte ich den Fernseher an und drückte mich durch die Programme: Spielshow. Soap-Opera. Spielshow. Soap-Opera. Wetterbericht. Spielshow. Nachrichten. Spielshow. Nach einigen Minuten schaltete ich ihn wieder aus. Dafür war mir meine Zeit doch zu schade, egal wie viel ich besaß.
Ich ging zum Friseur und ließ mir die Haare ähnlich kurz schneiden wie Naoko, nur ohne Pony.
Ich reinigte die Wohnung gründlich, taute den Kühlschrank ab, wischte Schränke, putzte Fenster, dekorierte ein wenig um. Die Kommode kam von einer Seite des Zimmers auf die andere, darüber hängte ich einen Kalender mit Bildern aus Paris. Im Flur brachte ich endlich neue Garderobenhaken an, im Bad ersetzte ich den gesprungenen Spiegel.
Viel Zeit verbrachte ich mit Lesen, ohne dabei besonders wählerisch zu sein. Alte Manga-Serien gehörten zu meiner Lektüre, französische Autoren, die meine Mutter gern gelesen hatte, jüngere japanische Schriftstellerinnen mit ihren Debütromanen.
In meinen Gedanken war ich viel bei Kento. Ich wusste zu wenig über die Welt eines Hikikomori, um mir seinen Rückzug schlüssig erklären zu können. Alles, was ich hatte, waren Mutmaßungen, Spekulationen, Fantasien. Am wahrscheinlichsten erschien es mir, dass ihn unsere Reise ans Meer und der Abschied von meiner Mutter, überfordert hatten. Ich hatte ihm indirekt zu verstehen gegeben, wie sehr ich mich freuen würde, wenn er mich begleitete. Er hatte mich nicht enttäuschen wollen und war dabei weit über seine Grenzen hinausgegangen. Das musste ihn unendlich erschöpft haben, um sich zu schützen, zog er sich wieder zurück.
Oder unser Ausflug hatte ihm gezeigt, wie groß die Welt außerhalb seiner kleinen Wohnung war und wie wenig er dazugehörte. Wie weit er sich davon entfernt hatte. Wie weit der Weg zurück sein würde …
In beiden Fällen wäre es meine Schuld, es tat mir leid, dass ich ihn so überfordert hatte.
Zum ersten Mal beschlich mich die Angst, er könne sich etwas antun, auch wenn ich gelesen hatte, dass Hikikomoris nicht mehr zu Depressionen und Suizid neigten als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Meine letzten beiden Nachrichten hatte er nur mit einem Satz beantwortet, trotzdem versuchte ich es mit einer neuen.
Wie geht es dir? Ich habe jetzt viel Zeit für mich, das tut mir gut.
Ich stockte. Einem Hikikomori zu schreiben, man habe viel Zeit für sich, und das tue gut, war ziemlich unsensibel.
Wie geht es dir? Ich freue mich immer, von dir zu hören. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit zu einem Spaziergang?
Seine Antwort ließ diesmal nicht lange auf sich warten.
Mir geht es gut. Es tut mir leid, dass ich in den vergangenen Wochen so wenig mitteilsam war. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder einmal sehen.
Das fände ich schön, danke.
Du hast jetzt viel Zeit, vermute ich.
Ja.
Langweilst du dich?
Überhaupt nicht.
Das hätte mich auch gewundert. Ich melde mich in den kommenden Tagen.
Für Kentos Verhältnisse war das fast wie eine Verabredung, der Ton seiner SMS beruhigte mich, ich hoffte, er würde Wort halten.
Als Vorbereitung auf meine Reise nach Paris ging ich einmal in der Woche zu meiner Französischlehrerin Madame Montaigne, lernte fleißiger Vokabeln, schaute Filme im französischen Original.
Ich suchte nach Flügen und einem Hotel, konnte mich aber noch nicht entscheiden, in welchem Monat ich fahren wollte, und verschob die Buchungen.
Im Netz fand ich einen Online-Kochkurs, »Französisch kochen wie ein Profi«, er hatte großartige Bewertungen, war im Original mit japanischen Untertiteln, ich könnte nebenbei noch mein Französisch verbessern. Gleich nach der ersten Folge gab ich wieder auf. Die Köchin, eine ältere Französin, stellte zu Beginn die Küchengeräte vor, die wir für ihren Kurs brauchten. Abgesehen von einem scharfen Messer, einem Sieb, Topf und Pfanne, besaß ich nichts davon, hätte ich nur die Hälfte der benötigten Utensilien, wäre in meiner Küche kein Platz, um zu kochen.
Davon abgesehen, genoss ich es, Tage einfach verstreichen zu lassen. Ohne Pläne, ohne Programm, ohne Struktur. Trotzdem langweilte ich mich keine Sekunde oder glaubte, meine Zeit zu vergeuden.
Auf dem Futon liegend, erfüllte mich eine Ruhe, wie ich sie nicht kannte. Mit jedem Tag eroberte ich mir mein Leben mehr zurück.
Etwas fiel von mir ab, ohne dass ich mit Sicherheit hätte sagen können, was es war.
Ich musste keine Rolle spielen, dachte ich. Nicht die der Tochter. Nicht die der Schülerin. Nicht die der Freundin, Studentin, Buchhalterin oder Kollegin.
Abgesehen von Naoko, gab es niemanden mehr, der etwas von mir erwartete.
Sie schickte mir jeden Tag die gleiche Nachricht: »Du fehlst mir«, dazu ein Foto von meinem leeren Schreibtisch und ein weinendes Emoji. Ich antwortete mit »Du mir auch« und einem Selfie von mir im Bett. Oder im Schlafanzug. Oder dem Bild eines dampfenden Bechers Kaffee mit einem goldgelben Croissant daneben. Das war zwar aus Plastik, ich hatte es meiner Mutter einmal zum Geburtstag geschenkt, doch auf dem Foto war das nicht zu erkennen.
Am frühen Nachmittag schlenderte ich gern durch Shimokitazawa, trank im Sidewalk Coffee auf der Terrasse des Mustard Hotels einen Kaffee. Sie rösteten ihn selbst, er besaß eine leicht bittersüße Note und schmeckte mir im ganzen Viertel am besten.
Einmal saß mir eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn gegenüber. Sie war vermutlich in meinem Alter, das Kind mochte eineinhalb, vielleicht zwei sein, das Alter von Kleinkindern zu schätzen, fiel mir schwer. Er hockte auf ihrem Schoß, in der Hand hielt sie einen großen Haferkeks, brach ihn in kleine Stücke und fütterte den Jungen. Er griff nach dem Keks, sie gab ihm ein Viertel, er zerbröselte es, ohne davon zu essen. Sie strich die Krümel von seiner Jacke. Er hatte Durst. Sie reichte ihm eine Flasche, er trank und verschüttete etwas, sie wischte seinen Kragen trocken, packte die Reste des Keks in eine Plastiktüte, verstaute sie im Netz des Kinderwagens. Sie holte ein Stück Apfel hervor, reichte es ihm, angewidert drehte er seinen kleinen Kopf zur Seite. Er zappelte, wollte sich bewegen, sie setzte ihn ab. Er lief los. Sie hinterher. Neugierig näherte er sich einem kleinen Hund, fiel hin. Sie half ihm hoch, wischte ihm die Händchen mit einem feuchten Tuch sauber. Er lief Richtung Treppe, seine Mutter folgte ihm und passte auf, dass er nicht die drei Stufen hinunterfiel. Er drehte sich um, ging Richtung Schiebetür. Sie folgte ihm, darauf achtend, dass er sich nicht die Finger klemmte. Er fiel wieder hin und weinte, sie hob ihn auf und tröstete ihn.
Ich war schon vom Zuschauen erschöpft. Würde ich jemals in der Lage sein, mich so hingebungsvoll und aufmerksam um einen anderen Menschen zu kümmern und die Verantwortung für sein Wohlergehen zu tragen? Ihm so viel Zeit zu widmen? Ich konnte es mir nicht einmal im Ansatz vorstellen, allein von der Idee fühlte ich mich überfordert.
Ich trank den letzten Schluck meines Kaffees und ging weiter.
Eines Morgens nahm ich das Buch von Murakami zur Hand. Ein Kapitel hieß: »Und worüber soll ich schreiben?«
»Was kann ich tun, um Schriftsteller zu werden? Wie kann ich üben? Kann ich es lernen?« Neugierig begann ich zu lesen.
Im Gegensatz zu mir hat Murakami nicht davon geträumt, Schriftsteller zu werden. Die Idee für seinen erst