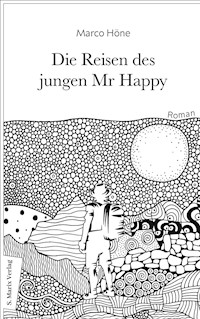
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der junge Mr Happy ist enttäuscht vom Leben. Anders als die Zeichentrickserien aus seiner Kindheit ihm suggeriert haben, sieht er sich im beginnenden Erwachsenenleben bloß mit Banalitäten und Langeweile konfrontiert. Dazu kommt eine verklemmte Sexualität. In exotischen Reisen und hedonistischen Ausschweifungen sucht er, wie viele Reisende vor ihm, Erlösung zu finden. Die Glücksuche hinter dem Horizont. Aber sein Streifzug um die Welt wirft Zweifel auf. Was taugen die Kalendersprüche der Backpacker? In seinen Berichten erzählt er nüchtern-zynisch von seinen Abenteuern im thailändischen Rotlichtmilieu und dem Propagandawahnsinn in Nordkorea; aber auch von der Einsamkeit in der Sahara oder Geheimdienstverhören in Israel. Dabei entwickelt er eine ganz eigene Sicht auf eine Welt, in der Wahrheit nur Wahrnehmung, echte Liebe käuflich und Langeweile eine Tugend ist. Ein Entwicklungsroman, der im ewigen Jagen nach dem Glück die eigentliche Quelle der Unruhe entlarvt und letztlich die Angst vor der Sinnlosigkeit nimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marco Höne
Die Reisen desjungen Mr Happy
Roman
INHALT
Einleitung:Die Langeweile
Reise 1:Guns and Moses in Israel
Musiktipps für eine gelungene Weltsicht 1:Ravishing Grimnes
Reise 2:Ein schrecklich netter Pauschalurlaub
Reise 3:Meine erste Liebe war ein thailändischer Moneyboy
Musiktipps für eine gelungene Weltsicht 2:Antichrist Superstar
Reise 4:See you in Pjöngjang
Reise 5:Laos für Dummies
Musiktipps für eine gelungene Weltsicht 3:Reise, Reise
Reise 6:Vor dir Leere, hinter dir Leere – Marokko
Reise 7:Verliebt in die Leere – Island
Musiktipps für eine gelungene Weltsicht 4:Dream Machine
Reise 8:Good Morning in Vietnam
Epilog:Es ist alles egal
EINLEITUNG:
DIE LANGEWEILE
Das Leben hatte mich immer enttäuscht. Meine liebsten Kinderserien waren Biene Maja und Heidi. Ich wuchs auf in der Erwartung einer Welt voller Freiheit, Liebe und Abenteuer. Sicher gab es darin Herausforderungen – aber spätestens nach einem harten Kampf, bei dem das Gute obsiegte, würden Freunde auf einen warten, um eine Pizza zu teilen. Die Bösewichte würden in ihre Schranken gewiesen, so wie Gargamel am Ende jeder Schlümpfe-Folge.
So würde man Tag für Tag die Fensterläden aufreißen, die Sonne und die Waldtiere begrüßen, seine Herausforderungen meistern und immer ein warmes Plätzchen haben, an das man gehörte. Meine Mutter erzählte, dass ich strohblond und tanzend durch die Straßen lief und sang: »Das Leben ist schön, das Leben ist so schön.«
Das war meine behütete Kinderwelt. Meine Existenz ein fröhliches Wunder. Als ich zehn Jahre alt war, begriff ich, dass ich betrogen worden war. Mein Vater, mit dem ich im Campingurlaub beim Bauern auf dem Feld Kartoffeln geklaut hatte, war ein Alkoholiker. Er soff sich mit aller Konsequenz ins Grab. Nicht jedes Kind ist an den Anblick eines Vaters gewöhnt, der morgens die Matratze föhnte, weil er sich wieder eingepisst hatte. Meine Mutter schien mir bis ins späte Alter vernünftig. Magersucht, Missbrauchserfahrungen und Selbstmordfantasien wusste sie gut zu verbergen.
Zu allem Überfluss wurde mir langsam bewusst, dass ich Jungs lieber als Mädchen mochte. Ich liebte die Trockenfickspielchen mit meinen hübschen Kumpels. Aber auch wenn ich beim Wichsen ehrlich zu mir war: Diesen Teil meiner Persönlichkeit konnte ich im Alltag nicht akzeptieren. Die schwulen Role-Models, die ich kannte, waren feminin und das gefiel mir nicht. So wollte ich nicht sein. Deswegen konnte ich mir – aber auch anderen – gegenüber nicht dazu stehen und beließ es bei Wichsfantasien. Alles wurde kompliziert.
Um mich in der Schulzeit zwischen Mobbing, eigener sexueller Unsicherheit und Leistungsdruck zu behaupten, krönte ich mich zum Schulhof-Satanisten. Damit hob ich einen tiefen Graben zwischen mir und meinen Mitschülern aus. Ich wurde weitestgehend von den Machtkämpfen und Testosteronschüben anderer verschont. Viele fanden mich unheimlich und mieden mich. Mal stellte ich mich auf die Seite der Mobber, mal gab ich den Einzelgänger. Mir stand es frei. Die Traumata wurden anderen beschert. Ich bekam sogar einen freundlichen Spitznamen. Da ich immer schwarz trug, die Welt verfluchte und mit düsteren Kommentaren im Unterricht glänzte, tauften mich meine Mitschüler: Mr Happy. Der Sarkasmus gefiel mir. Ich behielt den Namen.
Die Taufe dazu fand auf einer Klassenfahrt in Italien statt. Wir waren gruppenweise und abseits der Lehrer auf einem Ferienkomplex in kleinen Häusern untergebracht. Binnen Stunden hatte es sich in eine heruntergekommene Trinkerhöhle verwandelt. Pornografische Bilder an den Wänden, überall leere Alkoholflaschen und im Garten rauchten die Reste einer verbrannten Deutschlandfahne. Wir tranken die Nächte einfach durch. Wie so oft, hielt ich mich stumm im Hintergrund, aus Angst jemand könnte meine Homosexualität entdecken, weil ich mich verplapperte oder jemandem zu lange in die Augen sah. Einige Jungs im Haus waren extrem hot, die Gefahr also hoch. Eines nachts, jenseits von zwei Promille, stand einer von den Sportlertypen auf und meinte: »Du machst mir keine Angst mit deinem Satanskreuz und deinen schwarzen Pullovern, du nicht. Ich sehe ganz genau, was hier abgeht.«
Er griff sich ein Bier, das jemand anders zuvor als Aschenbecher benutzt hatte. Ich war besorgt.
»Du willst dich nur interessant machen. Du willst nur, dass die Ladys dich für mysteriös halten. Du bist kein Satanist, du bist Mister Happy!«
Alle feierten diesen Ausbruch. Damit bekam ich meinen Namen und ließ ihn an mir haften, sodass mein wirklicher Name nur noch eine Notwendigkeit auf dem Einwohnermeldeamt wurde.
Die Satanisten-Szene war als Fluchtpunkt vor dem Mainstream eine Enttäuschung. Ich suchte nach Leuten, die pessimistische und misanthropische Weltanschauungen mit Glaubhaftigkeit vertraten. Ich wollte Missmut atmen. Gefunden hatte ich einen öden Haufen Poser – viele aus sozialen Berufen wie Behinderten- oder Krankenpflege –, die einfach nur mal Dampf abließen. Menschenhass war ein Ventil, um am Tag wieder fürsorglich sein zu können.
Anfängliche Experimente mit Okkultismus bestätigten die Lachhaftigkeit von Esoterik und Glauben. Sexorgien und Menschenopfer fanden nur in den Medien statt und nicht in den Lübecker Wohnzimmern, in denen wir Apfelkorn tranken, »Heil Satan« brüllten und Black Metal hörten.
Eine Zeit lang schnitt ich mir in den Arm. Das hatte etwas Rituelles und verschaffte mir Befriedigung. Ich will es aber nicht überhöhen: Es blieb ein Partygag der derben Sorte, der sich schnell abgenutzt hatte. Beim letzten Mal schnitt ich mir mit einem Jagdmesser eine große Fleischwunde in den Arm. Das Blut bildete zwischen meinen Füßen sofort eine Pfütze und niemand außer mir nahm Notiz davon. Die Bong war interessanter. Schnell wickelte ich Klopapier um die Wunde und schnitt mich nie wieder.
Dr. Sommer hatte mir in der Bravo versprochen, ich würde spätestens mit 16 Sex haben, vermutlich sogar früher. Als ich mit 21 endlich mit einer Frau schlief, war ich wieder enttäuscht. Statt einer Lustorgie ein bemühtes Reiben. Kein Wunder: Brüste und Vaginas standen bei mir nicht hoch im Kurs (siehe oben). Es war anstrengend und beschämend. Nur den Orgasmus fand ich gut. Klar, dass man dieses Gefühl nur ein paar Sekunden genießen darf und dafür schuften muss wie ein angeschossener Eber.
Alkohol und Drogen waren dagegen viel besser, als das bisweilen vermittelt wird. Aber auch diese Kicks, die ich mir in frühester Jugend auch mal durch Ladendiebstahl verschafft hatte, waren nur ein kurzes Glimmen in der Asche, die ich verzweifelt durchwühlte. Man setzte sich zusammen, soff, rauchte, schniefte und dann gab es irgendwann einen kurzen Moment der Glückseligkeit, bevor der Rausch wieder alles zum Einsturz brachte. Und zwar dann, wenn man so taub wurde, dass man nur noch ein Promillezombie war. Die Existenz, insbesondere die pure, blieb geschmacklos.
Auch mein Studium wurde keine Dauer-Party. Ich glitt in Sinnkrisen. War einem in der Schule noch in Aussicht gestellt worden, einmal etwas zu werden, begriff man während des Studiums, dass man nichts wird. Ich machte keine Auslandssemester oder Praktika, sondern Nachtschichten an der Tanke und begrüßte dort immer gegen etwa drei Uhr morgens den ganzen Abschaum der Gesellschaft. Immer dieselben Gesichter aus der Großraumdisco auf der Suche nach Zigarettenblättchen und Bier.
Ein- bis zweimal die Woche schlürfte ich alleine in meiner Wohnung Tetrapack-Wein, bis ich volltrunken war. Nach Mitternacht wankte ich dann in eine Schwulenbar. Bevor ich eintrat, vergewisserte ich mich, dass mich niemand sah. Innen traf ich nur alte und kaputte Menschen. Die jungen und hübschen waren längst am Bumsen.
Meinen ersten richtigen Job hatte ich im Bereich Public Relations. Weil da jeder Affe mit ein paar kreativen Ideen und Durchsetzungswillen akzeptiert wird, wurde mir auch das bald langweilig. Ständig dieselben Journalisten. Geschichten immer nur nach Schema F. Nach Events versackten alle an der Bar und schrien auf der Straße ihren Größenwahnsinn in den Sonnenaufgang. Das war kurz lustig, aber ich machte eine Fortbildung zum Projektmanager. Meine Hoffnung war, dass ich ständig neuen Herausforderungen begegnen würde. Keine Chance für die Langeweile.
Doch ihr ahnt es: Enttäuschung. Letztlich ist es egal, ob du in Saudi-Arabien einen Brunnen bohrst oder für einen Bürgermeister eine Social-Media-Präsenz aufbaust. Als Projektmanager kannst du alles und nichts. Es geht immer nur um eins: Das sofort Wichtige vor dem demnächst Wichtigen zu tun. Unwichtiges gleich sein lassen. Am Ende erklärt man einen Haufen Reaktionen zu einem Masterplan. Wenn man von etwas keine Ahnung hat, schreibt man in den Projektplan entsprechenden Projektschritt und kauft jemanden mit Fachwissen ein. Ich war unnütz und überbezahlt zugleich. Merkte aber keiner, weil sich die Menschen nach Führung sehnten.
Routinen häuften sich an, wie alte Zeitungen. Ich konnte nie ruhig sitzen. Alles war langweilig. Wenn ich einen Film sah, machte ich nebenher Sit-ups und las auf dem Handy Nachrichten. Dann war ich kurz davon abgelenkt, dass ich in meiner kleinen Box einen unnützen Tag gealtert war.
Nun will ich es nicht zu lang halten mit den einleitenden Worten. Ich denke, ihr habt es verstanden: Das Leben war mir bereits im ersten Viertel meines Daseins öde. Die Existenz nur in ihrer Verdrängung amüsant. Was konnte mir helfen, dem Leben Interesse entgegenzubringen? Was führte dazu, dass man sich freute, morgens aufzuwachen? Antwortversuche füllen Kilometer von Bücherregalen.
Religiöse fand ich pfiffig, weil sie den Sinn in diesem Unsinn im Jenseits verorteten. Damit nahmen sie sich den Druck, im grauen Alltag Farbe finden zu müssen. Leiden war ok, damit konnte man Credits für die Chill-Out-Lounge im Himmel sammeln. Es gelang mir trotzdem nicht, davon etwas anzunehmen. Christus, Mohammed, Buddha oder auch der Beelzebub – keiner davon fand Einlass in mein Herz.
Viele Freunde suchten ihr Heil in Kindern oder Katzen. Kinder waren für mich aufgrund meiner (auch noch ungeouteten!) Homosexualität nicht so einfach. Haustiere hatte ich schon genügend beerdigt (drei Meerschweine und einen Hund).
Begabte Menschen widmeten ihr Leben einem Talent. Sie rannten, sie malten, sie sangen oder traten gegen einen Ball und lebten vom Applaus. Taten ständig nur die eine Sache, auf der Jagd nach Perfektion. Das schien mir attraktiv. Meine Marktanalyse ergab leider, dass ich selbst beim Saufen noch Mittelmaß war.
Was also sollte ich in dieser Welt mit mir anfangen? Selbstmord war mir völlig fremd. Es war ja nicht so, als hätte ich nicht noch eine Erwartung. Der Tod ist schon gewiss. Um seinen Abgang muss sich keiner Sorgen machen. Warum vorausgreifen?
Wann immer ich meine Mutter besuchte, hielt sie mir, wohl ähnlich vom Dasein verwirrt, einen neuen Lebensratgeber unter die Nase. Absolut deprimierende Machwerke, die die Kindheitsenttäuschung für Erwachsene reproduzierten.
Alle Bücher verkündeten, dass man alles tun und schaffen könnte, was immer man wollte: Im niedrigschwelligen Bereich mit guter Ernährung und Darmspülung; im ambitionierten Bereich mit jahrelanger, stummer Meditation im Kloster. Das Amüsante ist, dass Millionen diese Bücher lesen und davon träumen ihren Job hinzuschmeißen, während sie ins Büro fahren.
Aber etwas verfing bei mir: Die Annahme, man könnte mehr über die Freude am Leben lernen, indem man auf Reisen ging. Reisebücher werden von Leuten auf dem Balkon mindestens so gerne gelesen wie Lebensratgeber auf dem Weg ins Büro. Viele sind auch eine Mischung. Weil man im Amazonasdschungel Schlangen gegessen hat, wisse man nun den Bäcker um die Ecke richtig zu schätzen. Als man in Afrika mit den Einheimischen getanzt habe, habe man deren Lebensmut aufgesogen (»Die sind zwar arm, aber sooo freundlich!«).
Der deutsche Punkrocksänger Farin Urlaub beschreibt in einem Interview, wie er mittlerweile ganz entspannt bleibe, wenn er mit einer Pistole bedroht wird. Das sei schon sehr oft (»sehr sehr oft«) passiert und gehöre in Afrika zum guten Ton. Hatte er die Verunsicherung, die der unausweichliche Tod verbreitet, durch seine Abenteuer überwunden?
Mir selbst war Urlaub bis dahin an der Nordseeküste vergönnt gewesen. Leider kann ich nicht behaupten, dass Pellworm meine Ansichten zum Leben geändert hätte. Im Gegenteil: Der örtliche Tierarzt, der im Nebenerwerb Ferienwohnungen vermietete, war nach der Besamung von Dutzenden Kühen erst (und nur kurz) glücklich, wenn er abends den Ouzo auf den Tisch stellte.
Aber es ging bei der Idee mit dem Reisen auch nicht um eine Radtour durch die Uckermark, sondern darum, seinen Kontext radikal auf den Kopf zu stellen. Es ging um einen Kulturschock, darum, sich neu zurechtfinden zu müssen und um fehlende Frames. Es ging um die Hoffnung: Freiheit, Liebe, Abenteuer am Ende des Regenbogens!
Ich beschloss, mein unerhörtes Privileg (Deutscher Pass, dickes Bankkonto) wahrzunehmen und ein Reisender zu werden. Ich musste mal aus meiner Box springen. Farin Urlaub wirkte immer sehr glücklich. Vielleicht weil er sehr viele Zähne hatte, aber vielleicht auch wegen der vielen Stempel in seinem Pass. Es konnte doch sein, dass mir der Horizont fehlte, um die Ordnung zu begreifen, in die ich mich nicht fügen konnte? Dann würde ich entspannt auf den Tod warten können, ohne diese Unruhe, betrogen worden zu sein.
Ich will es vorwegnehmen. Es hat funktioniert. Ich bin jetzt wirklich Mr Happy. Gerne will ich mein Geheimnis teilen, euch mitnehmen auf die Reisen des jungen Mr Happy.
Ihr, die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren.
REISE 1:
GUNS AND MOSES IN ISRAEL
Idealistische Menschen wirken unangreifbar, als trügen sie eine Wahrheit in sich, die nichts erschüttern kann. Meine erste Station sollte daher eine politische sein. Ich wollte etwas haben, das meine innere Kompassnadel streng ausrichtete, und von Ideen beseelt werden, die über mein Leben hinausweisen konnten. Es musste um Fragen von Krieg und Frieden, Menschenrechten und Gerechtigkeit gehen.
Nur wenige Flugstunden von Deutschland entfernt, im Einzugsbereich des Eurovision Songcontest, liegt Israel. Jenes Gebilde, das unter dem Eindruck des Holocaust den Juden als Heimstätte (wieder-)gegeben wurde. Im idealistischen Raum scheinen zwei Sichtweisen auf Israel vorzuherrschen: Die einen sehen dieses kleine Fleckchen Land als wichtige Schutzstätte der Juden. Ein Ort, an dem sie nicht Gefahr laufen, erneut Opfer eines Völkermordes zu werden. An dem sie sich selbst verteidigen können.
Die andere Sichtweise versteht Israel als ein imperiales Projekt. Im Westen am grünen Tisch ersonnen, den arabischen Völkern aufgezwungen und durch Vertreibung der Palästinenser errichtet.
Ein Reisetrend ist es, seinen Aufenthalt mit einem Ehrenamt zu verbinden. Ich nahm Kontakt zum Israel Comitee against House Demolitions (ICAHD) auf. Eine israelische Organisation, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt. Die perfekte Dialektik. Sie fordern eine Zweistaatenlösung und bieten Widerstand gegen die israelische Praxis, palästinensische Häuser in den besetzten Gebieten abzureißen. Angeführt wird diese Nicht-Regierungs-Organisation von einem kleinen Weihnachtsmann namens Jeff Halper. Er wurde mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert. Angespuckt wurde er vermutlich noch häufiger.
Nach einem kurzen Skype-Interview war die Sache geritzt. Zwei Monate würde ich ohne Gegenleistung meine Arbeitskraft als Projektkoordinierer zur Verfügung stellen und erhoffte mir dafür einen Mindchanger.
Der Taxifahrer am Flughafen empfahl mir, meine Reise nicht in Tel Aviv zu beginnen, aber ich hörte nicht auf ihn. Ich begriff erst Wochen später, warum dieser Tipp richtig gewesen war.
Am Morgen nach meiner Anreise stand ich rauchend am Fenster meines Hotelzimmers und blickte auf die Israelfahnen, die überall am Strand wehten. Ein von vielen verteufeltes Land, stolz im Wind. Die Fahnen vermittelten mir ein Gefühl der Entschlossenheit eines Volkes, das am Abgrund der Vernichtung stand und es überlebt hatte. Im Fernsehen sangen U2 It’s a beautiful day. In der Tasche hatte ich die Nummer einer fetten Prostituierten, die ich aus Dankbarkeit in der Nacht zuvor fast aufs Zimmer mitgenommen hätte. Da ich keine Unterkunft reserviert hatte und Ferienzeit war, war ich die halbe Nacht umhergeirrt, um ein Zimmer zu finden. Ihre profunden Hotelkenntnisse hatten mich gerettet. Sie hatte gewusst, wo noch ein paar Betten frei waren. Im Nachbarzimmer stritt ein französisches Pärchen über einen Bordellbesuch.
Ich flanierte am Strand und war überwältigt von Lebensfreude und Toleranz. Übergroße Wandmalereien feierten die schwule Liebe. Die Menschen trugen trendige Klamotten. Es gab moderne Clubs. Die Leute schienen nicht nur zu leben. Sie feierten jeden Augenblick. Das sah nicht nach imperialer Unterdrückung aus, sondern nach Befreiung. Ein Ort, an dem Liebe und Träume blühen konnten. Die Steinzeit-Feinde ringsum versuchten es zu zertreten. Nur die Israel Defense Forces (IDF) hielten die dünne Front zwischen Freiheit und Zerstörung. Das Land ist nur wenige Kilometer breit. Hinter Tel Aviv war das Meer. Israel steht im Grunde immer mit dem Rücken zur Wand. Eine Drehtür der Gefühle geriet in Bewegung.
Was mich erschreckte, war, dass jeder kleine Laden eine eigene Security hatte. Das Sicherheitsbedürfnis war durch Jahrzehnte voller blutiger Anschläge maximal. Ich versuchte, mich nicht stressen zu lassen. Die Paranoia war mir fremd. Nach zwei Tagen ging ich zu Fuß mit meinem Rollkoffer zum Bahnhof von Tel Aviv. Bahnhöfe sind in diesem Land immer am Stadtrand zu finden.
Weil ich befürchtete, ich könnte nicht genug Facebook-Erinnerungen haben, fotografierte ich ein bisschen die Gegend. Ich dachte noch, dass die Häuser auf der anderen Straßenseite merkwürdig unecht aussahen, als seien sie nur aufgemalt. Dann schrie jemand hinter mir in kehligem Englisch, ich solle stehen bleiben. Verwundert drehte ich mich um und sah einen kleinen Mann, der aussah wie jemand, der Ladendiebe jagte, auf mich zusprinten. Beim Rennen sprach er in sein Funkgerät.
»Gibt es ein Problem?«, versuchte ich mich zu erkundigen. Barsch wurden mein Koffer und ich getrennt. Noch mehr Security erschien, wie Fliegen, die einen Scheißhaufen gefunden hatten. Einer schnappte sich meinen Koffer und legte ihn in eine Häuserecke. Zwei andere hielten mich an den Armen fest.
»Entschuldigung, ich will nur zum Bahnhof?«
Bis hierhin war ich begeisterter Zuschauer. Vor mir entrollte sich eine großartige Anekdote.
»Geben Sie uns den Schlüssel für Ihren Koffer.«
Ich holte den Schlüssel bemüht langsam aus meiner Tasche. Alle waren sehr nervös. Die Sonne brannte ihr Autogramm tiefrot in meine Stirn.
Mit dem Schlüssel in der Hand näherte sich die arme Sau vorsichtig meinem Koffer. Ich malte mir aus, was passieren würde, wenn ich wirklich ein Terrorist wäre. Dann würde er sich gleich zusammen mit meinen Unterhosen in der näheren Umgebung verteilen.
Nach einer ersten Prüfung meiner Unterwäsche wurde ich in ein naheliegendes Gebäude gebracht und auf einen Stuhl gesetzt. Am Eingangstor sah ich zum Hohn das große Schild »Fotografieren verboten«.
Es gab eine Theke, auf die mein Koffer gelegt und ausgeweidet wurde. Zwei schwarze Soldaten mit schlechtsitzenden Uniformen und Maschinengewehren standen missmutig herum. Ein dicker Polizeibeamter kam herein, ließ sich instruieren und begann mir immer dieselben Fragen zu stellen:
»Warum fotografierst du hier?«
»Wo willst du hin?«
»Wo hast du letzte Nacht geschlafen?«
Ich antwortete auf alles: »Keine Ahnung, ich bin nur Tourist.«
Eine Ahnung ließ mich mein Praktikum verheimlichen. Ich fühlte mich respektlos behandelt. Spätestens seit sie in meinen Koffer gesehen hatten, hätte das Ganze eine Wendung nehmen müssen. Aber sie hatten eine Lüge gerochen.
Der Polizist nahm meine Digitalkamera und sah sich ohne mein Einverständnis die Fotos an. Schnell war er bei Fotos aus Deutschland angelangt. Darauf zu sehen waren ich und Jannes. Er trug ein Metal-Shirt von mir.
»Wer ist das?«
»Das ist mein Boyfriend.«
Kurz vor meiner Abreise hatte ich Jannes kennengelernt. Einen jungen Tänzer, der aussah wie die polnische Version von Justin Bieber. Völlig betrunken war ich über mich hinausgewachsen und hatte ihn am Pissoir einer Kneipe, in der ich meine baldige Reise feierte, angesprochen. Er kam mit mir nach Hause, Neugierde trieb ihn. Meine betrunkene Selbstsicherheit hielt kaum fünf Minuten, nachdem wir die Bar verlassen hatten. Ich war völlig verschüchtert und unbeholfen. Wir verbrachten dann die Nacht zusammen. Es war eine Nacht, in der das Schicksal nach Sex verlangt hatte, aber ich war dazu nicht in der Lage gewesen, hatte mich nur weiter an meiner Hausbar betrunken, konnte keine Nähe zulassen. Immer wenn er an mich herangerückt war, war ich aufgesprungen. Trotzdem schlief er bei mir. Dafür hatte ich ihm das Metal-Shirt gegeben. Erst als er schlief, hatte ich mich langsam annähern können und ihn umarmt. Da war so viel Angst im Weg gewesen, soviel Unfähigkeit, meine Gefühle auszudrücken. Nun nannte ich ihn »Boyfriend«. Ich sprach es aus, ohne nachzudenken. Ich wollte keinen Millimeter in die Defensive geraten. Der Polizist war der erste Mensch, vor dem ich mich geoutet hatte.
»Dein Boyfriend? Du bist schwul?«
»Ja, bin ich.«
Auch im liberalen Israel schien er überrascht darüber zu sein, mit welcher Klarheit ich seine Fragen beantwortete. Das gab mir kurz Oberhand. Dann fanden sie mein Notizbuch.
Es entstand wilder Gesprächsbedarf. Der Polizist nahm das Notizbuch und schlug die Seite auf, auf der ich mir die Adresse von verschiedenen Hostels in Jerusalem notiert hatte.
»Warum ist hier eine Adresse in Ostjerusalem? Was willst du da?«, sein Ton wurde nun ernster.
»Das ist ein Hostel, wo ich vielleicht übernachten will.«
»Wen triffst du da?«
»Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich treffe da niemanden. Ich will nur gucken, ob es da ein freies Zimmer gibt.«
Er sah mir tief in die Augen.
»Für wen ist das Geld?«
Aus den letzten Seiten des Notizbuches rutschten dreihundert Euro in seine Hand.
»Das ist mein Geld.«
Ich bekam ein warnendes Gefühl. Die Indizien verwandelten sich in dieser Unterhaltung Stück für Stück in eine Realität, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte.
»Warum ist hier die Adresse von ICHAD aufgeschrieben? Kennst du diese Organisation?«
»Ja, ich kenne die.«
»Woher kennst du sie?«, er kam näher an mein Gesicht.
»Aus dem Internet. Ich habe Politik studiert. Ich interessiere mich für solche Sachen.«
Ich begab mich vollends auf das Glatteis einer Lüge. Ob das Eis trug, war ungewiss. In meinem Kopf tauchte die Frage auf, ob mein Touristenvisum rechtlich ausreichend war, um ein Praktikum zu machen?
Auf diese Weise vergingen zwei Stunden. Immer wieder dieselben Fragen, immer wieder dieselben Antworten. Sogar nach Jannes fragte er erneut. Es ging sicherlich darum, einen Widerspruch zu finden.
Nach vier Stunden betrat ein neuer Mann das Spielfeld. Trotz des Hemdes war erkennbar, dass er überall stark behaart war. Die Haare kräuselten aus jeder Ritze, guckten ihm hinten aus dem Kragen. Er nahm meinen Pass und auch meine Bankkarte und kopierte sie. Dann führte er mich nach draußen auf die Straße. Den Pass nahm er dabei mit, alles andere blieb im Raum. Er gestattete mir, eine Zigarette zu rauchen. Die perfekte Gelegenheit, um wegzurennen. Ob sie das wollten? Es wäre ein starkes Indiz für meine ansonsten noch nebulöse Schuld.
»Du hast gesagt, du kennst ICHAD. Dann sagst du, du triffst niemanden. Das ist Bullshit!«
Ein paar Tränen meldeten sich in meinen Augen. Es war so absurd.
»Nicht ›kennen‹, kennen. Nicht persönlich kennen. Ich habe im Internet darüber gelesen und fand es interessant.«





























