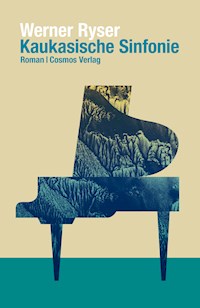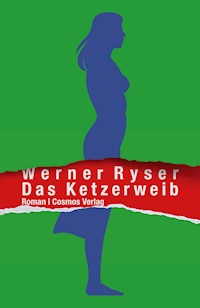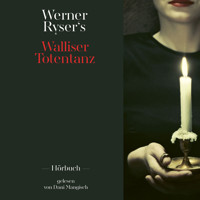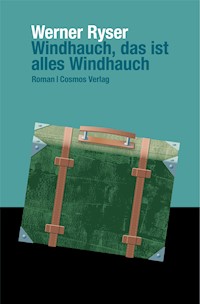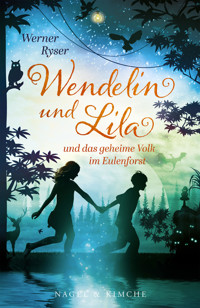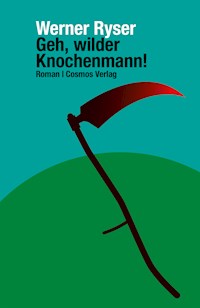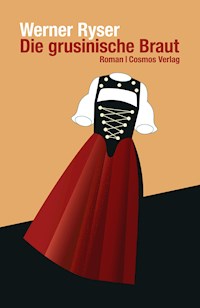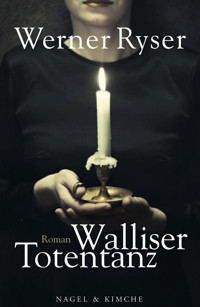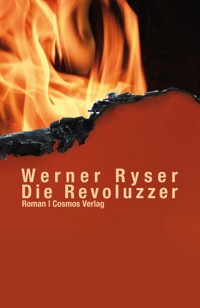
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cosmos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Niemand wird mir den Mann abspenstig machen, den ich liebe." Sie ist die Basler Patrizierin Dorothea Staehelin, er ist der Bauer Mathis Jacob, Pächter ihres Sennhofs am Oberen Hauenstein. Es ist der Vorabend der französischen Revolution. Die Menschen in der Landschaft Basel sind leibeigene Untertanen des städtischen Regimes. Die revolutionären Forderungen nach Freiheit und Gleichheit, die in Form von Flugblättern auch in die abgelegenen Juratäler kommen, lassen Mathis zusammen mit anderen Baselbieter Leibeigenen zum Rebellen werden … Werner Ryser schreibt mehr als nur grossartige historische Romane. Wie in "Walliser Totentanz" und "Das Ketzerweib" erzählt er auch in diesem Roman von Machtmissbrauch und Knechtschaft. Und von einem, der fest auf der Erde steht und gleichzeitig die Arme zu den Sternen streckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Ryser
Die Revoluzzer
RomanCosmos Verlag
Für Heidi und Ursula
Alle Rechte vorbehalten
© 2017 by Cosmos Verlag AG, Muri bei Bern
Lektorat: René Karlen
Umschlag: Stephan Bundi, Boll
Satz und Druck: Merkur Druck AG, Langenthal
Einband: Schumacher AG, Schmitten
ISBN 978-3-305-00476-8
eISBN 978-3-305-00496-6
Das Bundesamt für Kultur unterstützt
den Cosmos Verlag mit einem Strukturbeitrag
für die Jahre 2016–2020
www.cosmosverlag.ch
Inhalt
Die Leibeigenen 1775–1796
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Die Patrioten 1796–1798
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Franzosenzeit 1798–1813
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Herrenjahre 1813–1816
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Freiheit und Gerechtigkeit? 1816–1852
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nachwort
Werner Ryser: Das Ketzerweib Roman. 224 Seiten. Cosmos Verlag
Die Leibeigenen
1775–1796
1
Am Sonntag, dem 16. Juli 1775, wollte Mathis Jacob, dessen Vater Pächter auf dem Sennhof Sankt Wendelin am Oberen Hauenstein war, mit der achtzehnjährigen Barbara Strub vor den Traualtar treten. Die Zeit drängte, denn die Braut war bereits im vierten Monat schwanger, und ihr Zustand würde sich nicht mehr lange verbergen lassen. Was noch fehlte, war der Eheschein, der in der Kanzlei des Schlosses ausgestellt wurde und für den eine Gebühr von zwei Pfund zu entrichten war. Gleichzeitig wurden Uniform und Waffen inspiziert, welche sich die Wehrmänner der Landmiliz, der Mathis wie jeder Baselbieter angehörte, auf eigene Kosten anschaffen mussten. Mathis hatte sein Steinschlossgewehr und das Bajonett gereinigt, und jetzt, vier Tage vor der Hochzeit, war er in der blauroten Montur, die seine Mutter am Vorabend ausgebürstet hatte, unterwegs Richtung Schlossberg.
Seit bald sechs Jahrhunderten beherrschte die hochmittelalterliche Veste, die wie ein Adlerhorst auf einer zerklüfteten Fluh über dem Städtchen Waldenburg thronte, die Strasse über den Oberen Hauenstein. Sie diente seit bald vierhundert Jahren den Gnädigen Herren der Stadt Basel als Sitz für die Landvögte, die in ihrem Auftrag über ihre leibeigenen Baselbieter Untertanen regierten. Die Anlage war durch eine Ringmauer und steil abfallende Felswände geschützt und bestand aus einer Hauptburg, einem Bergfried, Wohngebäuden sowie dem alten und dem neuen Schloss, einem mehrstöckigen Palas.
Gegen neun Uhr stieg Mathis die schier unendlichen Treppenstufen hinauf und durchquerte den Zwinger der Vorburg. Eine Wache, die am inneren Tor stand, wies ihm den Weg in den Empfangsraum, wo ihm ein zweiter Soldat bedeutete, Platz zu nehmen. Rund ein Dutzend Bauern und Handwerker warteten bereits. Sie waren entweder vorgeladen worden oder hatten, wie er, ein Anliegen an die Obrigkeit.
Die städtischen Landvögte in den sieben Ämtern des Kantons überwachten die von ihnen als Gemeindevorsteher ernannten Meier oder Untervögte und die dörflichen Niedergerichte. Darüber hinaus zogen sie die Steuern ein und machten, zusammen mit den Pfarrherren, die Erlasse des städtischen Rats bekannt und kontrollierten deren Einhaltung. Neben ihrem Gehalt und den Einkünften aus dem von einem Pächter geführten Bauerngut, dem Schlosshof, standen ihnen die Gebühren für die von ihrer Kanzlei ausgestellten Urkunden zu. Ausserdem erhielten sie einen Anteil der von ihnen verhängten Bussen.
Während der Schlossschreiber, Koni Schäublin, die Vorgeladenen, einen nach dem anderen, in die Kanzlei rief, unterhielten sich die Wartenden. Man erzählte sich, weshalb man hier war. Einer war verklagt worden, weil er nach seiner Hochzeit den Gästen zum Tanz hatte aufspielen lassen, ein Vergnügen, das die sittenstrengen Gnädigen Herren partout nicht dulden mochten. Zumindest nicht unter den Landleuten. Ein anderer erwartete eine Geldstrafe, weil er seine Verwandten im fricktalischen Rheinfelden besucht, also verbotenerweise fremdes, vorderösterreichisches Territorium betreten hatte. Die Rede kam auf die Willkür der Landvögte, auf die Gier, mit der sie Bussen und Gebühren eintrieben, um so ihre Amtszeit, die sie dem Losglück verdankten, möglichst ertragreich zu gestalten. Franz Brodbeck, der zurzeit das Amt Waldenburg verwaltete, hatte den Ruf, ein launischer Herr zu sein, der seine Entscheidungen ganz nach eigenem Gusto traf.
Staunend folgte Mathis Jacob der Unterhaltung. Bis heute hatte sich der zweiundzwanzigjährige Jungbauer wenig Gedanken über Fragen von Macht und Herrschaft gemacht. Wenn es im Schloss etwas zu regeln gegeben hatte, war das von seinem Vater Johannes erledigt worden. Aber die Kräfte des Alten liessen nach, und Mathis würde wohl bald den Hof und damit auch den Verkehr mit der Landvogtei übernehmen müssen.
Gegen Mittag trat der etwa dreissigjährige Schreiber in die Tür der Kanzlei und sagte, der Herr Landvogt habe die Geschäfte mit den Vorgeladenen erledigt. Jetzt sei er ausgeritten. Jene, die ein Anliegen an ihn hätten, müssten sich bis zu seiner Rückkehr gedulden.
Mathis wurde unruhig. Er hatte damit gerechnet, zum Mittagessen zu Hause zu sein. Er fragte einen älteren Mann, der ebenfalls etwas vom Landvogt wollte, wie lange es wohl dauern werde, bis der Gnädige Herr zurück sei.
Der andere zuckte mit den Schultern: «Wenn wir Glück haben, vielleicht drei Stunden. Es kann aber auch sein, dass wir morgen früh wiederkommen müssen.»
«Aber ich brauche den Eheschein! Er kann uns doch nicht einfach hängen lassen!»
«Er kann», sagte der Mann. «Glaub mir, er kann.»
Die Gespräche verstummten. Die meisten dösten auf den harten Bänken an der Wand. Mathis wanderte unruhig hin und her. Er hatte Hunger. Die Zeit zog sich in die Länge. Man hörte den Glockenschlag der Schlossuhr. Er verkündete die erste, die zweite und dann die dritte Stunde des Nachmittags.
Um vier Uhr wurde die Tür zur Kanzlei wieder geöffnet, und der Erste der Wartenden durfte sein Anliegen vortragen. Er schien seine Sache schlecht zu vertreten. Bis in den Empfangsraum hörte man die Stimme des Landvogts, der den Bittsteller lautstark massregelte. Mit betretenem Gesicht kam der Mann heraus. Wortlos verliess er den Ort seiner Niederlage. Auch den beiden Nächsten, die vorgelassen wurden, ging es nicht besser. Der Lärm, der aus der Kanzlei drang, machte deutlich, dass sich die Laune des Gnädigen Herrn zusehends verschlechterte.
Dann war Mathis an der Reihe. Er trat über die Schwelle. Franz Brodbeck lag halb in seinem grossen, geschnitzten Sessel, die Hände über dem Bauch gefaltet. Koni Schäublin beugte sich hinter seinem kleinen Pult über irgendwelche Akten.
«Nimm Stellung an!», bellte der Landvogt. Und während Mathis Jacob steif und starr dastand, sein Gewehr vorschriftsgemäss mit der Linken am Lauf umklammerte und gegen Hüfte und Ferse presste, erhob sich der Herr, umkreiste ihn lauernd und musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen. Mathis kam sich vor wie ein Stück Vieh, das auf dem Markt vom Händler begutachtet wurde.
«Wenigstens einer, der nicht aussieht wie ein vollgeschissener Strumpf», knurrte Brodbeck schliesslich. «Rühr dich! Was willst du?»
Er bitte untertänigst um einen Eheschein, sagte der junge Mann.
«Das kostet zwei Pfund. Hast du das Geld?»
Mathis holte seinen Beutel aus der Tasche. Schäublin fragte nach seinem Namen und dem seiner Braut. Alles wurde notiert. Und während der Hochzeiter umständlich die geforderten vierzig Schillinge, die ihm der Vater gegeben hatte, auf den Tisch zählte, wollte der Vogt wissen, wann die Trauung sei.
«Am Sonntag, Gnädiger Herr.»
«Was?», schrie Brodbeck. «Seid ihr schon verkündet?»
«Ja, Gnädiger Herr.»
«Der Pfaffe weiss, dass er niemanden verkünden darf, bevor ich nicht die Einwilligung gegeben habe. Ich will ihn lehren, sich an Recht und Ordnung zu halten. Sag ihm, dass ich ihn beim wohlweisen Herrn Bürgermeister verklagen werde. Und nun verschwinde!» Er wandte sich an den Schreiber: «Ihr werdet dem Bauern keinen Schein ausstellen.»
«Aber Gnädiger Herr …», begann Mathis, der an seine schwangere Braut und an das bereits bestellte Hochzeitsessen im Wirtshaus dachte.
«Schweig», brüllte Brodbeck, «oder ich lasse dich ins Verlies sperren, wo du Zeit hast, darüber nachzudenken, wie man sich gegenüber seiner Obrigkeit benimmt!»
Mathis spürte, wie der Zorn in ihm hochkroch. Was konnte er dafür, dass sich Pfarrer Werthemann nicht an die Regeln gehalten hatte. «So gebt mir wenigstens mein Geld zurück …»
Weiter kam er nicht. Der Landvogt hieb mit der flachen Hand auf den Tisch. «Der Kerl kommt für fünf Tage bei Wasser und Brot ins Loch!», schrie er. «Das wird ihn lehren, wie sich ein Bauernlümmel gegen seine Herrschaft zu benehmen hat. Schaff ihn hinaus.»
Schäublin stand auf und drängte Mathis aus dem Zimmer. «Komm», flüsterte er dem sich Sträubenden ins Ohr, «mach dich nicht unglücklich. Fünf Tage sind keine Zeit.»
Draussen im Empfangsraum wies er die Wache an, Mathis in den Kerker zu bringen.
Es war ein finsteres Loch, in das man Mathis Jacob eingesperrt hatte. Aus einer schmalen Luke fiel nur wenig Licht in den engen Raum mit vier feuchten Mauern aus rohen Quadersteinen und einem gestampften Lehmboden. Seine Notdurft würde er in einer Ecke verrichten müssen. Er setzte sich auf eine aus ungehobelten Brettern gefügte Pritsche. Noch immer war er voller Zorn über die Willkür des Landvogts. Zu Hause wartete man auf ihn. Auch seine Braut würde gegen Abend von Waldenburg, wo sie lebte, nach Sankt Wendelin hinaufsteigen, um mit ihm noch dieses und jenes im Zusammenhang mit der Hochzeit zu besprechen, die nun gar nicht stattfand, jedenfalls nicht am nächsten Sonntag. Hoffentlich erzählte ihr der Schlossschreiber, der auch im Städtchen wohnte, was geschehen war.
Seiner misslichen Lage zum Trotz lächelte Mathis, als er sich vorstellte, wie Barbara zetern würde, wenn sie von seinem Missgeschick erfuhr. Sie war ein temperamentvolles Ding und würde ihn dafür verantwortlich machen, dass sie nun mit dickem Bauch vor den Altar treten musste und man sich im ganzen Tal das Maul über das hitzige junge Paar zerreissen würde, das nicht hatte warten können und es bereits vor der Hochzeitsnacht miteinander getrieben hatte.
Mathis hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Wasser und Brot, hatte der Landvogt gesagt. Ob er bereits heute etwas bekommen würde? Er glaubte es nicht. Der Hunger, die Dunkelheit, das Nichtstun – ihm standen wohl die fünf längsten Tage seines bisherigen Lebens bevor.
Während er so dasass, den Kopf in die Hände gestützt, fiel ihm ein, dass er nicht der erste Jacob war, den man ins Verlies geworfen hatte. Seine Vorfahren waren im letzten Jahrhundert im Emmental als Täufer verfolgt worden. Den Urgrossvater, Ueli Jacob, hatten die Gnädigen Herren von Bern seines Glaubens wegen zu einer Galeerenstrafe verurteilt. Auf einer Ruderbank angeschmiedet, war er elend zugrunde gegangen. Seine Frau Anna, die sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hatte, war im Schloss Trachselwald eingekerkert und dann aus ihrer Heimat verbannt worden. Mit ihren drei Jüngsten war sie auf den Sonnenberg im Fürstbistum Basel gezogen, wo man mit Erfolg eine Käserei geführt hatte. Ihr Enkel Johannes, der Vater von Mathis, hatte keinerlei Aussicht, den Betrieb übernehmen zu können, denn dieser wurde nach bernischer Tradition an den jüngsten Sohn vererbt. So wanderte er in den Baselbieter Jura aus. Am Oberen Hauenstein, auf halber Höhe zwischen dem Städtchen Waldenburg und Langenbruck, fanden er und seine Familie ein Auskommen als Pächter von Sankt Wendelin, einem Sennhof, der dem reichen Basler Seidenfabrikanten Remigius Preiswerk gehörte. Der Bändelherr hatte ihn vor zwei Jahren, als seine Tochter Dorothea den Obristen Staehelin heiratete, der jungen Frau als Mitgift überschrieben.
Mathis legte sich auf die harte Pritsche und starrte in die Dunkelheit. Was wohl die Leute auf Sankt Wendelin machten?
Zur selben Stunde sassen dort Elisabeth Preiswerk, eine geborene Debary, und ihre Tochter Dorothea vor dem Hof an ihren Staffeleien und bemühten sich, den rot flammenden Abendhimmel über den bewaldeten Hügeln im Westen auf die Leinwand zu bannen. Remigius Preiswerk stand hinter ihnen. Er unterbrach seine wenig kunstsinnigen Bemerkungen, mit denen er das Schaffen der beiden Frauenzimmer kommentierte, und starrte stirnrunzelnd auf seinen Pächter, der vergeblich versuchte, die hemmungslos weinende Braut seines Sohnes zu trösten. Sie war soeben auf Sankt Wendelin eingetroffen.
«Was hat denn die Dirne so zu heulen», knurrte Preiswerk schliesslich. «Geh, frag sie», befahl er Dorothea.
Die junge Frau gehorchte widerwillig. Es widerstrebte ihr, sich in die Angelegenheiten der Jacobs zu mischen.
Schluchzend erzählte Barbara Strub, sie habe vor einer Stunde vom Schlossschreiber Schäublin erfahren, dass der Landvogt ihren Mathis für fünf Tage ins Loch gesteckt habe und dass nun am Sonntag nichts aus der Hochzeit werden könne.
Der Seidenbandfabrikant, der zu ihnen getreten war, hörte zu. «Soso», bemerkte er spöttisch. «Und den Pfarrer Werthemann will er beim wohlweisen Herrn Bürgermeister verklagen.» Dann wandte er sich barsch an die weinende Barbara: «Hör auf zu flennen, das bringt jetzt auch nichts! Ich werde morgen ins Schloss reiten und die Sache regeln.»
Als Remigius Preiswerk am nächsten Tag von seinem Ausritt zurückkam, übergab er Dorothea den Eheschein. «Bring ihn zu Johannes und sag ihm, sein Sohn könne heiraten, sobald er seine Strafe abgesessen habe.» Er war gut gelaunt. Auf ihre Frage, wie er das Kunststück fertiggebracht habe, den Landvogt umzustimmen, erklärte er: «Ich habe dem Parvenü mit seinem wohlweisen Herrn Bürgermeister gedroht.»
Dorothea begriff. Für den reichen und angesehenen Fabrikanten und Handelsherrn, der als Dreizehnerrat dem wichtigsten Kollegium der Basler Obrigkeit angehörte, waren Zeitgenossen wie Brodbeck Nonvaleurs. Selbst wenn sie ein gewisses Vermögen besassen, stammten sie nur aus Handwerkerkreisen. Für solche Leute war das Amt eines Landvogts, das sie nur dank Losglück erhielten, bereits die höchste Stufe, die sie erreichen konnten. Brodbeck gehörte eben nicht zu jenen alteingesessenen Familien wie die Burckhardts, die Vischers, die Staehelins, die Preiswerks, die Iselins oder die Werthemanns, die über die Verhältnisse im Kanton Basel bestimmten. Als Mitglied des Kleinen Rats war der Vater letztlich Vorgesetzter des Landvogts. Ausserdem war er nicht nur mit dem Pfarrer von Waldenburg, sondern über seine Frau auch mit dem Bürgermeister Johannes Debary verwandt. Dass Brodbeck damit gedroht hatte, Werthemann beim Staatsoberhaupt zu verklagen, war für ihn unfassbar. Er hatte den Wichtigtuer auf den ihm gebührenden Platz verwiesen.
«Und wann kommt Mathis zurück?», wollte Dorothea wissen.
«Der wird seine Strafe abhocken müssen», knurrte Preiswerk. «Ich habe ihm übrigens noch fünf weitere Tage aufgebrummt. Es ist höchste Zeit, dass der Kerl lernt, was ein Herr und was ein Knecht ist.» Er wandte ihr den Rücken zu und stolzierte über den Hof. Am Sonntag würden er und seine Frau nach Basel fahren.
Dorothea sah ihrem Vater nach. Sie hasste ihn. Er war ein machtbesessener, auf seine Würde bedachter städtischer Patrizier, der das Glück seiner Mitmenschen bedenkenlos mit Füssen trat, wenn es um seine eigenen Interessen ging. Manchmal geschah dies gar aus einer blossen Laune heraus. Nicht nur Mathis, auch sie selbst war ein Opfer der väterlichen Willkür.
Mathis war zwei Jahre älter als sie. In ihrer Jugend waren sie unzertrennlich gewesen. Sie begleitete ihn auf die Weide und in den Wald. An seiner Seite half sie bei der Heuernte mit. Er brachte ihr das Melken bei. Einmal durfte sie dabei sein, als eine Kuh kalbte. Dorothe nannte er sie – bis zu jenem Tag vor vier Jahren, als ihr Vater zwischen seinen Geschäften in der Stadt wieder einmal für zwei oder drei Tage nach Sankt Wendelin kam. Preiswerk machte dem damals Achtzehnjährigen unmissverständlich klar, dass er als Sohn des Pächters seine Tochter als Jungfer Dorothea anzusprechen habe. Er hatte ihn unterm Kinn gefasst und gezwungen, ihm in die kalten Augen zu schauen. «Jungfer und Dorothea. Dorothea, nicht Dorothe. Sie ist schliesslich keine Bauerndirne. Hast du das verstanden?» Und als der junge Mann eingeschüchtert schwieg, lauter: «Hast du das verstanden?»
«Ja, Herr», presste Mathis zwischen den Zähnen hervor.
«Na also, es geht doch.» Remigius Preiswerk wandte sich an Mathis’ Vater, der schweigend danebenstand. «Wenn du auf dem Hof Pächter bleiben willst, Johann», knurrte er, «dann sorg dafür, dass die Ordnung der Dinge gewahrt bleibt.»
Später, beim Nachtessen, oben in der Wohnung, begehrte sie gegen den Alten auf. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen: «Ich bin nicht die Jungfer Dorothea!», schrie sie. «Nicht für Mathis.»
Er zog die Brauen zusammen. «Jungfer Dorothea und später Madame und der Name des Mannes, den ich für dich aussuchen werde.»
«Nein.» Sie ballte die Fäuste.
«Nein?» Remigius Preiswerk packte sie, legte sie übers Knie und verprügelte sie mit seinem Stock. «Wer bist du?», brüllte er, immer wieder. «Wer bist du?» Er liess erst von ihr ab, als sie ihm schluchzend bestätigte, sie sei die Jungfer Dorothea.
Am andern Tag, als sie sich vor dem Hof begegneten, schauten sich die beiden Jungen verstört an. «Grüss dich, Mathis», sagte sie schliesslich.
«Grüss Euch.» Er schaute sie kurz an und lief dann in Richtung Wald davon.
Damals war etwas in ihr zerbrochen. Zwei Jahre später wurde Dorothea, ohne dass man sie nach ihrer Meinung gefragt hätte, standesgemäss mit dem mehr als doppelt so alten Christoph Staehelin verheiratet. Nachdem dieser während Jahren als Offizier in einer der vier Basler Kompanien in Frankreich gedient hatte, wurde er Oberst bei der Landmiliz. Die Ehe war nicht glücklich. Trotz Dorotheas Bitten und Drängen weigerte sich Staehelin, ein ausgesprochener Libertin, sein Verhältnis mit einer Dame von zweifelhaftem Ruf aufzugeben.
Dass sie zur Heirat den Hof Sankt Wendelin als Brautgabe erhalten hatte, war für sie ein Trost. Staehelin war kurz nach der Hochzeit einmal dort gewesen. Aber das Landleben behagte ihm nicht. Dorothea hingegen verbrachte die Zeit zwischen Johanni und Michaelis meist auf dem Hof.
Mathis schloss, vom ungewohnten Licht geblendet, die Augen. Die Tür zu seinem Kerker war endlich aufgeschlossen worden, und eine Laterne erleuchtete das Verlies. Gestern hätte seine Hochzeit stattfinden sollen. Jetzt würde man ihn laufenlassen.
«Das stinkt ja wie in einem Schweinestall», sagte Brodbeck angewidert und trat einen Schritt zurück. Der Landvogt hatte sich persönlich zu ihm in die Unterwelt bemüht. Eine Wache begleitete ihn. «Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt», knurrte er.
«Ja, Gnädiger Herr», sagte Mathis, gewillt, den Zorn zu bezähmen, der ihm geholfen hatte, die vergangenen Tage zu überstehen.
«Nun, der Ratsherr Preiswerk war der Meinung, die fünf Tage, zu denen ich dich verurteilt habe, seien für einen Flegel wie dich zu wenig, um ihn zur Besinnung zu bringen. Wir werden dich deshalb bis Ende Woche hierbehalten.» Brodbeck sah seinen Gefangenen lauernd an.
Mathis biss sich auf die Unterlippe
«Du hast nichts dazu zu sagen?»
«Nein, Herr», sagte er gepresst.
«Weiterhin Wasser und Brot!», befahl der Landvogt der Wache. «Und nun sperr die Türe wieder zu!»
Wie betäubt liess sich Mathis auf die Pritsche fallen. Seit Remigius Preiswerk ihm zu verstehen gegeben hatte, dass er keinerlei freundschaftlichen Verkehr zwischen ihm und Dorothea dulde, hatte er den Sohn seines Pächters mit Misstrauen beobachtet. Mathis wusste, dass der Tyrann an jenem Abend seine Tochter gezüchtigt hatte. Er war damals im Hof unter dem offenen Fenster gestanden, ohnmächtig, mit geballten Fäusten.
Mathis hatte sich geschämt, dass er unfähig war, sie vor ihrem Vater zu schützen. Er war überzeugt, ihrer nicht wert zu sein. Seither hatte er sich von Dorothe – für ihn war sie Dorothe geblieben – ferngehalten. Und er hatte auch stets darauf geachtet, dem Alten nicht in die Quere zu kommen. Weshalb hatte Remigius Preiswerk trotzdem seine Kerkerhaft verlängert? Aus schierer Boshaftigkeit? Ging es ihm darum, seine Macht zu demonstrieren und ihn, den leibeigenen Untertanen, klein zu halten?
Mathis spürte, wie sich zum Zorn der vergangenen Tage der Hass gesellte, ein kalter, abgrundtiefer Hass: auf den Landvogt, auf Remigius Preiswerk, auf die Gnädigen Herren von Basel. Und er fühlte, dass dieser Hass ihn künftig begleiten würde.
Am 22. Juli blieb Dorothea Staehelin in ihrer Wohnung. Sie wusste, dass Mathis heute im Verlauf des Tages aus seiner Haft entlassen würde. Das niederträchtige Handeln ihres Vaters erfüllte sie mit Scham, und die Vorstellung, dass Mathis glauben könnte, sie sei damit einverstanden gewesen, quälte sie. Was sollte sie tun oder sagen, wenn sie ihm draussen vor dem Haus gegenüberstehen und er an ihr vorbeigehen würde, ohne sie zu beachten?
Sie hatte sich mit einer Stickerei ans Fenster gesetzt, aber sie mochte nicht arbeiten. Sie dachte an das schwärmerische junge Mädchen, das sie einst gewesen war. Ihr Herz war weit geworden, wenn sie das Geläut der Herden und den morgendlichen Gesang der Vögel gehört hatte. So hatte sie es jedenfalls in einem Brief an ihre Freundin, Anna Sarasin, formuliert. Was sie ihr aber nicht geschrieben hatte: In Mathis Jacob, dem Sohn des Pächters, sah sie das lebende Vorbild für den allerliebsten Schäfer in seinem Rokokokostüm, das in der Manufaktur von Meissen hergestellt worden war und im elterlichen Haus zum Goldenen Falken am Nadelberg die Kredenz zierte.
Vom Vorhang halb verborgen, schaute sie immer wieder aus dem Fenster. Endlich, um die Vesperzeit, sah sie, wie Mathis vom Wald her auf den Hof zuschritt: ein Soldat der Landmiliz, das Gewehr an einem Riemen über die Schulter gehängt. Ihr Herz klopfte wie wild, und sie spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Seine Uniform war verschmutzt, sein Gesicht ausgezehrt vom zehntägigen Fasten, sein schwarzes, struppiges Haar fiel ungekämmt über die Ohren, und seine unrasierten Wangen und das Kinn schimmerten bläulich. Das war nicht mehr der romantische Schäfer ihrer Jungmädchenträume, das war ein Krieger, der stattlichste Mann, dem Dorothea je begegnet war.
Mathis schaute zum Fenster hoch. Ihre Blicke kreuzten sich. Zaghaft hob sie die rechte Hand. Huschte ein Lächeln über sein Gesicht? Sie glaubte, es gesehen zu haben. Sie wollte es gesehen haben.
2
Dorothea liebte das Land am Oberen Hauenstein mit seinen steilen Hügeln, den schroffen Kalksteinfelsen, dem lichten Mischwald und den Waldweiden. Sie liebte den weiten Blick nach Norden über die Hochebenen des Tafeljuras bis zum fernen Schwarzwald. Sie liebte Sankt Wendelin, ihren Hof, mit seinen aus hellem Jurakalk gefügten Bruchsteinmauern und dem mit Ziegeln bedeckten Satteldach. Es beschirmte den grossen Stall, das Tenn und die beiden Wohnungen, von denen sie jene im ersten Stockwerk für sich bestimmt hatte. Sie oben, die Jacobs unten. Besitzer und Pächter, städtische Herrschaft und ländliche Untertanen, oben und unten – wie es im Baselbiet Brauch war.
Fünfzehn Jahre waren vergangen, seit Mathis aus seiner Haft entlassen worden war. Remigius Preiswerk, der reiche Handelsherr, und Johannes Jacob, sein Pächter auf Sankt Wendelin, hatten längst das Zeitliche gesegnet, und auch ihre Ehefrauen waren den beiden ins Grab gefolgt.
Im Dezember 1775 hatte Barbara Jacob das von Mathis in vorehelicher Lust gezeugte Kind zur Welt gebracht. Auf Martha folgte ein Jahr später Peter, der erste Sohn. 1778 schrie der zweite, Paul, in seiner Wiege. Zwölf Monate darauf gab es noch einmal ein Mädchen, Hanna. Nach einer unfruchtbaren Zeit stillte Barbara die kleine Klara, der aber lediglich drei Wochen auf dieser Welt beschieden waren. 1786 schliesslich, sieben Jahre nach Hanna, kam Samuel zur Welt. Er blieb der Jüngste der Familie Jacob.
Nach dem Tod seines Vaters wurde Mathis Pächter von Dorothea Staehelin. Auch sie war inzwischen Mutter geworden. Ihre 1784 geborene Tochter Salome wuchs vaterlos auf, denn Dorothea hatte im Jahr ihrer Geburt den Obristen Christoph Staehelin, der sie immer wieder mit losen Weibern betrogen hatte, wegen Ehebruchs vor Gericht zitiert.
Die Familie des treulosen Gatten hatte mit allen Mitteln versucht, eine Scheidung, die als schimpflich galt, zu verhindern. Als Dorothea den alten Elias Staehelin auf dessen Landgut in Münchenstein aufsuchte, um über die bevorstehende Trennung zu sprechen, verjagte der Wüterich seine Schwiegertochter mit Steinwürfen und drohte, sie zu erschiessen, falls sie von ihren Plänen nicht Abstand nehme. Sie liess sich nicht einschüchtern, und nach langwierigen Verhandlungen gelang es ihr, mithilfe eines Anwalts, die Scheidung durchzusetzen und das Sorgerecht für Salome zu erstreiten. Zum Vormund des Mädchens bestellte der Kleine Rat ihren älteren Bruder, Benedikt Preiswerk, der die väterliche Seidenbandfabrik übernommen hatte und Mutter und Tochter im elterlichen Haus zum Goldenen Falken am Nadelberg in Basel aufnahm.
Als geschiedene und alleinerziehende Frau erlitt Dorothea Staehelins gesellschaftliche Reputation Schaden. Ob sie darunter litt, liess sie sich nicht anmerken. Eines aber war unübersehbar: Die vordergründig stolze und kalte Frau blühte auf, wenn sie die Sommermonate, zusammen mit ihrer Tochter, fern der Stadt, auf Sankt Wendelin verbrachte.
Ihr Verhältnis zu Mathis blieb allerdings seltsam distanziert. Zwar sprachen sie unbefangen über Dinge, die den Betrieb betrafen, über Neuanschaffungen etwa oder Viehzucht, manchmal auch über Allgemeines, aber was sie als Kinder und Jugendliche verbunden hatte, schien zerstört. Sie nannte ihn «Ihr» und «Mathis». Er selber blieb beim nackten «Ihr». Die «Madame Staehelin» wollte ihm so wenig über die Lippen wie seinerzeit die «Jungfer Dorothea». Gleichwohl entging ihr nicht, wie er sie in Augenblicken, in denen er sich unbeobachtet fühlte, betrachtete. Sie schalt sich ein närrisches Wesen, wenn sie merkte, wie unsinnig sie sich darüber freute.
Sie liebte es, ihn bei der Arbeit zu beobachten. Mithilfe seiner beiden heranwachsenden Söhne Peter und Paul verarbeitete Mathis die Milch seiner drei Dutzend Kühe zu Butter und Käse, die er auf den Märkten in Waldenburg und Liestal verkaufte. Daneben betrieb er eine Schweinemast. Die Tiere fütterte er mit der Molke, die aus der Käseherstellung übrigblieb. Ausserdem besass er Schafe, ein Hühnervolk und zwei Pferde, die er gegen Entgelt seinem Schwiegervater, dem Fuhrunternehmer Emil Strub, auslieh, als zusätzlichen Vorspann für die schweren Deichselwagen, mit denen dieser Waren über den Oberen Hauenstein transportierte.
Jedes Jahr legte Mathis auf seinem Weideland einen neuen Acker an, auf dem er Dinkel, Hafer und Roggen ansäte. Das alte Feld überliess er dem Graswuchs. Im Gemüsegarten vor dem Haus pflanzte Barbara Bohnen, Lattich, Kresse, Spinat, Kabis, Kohl und Zwiebeln. An den Obstbäumen im Bungert wuchsen Kirschen, Äpfel, Birnen und Zwetschgen. Und aus dem nahen Wald holte man Pilze, Beeren und Nüsse. In den Abendstunden arbeiteten Barbara und ihre Töchter an den beiden Webstühlen, die in der Spinnstube standen, und verdienten so ein Zubrot für die Familie.
Im Frühsommer 1790 wurde die Wohnung im oberen Stockwerk von Barbara Jacob, Martha und Hanna gründlich gereinigt. Die Tücher, die das Mobiliar vor Staub geschützt hatten, wurden entfernt, denn Anfang Juni traf Madame Staehelin mit Salome auf Sankt Wendelin ein, zweispännig kutschiert von einem Bediensteten ihres Bruders Benedikt. Wie jedes Jahr standen die Jacobs – Vater, Mutter und die sechs Kinder – vor dem Haus und erwiesen der Besitzerin des Hofs, die in den nächsten Monaten mit ihnen unter demselben Dach leben würde, die Reverenz. Und wie jedes Jahr hatte diese Geschenke mitgebracht, dieselben wie immer: Tabak für Mathis, einen Likör für seine Frau Barbara und Süssigkeiten für die Kinder.
Madame Staehelin trug, dem sommerlich warmen Wetter entsprechend, eine Robe à la Chemise, ein hemdartiges, knöchellanges Kleid aus federleichtem, weissem Musselin. Ihr Gurt, ein aufwendig gewobenes, mit farbigen Mustern durchsetztes Seidenband aus der Fabrikation ihres Bruders, das sie im Rücken zu einer grossen Schleife gebunden hatte, betonte ihre schlanke Taille. Ihr dunkles, gewelltes Haar war bedeckt von einer weichen, ebenfalls mit einem Seidenband geschmückten Haube mit breiter Krempe, die ihr Gesicht halb verdeckte. Die sechsjährige Salome war ähnlich gekleidet wie ihre Mutter. Die beiden folgten Mathis, der dem Kutscher half, die Bagage in den ersten Stock zu tragen.
Samuel, der vor kurzem vier Jahre alt geworden war, schaute ihnen staunend nach. Sie sahen ganz anders aus als seine Mutter und seine Schwestern mit ihren dunklen Röcken und den mit Ärmeln versehenen Schnürmiedern, über denen sie Schürzen trugen. Obwohl man ihm gesagt hatte, dass Madame Staehelin und ihre Tochter schon im vergangenen Jahr hier gewesen waren, erinnerte er sich nicht mehr an sie.
Am nächsten Tag hatten Madame Staehelin und Salome die Musselinkleider gegen ähnliche Trachten ausgetauscht, wie sie Barbara und ihre Töchter trugen.
«Wir sind jetzt auf dem Land», bemerkte Dorothea, «und wollen uns nicht herausputzen.»
Salome, die entdeckt hatte, dass Hanna und Samuel keine Hüte tragen mussten und barfuss gingen, quengelte so lange, bis auch sie die Haube ablegen und ihre Schnürstiefelchen und Strümpfe ausziehen durfte. Die kleine Mamsell nahm den um zwei Jahre jüngeren Samuel, der sich ihr bereitwillig unterordnete, unter ihre Fittiche.
«Mir will scheinen», sagte Dorothea zu ihrem Pächter, der über den Hof schritt, «meine Tochter habe einen neuen Galan gefunden. Manchmal frage ich mich», fuhr sie fort, «ob Ihr Euch noch erinnert, dass wir als Kinder auch miteinander gespielt haben?» Sie sah ihm forschend ins Gesicht.
Er strählte mit den Fingern durch den schwarzen Bart. Ihre Frage war ihm unangenehm. «Ich habe in der Käserei zu tun», brummte er.
Sie sah ihm betroffen nach. Ob er ihr nicht verzieh, dass sie durch den Zufall ihrer Geburt zu jener Schicht gehörte, die Menschen wie ihn zum Stand der Leibeigenschaft verurteilte? Sie seufzte.
Dorothea glaubte, selber von ständischem Denken frei zu sein. Sie bestand darauf, auf Sankt Wendelin dasselbe zu essen wie die Jacobs: Das dunkle, von Barbara gebackene Brot, dazu Käse, ferner Gemüse aus dem Pflanzgarten, manchmal auch Fleisch und zur Nachspeise Beeren. Nach dem Vorbild von Jean-Jacques Rousseaus Émile sollte Salome ein Stück jener Natürlichkeit erfahren, die Dorothea, im Vergleich zum Leben im Stadtpalais ihres Bruders, als die wahrhaftigere Form des Daseins erschien.
Nicht ganz dazu passen wollte, dass ihr die inzwischen elfjährige Hanna auf Sankt Wendelin als Magd dienen musste. Das Mädchen hatte am Morgen als Erstes die Nachttöpfe von Madame und Salome zu leeren. Später war sie bei der Morgentoilette behilflich. Mit geschickten Händen flocht sie den dunkelbraunen Zopf, den Dorothea anschliessend à la Pompadour auf ihrem Scheitel feststeckte. Täglich fegte Hanna den Boden, denn man hielt im oberen Stockwerk auf Reinlichkeit. Ausserdem hatte sie Botengänge zu erledigen. Zu Dorotheas Vetter etwa, Pfarrer Theophil Grynäus, nach Waldenburg. Mit ihm tauschte Madame Bücher aus: Goethe, Schiller und Lessing, auch Diderot, Voltaire und eben – Rousseau. Letztere im Originaltext. Dorothea Staehelin sprach fliessend Französisch. Vetter und Base trafen sich regelmässig, um sich über ihre Lektüre zu unterhalten.
Wenn sie nicht las, unternahm sie ausgedehnte Spaziergänge, manchmal zusammen mit ihrer Tochter und dem kleinen Samuel. Meistens aber streifte sie, ausgestattet mit einer Botanisiertrommel, allein durch die Wälder am Nordhang des Oberen Hauensteins. In ihnen wuchsen neben den belaubten Buchen, Eichen, Sommerlinden und Mehlbeerbäumen auch Fichten, Eiben, Föhren und Edeltannen. Wo die Sonne durchs Geäst brach, fand sie, je nach Bodenbeschaffenheit, den leuchtend roten Pyramiden-Hundswurz, das violette Knabenkraut, den Berg-Seidelbast und die Alpenhagrose. Sie pflückte einzelne Blumen, die sie zu Hause presste. Auf einem Herbarbogen, der ihre lateinische Bezeichnung und Angaben über den Fundort enthielt, wurden sie später in ihre Sammlung aufgenommen. Daneben malte sie mit Wasserfarben Pflanzen, die ihr besonders gefielen.
Dorothea genoss die ländliche Idylle, während jenseits der Grenzen des Freistaats Basel ein Sturm aufzog. Wenn er sich ausbreitete, konnte er die Weltordnung auf den Kopf stellen. Als vor einem Jahr, im Juli 1789, die aufständische Bevölkerung von Paris die Bastille erstürmte, etwas später die französischen Standesprivilegien abgeschafft wurden und die Nationalversammlung eine Art Volksherrschaft erzwungen hatte, waren adelige Emigranten auf ihrer Flucht durch Basel gekommen. Man hatte sich wochenlang über die Sundgauer Bauern erregt, die Schlösser in Flammen aufgehen liessen und die Bezahlung von Zinsen und Zehnten verweigerten. Dorotheas Bruder Benedikt, der Besitzungen im Elsass hatte, hatte Verluste erlitten. Ob die Baselbieter Bauern auch zu solchen Aufständen fähig wären? Mathis Jacob? Sie wusste, dass er einen tiefen Groll gegen die Obrigkeit hegte. Aber sie wagte nicht, ihn zu fragen. Er selber äusserte sich nicht zu den Vorgängen in Frankreich.
Jener Teil der städtischen Oberschicht, der sich in den Reformgesellschaften traf und das Gedankengut der Aufklärung diskutierte, war überzeugt, dass man handeln müsse. Der Ratsherr Abel Merian, der mit den neuen Ideen sympathisierte, hatte mit vor Pathos bebender Stimme gefordert, die Barbarey des Mittelalters zu beenden und die Leibeigenschaft der Untertanen draussen in der Landschaft aufzuheben. Das war vor bald neun Monaten gewesen. Aber noch immer hatte man im Grossen Rat nicht über den Antrag entschieden.
3
Sankt Peter, die einzige Kirche der Talschaft, lag flussabwärts, unterhalb von Oberdorf. Am Sonntag nach ihrer Ankunft begleitete Dorothea Staehelin Barbara Jacob und deren drei älteste Kinder in den Gottesdienst. Heute war Anwesenheit Pflicht, denn die Männer des Amtes Waldenburg hatten vor dem neuen Landvogt Hans Jakob Müller den Huldigungseid abzulegen. Mathis war allerdings nicht mitgekommen. Er habe sich nachts mehrmals übergeben müssen, berichtete seine Frau. Ausserdem quälten ihn heftige Kopfschmerzen. Auch Salome und Samuel waren, unter der Obhut von Hanna, zu Hause geblieben.
Amüsiert beobachtete Dorothea, wie Müller, ein kleiner, gedrungener Mensch, hoch aufgerichtet auf dem für ihn reservierten Stuhl im Chor der Kirche sass. Er war Meister der Zunft zu Metzgern in Basel. Durch einen Losentscheid war ihm für acht Jahre die Herrschaft über das Amt Waldenburg in den Schoss gefallen. Er trug einen schwarzen Mantel, schwarze Kniehosen und schwarze, seidene Strümpfe. Den Ratsherrenhut hielt er auf den Knien. Das Kinn in die gefältelte spanische Halskrause gedrückt, betrachtete er misstrauisch seine Untertanen. Dorothea wusste, dass bei der Besetzung von einträglichen Stellen im Freistaat Basel in der Vergangenheit ein unschöner Ämterschacher üblich gewesen war. Neuerdings liess man sich bei der Vergabe von Landvogteien vom Zufall leiten – nach dem Grundsatz, wonach Gott jenen, denen er ein Amt gibt, auch den notwendigen Verstand schenkt.
Ihr Vetter, der Pfarrer, hatte an diesem Tag auf Anordnung des Antistes einen Text aus dem Römerbrief auszulegen: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen.
Während er predigte, fragte sich Dorothea, ob es Theophil Grynäus, mit dem sie zuweilen geistreiche Gespräche über Freiheit und Menschenrechte führte, nicht genierlich war, von seiner Gemeinde bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Bürgermeister, dem Oberstzunftmeister und dem Landvogt zu verlangen.
Nachdem er endlich zum Schluss gekommen war, sprach er den Männern der Talschaft, die sich erhoben hatten, den Treueeid vor, den sie Wort für Wort dumpf nachbeteten.
Hans Jakob Müller stand vor dem Altartisch und schien in den verschlossenen Gesichtern seiner Untertanen nach Widerborstigkeiten zu suchen. Die Hand auf dem Zierdegen an seiner Rechten war er bereit, sie im Keim zu ersticken. Ein kleiner, kampfbereiter Mann. Was für ein aufgeblasener Frosch, dachte Dorothea halb belustigt, halb ärgerlich. Sie war froh, dass Mathis nicht an diesem Ritual der Unterwerfung hatte teilnehmen müssen.
Theophil Grynäus war wie so viele zweit- und drittgeborene Söhne von Basler Handelsherren, denen es nicht vergönnt war, das väterliche Geschäft zu übernehmen, vor die Wahl gestellt worden, Offizier in fremden Diensten oder Geistlicher zu werden. Der durch und durch unkriegerisch gesinnte Mensch hatte sich für Gott entschieden und war nach seinem Theologiestudium vom Rat als Pfarrer in Waldenburg eingesetzt worden. Er hätte es schlechter treffen können. Wie seine Amtsvorgänger lebte er im Schönthaler Hof, dem «Steinernen Haus», wie man es im Ort nannte. Es lag in der Nordwestecke der Stadtbefestigung. Ein mächtiger, zweigeschossiger Bau, der durch einen Toreingang über den Hof zugänglich war. Ursprünglich hatte das Haus, das zu den ältesten im Städtchen gehörte, wohl als Adelssitz gedient. Er war verwitwet. Eine Magd besorgte ihm den Haushalt und kümmerte sich um seine vier Kinder. Für die kleine pfarrherrliche Landwirtschaft war ein Knecht zuständig.
Wie von jedem Pfarrer in der Landschaft erwartete die städtische Obrigkeit auch von ihm, dass er sie regelmässig über mögliche Unruhestifter in seiner Herde informierte. Da jetzt zu befürchten war, die Baselbieter könnten sich die aufrührerischen Sundgauer Bauern zum Vorbild nehmen, war das Misstrauen der Gnädigen Herren besonders gross. Grynäus richtete seine akkurat verfassten Schreiben an den Münsterpfarrer, der als Antistes Vorgesetzter aller Geistlichen im Kanton war. Die Berichte wurden an die Staatskanzlei weitergeleitet, wo man entsprechende Massnahmen gegen unbotmässige Untertanen ergriff.
Schon vor ein paar Tagen hatte Theophil Grynäus seine Base eingeladen, nach dem sonntäglichen Gottesdienst das Mittagessen mit ihm im Schönthaler Hof einzunehmen. Jetzt sass man bei Tisch in der Halle unter der Balkendecke, die mit Blumen, Granatäpfeln, Trauben und einem Hirsch bemalt war. Die Haushälterin hatte einen Braten zubereitet. Dazu gab es Kartoffeln und Apfelschnitze.
Nach dem Essen schickte der Pfarrer seine Jungmannschaft in den Hof zum Spielen und bat Dorothea zu einem Gespräch unter vier Augen in seine Studierstube. «Es geht um deinen Pächter», sagte er, als sie Platz genommen hatte. «Im Schloss oben verdächtigt man ihn der Ketzerei.»
Dorothea lachte. «Das kann nicht sein. Mathis ist ein braver Mann, der jeden Sonntag in die Kirche geht. Er hat alle seine Kinder taufen lassen und schickt sie auch in die Kinderlehre.»
«Ich weiss», seufzte der Pfarrer. «Gleichwohl hat mich der Landvogt beauftragt, der Sache nachzugehen. Er hat sogar gedroht, andernfalls selber die Obrigkeit zu orientieren.» Er schaute seine Base an. «Ich frage dich nun ganz direkt: Ist Mathis ein Täufer, wie sein Vater Johannes einer war? Und bevor du jetzt etwas sagst», schob er eilig nach, «musst du wissen, dass er sich regelmässig mit ein paar anderen Bauern in einem Hauskreis trifft, wo man die Bibel liest und das Wort Gottes auslegt.»
Davon wusste Dorothea nichts. «Wer hat dir das erzählt?»
«Heinrich Bidert, der Schuhmacher, der in Bärenwil bei Langenbruck lebt. Er nimmt in meinem Auftrag an diesen Konventikeln teil und berichtet mir darüber.»
«Du lässt die Mitglieder deiner Gemeinde heimlich überwachen?» Dorothea schaute ihn ungläubig an.
«Das gehört zu meinem Hirtenamt.» Grynäus zitierte aus dem Lukasevangelium: «Welcher von euch, wenn er hundert Schafe hat, und verliert eines von ihnen, lässt nicht die neunundneunzig in der Wüste, und gehet dem verlorenen nach, bis er es findet?»
Dorothea stellte sich den kleinen, rundlichen Vetter als Hirten vor und ihren Pächter, der ein stattliches Mannsbild war, als verlorenes Schaf. Nur mit Mühe konnte sie ein Lächeln unterdrücken. Natürlich wusste sie um den täuferischen Hintergrund der Jacobs. Tatsächlich gab es viele reiche Basler, die, wie ihr Vater, ihre Sennhöfe in der Landschaft am liebsten an Mennoniten verpachteten. Diese standen im Ruf, zuverlässig und fleissig zu sein. Ihr Glaube störte nicht, solange sie ihre Zinsen pünktlich bezahlten. Es erschien ihr als Anachronismus, jemanden als Ketzer zu bezeichnen, nur weil er einem etwas abweichenden Glauben anhing. «Aber Theophil», tadelte sie den Cousin, «denk an unsere Diskussionen über die Dichter und Denker, die in deinem Bücherregal stehen. Ich kann nicht glauben, dass du dich dafür hergeben magst, deine Schäfchen auszuspionieren.»
«Der Herr Landvogt und der Herr Antistes in Basel …» Grynäus, der wenig mutig und überdies obrigkeitsgläubig war, rang die Hände. Das Gespräch war ihm peinlich. «Mathis Jacob war heute nicht in der Kirche, als die Treue zur Stadt beschworen wurde. Der Herr Landvogt hat von mir verlangt, eine Liste jener Männer zu erstellen, die an der Zeremonie fehlten. Während des Gemeindegesangs habe ich seinen Auftrag erledigt. Mathis Jacob war nicht da!» Grynäus schaute seine Base herausfordernd an.
«Du wirst ihn von deiner Liste streichen! Er ist krank.»
«Ob das der Landvogt glauben wird?»
«Da gibt es nichts zu glauben. Er steht nicht auf deiner Liste, sonst sind wir geschiedene Leute.»
Grynäus blieb hartnäckig: «Immerhin hat dein Pächter den Ruf, wider den Stachel zu löcken. Du weisst: Man hat ihn auch schon einmal mit Kerkerhaft bestrafen müssen.»
«Mach dich nicht lächerlich.» Wie immer, wenn sie sich ärgerte, vertieften sich die zwei Falten über Dorotheas Nasenwurzel. «Erstens liegt die Sache fünfzehn Jahre zurück, und zweitens war das eine Schikane, an der mein Vater, Gott möge ihm verzeihen, ein gerütteltes Mass an Mitschuld trägt. Wie kommt der hochwohlgeborene Metzgermeister überhaupt dazu, von diesen Dingen zu wissen?»
«Das Schlossarchiv hat ein langes Gedächtnis. Nach seiner Ankunft in Waldenburg hat er sich alle Akten, die Strafsachen betreffen, vorlegen lassen. Wenn sich jetzt noch herausstellen sollte, dass er ein Ketzer ist, gerät er in Schwierigkeiten. Ich habe gehofft, dass du mir bestätigst, dass Mathis Jacob kein Täufer ist. Dann könnte ich mich in meinem Bericht auf dich berufen. Am Wort einer geborenen Preiswerk wird der Landvogt nicht zu zweifeln wagen.»
«Das würde dir so passen, die Verantwortung auf ein Frauenzimmer abzuschieben.» Wieder war eine gewisse Schärfe in ihrer Stimme. Und mit leisem Spott fuhr sie fort: «Wie du richtig gesagt hast: Du bist sein Hirte, also wirst du selber auch Zeugnis für seine brave Gesinnung ablegen. Lass deinen Knecht die Chaise anspannen, und fahr mit mir nach Sankt Wendelin. Dann kannst du ihn gleich selber fragen.»
Eine Stunde später sassen sie in der Stube von Sankt Wendelin: Mathis Jacob, der offenbar wieder munter war, seine Frau Barbara, Dorothea Staehelin und Pfarrer Grynäus. Martha, Peter und Paul hatten noch im Städtchen bleiben dürfen und würden später heimkehren. Hanna war angewiesen worden, im oberen Stockwerk auf Salome und Samuel aufzupassen. «Macht keinen Lärm!», hatte ihnen Madame eingeschärft. «Wir haben hier wichtige Dinge zu besprechen.»
Mathis war Theophil Grynäus unheimlich. Er war grösser und kräftiger als der Geistliche, und mit seinem vollen, dunklen Haarschopf und dem Bart, die sein markantes Gesicht umrahmten, schien er ihm bedrohlich. Jetzt schwieg er und wartete darauf, was Grynäus zu sagen hatte.
Der schaute um Hilfe heischend zu seiner Base. Ein spöttisches Lächeln spielte um ihre Lippen.
Der Pfarrer gab sich einen Ruck. «Ich will nicht drum herumreden, Mathis. Es geht das Gerücht, dass du zu den Täufern gehörst.»
«Unsinn!» Der Bauer sah Grynäus durchdringend an.
«Unsinn? Das musst du mir genauer erklären.» Und hastig: «Der Herr Landvogt hat mir den Auftrag gegeben, über dich einen Bericht zu schreiben.»
«Ihr wisst genau, dass ich getauft bin und dass Ihr selber meine Kinder getauft habt. Ich und die Meinen kommen Sonntag für Sonntag zur Kirche. Mein Vater war ein Taufgesinnter. Ich bin es nicht.»
«Der Herr Landvogt scheint dir nicht zu glauben.»
«So, er glaubt mir nicht?» Mathis erhob sich und trat ans Fenster.
Grynäus duckte sich, als er an ihm vorbeiging. Von dem Mann ging eine versteckte Gewalttätigkeit aus, die ihn ängstigte.
«Wenn er meinem Wort nicht vertraut», sagte der Bauer und schaute hinaus auf die Weide, «kann man nichts machen. Was wollt Ihr?» Er kehrte sich um und schaute den Pfarrer an. «Möchtet Ihr, dass ich einen heiligen Eid schwöre? Oder geht es Euch gar nicht darum? Möchtet Ihr und Euer Landvogt mich und meine Familie vom Hof vertreiben, wie es die Gnädigen Herren von Bern mit meinen Vorfahren getan haben?»
«Mathis, bitte», versuchte ihn seine Frau zu beschwichtigen.
Er wischte ihren Einwand mit einer Handbewegung weg. «Wie lange noch glaubt Ihr und Euresgleichen, über unser Gewissen bestimmen zu können?» Er schaute Grynäus feindselig an. «Selbst wenn ich Täufer wäre, so wäre das eine Sache, die ich allein vor Gott zu verantworten hätte. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Das schliesst unserer Meinung nach auch das Recht auf den freien Glauben ein.»
Dorothea Staehelin hob den Kopf. Sie besass ein Exemplar der Droits de l’Homme et du Citoyen. Mathis hatte von «uns» gesprochen. Dass auch die Untertanen in der Basler Landschaft die Menschenrechte lasen und sogar daraus zitierten, verblüffte sie.
Der Pfarrer war schockiert. «Woher hast du das?»
«Glaubt Ihr, wir wüssten nicht, was in Frankreich geschieht?»
Grynäus verschlug es die Sprache. War man schon so weit? Musste man bei den eigenen Untertanen mit Gewalt und Rebellion rechnen? Der Pfarrer stand auf. Auf seiner Stirn standen Schweisstropfen. «Ich sehe schon, du bist kein Täufer, du bist ein Revoluzzer. Ich werde dies dem Herrn Landvogt mitteilen müssen.»
«Nichts wirst du!», zischte Dorothea. Und dann fuhr sie auf Französisch fort: «Was Mathis sagt, ist genau das, was auch du mir gesagt hast, als wir das letzte Mal über die Menschenrechte und die verknöcherte Herrschaft in Basel diskutiert haben. Wenn ein Wort über dieses Gespräch nach aussen dringt, wenn du es wagen solltest, Mathis Jacob zu denunzieren, wenn du erwähnst, dass er heute beim Huldigungseid nicht anwesend war, werde ich deine Vorgesetzten über deine Lektüre und deine aufrührerischen Reden ins Bild setzen, und dann wird es mit deiner Pfarrherrenherrlichkeit im schönen Waldenburg ein rasches Ende nehmen.»
«Dorothea!» Er schaute seine Base entsetzt an.
«Mathis Jacob ist mein Pächter», sagte sie jetzt wieder im Dialekt, «und ich lasse nicht zu, dass ihm ein Leid geschieht.»
Noch während sie dem Vetter zornig in die Augen starrte, hörte man einen Schrei, dann wurde die Tür zur Stube aufgerissen.
«Sämi», stammelte Hanna. Sie war kreidebleich.
Hinter ihr stand Salome. Auch ihr war der Schrecken ins Gesicht geschrieben. «Er ist tot.» Sie stürzte zu ihrer Mutter und vergrub schluchzend den Kopf an ihrer Brust.
4
So schnell sie konnte, lief Hanna über den Waldweg zur Chlusweid hinauf. Tränen flossen über ihre Wangen. Einmal stolperte sie über eine der knorrigen Flachwurzeln und fiel hin. Sie rappelte sich hoch, ohne auf die blutig geschürften Ellenbogen zu achten. Sie lief weiter, immer weiter. Nur einmal blieb sie kurz stehen und rang nach Atem, dann rannte sie wieder. In der Hand hielt sie das Papier mit der Nachricht von Madame Staehelin, die sie Doktor Alioth übergeben sollte.
«Sag ihm, er soll sich beeilen, vielleicht kann er Samuel retten», hatte sie gesagt. «Und nun lauf. Es geht um Leben und Tod!»
Hanna hatte im oberen Stockwerk die Kinder hüten müssen. «Seid leise», hatte sie gesagt, immer wieder: «Seid leise, wir dürfen die Erwachsenen nicht stören.» Aber Salome und Sämi hatten ihr nicht gehorcht. Sie waren übermütig gewesen, hatten begonnen, Fangen zu spielen und sich gegenseitig durch die Wohnung gejagt. Hanna war ihnen nachgerannt, hatte sie beschworen ruhig zu sein, aufzuhören, hatte gefleht und gedroht. «Sämi!», hatte sie gerufen und «Mamsell Salome!» Vergeblich. Für die beiden war ihre Aufregung ein zusätzlicher Anreiz, Teil des Spiels. Dann endlich hatte sie den kleinen Bruder am Arm erwischt. Sie standen am oberen Ende der Treppe. Sie hielt ihn fest, aber er konnte sich losreissen – und stürzte kopfvoran die Treppe hinunter. Zweimal überschlug er sich. Dann blieb er am Fuss der Treppe liegen. Bewegungslos. Aus seinem Mund und den Ohren floss Blut. Hanna hatte laut geschrien.
Starr vor Schreck waren Vater und Mutter vor dem kleinen, regungslosen Körper gestanden. Der Pfarrer hatte sich im Hintergrund gehalten. Madame Staehelin aber hatte sich von der weinenden Salome gelöst und war neben Sämi auf den Boden gekniet. Sie hatte ihr Ohr an seine Brust gelegt, hatte seinen Puls gefühlt und schliesslich gesagt: «Er lebt noch». Dann hatte sie Anweisungen erteilt: «Ihr, Barbara, müsst das Bett in der leeren Kammer in meiner Wohnung frisch beziehen. Sobald das getan ist, werdet Ihr, Mathis, Euer Kind ganz vorsichtig hinauftragen. Ich denke, dass sein Kopf nicht bewegt werden darf. Und du», sie hatte sich an Hanna gewandt, «wirst nach Langenbruck laufen, zu Doktor Alioth. Du bittest ihn, so rasch wie möglich hierher zu kommen. Ich gebe dir ein paar Zeilen mit. Wenn er fragt, wie es Samuel geht, so sagst du ihm, er sei die Treppe hinuntergefallen. Er habe die Besinnung verloren und blute aus dem Mund und den Ohren.»
«Er lebt noch», hatte sie gesagt. Hanna klammerte sich an dieses «noch». Inzwischen hatte sie das ehemalige Kloster Schönthal erreicht, das vor vielen hundert Jahren, mitten in der bewaldeten Hügellandschaft am Oberen Hauenstein, erbaut worden war. Abermals blieb sie stehen, um Atem zu schöpfen. Ihr Blick fiel auf die Fassade der Kirche. Über dem Torbogen war ein Lamm zu erkennen, das auf seinen Schultern ein Kreuz trug. Links davon war eine Muttergottes samt Jesuskind in den gelben Sandstein gehauen.
Hanna wusste, dass sich die Katholiken drüben im Solothurnischen an die Jungfrau Maria wandten, wenn sie ein Herzensanliegen hatten. Pfarrer Grynäus hatte in der Kinderlehre erklärt, das sei eine Art Götzendienst. Wer den wahren, reformierten Glauben habe, könne sich direkt Gott oder Jesus anvertrauen. Ergriffen von der Innigkeit, mit der Maria das Kindlein in ihrem Schoss betrachtete, schickte Hanna aber auch zu ihr ein Stossgebet. «Lass lieber mich sterben als ihn», flüsterte sie.
Doktor Alioth und seine Frau sassen bei einer Tasse heisser Schokolade und einem Stück Kuchen unter dem grossen Apfelbaum vor ihrem Haus und genossen den Frühsommernachmittag. Karl Alioth war gegen fünfzig Jahre alt. Seine ehemals blonde, inzwischen silbergraue Lockenpracht hatte sich an der Stirn ziemlich gelichtet. Aus seinem runden Gesicht blickten, umrahmt von unzähligen Lachfältchen, zwei kluge blassblaue Augen. Sie weiteten sich erstaunt, als Hanna Jacob durch seinen Garten stürmte und mit hochrotem Kopf, schwitzend und verheult, vor ihm stehen blieb. Vor elf Jahren war er wegen ihr geholt worden, da ihre Geburt mit Komplikationen verbunden gewesen war. Seither hatte er sich ab und zu nach ihrer Entwicklung erkundigt.
«Du bist ja ganz ausser dir, Kind», sagte seine Frau. «Was ist denn geschehen?»
«Sämi!», stiess Hanna hervor, und dann wurde sie von einem Weinkrampf geschüttelt.
Der Doktor strich ihr beruhigend übers schweissnasse Haar. «Nun sag schon, was mit dem Brüderchen ist.»
«Er stirbt», schluchzte Hanna. Sie reichte ihm das zerknüllte Blatt, das ihr Madame Staehelin mitgegeben hatte.
Karl Alioth las die Zeilen. «Er ist also die Treppe hinuntergestürzt?»
«Er ist ohne Besinnung und blutet aus den Ohren und dem Mund und der Nase, soll ich Euch ausrichten», stammelte das Mädchen.
Der Doktor nickte. «Sag dem Knecht, er soll das Pferd satteln», bat er seine Frau. «Ich werde inzwischen die Tasche mit den Medikamenten holen. Und dich nehme ich zu mir aufs Pferd», sagte er zu Hanna. «Unterwegs kannst du mir dann nochmals genau erzählen, was passiert ist.»
Die nächsten Tage wurden für Hanna zu einem einzigen Albtraum. Sämi lag in einer verdunkelten Kammer in Madame Staehelins Wohnung. Der Doktor hatte einen Schädelbruch diagnostiziert und verschiedene Anordnungen getroffen. Er hatte Madame ein Fläschchen mit einer Opiumtinktur gegeben und sie angewiesen, Samuel alle paar Stunden davon fünf Tropfen einzuträufeln. Es gehe darum, ihn stillzulegen, er dürfe sich so wenig wie möglich bewegen. Nur sie dürfe zu ihm. Vielleicht noch ab und zu die Mutter, sonst aber niemand. Samuel brauche Ruhe, absolute Ruhe, ausserdem höchstens Dämmerlicht. Er dürfe auch keine feste Nahrung bekommen. Fleisch- und Gemüsebrühe, das schon, und vor allem Schafgarbentee, den man auch Blutstilltee nenne oder, wie das seine Mutter getan habe, «Heil der Welt». Man müsse ihn mit Honig süssen, denn er schmecke bitter. Aber die zarten, weissen Blüten, die man auf jeder Wiese finde, würden das Blut reinigen und den Kreislauf anregen, hatte er erklärt. Im Übrigen müsse man der Natur ihren Lauf lassen. Wie sich die Sache entwickle, liege in Gottes Hand. Samuel könne sterben oder genesen. Aber auch dann müsse man abwarten, ob keine Schädigung des Hirns zurückbleibe. «Aber davon sagt Ihr den Eltern besser nichts», hatte er Madame Staehelin geraten. «Falls das Schlimmste eintrifft, werden sie es noch früh genug erfahren.» Er selber werde regelmässig vorbeikommen, um nach dem Kleinen zu sehen.
Die Eltern kam es hart an, ihren Jüngsten in der Obhut und Pflege von Madame Staehelin zu belassen, aber sie wagten nicht, gegen die Anweisungen des Doktors aufzubegehren. Beim Abendbrot schöpfte die Mutter schweigend den Haferbrei aus der Schüssel. Alle erhielten ihre Portion. Nur Samuels Teller, den Barbara aufgetischt hatte, blieb leer. Sie mochte sich einreden, solange man auch für den Jüngsten den Tisch decke, bleibe er am Leben. Für Hanna allerdings war dieser leere Teller ein stummer Vorwurf. Niemand sprach mit ihr. Niemand beachtete sie, als Tränen auf ihren Brei tropften. Sie würgte ihr Essen hinunter. In der Nacht weinte sie sich in den Schlaf. Sie biss ins Kissen, um Martha, die mit ihr die Kammer teilte, nicht aufzuwecken. «Hättest du nicht besser aufpassen können?», hatte die grosse Schwester gefragt.
«Hättest du nicht besser aufpassen können?», wollten am nächsten Morgen die beiden Brüder, Peter und Paul, wissen.
Der Vater sagte nichts. Er schaute sie nur an. Vorwurfsvoll? Hanna war überzeugt, dass er ihr die Schuld an Sämis Unfall gab. Sie täuschte sich. Mathis Jacob, dessen heimlicher Liebling sie war, ahnte, wie es in seiner Tochter aussah. Er hätte es aber weder ausdrücken können, noch hatte er je gelernt, dass man anderen mit einem guten Wort wenigstens einen Teil der Last, die jetzt seine eigene Tochter zu erdrücken drohte, von der Seele nehmen konnte.
Auch die Mutter sprach nicht mit ihr. Sie behandelte sie wie Luft. «Sag ihr», wies sie Martha an, «sie soll hinaufgehen und ihre Arbeit machen.»
Hanna schlich mit hängendem Kopf davon. Am Fuss der Treppe waren noch Blutflecken. Sie holte draussen am Brunnen einen Kessel Wasser und schrubbte den Boden, bis nichts mehr zu sehen war.
Madame Staehelin stand oben und schaute ihr zu. Dann befahl sie ihr, die Nachttöpfe zu leeren und die Wohnung zu putzen. «Später gehst du mit Salome nach draussen und pflückst mit ihr einen Strauss Schafgarben. Ich brauche die Blüten für Samuel.» Ihre Stimme klang wie immer, gleichgültig, so, wie man eben mit einer Magd sprach.
«Wie geht es ihm?», wagte Hanna zu fragen.
«Er hat die Nacht überstanden. Geh jetzt an deine Arbeit.» Die Frau verschwand in der Kammer, in der Sämi lag.
Hanna quälte sich mit Vorwürfen. Hätte sie den Kleinen doch nicht am Arm festgehalten, dann hätte er sich nicht losreissen müssen und wäre nicht die Treppe hinuntergestürzt. Wenn sie nach Waldenburg hinuntergeschickt wurde, um bei Pfarrer Grynäus die von Madame Staehelin gelesenen Bücher zurückzugeben und neue mitzunehmen, so drückte sie sich mit gesenktem Kopf den Häusern entlang durch die Strassen. Sie war überzeugt, gezeichnet zu sein, so wie Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hatte, von Gott gezeichnet worden war. Sie glaubte, jedermann könne erkennen, dass sie schuldig war.
Nachts schreckten sie Träume aus dem Schlaf, der sie nur für kurze Zeit erlöste. Immer wieder überschlug sich Sämi vor ihren Augen auf der Treppe und blieb regungslos liegen. Manchmal schrie sie auf. «Sei still!», fauchte dann Martha, die schlafen wollte. Hanna mochte kaum mehr essen. Niemand kümmerte sich darum.
Einmal, als er auf Krankenvisite kam, bemerkte der Doktor das Mädchen, das im Hof stand und ihn mit grossen Augen verzweifelt ansah. «Was ist denn mit dir, Hanna?», fragte er, erschreckt über ihr blasses Aussehen. «Du wirst doch nicht etwa auch krank sein?»
Es war seit Tagen das erste Mal, dass jemand ein Wort an sie richtete, in dem eine gewisse Wärme lag. Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann zu weinen.
«Na, na», brummte der Arzt. Er legte den Arm um ihre schmalen Schultern, führte sie zur Bank vor dem Haus und liess sie neben sich ausweinen. «Willst du mir nicht sagen», fragte er endlich, «was dir so grossen Kummer macht?»
«Ich bin schuld, wenn Sämi stirbt!», brach es aus ihr heraus, und schniefend erklärte sie dem Doktor, dass sie doch nicht gewollt habe, dass der Bruder die Treppe hinunterfalle. Sie habe doch versucht, ihn zurückzuhalten.
Der Arzt, der ein einfühlsamer Mensch war und wusste, wie sehr sich eine Kinderseele quälen konnte, zog Hanna näher an sich und strich ihr über den Kopf. «Du bist nicht schuld.» Er betonte jedes einzelne Wort. «Du bist nicht schuld.»
Er blieb noch eine Weile neben ihr sitzen. «Ich muss jetzt zu deinem kleinen Bruder», sagte er schliesslich. «Er wird den Schädelbruch überleben, aber ich weiss noch nicht, ob er sich völlig erholt.» Dann fasste er Hanna unter dem Kinn und zwang sie, ihn anzuschauen. «Aber denk immer daran: Du bist nicht schuld.» Er strich ihr nochmals über den Kopf und stand dann auf.
Eine halbe Stunde später beobachtete Hanna, wie der Doktor unter der Haustüre mit den Eltern und Madame Staehelin sprach. Sie sahen immer wieder zu ihr hinüber. Als er ging, winkte er ihr zu.
Von da an redete die Mutter wieder mit ihr. Sie tat, als sei nichts geschehen. Auch der Vater strich ihr jetzt wieder ab und zu über die Wangen, so verlegen wie vor dem Unglück, denn er hatte seine Gefühle nie zeigen können. Hanna lächelte verstohlen. Zum ersten Mal seit langem.
Und dann, vier Wochen nach dem schrecklichen Unfall, kam jener Tag, an dem Madame Staehelin die Tür zu Samuels Kammer öffnete und Hanna zu sich rief. «Der kleine Mann scheint jetzt wieder hergestellt zu sein. Jedenfalls hat er mich erkannt und dann nach dir verlangt. ‹Wo ist Hanna›, hat er als Erstes gefragt. Er will dich sehen, nicht die Mutter, nicht den Vater, nur dich.»
5
Zu Silvester 1790 lag das Land am Oberen Hauenstein unter einer dicken Schneedecke. Auf den Waldweiden waren Spuren von Wildtieren zu erkennen, die sich nachts, getrieben von der Hoffnung auf etwas Essbares, in die Nähe des Hofs wagten. Die bizarren Felsformationen auf der Gerstelfluh trugen weisse Kappen. Auch auf den Ästen der Bäume lag Schnee.
Tags zuvor war überraschend Dorothea Staehelin mit Salome eingetroffen. Die Kutsche ihres Bruders hatte in Waldenburg umkehren müssen. Die Passstrasse war vereist und nicht befahrbar. So waren sie, in Begleitung des Knechts von Pfarrer Grynäus, der ihr Gepäck trug, zu Fuss nach Sankt Wendelin hinaufgestiegen. Sie wolle das alte Jahr auf ihrem Hof ausklingen lassen und hier auch die ersten Tage des neuen verbringen, hatte sie gesagt.
Mathis befahl Hanna, den Kachelofen in der oberen Wohnung einzuheizen. Einstweilen wärmten sich Mutter und Tochter in der Stube der Jacobs auf. Während Barbara Glühwein und Gebäck auftischte, kramte Madame Staehelin die üblichen Geschenke aus ihrer grossen Reisetasche: Tabak, Likör und Süssigkeiten. Für Samuel aber hatte sie etwas Besonderes mitgebracht: eine für seine Grösse passende Uniform der Basler Landmiliz mit dunkelblauen Hosen und einem dunkelblauen Frack mit scharlachroten Auf- und Überschlägen. Dazu einen schwarzen Dreispitz, Gamaschen, ein weisses Bandelier sowie Flinte und Säbel aus Holz. Sie half Samuel, die Sachen anzuziehen. «Ist er nicht ein süsser Soldat, mein kleiner Goldschatz?», wandte sie sich an die Eltern. «Er wird gewiss einmal ein schmucker Offizier.»
Mein kleiner Goldschatz. Mein! Barbara Jacob hob die Brauen. Dorothea bemerkte es nicht. Sie liess den kleinen Burschen in der Stube auf und ab marschieren. «Links – links – links!», kommandierte sie lachend. Salome klatschte in die Hände.