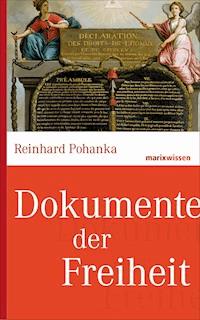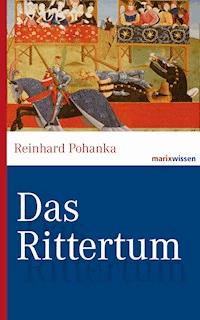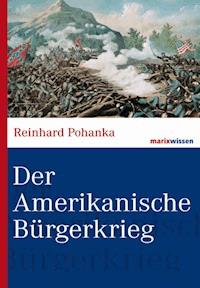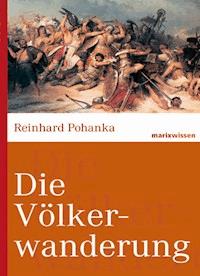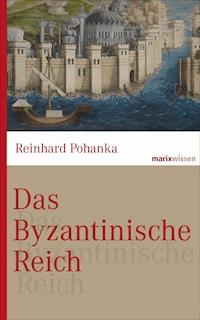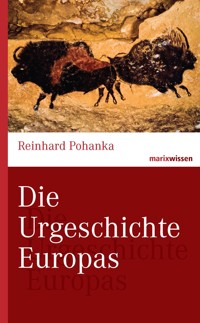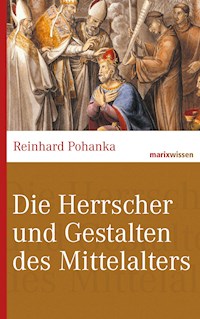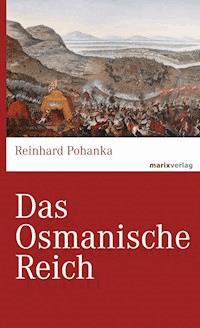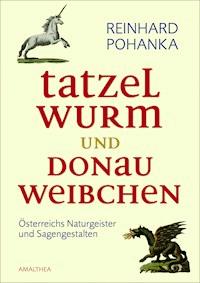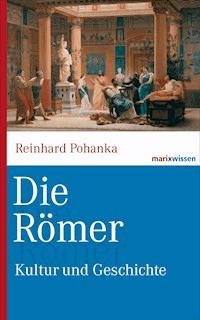
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marix Verlag ein Imprint von Verlagshaus Römerweg
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: marixwissen
- Sprache: Deutsch
Die Römer schufen ein Imperium, das länger bestand als jedes andere vor und nach ihm: Ausgehend von einem kleinen Hirtenvolk, das auf den sieben Hügeln Roms lebte, brachten sie ihre Tugenden, ihr Recht, ihre Politik und ihre Armeen zur Herrschaft über die antike Welt. Ihr Verdienst lag in der Schaffung einer ein heitlichen Kultur, die den gesamten Mittelmeerraum und ein Viertel der damals existierenden Menschheit umfasste, und noch heute besteht ihr umfangreiches Vermächtnis fort. So beruht etwa unsere Justiz zum Teil auf den Rechtsvorstellungen der Römer und die lateinische Sprache findet ihren Niederschlag in diversen Fachbegriffen und in der Medizin. In vielen Teilen Europas haben sich zahlreiche Baureste der Römer erhalten, die seit fast 2000 Jahren existieren und noch in unseren Tagen ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Kunst und Architektur sind. Das vorliegende Buch folgt der Geschichte des Römischen Reiches von seinen etruskischen Anfängen bis zum Ende Westroms 476 n. Chr. und gibt neben den geschichtlichen Ereignissen auch einen Einblick in die Alltagskultur, das Rechtswesen, die Literatur und die Gedankenwelt der Römer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
Über den Autor
Dr. Reinhard Pohanka, geb. 1954, ist Archäologe am Historischen Museum der Stadt Wien. Zahlreiche Veranstaltungen mit den Schwerpunkten Mittelalter und römische Zeit, über 15 Publikationen, darunter bei marixwissen: Die Herrscher und Gestalten des Mittelalters; Der Amerikanische Bürgerkrieg; Die Völkerwanderung; Dokumente der Freiheit; Das Rittertum.
Zum Buch
Die Römer schufen ein Imperium, das länger bestand als jedes andere vor und nach ihm: Ausgehend von einem kleinen Hirtenvolk, das auf den sieben Hügeln Roms lebte, brachten sie ihre Tugenden, ihr Recht, ihre Politik und ihre Armeen zur Herrschaft über die antike Welt. Ihr Verdienst lag in der Schaffung einer einheitlichen Kultur, die den gesamten Mittelmeerraum und ein Viertel der damals existierenden Menschheit umfasste, und noch heute besteht ihr umfangreiches Vermächtnis fort. So beruht etwa unsere Justiz zum Teil auf den Rechtsvorstellungen der Römer und die lateinische Sprache findet ihren Niederschlag in diversen Fachbegriffen und in der Medizin. In vielen Teilen Europas haben sich zahlreiche Baureste der Römer erhalten, die seit fast 2000 Jahren existieren und noch in unseren Tagen ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Kunst und Architektur sind.
Haupttitel
Reinhard Pohanka
Die Römer
Kultur und Geschichte
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten Copyright © by marixverlag GmbH, Wiesbaden 2012 Lektorat: Dr. Lenelotte Möller, Speyer Covergestaltung: Nicole Ehlers, marixverlag GmbH nach der Gestaltung von Thomas Jarzina, Köln Bildnachweis: akg-images GmbH, Berlin eBook-Bearbeitung: Sina Ramezan PourInhalt
Cover
Über den Autor
Zum Buch
Haupttitel
Impressum
Inhalt
Einleitung
1. Die älteste Geschichte Italiens (1200–753 v. Chr.)
Italien im 1. Jahrtausend v. Chr
Italiens Ureinwohner
Die Einwanderung der Griechen
Die Etrusker
Städte- und Wohnbau der Etrusker
Religion
Politische Geschichte
2. Das archaische Rom (753–510 v. Chr.)
Die Gründung Roms
Vom Königtum zur Republik
Die soziale Ordnung der Königszeit
3. Die Religion als Grundlage des Staates
Die Götter
Die Priesterschaft
Kultstätten und Kulthandlungen
4. Das Zeitalter der Ständekämpfe (509–396 v. Chr.)
Patrizier und Plebeier
Die innere Organisation
Die Eroberung Latiums durch Rom
Kelteneinfall und Latinerkrieg
5. Die Erringung der römischen Hegemonie in Italien (327–265 v. Chr.)
Die Eroberung Mittelitaliens in den Samnitenkriegen (327–304 v. Chr.)
Die Übernahme der Magna Graecia (282–264 v. Chr.)
6. Die Eroberung des Mittelmeerraumes (264–134 v. Chr.)
Die Geschichte Karthagos
Die Kriege gegen Karthago
Die Ursachen
Der erste Punische Krieg (264–241 v. Chr.)
Der Zweite Punische Krieg (218–201 v. Chr.)
Die Unterwerfung der hellenistischen Staaten (201–146 v. Chr.)
Die Sicherung der römischen Herrschaft in Ost und West
Die Innenpolitik Roms von 264 bis 133 v. Chr.
7. Kultur und Wirtschaft der römischen Republik
Tägliches Leben in Rom
Hausbau und Wohnen
Die Stellung der Frauen
Hochzeit
Kindererziehung
Alter, Tod und Begräbnis
Das Los der Sklaven
Landwirtschaft und Handel
Münzwesen
Das römische Recht
Lateinische Sprache und Literatur
8. Von der Republik zum Prinzipat (133–31. v. Chr.)
Die innere Krise Roms zur Zeit der Gracchen
Gaius Marius
Kimbern und Teutonen (113–101 v. Chr.)
Der Bundesgenossenkrieg (91–88 v. Chr.)
Der Erste Mithridatische Krieg (89–84 v. Chr.)
Lucius Cornelius Sulla
Gnaeus Pompeius Magnus
Das Erste Triumvirat (60 v. Chr.)
Der Gallische Krieg (58–50 v. Chr.)
Gaius Iulius Caesar
Octavian und Marcus Antonius
9. Die römische Kultur bis zum Beginn der Kaiserzeit
Das Heerwesen
Straßenbau
Wasserversorgung
Kleidung
Ernährung
Zeitrechnung
Maße
Geschichtsschreibung
Redner und Philosophen
10. Von Augustus zu den flavischen Kaisern (31. v. Chr. – 96 n. Chr.)
Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr., Kaiser ab 27 v. Chr.)
Die Kultur des augusteischen Zeitalters
Dichtung
Das iulisch-claudische Kaiserhaus
Die Flavier (69–96 n. Chr.)
Die Anfänge des Christentums
Die Dichtung des flavischen Zeitalters
Brot und Spiele
11. Die Zeit der Adoptivkaiser (96–192 n. Chr. )
Die fünf „guten Kaiser“
Commodus
Regierung und Volk zur Zeit der Adoptivkaiser
Religion und orientalische Kulte
Literatur
Musik
Philosophie und Wissenschaft
12. Die Zeit der Soldatenkaiser (193–285 n. Chr.)
Die Wirtschaftskrise des 3. Jahrhunderts
13. Letztes Aufbäumen der römischen Herrschaft (286–395 n. Chr.)
Das Reich im 4. Jahrhundert
Die barbarische Bedrohung
Das gotische Problem 376–396 n. Chr.
Das spätantike Heer
Gallien und Italien
14. Die Reichsspaltung und das Ende des weströmischen Reiches (395–476 n. Chr.)
Das Christentum in der Spätantike
Die Literatur
Der Untergang des Weströmischen Reiches (457–476 n. Chr.)
15. Die Ursachen des Untergangs des Weströmischen Reiches
Das römische Erbe
Anhang
Zeittafel
Literaturauswahl
Fußnoten
Kontakt zum Verlag
Einleitung
War es die Gier nach Reichtum, war es eine Ideologie oder waren es religiöse Gründe, welche die Römer dazu brachten, ein antikes Weltreich zu errichten? Wahrscheinlich war es keines davon, es war wohl der Ruhm, nachdem die Konsuln, die Ritter und der Senat, die Generäle und Heermeister strebten, es war die Suche nach der Vergöttlichung, welche die römischen Kaiser dazu bewog. Kein anderes Volk im Altertum ist so dem Diesseitigen verpflichtet gewesen wie die Römer, keines der anderen antiken Völker brachte denselben Pragmatismus auf wie die Bewohner der Siebenhügelstadt, der sie befähigte, ohne jedwede Ideologie zu handeln und wenn es ihnen angebracht schien, auch grausam zu sein und ganze Völker in die Sklaverei zu verkaufen. Es gibt wenig, was die Römer selbst erfunden haben, den Kalender mit den 365 Tagen übernahmen sie von den Ägyptern, die Baukunst bis hin zur Ingenieursleistung des Wasserleitungsbaues von den Griechen, von denen sie auch die Kunst, Literatur und Philosophie importierten, und von den Karthagern lernten sie den Schiffbau. Nur die Schaffung dessen, was ihnen die Beherrschung dieser Dinge garantierte, die Organisation des Staates und der Befehl über eine der mächtigsten Armeen aller Zeiten, waren ihre ureigenste Schöpfung.
Die Römer waren die Meister der Kriegskunst, die zwar immer wieder Schlachten verloren, ihre Kriege aber die längste Zeit gewonnen haben. Allerdings beließen sie es nicht allein bei der Eroberung und Ausbeutung von Provinzen, sie brachten den eroberten Ländern auch ihre Kultur mit, ihre Sprache, ihre Straßen, Thermen, Brücken und Aquädukte. Sie gründeten Städte rund um das Mittelmeer und erschlossen öde Landstriche mit ihren hier angesiedelten Veteranen. Sie brachten das „Feuer der Zivilisation“ oder das, was sie darunter verstanden, den Barbaren jenseits ihrer Grenzen. Ihr Verdienst ist die Schaffung einer einheitlichen Kultur, die den gesamten Mittelmeerraum und ein Viertel der damals existierenden Menschheit umfasste.
Aber sie brachten nicht nur den sichtbaren Ausdruck ihrer Zivilisation mit, wichtiger waren ihre unsichtbaren Monumente, Recht und Politik. In ihrem Imperium galt das Recht für alle freien Menschen und es war geschriebenes Recht, auf das man vertrauen konnte. Auch für die Sklaven wurden Rechte geschaffen um ihr Los zu erleichtern, wenngleich sich das Römische Reich, auch unter dem Einfluss des Christentums, niemals von dieser Institution befreien konnte. In ihrer Politik nach außen waren die Römer großzügig, unterworfene Völker konnten ihre Eigenheiten, ihre Könige und Teile ihrer alten Macht behalten, wenn sie sich Rom unterordneten. Die Römer waren tolerant, Religion war, mit zeitweiser Ausnahme des Christentums, in jeder Form erlaubt, solange man dem Staatskult ein Opfer brachte.
Jedes Weltreich hat einen Anfang. Rom entstand der Sage nach durch einen Brudermord, als Romulus den Remus erschlug und sich mit wenigen Getreuen in einer sumpfigen Ebene zwischen sieben Hügeln ansiedelte. Von hier ging der Weg hinaus, die Königsherrschaft wurde abgeschüttelt, die Republik überzog Italien so lange mit Krieg, bis es unter der alleinigen Herrschaft Roms stand. Dann griff man über die Grenzen der Halbinsel hinaus, man besiegte den Handelskonkurrenten Karthago und brachte Griechenland und Kleinasien unter Kontrolle, Caesar eroberte Gallien, und Octavian schloss Ägypten an das Reich an. Unter Kaiser Traian reichte das römische Imperium vom Persischen Golf bis nach Schottland, vom Karpatenbogen bis an den Rand der Sahara. Wohin der römische Legionär auch kam, brachte er die römische Zivilisation mit und ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. hatten die Römer ein Reich errichtet, indem dasselbe Gesetz, dieselben Maße und dieselbe Währung galten wie anderswo. Vierhundert Jahre hielt dieses Staatswesen unter guten und schlechten Kaisern zusammen, aber stets so in sich gefügt, dass es auch Katastrophen hinnehmen und überleben konnte. Sein Ende fand das Reich nicht allein durch die Barbaren der Völkerwanderung, innere Streitigkeiten über einen Zeitraum von 100 Jahren brachten es zu Boden, es wurde nicht ermordet, es verdämmerte langsam.
Die eigentliche Leistung der Römer war die Befreiung Europas und der Mittelmeerwelt von ihrer Kleinräumigkeit. Der Mittelmeerraum und die nördlich daran anschließenden Länder waren einst fragmentiert in viele kleine Kulturräume. Erst das Imperium Romanum gab diesen Gebieten ein Recht, eine Kultur und eine Geschichte, ohne Rom wäre Europa zu einem zersplitterten Territorium geworden, das niemals die Kraft gehabt hätte, die Weltgeschichte für fast zwei Jahrtausende zu dominieren. Die Römer sind die Gründerväter unserer Staatsform und unserer Lebensart geworden, den selbst als Westrom 476 n. Chr. unterging, eiferten die Nachfolgestaaten dem Gedanken des Imperiums nach und der deutsche König Otto III. sah sich mit einer Erneuerung des Römischen Reiches und nach seiner Krönung in Rom wieder als legitimer römischer Kaiser, wie viele andere Herrscher vor und nach ihm.
Mit der Wirkung, die Rom auf die Welt hatte, ist römische Geschichte Universalgeschichte, es gibt kein Verständnis der heutigen Geschichte, ohne dass man den Lauf der Zeiten unter den Römern verfolgt.
1. Die älteste Geschichte Italiens (1200–753 v. Chr.)
Die Flavier (69–96 n. Chr.)
Titus Flavius Vespasianus stammte aus einer bürgerlichen Familie aus der Gegend des sabinischen Reate; er selbst stand viele Jahre als Offizier und Verwaltungsbeamter im Dienste der Kaiser. Er galt als harte, arbeitsame und sparsame Natur. Als er von den Legionen zum Kaiser ausgerufen wurde, befand er sich im Krieg gegen Iudaea, das 67 n. Chr. einen Aufstand gegen die römische Besatzung unternommen hatte. Als er nach Rom ging, überließ er den Krieg seinem Sohn Titus, der mit großer Härte gegen die Juden vorging. Er eroberte nach wochenlanger Belagerung die Stadt Jerusalem und zerstörte den Tempel Salomons, der letzte jüdische Widerstand wurde 73 n. Chr. mit der Eroberung der Festung von Masada beendet. Die Niederlage der Juden war so vollständig, dass viele danach das Land verließen und sich in verschiedene Teile des Reiches zerstreuten, der Beginn der jüdischen Diaspora. Niedergeschrieben wurden diese Ereignisse in der Geschichte des jüdischen Krieges (Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους) vom jüdischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius (37–100 n. Chr). Als Sieger erhielt Titus einen Triumph in Rom und den steinernen Titusbogen am Forum zum Gedenken.
Ein zweiter Aufstand beschäftigte Vespasian in Germanien. Im Rheindelta waren die Bataver 69 n. Chr. unter Iulius Civilis gegen Vitellius aufgestanden und hatten zahlreiche Kastelle am Rhein zerstört. Erst unter Petilius Cerealis, einem General Vespasians, konnten die Bataver wieder befriedet werden.
Vespasian bemühte sich auch um den Ausbau des Reiches, im Norden von Britannien schob er die Grenze bis zum schottischen Hochland vor und in Germanien erreichte er den Oberen Neckar und verband die Donaulinie mit dem Rhein mit einer Straße.
Da die Kassen des Reiches unter Nero geleert worden waren, sparte er wo immer er konnte und ließ sogar die öffentlichen Latrinen in Rom besteuern. Als ihm sein Sohn Titus daraufhin Vorwürfe machte, soll er geantwortet haben:Non olet(Es – das Geld – stinkt nicht1.
In Rom ließ er die Domus Aurea zum Teil abtragen, die 36 m hohe Kolossalstatue Neros wurde in eine Statue des Sonnengottes Sol invictus umgewandelt. Vespasians größtes Vermächtnis ist das Amphitheatrum Flavium, heute als Kolosseum bezeichnet, das er aus der Beute des jüdischen Feldzuges erbauen ließ. Es ist mit einer Grundfläche von 77 x 46 m und einer erhaltenen Höhe von 48 m eines der größten noch bestehenden römischen Bauwerke.
Als er 79 n. Chr. den Tod nahen fühlte, stellte er sich auf die Füße und sagte, imperatorem … stantem mori oportere (dass ein Imperator im Stehen sterben müsse)2.
Er hinterließ seinem ältesten Sohn und Nachfolger Titus Flavius Sabinus Vespasianus (39–81 n. Chr., Kaiser ab 79 n. Chr.) ein geordnetes Reich und dieser war in den zwei kurzen Jahren seiner Regierung amor et deliciae generis humani (Liebe und Wonne des Menschengeschlechts)3, der von sich selbst sagte, dass der Tag verloren sei (diem perdidi … esse), an dem er niemandem eine Wohltat erwiesen hätte4.
In seiner Regierungszeit kam es zu einer der größten Katastrophen, von der wir aus der antiken Welt Nachricht haben. Am 24. August 79 n. Chr. wurden durch einen Ausbruch des Vesuv die Landstädte Pompeii und Herculaneum an einem einzigen Tag völlig zerstört, es sollen dabei mehr als 50 000 Menschen den Tod gefunden haben. Eine Beschreibung der Vorkommnisse findet man bei C. Plinius, dem Neffen des Naturforschers und Kommandanten der kaiserlichen Flotte des westlichen Mittelmeeres. Plinius der Ältere selbst fand bei dem Ereignis den Tod5.
80 n. Chr. weihte Titus das von seinem Vater begonnene Kolosseum mit hunderttägigen Spielen ein und stiftete für die Bevölkerung dieThermae Titianae. Als er im dritten Jahr seiner Regierung mit nur 42 Jahren starb, trauerte ganz Rom um ihn.
Gänzlich anders geartet war sein Bruder und Nachfolger Titus Flavius Domitianus (51–96 n. Chr., Kaiser ab 81 n. Chr.). Zwar war er ein ausgezeichneter Verwalter des Reiches und kümmerte sich um Gesetze und Rechtsprechung, allerdings hielt er nicht viel von der Regierungsform des Prinzipates wie sie Augustus eingeführt hatte. Dafür ließ er sich mit der lebenslänglichen Zensur ausstatten und setzte danach den Senat nach seinen Wünschen zusammen, wer ihm im Wege stand wurde beseitigt und dessen Vermögen eingezogen. Seine Stütze in der Politik waren die Ritter und das gemeine Volk, die er mit großzügigen Spenden und Spielen auf seine Seite brachte. Der Senatsadel hasste ihn dafür und die Historiker seiner Zeit (wie etwa Tacitus)6, haben kein gutes Haar an ihm gelassen.
In der Außenpolitik ging er den vorsichtigen Weg seines Vaters weiter. In Britannien schob er die Grenze mit General Julius Agricola bis zur Linie Firth of Clyde – Firth of Forth vor, in Germanien besetzte er das Land zwischen Oberrhein und oberer Donau und sicherte es mit einem Wall, Kastellen und Wachtürmen (obergermanisch-rätischer Limes) ab. Das eroberte Land wurde alsagri decumates(Zehntland) mit Veteranen besiedelt.
Einen schwierigen Feldzug hatte er gegen den dakischen König Decebalus zu führen, der Dakien (das heutige Rumänien) verlassen und die römische Provinz Moesien angegriffen hatte. Domitian, der selbst am Kriegsschauplatz erschien, konnte keine militärische Entscheidung herbeiführen und musste Decebalus durch die Zahlung von Jahresgeldern zum Abzug bewegen. Einen Aufstand der obergermanischen Legionen konnte er hingegen niederschlagen.
Diese Misserfolge erschütterten seine Stellung im Reich und die Gegnerschaft im Senat lebte wieder auf. Domitian antwortete darauf mit großer Härte und Grausamkeit, er führte die zwischenzeitlich ausgesetzten Majestätsprozesse wieder ein und versuchte die erschöpften Kassen mit Vermögenseinziehungen zu füllen. Als sein Wüten immer unberechenbarer wurde, bildete sich eine von seiner eigenen Gemahlin Domitia Longina geführte Verschwörung, der er am 18. September 96 n. Chr. zum Opfer fiel, damit war das Ende des flavischen Kaiserhauses gekommen.
1 Sueton, Vespasian 23.
2 Sueton, Vespasian 24.
3 Sueton, Titus 1.
4 Sueton, Titus 7.
5 Plinius, Epistulae 6,16.
6 Tacitus, Agricola 2,2.
Italien im 1. Jahrtausend v. Chr.
In geographischer Hinsicht umfasste der Begriff Italien bei den Römern nur einen Teil der Halbinsel, beginnend im Norden mit einer Linie, die etwa von Rimini nach Pisa verläuft. Die Poebene wurde erst in der Kaiserzeit zu Italien gerechnet, Inseln wie Sizilien und Sardinien gehörten in römischer Zeit nicht zu Italien.
Der Name Italien dürfte auf einen süditalischen Stamm zurückgehen, der sich die „Jungstierleute“ (Itali, vonvitulus – das Rind) nannte. Gebräuchlich wurde der Name durch die ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. einwandernden Griechen in Süditalien, die als erste mit diesem Stamm in Berührung kamen. Danach übernahmen die anderen Bewohner der Halbinsel diese Bezeichnung.
Es ist typisch für Italien, dass die Halbinsel ein geographisch stark gegliedertes Gebiet ist. Es gibt große zusammenhängende Landstriche wie die latinische, die kampanische, die südostitalienische und die apulische Ebene, die durch Flüsse wie Po und Tiber, Volturno und Aufidus (Ofanto) unterteilt werden. In Nord-Süd-Richtung verläuft das Gebirge des Apennin, der in seinem Verlauf mehrere kleine Ebenen freilässt. Dazu kommt wie in der Toskana, dem alten Etrurien, ein starker Wechsel von Hügelland und kleinen Ebenen.
Die Topographie Italiens präsentierte sich in der Antike anders als heute. Weite Teile des Landes, besonders in Süditalien und Sizilien, waren dicht bewaldet und in Kalabrien erstreckte sich bis zum Golf von Tarent der riesige, fast undurchdringliche Sila-Wald, der zur Holz-, Pech- und Honiggewinnung genutzt wurde. Erst die Verwendung der Wälder zur Gewinnung von Holzkohle und zum Schiffbau sowie die Ziegenwirtschaft haben bis zum Beginn der Kaiserzeit einen starken Rückgang in der Bewaldung Italiens gebracht.
Auch die Küstenlinie hat zahlreiche Veränderungen erfahren. Flüsse wie Po, Arno und Tiber haben in Deltas das Land gegenüber dem Meer vorgeschoben, ein Ansteigen des Meeresspiegels hat wie etwa inPuteoli(Pozzuoli) antike Siedlungen unter Wasser gesetzt.
Italiens Ureinwohner
Betrachtet man die ethnische Zusammensetzung Italiens zur Zeit der frühen Republik um 300 v. Chr. so wird deutlich, dass das Land von zahlreichen Stämmen besetzt war, von denen ein Teil zur Urbevölkerung, ein anderer zu späteren Einwanderern gerechnet werden muss1.
In der Poebene siedelten zu dieser Zeit keltische, daran nach Süden anschließend italische Stämme, die sich in die zur Gruppe der nördlich siedelnden Umbro-Sabeller (Umbrer, Sabiner, Äquer und Marser) und in die südlich siedelnden Osker (Samniten) zusammenfassen lassen. Im westlichen Mittelitalien und am unteren Tiber siedelte die mit den Italikern verwandte Gruppe der Latino-Falisker und in den Tiefebenen des Nord- und Südostens die Veneter in der später nach ihnen benannten Landschaft Venetien. In den apulischen Ebenen lebten mit den Illyrern verwandte Stämme wie die Daunier, Peuketier, Messapier und Salentiner. In der Toskana siedelten die Etrusker, die, anders als die anderen Stämme, die Ackerbaugemeinschaften waren und in Dörfern lebten, eine Stadtkultur aufgebaut hatten. Nördlich von Genua saßen die Ligurer, die zur Urbevölkerung zählten wie auch die in Sizilien beheimateten Sikaner. Unteritalien war das Land der Griechen, die hier seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. ansässig waren und ihre heimatliche Siedlungsform der Stadtkultur (polis) mitgebracht hatten.
Wie die Einwanderung der Stämme nach Italien vor sich gegangen ist und welche Völker zur Urbevölkerung zu rechnen sind, ist nach wie vor Gegenstand der Forschung. Zu den vorindogermanischen Urbewohnern scheinen die Ligurer gezählt zu haben, denen in der Bronzezeit auch die Pfahlbaukulturen an den oberitalienischen Seen zuzurechnen sind. Die in der Emilia nördlich des Apennin anzusetzende Terramare-Kultur gehörte vermutlich zu einer ersten von 1600–1200 v. Chr. andauernden indogermanischen Wanderungsbewegung, die eine historische Parallele im zeitgleichen indogermanischen Einwanderungsschub in Griechenland findet. Um die Jahrtausendwende scheint eine neue Wanderungsbewegung die Italiker, die ebenfalls zu den Indogermanen zu rechnen sind, in mehreren Wellen ins Land gebracht zu haben. Zu ihnen gehörten die Latino-Falisker, die im Umland des späteren Rom siedelten, sowie die zahlreichen italischen Stämme, welche die Halbinsel besiedelten, dazu kamen illyrische Stämme im Norden und Südosten, die etwa im 9. Jahrhundert v. Chr. eingewandert sein dürften. Diese teilten sich in Venetier und Messapier, die sich in Apulien und Kalabrien ausbreiteten.
Eine Sonderstellung unter den Einwanderern nach Italien nehmen Etrusker und Griechen ein, die seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. auf der Halbinsel nachweisbar sind. Besonders die Frage der Herkunft der Etrusker ist seit langer Zeit Gegenstand der Forschung. Der früher vorherrschenden Meinung, sie seien Einwanderer aus Kleinasien gewesen, steht heute die Theorie einer autochthonen Herkunft gegenüber, wobei diese Frage von der Interpretation der Villanova-Kultur in der Toskana, in der Emilia und am Tiber abhängt, die entweder für die Etrusker oder für die Italiker beansprucht wird.
Die letzten vorgeschichtlichen Einwanderer in Italien waren die aus Mitteleuropa stammenden Kelten, die vom 5. bis zum 3. Jahrhundert v. Chr. die Poebene besetzten.
Die Einwanderung der Griechen
Eines der wesentlichen Bevölkerungselemente der italischen Halbinsel waren die Griechen, die in Unteritalien ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. einwanderten. Sie kamen als Kolonisten, da die Überbevölkerung des Mutterlandes und dessen wirtschaftliche Probleme sie zur Auswanderung zwangen. Die ersten Kolonien entstanden an der Westküste Italiens, Kyme (Cumae) in Kampanien scheint als älteste griechische Siedlung um 750 v. Chr. gegründet worden zu sein. Von dort zog sich bald eine Kette griechischer Stadtstaaten südwärts um die Spitze Italiens bis zum Golf von Tarent, wobei sich die Griechen an jenen Orten ansiedelten, die ihnen zur Beherrschung des Seehandels mit Griechenland und Kleinasien günstig erschienen, wenngleich die ersten Siedlungen als Ackerbaukolonien angelegt wurden und der Handel als Einnahmequelle erst später dazukam. An der Kolonisationsbewegung beteiligten sich alle griechischen Stämme des Mutterlandes, die, nachdem die Ufer des Festlandes südlich des Flusses Volturno fest in griechischer Hand waren, auch auf Sizilien übergriffen. Die älteste griechische Siedlung hier war Naxos, gegründet 741 v. Chr. von den Ioniern von Chalkis auf Euböa, die auch Katane (Catania) und Leontinoi (Lentini) besiedelten. Eine zweite Siedlungswelle ging von den griechischen Dorern aus, das mächtige Korinth gründete 735 v. Chr. Syrakus, das zu einer der bedeutendsten Griechenstädte Italiens wurde. Weitere große Städte wie Selinunt (629 v. Chr.) Segesta und Akragas (Agrigento), gegründet 582 v. Chr., Messene (Messina), Rhegion (Reggio di Calabria) Kroton, Sybaris und Taras (Taranto) umfassten eine städtische Kultur, die auf Ackerbau und Handel basierte und die so bedeutend war, dass sie unter dem Begriff Großgriechenland (Magna Graecia) zusammengefasst wurde.
Als mächtigster Konkurrent der griechischen Städte entstand ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. das karthagische Reich1, welches das westliche Sizilien mit dem Hauptort Lilybaeum (Marsala) in seinen Besitz brachte und für lange Zeit auch behaupten konnte. Damit und mit dem Zusammenschluss der Etrusker war auch dem Expansionsdrang der Griechen in der Magna Graecia ein Ende gesetzt; man begann die errungenen Positionen auszubauen und zu verteidigen. Die Griechen hatten sich vor allem an den Küsten angesiedelt, eine Einflussnahme auf das Landesinnere fand nur in geringem Maße statt. Die Siedlungsform der Polis machte den Zusammenschluss der griechischen Kolonien zu größeren politischen Gebilden unmöglich, auch die Versuche von Syrakus unter Dionysius I. (405–367 v. Chr.) ein größeres zusammenhängendes Territorium in Italien zu errichten, fanden keinen Erfolg.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!