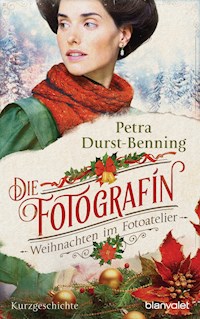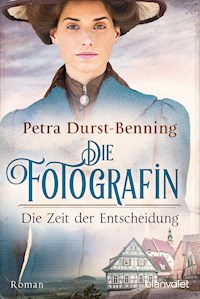9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unbändige Liebe am Hof von Württemberg Die russische Großfürstin Wera ist fast noch ein Kind, als sie 1863 ihre Familie und ihre Heimat verlassen muss. Der Zar möchte seine Nichte loswerden, das Mädchen ist ihm zu wild und rebellisch. Er schickt sie zu seiner Schwester nach Deutschland, zu Königin Olga von Württemberg. Die kinderlose Olga nimmt Wera freudig bei sich auf – sie will aus ihr eine gesellschaftsfähige junge Dame machen, die auf jedem Parkett glänzt. Doch Wera will keine würdige Großfürstin sein, sie will lernen, ein glücklicher Mensch zu sein. Und dann verliebt sie sich …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Petra Durst-Benning
Historischer Roman
List
Auch aus Steinen,
die in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.
Johann Wolfgang von Goethe
TEIL I
Es tönen meine Lieder
Gar traurig durch die Nacht,
Die ich am Meeresufer
So einsam durchgewacht.
Ich blicke auf die Welle,
Die still der Mond bescheint
Und die mit meinem Liede
Sanft murmelnd sich vereint.
Weshalb sind meine Lieder
So trüb und kummervoll?
Wie kommt’s, dass selbst der Mondschein
Mich nicht ergötzen soll?
Und dass der Wellen Tosen
Mich nicht erquicken kann?
Das kommt, weil alles Schöne
Zu früh für mich verrann!
Weil ich auf dieser Erde
Muss leben ganz allein …
Was soll mich noch erfreuen?
Wie kann ich glücklich sein?
Aus: »Liederblüthen«, Gedichte von
PROLOG
St. Petersburg, Sommer 1863
Wie so oft, wenn sie böse gewesen war, hatte sich Wera in eines ihrer Lieblingsverstecke verkrochen, eine kleine Kammer, die zwischen dem Blauen Salon und dem Musikzimmer lag. Außer defekten Musikinstrumenten, zerfledderten Notenblättern und Stapeln ausrangierter Bücher wurden hier noch die schweren Samtvorhänge aufbewahrt, die man im Winter vor die Fenster der oberen Etage hängte, um die Kälte draußen zu halten. Wera liebte diese Kammer, die nach Mottenkugeln und altem Papier roch.
Sie drückte ihr rechtes Auge an die Ritze in der Wand zum Blauen Salon. Sie wollte nicht nur hören, was ihre Eltern redeten. Sie wollte sie auch sehen!
Eigentlich hatte sie erwartet, dass ihre Mutter dem Vater wieder einmal ihr Leid klagen würde, ein so böses Kind wie Wera zu haben. Doch bisher war ihr Name nicht gefallen. Vielmehr schien es um ihre ältere Schwester zu gehen. Das war ungewöhnlich! Voller Neugier rutschte Wera noch näher an den Sehschlitz heran.
»Unsere Olgata und der König von Griechenland. Liebe auf den ersten Blick. So viele Parallelen zu unserer eigenen Geschichte – Kosty, das muss doch etwas Gutes bedeuten!« Noch während sie sprach, schlang die Mutter ihre Arme um Vaters Hals. »Auch bei uns erwachte einst die Liebe im Kinderzimmer. Auch bei uns war es Liebe auf den ersten Blick. Und nun scheint der griechische König ebenso zu fühlen – ist das nicht romantisch? Wir müssen alles tun, um unserer Olgata die Chance auf die große Liebe zu ermöglichen!«
Parallelen? Romantisch? Warum wurde Mutters Stimme immer so heiser, wenn sie von Liebesdingen sprach?
Eine Woge Sehnsucht durchflutete Wera, als sie die zärtliche Umarmung ihrer Eltern sah. Wie schön musste es sein, Mutters Arme so um sich zu spüren! Aber als sie, Wera, am frühen Abend wegen der kaputten Vase bei ihr um Entschuldigung bitten wollte, hatte ihre Mutter sie von sich gestoßen und gezischt: »Du bist und bleibst ein böses Kind!«
Böse. Immer war sie böse. Wera nahm einen der ausgemusterten Notenbögen und begann, ihn in kleine Schnipsel zu rupfen.
Böse. Böse. Böse.
Als die Stimme ihres Vaters erneut ertönte, hielt sie inne und legte ihr Auge wieder an die Ritze in der Wand.
»Was heute Nachmittag geschah, ist unentschuldbar. Die Gouvernante kann ihre Sachen packen. Gleich morgen früh!«, sagte ihr Vater, und seine Augen glänzten eisig.
Die Mutter winkte ab. »Es ist nicht die Gouvernante, die unsere Olgata verdirbt. Du weißt ganz genau, dass unser Problem woanders liegt.«
Der abgrundtiefe Seufzer ihrer Mutter ließ Wera zusammenzucken. Ein Gefühl von Panik durchströmte sie. Wenn ihre Mutter so seufzte, ging es meistens um sie!
»Ich frage mich wirklich, wie aus Olgata jemals eine feine junge Dame werden soll. Dass sie die Nichte des Zaren ist, reicht als Garant für eine gute Partie allein nicht aus. Aber all unsere Bemühungen in puncto Erziehung, Bildung und Manieren werden doch zunichtegemacht, solange sie mit … ihrer Schwester zusammen ist. Kosty, so kann es einfach nicht weitergehen!«
»Und was erwartest du von mir? Soll ich mich jetzt auch noch um die Kindererziehung kümmern? Habe ich nicht genug um die Ohren?«
»Wie du das sagst! Als ob ich nicht mein Bestes gegeben hätte. Als ob wir nicht alle unser Bestes gegeben hätten. Aber was Wera angeht, sind wir mit unserem Latein am Ende, verstehst du das denn nicht?«
Ihre Mutter war wütend. Erst sorgte sie sich, dass aus Olgata keine feine Dame werden würde, und gleich darauf sprach sie wieder von ihr.
Der Vater nickte. »Die ganze Angelegenheit wird langsam peinlich. Ich möchte mir nicht vorstellen, was geschieht, wenn die heutige Szene zu Sascha durchdringt. Familiäre Probleme sind meinem Bruderherz ein Gräuel, das weißt du so gut wie ich. Nicht, dass ich ihm das verübeln würde! Als russischer Kaiser hat er weiß Gott genügend andere Probleme, da müssen wir ihm das Leben nicht noch unnötig schwermachen. Sanny, meine Liebe, allmählich glaube ich auch, dass wir handeln müssen.«
Das ungute Gefühl in Weras Bauch verstärkte sich. Bedeutete das etwa noch mehr ärztliche Untersuchungen für sie? Natürlich wollte auch sie gern wissen, warum sie immer so böse war. Unwillkürlich tastete Wera ihren Kopf ab. Eigentlich fühlte er sich ganz normal an, aber das konnte nicht sein, denn alle behaupteten das Gegenteil.
»Das Kind muss fort!«
»Du meinst … in eine Anstalt?«
»Nicht zwingend. Aber fort von hier, vielleicht sogar fort aus Russland.«
»Und wohin um alles in der Welt willst du sie geben? Wer würde sie nehmen?«
»Das ist in der Tat ein Problem …«
Atemlos folgte Wera dem Wortwechsel. Die Kammer war auf einmal zu eng, die Wände kamen auf sie zu, wollten sie erdrücken. Taumelnd wich Wera von der Wandritze zurück, fächelte sich Luft zu. Vielleicht – wenn sie nichts hörte, würden sich die Worte in nichts auflösen.
»Es ist ja nicht so, als ob mir dieser Gedanke nicht auch schon gekommen wäre«, sagte ihre Mutter. »Ich habe deswegen längst an Marie geschrieben. Aber meine liebe Schwester meinte, es sei ihr unmöglich, das Kind aufzunehmen. Dabei besäße sie als Königin von Hannover wirklich alle Mittel, um uns zu helfen!«
»Und wenn schon. Warum sollte sie sich das Leben unnötig schwermachen?« Weras Vater lachte bitter.
»Wenn Marie nicht will, müssen wir nach jemand anderem Ausschau halten, der Wera in seine Obhut nimmt. Sie in eine Anstalt zu geben wäre das letzte Mittel der Wahl. Stell dir vor, welches Gerede dies aufwirbeln würde! Wir würden uns zum Gespött von ganz Petersburg machen. Am Ende hieße es noch, unter den Romanows grassiere eine Geisteskrankheit.«
Wie verschüttete Tinte einen Stoff durchdrang, so durchdrangen die Worte ihrer Eltern allmählich Weras Bewusstsein. Sie sollte fort. Warum? In eine Anstalt? Fort aus Russland? Wohin?
»Ich hab’s!« Die zwei Worte, so triumphierend von ihrer Mutter ausgerufen, versetzten Wera erneut in Panik. Sie zog die Knie an, legte den Kopf darauf und wiegte sich hin und her. Alles würde gut werden. Gut. Nicht böse.
»Kosty, ich habe die Lösung für all unsere Probleme: Wir geben Wera zu Olly nach Stuttgart! Schließlich ist sie ihre Patentante, da kann sie schlecht nein sagen, wenn wir sie um diesen Gefallen bitten, oder?«
1. KAPITEL
Stuttgart, Herbst 1863
Während draußen auf den Straßen der Stadt das Leben in vollem Gange war, herrschte im Frühstückssalon des Kronprinzenpalais noch morgendlicher Müßiggang. Wie so oft war Thronfolger Karl auch am Vorabend erst sehr spät nach Hause gekommen und saß nun blass und in sich gekehrt am Frühstückstisch. Obwohl er nach seinem nächtlichen Ausgang die Kleidung gewechselt hatte und einen Morgenrock trug, roch er aus allen Poren nach Zigarettenrauch und Wein.
Was für ein schrecklicher Mann!, dachte Baronin Evelyn von Massenbach nicht zum ersten Mal bei sich, während sie ihm und seiner Gattin, der Kronprinzessin Olga, aus diversen Zeitungen vorlas. Karls Leib und sein Gesicht waren infolge seiner Lebensweise von Jahr zu Jahr aufgedunsener und schwammiger geworden, und seine Augen wirkten kleiner. Lag das nur daran, dass der Thronfolger regelmäßig mit befreundeten Herren durch sämtliche obskure Stuttgarter Gasthäuser zog und die Nacht zum Tage machte? Gott sei Dank wusste Evelyn nicht, mit wem er unterwegs gewesen war und zu welchem Zweck. So brauchte sie, wenn seine Gattin sie fragte, nicht zu lügen. Je weniger sie wusste, desto besser! Andere hielten sich mit ihrer Neugier nicht derart zurück, und so wurde in den Salons der Stadt heftig über das »unziemliche« Verhalten des Kronprinzen getratscht. Wie gut, dass seine Gattin davon nichts mitbekam!
Im Gegensatz zum derangierten Kronprinzen wirkte Olly, wie Kronprinzessin Olga von allen genannt wurde, an diesem Herbstmorgen frisch und ausgeschlafen. Das grün-silbern karierte Kleid, das sie erst kürzlich gemeinsam im feinsten Modehaus der Stadt ausgesucht hatten, stand ihr ausnehmend gut, befand Evelyn zufrieden. Der Blick, den sie Olly zuwarf, war voller Bewunderung, Zuneigung und Hingabe. Mit ihren einundvierzig Jahren war die Zarentochter noch immer schlank wie eine russische Birke, ihr Blick war klar, und keinerlei Fältchen oder Linien krochen über ihr edles Antlitz. Für die dreiunddreißigjährige Evelyn, die ebenfalls als äußerst attraktiv galt, stand fest, dass ihre Herrin eine sehr schöne Frau war. Und dieser Meinung schlossen sich die meisten an. Sogar der berühmte Maler Franz Xaver Winterhalter hatte bei seinem letzten Besuch verlauten lassen, dass er an sämtlichen europäischen Höfen lange suchen musste, um eine Schönheit wie Olly zu erblicken.
Schönheit … Nun, sie war allerdings kein Garant für ein glückliches Leben.
Eine Welle von Unmut schwappte über Evelyn, während sie versuchte, den Geruch nach Zigarettenrauch, der von dem Prinzen ausströmte, zu ignorieren. Der elegante Salon, von Olly mit feinsten Möbeln, Bildern und Accessoires eingerichtet, kam ihr auf einmal stickig vor. Am liebsten hätte sie eigenhändig die schweren Samtvorhänge aufgezogen, um Licht und frische Luft in den Raum zu lassen.
In neutraler Stimmlage fuhr sie fort, den Zeitungsartikel über den Frankfurter Fürstentag vorzulesen, und zumindest Olly schien er sehr zu interessieren. Karl widmete sich derweil eingehend seinem üppigen Morgenmahl. Dass Preußens König Wilhelm I. dem Treffen in Frankfurt ferngeblieben war, welches daraufhin ohne Ergebnis zu Ende ging, schien den Kronprinzen weniger zu interessieren als die gebundene Rinderconsommé, von der er sich nun schon zum zweiten Mal auftragen ließ. Die vergangene Nacht musste anstrengend gewesen sein, wenn der Herr einen solchen Hunger verspürte. Der Anblick, wie er tief über den Teller gebeugt seine Suppe verschlang, ließ Evelyns Ärger erneut aufwallen. Wer würde denn in absehbarer Zeit König von Württemberg werden und große Politik machen? Doch nicht Olly! Trotzdem war es die russische Zarentochter, die sich – im Gegensatz zu ihrem Mann – regelmäßig über die Weltpolitik informierte.
Es war Evelyns Aufgabe, aus dem dicken Stapel deutscher und französischer Tageszeitungen, der täglich angeliefert wurde, wichtige Berichte herauszupicken und beim Frühstück vorzulesen. Anschließend saß die Kronprinzessin dann meist stundenlang an ihrem Schreibtisch und schrieb Briefe an ihr vertraute Herren aus Politik, Wissenschaft und Kultur, in denen sie deren politische Einschätzungen erfragte oder selbst ihre Meinung äußerte. Vor allem der Briefwechsel mit dem russischen Staatskanzler Gortschakow, den Olly aus seiner Zeit als Gesandter in Stuttgart sehr gut kannte, war ihr wichtig. Was würde eine so kluge Prinzessin alles ausrichten können, wenn man sie nur ließe! Evelyn war es rätselhaft, wie die Schwester des russischen Zaren es aushielt, seit Jahren zu politischer Untätigkeit verdammt zu sein. Eine Untätigkeit, unter der sie unbestritten litt, die aber ihrem Mann Karl nichts auszumachen schien …
Was für ein seltsames Paar. In den zwölf Jahren, in denen sie nun schon als Hofdame und engste Freundin an Ollys Seite war, war es ihr nicht gelungen, das Geheimnis dieser Ehe zu lüften.
Ein Seufzen unterdrückend, nahm Evelyn die nächste Zeitung zur Hand und begann zu lesen:
»Die Hamburger St.-Nikolai-Kirche wurde im laufenden Jahr so weit fertiggestellt, dass sie am 27. September eingeweiht werden konnte. Obwohl die Bauarbeiten des Turms, der einmal hundertfünfzig Meter hoch werden soll, noch andauern, gilt sie schon heute als bisher höchstes Gebäude der Welt.« Evelyn, die wusste, wie abgöttisch Olly ihren Vater, den Zaren Nikolaus, über dessen Tod hinaus verehrte, hatte diese eher zweitrangige Nachricht aufgrund der Namensgleichheit bewusst ausgewählt.
Wie erwartet erschien auf Olgas vornehmer Miene ein zartes Lächeln. »Was für ein schöner Name! Ich nehme trotzdem nicht an, dass es in irgendeiner Form mit meinem Vater zu tun hat. Wahrscheinlich ist die Kirche vielmehr dem heiligen Nikolaus gewidmet.«
Evelyn bejahte dies und blätterte eine Seite weiter. Dort hatte sie einen Bericht über die erste Hundeausstellung Österreichs eingerahmt. Immerhin war Olly eine große Hundeliebhaberin, wovon ihr Windspiel zeugte, das ihr nie von der Seite wich.
»Es ist übrigens ein Brief aus St. Petersburg angekommen. Sascha hat mir geschrieben …«, kam es unvermittelt von Olly, bevor Evelyn zu lesen beginnen konnte.
Zum ersten Mal an diesem Morgen horchte der Kronprinz auf. »Der Zar hat geschrieben? Kommt Sascha uns etwa besuchen?« Ein Leuchten zog über sein Gesicht, das Evelyn trotz allem berührte.
Es war wirklich ein Jammer: Einzig bei Olly und ihrer Familie fand Karl die Zuneigung, die ihm sein eigener Vater und seine Schwestern seit jeher versagten. In den Augen König Wilhelms war Karl nur ein dummer, nichtsnutziger Faulpelz. Anstatt seinen einzigen Sohn an die zukünftige Aufgabe als Regent von Württemberg heranzuführen, hielt er ihn seit Jahren von jeglichen Regierungsgeschäften fern. Ihn – und Olly gleich mit dazu. Karls Schwestern, die nichts unversucht ließen, um sich beim König einzuschmeicheln, war das nur recht. Königin Pauline versuchte vergeblich, die Animositäten zu beseitigen – eine Hilfe war sie ihrem Sohn jedoch nicht. Was für eine Familie!
»Ein Besuch steht nicht an«, sagte Olly mit Bedauern in der Stimme. »Sascha hat vielmehr vor, seinen Sohn in Nizza zu besuchen. Nikolajs Tuberkulose schreitet voran, er sei nur noch Haut und Knochen, schreibt er.«
Karl runzelte die Stirn. »Schlägt die Behandlung in Nizza auch nicht an? Armer Sascha, da hat er einen Thronfolger und nichts als Sorgen mit ihm!«
»Noch ist Nikolaj nicht gestorben«, erwiderte Olly rau. »Aber lassen wir das, Saschas Brief handelt eigentlich von etwas anderem: Es geht um Wera, mein Patenkind …«
»Na dann … Evelyn, die Zeitung bitte.« Karls Interesse an der Depesche des Zaren hatte offensichtlich rapide nachgelassen.
Dennoch faltete Olly den Brief, den sie in ihrer Rocktasche getragen haben musste, auseinander, um daraus vorzulesen. Evelyn nutzte den Moment, um die erste Tasse Kaffee des Morgens zu genießen.
»Liebste Olly, ich hoffe, mein Brief erreicht Euch bei bester Gesundheit. Hier kommt der Winter dieses Jahr mit Siebenmeilenstiefeln daher und –« Irritiert durch Karls Zeitungsrascheln, hielt Olly inne. »Am besten komme ich gleich zum Wesentlichen: Liebstes Schwesterherz, heute möchte ich Dich um einen Gefallen bitten. Wie Du weißt, hat der König von Griechenland ein Auge auf Kostys und Sannys älteste Tochter Olgata geworfen. Ich muss Dir nicht erklären, dass solch eine gute Partie auch eine Stärkung der russisch-griechischen Beziehungen bedeuten würde. Sanny ist seit König Georgs Besuch völlig überdreht. Romantisch, wie sie ist, sieht sie darin eine Wiederholung ihrer eigenen Geschichte.« Olly schaute auf, suchte Evelyns Blick. »Mein Bruder Kosty hat sehr jung geheiratet. Er und Sanny haben sich sozusagen im Kinderzimmer kennengelernt. Beide behaupten nach wie vor, es wäre gleich die große Liebe gewesen, aber meiner Ansicht nach war es vor allem Kostys große Sehnsucht, endlich der Knute seiner schrecklich strengen Erzieher entfliehen zu können.« Sie zuckte in einer für sie typischen Geste mit den Schultern. Dann las sie weiter.
»Nun setzen Kosty und Sanny alles daran, Olgatas Erziehung in den nächsten zwei, drei Jahren zu vollenden. Sich gleichzeitig um Weras Erziehung zu kümmern überfordert die beiden allerdings sehr, vor allem, da Wera derzeit in einer schwierigen Phase ist …« Olly stockte, ihr Blick flog über das Blatt, erst dann las sie weiter.
»Olly, Du kennst unseren Bruder und unsere liebe Schwägerin selbst gut genug, um zu wissen, dass es angeraten ist, ihnen in solch einer Situation helfend zur Seite zu stehen. Geliebte Schwester, wäre es nicht schön, wenn Du als Patentante die kleine Wera für eine gewisse Zeit aufnehmen würdest? Bei Dir und Karl wüsste ich unsere Nichte bestens versorgt.« Olly ließ den Briefbogen sinken. »Sascha fügt noch an, ich würde Russland einen großen Dienst erweisen. Das hätte er nun wirklich nicht extra sagen müssen. Ich helfe doch immer, wo es geht.«
Evelyn runzelte die Stirn. Was war denn am Besuch eines Kindes derart staatstragend, dass sich der Zar höchstpersönlich darum kümmerte?
»Wera hat eine schwierige Phase, aha. Und da sollst ausgerechnet du sie aufnehmen?«, fragte Karl.
»Traust du mir das etwa nicht zu?«, fuhr Olly auf. »Nur weil wir keine eigenen Kinder haben, heißt das noch lange nicht, dass ich unfähig bin, solch ein kleines Wesen liebzuhaben und zu betreuen.« Wie immer, wenn es um das Thema Kinder ging, begannen Ollys Augen verdächtig zu glänzen. Wut, Trauer, ein Hauch von Resignation – selten hatte Evelyn eine Frau mit so viel Tiefe im Blick gesehen wie Olga. Es schien, als würden ihr noch viele weitere Worte auf den Lippen liegen, aber wie so oft schluckte sie diese hinunter.
War so viel Contenance nicht zu viel des Guten?, fragte sich Evelyn. Vielleicht wäre es wirklich besser, die Prinzessin würde ihrem Mann einmal gehörig die Meinung sagen! Oder tat sie dies, heimlich, hinter verschlossenen Türen? Es konnte doch nicht immer nur eitel Sonnenschein zwischen den beiden herrschen, oder?
»Aber warum gibt Ihr Bruder Konstantin seine Tochter nicht zu jemandem in Obhut, der in der Nähe wohnt? Russland und Württemberg liegen ja nicht gerade nur einen Katzensprung voneinander entfernt«, fragte sie vorsichtig.
»Und wenn schon!«, sagte Olly leichtherzig. »Wir Geschwister sind uns im Herzen nahe. Davon abgesehen, bin ich Weras Patentante. Also ist es selbstverständlich, dass meine Familie mich um Hilfe bittet.« Olly langte über den Tisch, ergriff die Hand ihres Mannes.
»Karl, stell dir vor: wir zwei und ein kleines Mädchen! Du könntest Wera bei deinen Spaziergängen mitnehmen, ihr Stuttgart zeigen. Wir könnten zusammen mit ihr in der Bibel lesen. Und zu dritt musizieren. Mit ihren neun Jahren ist sie bestimmt schon sehr klug und verständig, aber dennoch kindlich genug für Späße wie eine Schlittenfahrt im Winter!«
»Die Hügel direkt von der Villa hinab, das wäre was! Und die Stuttgarter Seen sind ideal zum Eislaufen. Ein Besuch in der Wilhelma würde der Kleinen sicher ebenfalls gefallen, meinst du nicht auch?« Bereitwillig spielte Karl mit.
»Ach Karl, wir wären endlich eine richtige Familie …«
Für einen langen Moment schauten sich die beiden Eheleute in die Augen. Und wieder spürte Evelyn das unerklärlich starke, unsichtbare Band, das dieses ungleiche Paar zusammenschweißte. War es wirklich Liebe? Abrupt stand sie auf, um endlich die Vorhänge aufzuziehen. Sogleich tauchten die einfallenden Sonnenstrahlen den Salon in ein goldenes Licht.
Karl blinzelte heftig. »Aber wie würde ich mich mit unserem Kind unterhalten? Deutsch wird die kleine Wera ja nicht können, spricht sie denn wenigstens Französisch? Du weißt ja, wie schlecht mein Russisch ist.«
»Unser Kind – wie schön sich das anhört!« Olly strahlte ihren Mann an.
»Ich habe noch nicht ja gesagt. Solch ein Schritt will wohlüberlegt sein. Was wird mein Vater dazu sagen, dass wir uns mit dem Gedanken tragen, ein fremdes Kind an den Hof zu holen? Wäre das in seinem Zustand nicht zu anstrengend für ihn?« Karl warf einen fast angstvollen Blick in Richtung Schloss.
Sein Vater. Das hatte ja kommen müssen, schoss es Evelyn durch den Kopf.
»Deinen Vater wollen wir mit dieser Entscheidung nicht belästigen, sie ist allein unsere Angelegenheit. Schließlich benötigt der König seine ganze Kraft, um zu genesen«, sagte Olly und tätschelte Karls Hand in mütterlicher Manier. »Außerdem ist Weras Aufenthalt ja nur für eine gewisse Dauer.« Der gütige Tonfall verschwand, Ollys sanfte Miene wurde plötzlich eisern. »Das Kind kommt. Daran gibt es nichts zu diskutieren!«
*
Mit zusammengekniffenen Augen schaute sich Olly in ihrem Schlafzimmer um. Wie Karls und ihr gemeinsamer Schlafraum war auch dieser in dunklen Farben gehalten: Nachtblau, Weinrot, Tannengrün. Die Möbel waren schwer und ausladend, teilweise mit Gold verziert, die Vorhänge aus weinrotem Samt. Als sie vor knapp neun Jahren das Kronprinzenpalais bezogen hatten, hatte sich Olly bewusst für diese schwermütig anmutende Farbgebung entschieden. Sie fühlte sich dadurch an die Salons des Winterpalastes in St. Petersburg erinnert, in denen gegen die Eiseskälte des Winters stets ein Feuer prasselte. Das Schwelgen in satten Farben sollte außerdem einen Gegenpol zu dem ansonsten sehr spröden, geradlinigen Bau der Kronprinzenresidenz bilden.
Auf dem Boden sitzend, betrachtete Olly skeptisch ihre Tischgruppe am Fenster. Wirkten die Möbel nicht zu düster? Es fiel ihr schwer, sich vorzustellen, wie sie mit Wera auf dem Schoß in einem der dunkelblauen Sessel saß, um ihr vorzulesen. Mochten kleine Mädchen nicht lieber zarte Pastellfarben? Rosa, Hellgrün, Himmelblau? Eine Gruppe von weißen Korbmöbeln, dazu himmelblaue Kissen, golden bestickt – das würde Wera bestimmt gefallen!
Gleich morgen wollte sie sich auf die Suche nach geeignetem Interieur machen, beschloss Olga, als ihr ein weiterer Gedanke durch den Kopf schoss: Welchen Raum würde sie eigentlich als Kinderzimmer umgestalten?
»Eure Hoheit, sind Sie hier? Ich habe neuen Wein mitgebracht, er schmeckt herrlich nach Herbst und Erntezeit!« Mit einem Tablett, auf dem eine Karaffe und zwei Gläser standen, betrat Evelyn von Massenbach das Schlafzimmer.
»Wollen Sie etwa verreisen?« Sie nickte mit ihrem Kinn in Richtung des großen Reisekoffers, den Olly unter Aufbietung sämtlicher Kräfte in die Mitte des Raums bugsiert hatte.
»Warum sollte ich?« Schmunzelnd zog Olly aus den Tiefen des Koffers eine Puppe, ein hölzernes Pferd und eine Spieluhr hervor. »Das ist mein altes Spielzeug. Ich habe den Koffer vorhin von der Bühne bringen lassen.«
Evelyn stellte das Tablett auf dem Tisch am Fenster ab, kniete sich neben Olly nieder und strich andächtig über das Holzpferd. »Man sieht jeden Muskel und jedes Haar der Mähne. Das ist aus wahrer Künstlerhand.« Beschützend legte sie ihren Arm um das Pferd. »Für ein Kind ist es viel zu schade!«
Olly lachte. »Von wegen. Ich kann es kaum erwarten, all das hier gemeinsam mit Wera anzuschauen. Was meinst du, Eve, ob kleine Mädchen Gefallen hieran finden?« Sie hielt eine filigrane Spieluhr, die wie ein Karussell gearbeitet war, in die Höhe. »Meine Schwestern und ich – wir liebten dieses Stück, nie wurden wir müde zuzusehen, wie sich die Pferde zur Musik drehten.«
Vorsichtig nahm Evelyn die Spieluhr an sich. »Doch nicht so etwas Schönes! Jetzt haben diese herrlichen Spielsachen so lange gehalten, da wäre es doch schade, wenn sie durch grobe Kinderhände kaputtgingen.«
»Du und deine schwäbische Sparsamkeit«, rügte Olly ihre Hofdame, die viel eher eine Freundin war, lachend. »Wera ist doch kein wilder Lausejunge, sie wird schon sorgsam und liebevoll mit den Dingen umgehen.«
Eine Zeitlang waren sie einträchtig damit beschäftigt, den Koffer zu leeren. Puppen, Kreisel, eine hölzerne Kutsche, noch mehr Pferde kamen zum Vorschein. Alles war etwas verstaubt, aber in bester Verfassung.
Glücklich schaute Olly auf den mit Spielzeug übersäten Teppich.
»Dass meine Kindersachen nach siebzehn Jahren Ehe doch noch zum Einsatz kommen würden, daran habe ich nicht mehr geglaubt.« Noch während sie sprach, spürte sie den altbekannten Schmerz in sich aufwallen. Es tat noch immer so weh.
Ein eigener Herd. Eine große Kinderschar. Und sie mittendrin. Das hatte sie sich mehr als alles andere gewünscht. Und geglaubt, dass diese Wünsche für eine russische Zarentochter ziemlich schlicht gewesen waren. Der liebe Gott hatte sie ihr dennoch nicht erfüllt.
Alle um sie herum hatten Kinder bekommen: ihre Schwester Mary als Erste, dann Cerise, ihre Schwägerin. Kostys Frau Sanny. Und Karls Schwestern. Auguste, die jüngste, hatte sechs Kinder! Vier Buben und zwei Mädchen. Aber nicht sie war es, die Olly spüren ließ, dass sie den Anforderungen an eine Kronprinzessin nicht entsprach. Dass sie minderwertig war. Diese Aufgabe hatte sich Karls ältere Schwester Katharina zu eigen gemacht. Sie ließ keine Gelegenheit aus, mit ihrem Sohn Wily zu prahlen. Sie hatte den erforderlichen männlichen Nachfolger geboren, wohingegen Olly an dieser einen, dieser einzig wichtigen Aufgabe kläglich gescheitert war. Dass dieses Scheitern womöglich nicht allein mit ihr zu tun hatte, interessierte niemanden. Wenn ihr alle nur wüsstet!, dachte Olly wieder einmal bitter.
Sie nahm eine in Lumpen gekleidete Puppe in die Hand, deren Haare völlig verfilzt waren. Der Anblick ließ sie den Schmerz der vergangenen Jahre vergessen. Sie konnte sich gar nicht daran erinnern, dass sie ihre Lieblingspuppe einst mit nach Stuttgart genommen hatte.
»Dieses ramponierte Etwas heißt Luisa. Die Arme hat bei mir ziemlich viel aushalten müssen. Was meinst du, Eve, soll ich sie gleich aussortieren? Bestimmt ist Wera Besseres gewohnt.«
Evelyn, die zum Tisch gegangen war und zwei Gläser neuen Wein einschenkte, sagte: »Sie freuen sich sehr auf Ihre Patentochter …«
»Ich kann es kaum erwarten, sie in meine Arme zu schließen.« Olly nahm Evelyn ein Glas ab und prostete ihr damit zu. »Ich habe meinen Brief an Sascha vorhin aufgegeben. Und Kosty und Sanny habe ich auch geschrieben, sie sollen wissen, dass Wera bei uns herzlich willkommen ist. Jahrelang habe ich bedauert, mein Patenkind so selten sehen zu können. Ich weiß nicht einmal, wie groß sie inzwischen ist und wie sie aussieht.« Liebevoll strich sie Luisa die krausen Haare aus der Stirn. »Wera ist ein ganz besonderes Mädchen, aufgeweckt, flink und lebhaft. Wenn ich nur an ihre Taufe denke! Geschrien hat sie auf meinem Arm wie am Spieß, ihr kleines Gesicht ist feuerrot angelaufen. Natürlich dachte ich, ich sei schuld, würde das Kind nicht richtig halten. Der Bischof war von Weras Geschrei derart irritiert, dass er seinen Taufspruch so schnell heruntergerasselt hat, wie ich es noch nie erlebt hatte.«
Evelyn stimmte in Ollys Lachen ein, dann sagte sie: »Ich möchte Ihre Freude nicht dämpfen, ganz im Gegenteil, ich freue mich sehr mit Ihnen. Aber was ist, wenn das Kind gar nicht von seinen Geschwistern und Eltern fortwill?«
Olly runzelte die Stirn. »Kosty und Sanny haben für Wera doch eh keine Zeit, jetzt, wo sie sich so intensiv um Olgatas Bräutigamschau kümmern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, als Mutter mit Mary unterwegs war. Während die beiden einen Ball und Empfang nach dem anderen besuchten, saß ich eifersüchtig zu Hause und fühlte mich wie das fünfte Rad am Wagen. Aber so ist das nun einmal, eine Tochter nach der anderen! In ein paar Jahren kommt auch Wera an die Reihe.«
Evelyn nickte, schien aber nicht überzeugt. »Und wenn –«
Olly unterbrach ihre Hofdame lachend. »Genug davon. Wir werden Wera eine so schöne Zeit bereiten, dass sie St. Petersburg keine Minute vermisst. Als Erstes kaufen wir ihr schöne Kleider, so etwas mögen kleine Mädchen immer. Und ihren ersten Fächer soll sie auch von mir bekommen. Und dann besuchen wir eines unserer schönen Kaffeehäuser. Kinder laden wir auch ein, Wera soll viele Spielkameraden bekommen. Ich lasse Kakao servieren und Kekse, und dann können die Kleinen nach Herzenslust spielen, so wird sie ihre Geschwister gewiss nicht vermissen. Cäsar Graf von Beroldingen werde ich beauftragen, für Wera das schönste Pony weit und breit zu besorgen – wozu habe ich einen fähigen Stallmeister? Ach Eve, es wird einfach herrlich werden!«
2. KAPITEL
Nach tausend Jahren und tausend Tagen fuhr die Kutsche am zweiten Dezember endlich in Stuttgart ein. Es war ein trüber, nichtssagender Tag, grau in grau. Genauso nichtssagend waren die Straßennamen: Schillerstraße, Königstraße, Kriegsbergstraße.
Warum liegt hier kein Schnee?, fragte sich Wera. Es ist doch Winter. Und warum hießen die Straßen nicht Newski-Prospekt oder Kasaner Straße? Auch Paläste sah sie nicht, dafür weiß gestrichene Bürgerhäuser, in deren Erdgeschossen Läden untergebracht waren. Wera konnte zwar die Ladenschilder nicht lesen, erkannte aber an den Schaufensterauslagen, um welche Art von Geschäft es sich handelte: Bäcker, Schlachter, Schuhmacher, und in einem Schaufenster hingen Tausende von Schlüsseln jeglicher Art, sehr seltsam. In den Läden und ringsherum herrschte ein reges Treiben. Frauen mit Kindern an der Hand, die an etwas Seltsamem kauten, Dienstmägde mit schweren Körben über dem Arm, die Einkäufe für die Herrschaften erledigten. Die Menschen lachten und schienen froher Stimmung zu sein.
Wera wandte sich angewidert ab.
Außer ihr saß nur noch Dr. Haurowitz in der Kutsche. Er war der Leibarzt ihres Vaters und war von ihm mit der Aufgabe betraut worden, sie nach Stuttgart zu begleiten. Ihre Mutter hätte eine Gouvernante als weitere Reisebegleitung für ihre Tochter gern gesehen, aber Weras Erzieherin hatte kurz zuvor gekündigt. Und eine neue war nicht aufzutreiben gewesen. Also hatten der alte Mann und das Kind den langen Weg von St. Petersburg nach Württemberg allein zurückgelegt.
»Jetzt sind wir gleich da. Bestimmt werden wir im Schloss schon sehnsüchtig erwartet! Schauen Sie nur, wie hübsch Stuttgart ist«, sagte der Arzt und zeigte auf einen großen Bau aus braunem Gestein, dessen Türme Wera an die uralte Ritterburg erinnerte, die sie in einem deutschen Kinderbuch einmal gesehen hatte.
Wera schwieg. Als ob Ritterburgen sie interessierten. Die ganze Fahrt über hatte das linke Hinterrad ihrer Kutsche seltsame Geräusche gemacht. Und von oben war unentwegt der Regen auf das Kutschendach gefallen. Pling. Pling. Pling. Wera war es so vorgekommen, als regnete es ihr direkt in den Kopf. Das war nicht schlimm gewesen. Der Regen hatte die vielen Fragen ausgelöscht, die in ihrem Schädel umherschwirrten.
Warum? Warum musste sie nach Stuttgart? Wo doch die Weihnachtszeit vor der Tür stand und sie mit ihrem Bruder Nikolai ein Singspiel hatte vorbereiten wollen. Warum hatten die Eltern nicht ihn geschickt?
Warum? Warum? Warum?
Weil es nun mal so ist, hatte ihre Mutter gesagt. Und dass sich Wera auf die liebe Tante Olga freuen solle.
Wera schüttelte es am ganzen Leib, was ihr einen schrägen Blick von Dr. Haurowitz eintrug. Sie wusste schon jetzt, dass sie »die liebe Tante Olga« hassen würde. Genau wie ihre Schwester, um die so viel Aufhebens gemacht wurde. Die nicht fortmusste zu irgendeiner Patentante, sondern die tanzen lernen durfte und schöne Bälle besuchte. Aus der einmal die Königin von Griechenland werden sollte.
Olga, Olga, Olga … Weras linke Hand hatte sich in die Ritze zwischen Sitz- und Rückpolster geschoben. Wenn sie sich anstrengte, konnte sie mit dem Fingernagel kleine Teile der Füllung herauskratzen.
»Fangen Sie schon wieder mit diesem Unsinn an?«, kam es sogleich von Dr. Haurowitz. »Muss ich Sie etwa auf dem letzten Wegstück erneut festbinden?«
Wera warf ihm einen Blick zu. Die linke Hand legte sie sittsam auf den Schoß. Kaum dass der Arzt aus dem Fenster schaute, begann sie mit ihrer rechten Hand in der Ritze zu pulen.
»Vater und ich kommen, so schnell es geht, auch nach Stuttgart«, hatte die Mutter zum Abschied gesagt. Ein kleiner Trost zumindest. Wann war »so schnell es geht«?
»Sehen Sie den großen Platz und das langgezogene Gebäude dahinter? Das ist das Stuttgarter Schloss«, sagte Dr. Haurowitz.
»Das soll ein Schloss sein? Wie klobig das aussieht. Und so schlicht!«, entfuhr es Wera. »Vaters Schwester muss eine sehr arme Frau sein …« Während sie noch rätselte, wie es sein konnte, dass eine russische Großfürstin arm war, kam ihr ein erhebender Gedanke: Womöglich hatte die Patentante nicht einmal genügend Geld, um sie, Wera, satt zu bekommen? Das wäre ja … Das wäre großartig! Wera nahm sich vor, besonders viel zu essen. Dann würde die Tante sagen, sie wäre zu teuer und müsse wieder nach Hause. Was für eine hervorragende Idee – ihre Eltern würden Augen machen, wenn sie plötzlich wieder in Petersburg auftauchte.
»Die Tante kann bestimmt nichts dafür, dass sie so arm ist«, sagte sie versöhnlich. »Sie ist ja keine Königin, sondern nur eine Prinzessin.«
»Die Württemberger arm – Sie kommen auf Ideen! Wehe, Sie geben nachher solch eine despektierliche Bemerkung von sich«, sagte Dr. Haurowitz, während er angestrengt aus dem Kutschenfenster schaute. Dabei gab es hier im Gegensatz zu den belebten Straßen von zuvor gar nichts zu sehen, der Platz vor dem Schloss war menschenleer. Nur ein paar Tauben stoben vor der heranfahrenden Kutsche davon.
Wera frohlockte. Von wegen: Sie wurden sehnsüchtig erwartet! Womöglich war die Tante verreist? Manchmal gingen Briefe verloren, oder? Vielleicht wusste die Tante gar nicht, dass sie anreiste? Dann konnten sie auf der Stelle kehrtmachen und heimfahren. Wera lächelte wie eine Katze in einem Mäusetraum.
»Und bei der Begrüßung wird auch nicht gesungen. Und nicht getanzt. Überhaupt: Wagen Sie es nicht, herumzuzappeln! Wenn die Kutsche hält und wir aussteigen, sind Sie still und warten, bis Sie von den Erwachsenen angesprochen werden. Dann machen Sie einen Knicks, wie es Ihre zahlreichen Gouvernanten Ihnen beizubringen versuchten. Haben Sie mich verstanden, Wera Konstantinowa?«
Wera nickte pflichtschuldig. Wie immer, wenn der Arzt besonders streng sein wollte, bewegten sich seine buschigen Augenbrauen wie kleine Tierchen auf und ab. Gustl und Moritz hatte Wera die beiden genannt. So hießen die zwei Eichhörnchen in dem deutschen Kinderbuch, das Tante Olga ihr einst als Weihnachtsgeschenk geschickt hatte. Gustl hatte mehr Haare als Moritz und saß ein Stück weiter oben.
Der Doktor tat zwar streng, war aber ein netter Mann. Viel netter als der schreckliche Arzt, der daheim so oft ihren Kopf untersucht hatte. Dr. Haurowitz hatte sie kein einziges Mal untersucht und ihr auch nicht weh getan. Stattdessen hatte er ihr spannende Geschichten erzählt. Von seiner Jugendzeit in Kopenhagen. Und einer Reise nach Indien, als er noch jung und Schiffsarzt gewesen war. Indien sei viel weiter entfernt als Württemberg, hatte er angefügt. Und dass sie froh sein könne, dass ihre Eltern sie nicht dorthin geschickt hatten. Dort würde nämlich der Pfeffer wachsen. Wera hatte diese Bemerkung nicht verstanden, aber dennoch in sein Lachen eingestimmt. Manchmal wäre es ihr allerdings lieber gewesen, der Arzt hätte geschwiegen, denn er hatte schrecklichen Mundgeruch. Moderigen Mundgeruch. Sie kicherte.
Der Arzt warf ihr einen wohlwollenden Blick zu. »Nun freuen Sie sich doch auf Ihre Patentante, nicht wahr?«
Die Kronprinzessin wohnte gar nicht im Schloss, erfuhr Dr. Haurowitz von den Wachen, die vor dem großen Portal postiert waren, sondern im Kronprinzenbau, und der lag dem Schloss direkt gegenüber.
Diese unerwartete Information brachte Wera durcheinander. Unruhig wippte sie mit beiden Füßen auf und ab. Was hatte das zu bedeuten? Sie sollte doch ins Schloss kommen, von einem Kronenbau war nie die Rede gewesen! Ob es ihren Eltern recht war, dass sie nun woandershin fuhren? Sie wollte gerade anfangen, darüber mit Dr. Haurowitz zu diskutieren, als die Kutsche hielt. Der Verschlag wurde aufgerissen und die kleine Treppe heruntergeklappt.
Dr. Haurowitz holte tief Luft, dann setzte er einen Fuß auf die Treppe. »Da wären wir.«
Wera lugte aus dem Fenster, während ihr Herz mit ihrem Magen Fangen spielte. Die vielen fremden Menschen. Württemberger.
Ganz vorn stand eine Frau, so schön, wie Wera noch keine gesehen hatte. Sie trug ein glänzendes Seidenkleid und einen kleinen Hund auf dem Arm. Ihre Haut war makellos, ihre Augen ausdrucksvoll und voller Tiefe. Aber es war etwas Unsichtbares, was Wera am meisten faszinierte. Diese Frau schien eine innere Leuchtkraft zu besitzen, und alle anderen Menschen, die ebenfalls auf dem Trottoir standen, schienen sich an ihr auszurichten. Wie Motten, die um ein Licht flatterten. War das ihre Patentante Olga?
Daneben stand eine zweite Frau, ebenfalls sehr hübsch. Sie hatte ihre rechte Schulter in einer beschützenden Weise vor die schöne Frau geschoben, als wollte sie diese vor jeglicher Unbill abschirmen. Ihr Blick war offen und freundlich, um ihren Mund lag jedoch ein energischer Zug, den Wera allzu gut kannte. Mit dieser Frau war nicht gut Kirschen essen!
Die Schöne und die Hübsche hatten sich beide schwarze Blumen ans Revers gesteckt.
Noch mehr Damen, wahrscheinlich Angehörige des Hofes, standen hinter ihnen. Auf den ersten Blick konnte Wera nichts Besonderes an ihnen erkennen. Viel interessanter waren die drei Herren, die ein wenig abseits standen. Jeder war auf eine besondere Art gutaussehend. Der Mann links, der mit der schneidigen Uniform, gefiel Wera am besten. Sie runzelte die Stirn. Warum waren alle Menschen in Württemberg so hübsch? Und warum trugen die Damen schwarze Blüten am Revers und die Herren schwarze Bänder um den Arm, das klassische Zeichen für Trauer an einem königlichen Hof?
»Wera Konstantinowa! Wo bleiben Sie denn?« Mit Dr. Haurowitz’ Frage schwappte ein Schwall Mundgeruch in die Kutsche.
Also gut! Wera holte tief Luft und stürzte an ihrem Reisebegleiter vorbei ins Unvermeidliche. Da Dr. Haurowitz’ rechter Fuß noch den Tritt okkupierte, blieb ihr nichts anderes übrig, als direkt aufs Trottoir zu springen. Sie stolperte und landete in den ausgebreiteten Armen der viel zu schönen Frau.
»Mein liebes Kind …« Die Frau lächelte. Und sie roch gut. Einen Wimpernschlag lang atmete Wera den feinen Duft ein, dann riss sie sich los.
»Ich bin nicht Ihr liebes Kind!« Wie ein angriffslustiger Stier stampfte sie mit dem rechten Fuß auf den Boden auf und schaute in die Menge, deren Blicke ihrerseits auf Wera gerichtet waren. Die Leute schauten nicht, sie starrten sie in einer Weise an, die sie gut kannte. Hierin waren sich die Menschen in Stuttgart und Petersburg also gleich.
Es war schließlich Dr. Haurowitz, der die Initiative ergriff, indem er sich als Leibarzt des Großfürsten Konstantin vorstellte.
»Bestimmt möchte Fräulein Wera Konstantinowa nun ordentlich guten Tag sagen.« Er warf ihr einen seiner strengen Blicke zu, bei dem Gustl und Moritz wild auf und ab hüpften.
»Wera, liebes Kind, erkennst du mich nicht mehr? Ich bin deine Patentante Olly«, sagte die schöne Dame lächelnd. »Und schau, dies ist Baronin Evelyn von Massenbach. Meine liebe Hofdame wird dir auf allen Wegen zur Seite stehen. Und das hier ist dein lieber Onkel Karl.« Sie zeigte auf einen der drei Herren, der sie anblickte, als habe er noch nie ein neunjähriges Mädchen gesehen. Wera hätte ihm am liebsten die Zunge herausgestreckt.
»Freiherr Wilhelm von Spitzemberg ist Karls Generaladjutant. Und der Herr zu meiner Linken ist Cäsar Graf von Beroldingen, unser aller Stallmeister. Er hat letzte Woche ein wunderschönes Pony für dich besorgt, nicht wahr, mein lieber Graf?«
Der Mann in der schneidigen Uniform nickte. Wie alle Herren trug er ein schwarzes Band um den rechten Arm. Der Stuttgarter Hof trug Trauer.
Wera presste die Lippen zusammen. Sie brauchte kein Pony. Zu Hause im Stall wartete Kalinka auf sie.
»Tragen Sie Trauerflor, weil ich gekommen bin? Ich kann auch wieder gehen!«, sagte sie bissig, während sie auf die schwarzen Blüten wies. Sogleich bekam sie von Dr. Haurowitz einen kleinen Stoß in den Rücken.
Ihre Patentante und die Hofdame wechselten einen entsetzten Blick.
»Aber Kind, wie kommst du auf solch eine Idee? Wir trauern, weil unser geschätzter Minister und Hofmarschall Friedrich Graf von Zeppelin heute früh gestorben ist.«
»Können Sie nicht einmal Ihren Mund halten?«, zischte Dr. Haurowitz in Weras Ohr. »Was haben Sie nun schon wieder angerichtet …«
Sie hatte schon wieder alles falsch gemacht. Wie immer. Wera drückte ihre geballte rechte Hand auf ihren Mund, um einen Aufschrei zu unterdrücken.
»Das … wollte ich nicht«, nuschelte sie. »Sie müssen mir glauben, bitte! Ich wollte nicht, dass der Mann stirbt. Hätten Sie ihm bloß nicht erzählt, dass ich komme.«
Ihre Patentante runzelte die Stirn. »Graf Zeppelin starb am Typhus, das hat doch mit dir nichts zu tun.«
»Machen Sie sich nichts daraus, Eure Hoheit«, sagte Dr. Haurowitz eilig. »Die kleine Dame ist nun einmal sehr … originell. Aber sie meint es nicht böse.«
»Was für ein trüber Tag, um Sie hier in Stuttgart in Empfang zu nehmen! Es wird höchste Zeit, dass wir ihm ein wenig Wärme verleihen. Wollen wir nicht endlich hineingehen?«, übernahm die Hofdame das Wort.
In einer freundschaftlichen Geste legte sie einen Arm um Wera, die sich sofort versteifte, woraufhin der Griff der Hofdame noch fester wurde.
»Nach der langen Reise bist du bestimmt hungrig und durstig. Es gibt Schokoladenkuchen und süßen, warmen Kakao!«
Wera blieb nichts anderes übrig, als Evelyn von Massenbach zu folgen. Wenn es sein musste, würde sie halt ein Stück Schokoladenkuchen essen. Oder zwei. Eines für sich und eines für den toten Grafen von Zeppelin. Zur Wiedergutmachung sozusagen. Ihre verkrampften Schultern entspannten sich ein wenig.
Ihre Tante schloss zu ihnen auf und sagte:
»Du bist müde und überreizt von der langen Reise, das ist normal. Deshalb bleiben wir heute entre nous, damit dir noch mehr Aufregung und Neues erspart bleiben. Morgen wirst du dann dem König und der Königin vorgestellt. Und danach habe ich ein paar Spielkameraden für dich eingeladen. Alle können es kaum erwarten, dich kennenzulernen.« Im Gehen legte Olly ihr von der anderen Seite her ebenfalls einen Arm um die Schulter.
Was redete die Tante da? Und warum taten alle so vertraulich mit ihr? Abrupt blieb Wera stehen, wand sich aus der Umklammerung der beiden Frauen.
»Ich brauche keine Spielkameraden. Ich will nach Hause zu meinen Geschwistern!« Bevor jemand etwas tun oder sagen konnte, drehte sie sich um und rannte die Treppe hinab. Ihre Augen rasten wild über den Schlossplatz, doch dann entschied sie sich anders, machte eine scharfe Kehre nach links und verschwand im engen Gewirr der Stuttgarter Straßen.
*
Karls Adjutant Wilhelm von Spitzemberg, Stallmeister von Beroldingen sowie ein halbes Dutzend weitere Bedienstete waren sofort losgestürzt, um das Kind einzufangen.
Händeringend saß Olly im Salon, ihr Blick starr auf den Eingang gerichtet. Wo blieben die Männer nur? Warum war Wera fortgelaufen? Die Vorstellung, wie das Kind orientierungslos durch die Stadt irrte, war zu schrecklich! Olly schluchzte auf.
»Jetzt weine doch nicht. Alles wird gut werden«, murmelte Karl und tätschelte hilflos ihre Hand. »Ehrlich gesagt habe ich mir das alles ein wenig anders vorgestellt. Das Kind selbst habe ich mir anders vorgestellt.«
Ollys Schluchzen hörte schlagartig auf. »Was willst du damit sagen?« Sie funkelte ihn angriffslustig an. Wehe, er wagte es, etwas gegen Wera zu sagen!
Karl hob abwehrend die Hände.
»Ich bin wirklich untröstlich, Eure Hoheit«, sagte Dr. Haurowitz. »Eine solche Aufregung hätte ich Ihnen gern erspart.« Er seufzte. »Allerdings kam diese Szene nicht unerwartet für mich. Genau aus dem Grund habe ich beim Großfürsten so beharrlich auf eine Alternativlösung gepocht.«
»Was soll das heißen? Dass Sie mit Weras Verschwinden gerechnet haben?«, fuhr Evelyn ihn scharf an. »Sie sind ja ein fabelhafter Aufpasser.«
»Eve, bitte. Dr. Haurowitz kann doch nichts dafür. Wahrscheinlich war die kleine Wera einfach überwältigt von unserem Wiedersehen«, sagte Olly. Sie schaute fragend von einem zum anderen. »Aber sie muss doch wissen, dass sie vor uns keine Angst zu haben braucht! Warum läuft sie fort?« Aus dem Augenwinkel heraus entdeckte sie einen Schatten an der Tür.
»Wera, endlich!«
Doch es war nur das Kammermädchen, das auf Karls Geheiß Weinbrand und Gläser brachte.
»Was meinten Sie mit Alternativlösung?«, sagte Karl und beäugte den Arzt eindringlich. »Sprechen Sie, Mann! Was hat das alles zu bedeuten?«
Der Leibarzt des Großfürsten Konstantin schaute betreten in die Runde, hüstelte verlegen.
»Sind Ihnen die näheren Umstände Weras Reise betreffend tatsächlich nicht bekannt?«
Olly, die gerade ihre Nase putzte, hielt inne. »Welche Umstände?«
»Vielleicht hätten Sie endlich die Freundlichkeit, uns reinen Wein einzuschenken?«, sagte Evelyn.
Mit einem gütigen Lächeln neigte sich der Arzt Olly entgegen. Eine Woge Mundgeruch traf sie, und sie presste ihr Taschentuch fester auf die Nase.
»Dass Sie Ihr Patenkind aufnehmen wollen, ist wirklich löblich«, sagte er. »Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob Liebe allein ausreicht, um Wera zu helfen. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber meiner Ansicht nach wäre das Kind in einer Anstalt mit ausgebildeten Ärzten und kräftigen Betreuern besser aufgehoben.« Er schüttelte betrübt den Kopf. »Diese ewigen Anfälle. Die Wutausbrüche. An manchen Tagen ist kein Durchdringen zu ihr möglich. Glauben Sie mir, nach dieser Reise weiß ich, wovon ich spreche.«
»Eine Anstalt? Kräftige Betreuer?« Konsterniert schaute Karl zwischen Olly und dem Arzt hin und her. »Wovon sprechen Sie, Mann? Olly, weißt du etwa mehr?«
»Was für eine Anstalt?«, fragte Olly mit hohler Stimme.
Der Arzt rieb über seinen Bart. »Nun ja … Sie wissen schon.« Er zuckte mit den Schultern. »Eine Anstalt für … spezielle Kinder.«
»Ein Irrenhaus?« Olly sprang so ruckartig auf, dass sie mit dem rechten Knie beinahe das Tablett mit dem Weinbrand umstieß. »Sie halten Wera für schwachsinnig? Wie können Sie es wagen, so von meinem Patenkind zu sprechen!«
»Ich weiß, allein der Gedanke an eine Unterbringung in solch einem Heim ist peinlich. Und dann auch noch die Nichte des Zaren …«, antwortete Dr. Haurowitz. Als Leibarzt des Großfürsten hatte er seit jeher auch unbequeme Wahrheiten von sich geben müssen. Er hatte sich längst abgewöhnt, sich von jedem bösen Blick, der ihn traf, einschüchtern zu lassen.
»Glauben Sie mir: Weras Eltern haben im letzten Jahr wirklich alles versucht. Ein halbes Dutzend meiner Kollegen wurden konsultiert, zahlreiche Untersuchungen mit dem Kind angestellt. Doch alle kamen sie zum selben Schluss. Deshalb war ich erstaunt, als ich hörte, dass die Kleine dennoch zu ihrer Tante nach Hannover sollte. Wie kann eine Frau, die einen blinden Ehemann zu versorgen hat, sich auch noch um ein geisteskrankes Kind kümmern?, wollte ich von Großfürst Konstantin wissen. Dann kam die Absage aus Hannover, und ich versuchte erneut, auf eine Einweisung in ein Heim hinzuwirken. Doch da war schon der Gedanke geboren, sie hierher zu schicken.« Er machte mit seiner rechten Hand eine ausholende Bewegung, die den Kronprinzenpalast einschloss. »Als Ihr Bruder mich bat, Wera auf dieser Reise zu begleiten, willigte ich ein, denn auch mir war klar, dass nach dem Vorfall während König Georgs Besuch in St. Petersburg etwas geschehen musste. Aber kaum sind wir angekommen, geht der Ärger schon weiter! Was meine Ansichten nur bestätigt.« Er nahm sein Glas Weinbrand und leerte es in einem Zug.
»Kosty wollte Wera zu Marie nach Hannover geben? Davon stand nichts in Saschas Brief …« Olly blinzelte verständnislos. Ihr Bruder hatte sie angelogen. Zumindest hatte er ihr nicht alles gesagt. Sie wusste nicht, ob sie traurig oder wütend sein sollte. Ein Umstand, der nicht neu war – ihre Gefühle für Sascha waren seit langer Zeit gemischter Art. Bilder, wie Sascha gemeinsam mit seiner blutjungen Geliebten Katharina Dolguruki und seiner lungenkranken Frau Cerise unter einem Dach hauste, schlichen sich in Ollys Kopf. In St. Petersburg und am Hof sprach man von einem Skandal. Olly nannte es schlicht eine Tragödie. Sie verstand einfach nicht, wie Sascha Cerise das antun konnte. Glaubte er, nur weil er Zar war, sich alles erlauben zu können? Hatte er ihr auch deswegen nicht die ganze Wahrheit Wera betreffend gesagt? Was war eigentlich die Wahrheit? Bisher kannten sie nichts als das Gerede eines alten Mannes.
Dieselbe Frage schienen sich auch Karl und Evelyn zu stellen, denn im selben Atemzug hoben sie zu sprechen an.
»Was war denn eigentlich los, während –«
»Was hat Wera angestellt, als König Georg –«
Dr. Haurowitz’ Auflachen entbehrte jeglicher Fröhlichkeit. »Sie wollen es wirklich wissen?« Mit hochgezogenen Brauen schaute er in die Runde. »Es war schauerlich. Als die Eltern mit König Georg das Kinderzimmer aufsuchten, um Olgata vorzustellen, fanden sie ihre Tochter nackt an einen Stuhl gefesselt. Ihr Körper war über und über mit Erdbeermarmelade beschmiert, diese sollte Blut darstellen. Wera und ihr Bruder Nikolai tanzten mit hölzernen Schwertern in der Hand um die weinende Gefangene herum. Während die Großfürstin mit einer Ohnmacht kämpfte, erbat der Großfürst eine Erklärung. Lachend erklärte Wera, sie seien Attentäter und Olga ihr Opfer. Je mehr Blut flösse, desto besser wäre es.« Der Arzt schaute in die Runde. »Sie müssen mir zustimmen: Solch ein Spiel kann doch nur einem kranken Hirn entspringen!«
»Die Kinder spielten ein Attentat nach?«, fragte Karl mit weit aufgerissenen Augen.
Ihr liebes kleines Patenkind und solch ein gemeines Spiel? Das ging so schlecht zusammen wie Öl und Wasser! Olly schüttelte den Kopf. »Bestimmt war Nikolai der Anstifter. Karl, erinnerst du dich – in fast jedem seiner Briefe beschwert sich Kosty über die Frechheiten seines Sohnes. Nikolai hat Wera zu diesem Spiel verführt, so war es!«
Dr. Haurowitz seufzte. »Ich befürchte, in diesem Fall war wirklich Wera die treibende Kraft. Es war nicht das erste Mal, dass man sie bei diesem … Spiel erwischt hat.«
»Kein Wunder, dass sich die Königin von Hannover weigerte, das Kind aufzunehmen«, sagte Evelyn von Massenbach. Sie ergriff Ollys rechte Hand, drückte sie und sagte leise, aber bestimmt: »Ihnen ist doch klar, dass es nicht dienlich wäre, Wera unter diesen Umständen hierzubehalten? Niemand von uns wäre in der Lage –« Sie brach ab, weil plötzlich neben ihr Lachen ertönte.
Beide Frauen schauten Karl entsetzt an.
»Verzeihung«, sagte der Kronprinz. »Aber die Vorstellung ist einfach zu komisch. Wäre ich an der Stelle des Griechen gewesen, so hätte ich auf dem Absatz kehrtgemacht.« Er hob sein Glas und prostete dem Arzt zu.
Olly schaute ihren Mann traurig an. »Es gab Zeiten, da bist du nicht vor jeder Herausforderung gleich zurückgeschreckt«, flüsterte sie ihm so leise zu, dass nur er es hören konnte. Dann wandte sie sich an den Arzt.
»Weiß Wera, dass man in Russland erwog, sie in ein Heim zu stecken?« War sie deswegen angsterfüllt fortgerannt? Weil sie geglaubt hatte, dasselbe Schicksal würde ihr hier in Stuttgart drohen?
Doch Dr. Haurowitz verneinte. »Wo denken Sie hin! Die Eltern haben mit Wera nicht darüber gesprochen.« Die Missbilligung in seiner Stimme war nicht zu überhören.
Olly atmete auf. »Dabei soll es auch bleiben. Und Wera darf niemals die wahren Gründe für ihr Exil erfahren, hört ihr? Wehe, es fällt auch nur eine Bemerkung dieser Art! Wera ist nicht geisteskrank, da können Sie sagen, was Sie wollen. Und in eine Anstalt kommt sie nur über meine Leiche. Ich weiß, wie es in solchen Heimen zugeht, schließlich stehe ich der Heil- und Pflegeanstalt Mariaberg vor. Das Personal gibt sich alle Mühe, davon kann ich mich bei jedem meiner Besuche überzeugen, aber sie sind mit der großen Zahl ihrer Pfleglinge überfordert. Karl, du kannst dir nicht vorstellen, wie laut es dort ist! Die armen Irren schreien unentwegt, andere toben und sind eine Gefahr für sich und andere. Den Pflegern bleibt nichts übrig, als sie zu fesseln. Etliche sind nicht nur krank im Geiste, sondern leiden auch unter Knochendeformierungen oder anderen körperlichen Behinderungen. Die Kinder in solchen Institutionen sind besonders arm dran. Wenn ich an ihre Blicke denke, leer und irr …« Ein Frösteln kroch über Ollys Rücken. Auch wenn sie es ungern zugab – von allen wohltätigen Verpflichtungen, denen sie sich verschrieben hatte, fielen ihr die Besuche in der Irrenanstalt in der Nähe von Reutlingen am schwersten.
»Ich pflichte Ihnen bei. Selbst nach dem Auftritt von vorhin glaube ich nicht, dass die kleine Wera ein Fall für Mariaberg oder sonst eine Anstalt wäre«, sagte Evelyn, die Olly bei ihren Besuchen stets begleiten musste. »Die Frage, ob wir in der Lage sind, ihr zu helfen, bleibt dennoch bestehen …«
Liebevoll schaute Olly ihre Hofdame an. So zaghaft kannte sie ihre beste Freundin gar nicht. Eigentlich ließ sich Eve von nichts und niemandem Bange machen.
Ollys Schultern strafften sich. Bangemachen galt auch jetzt nicht!
»Gewiss können wir das. Mit Liebe und Geduld lässt sich viel erreichen. Ich gebe zu, was Dr. Haurowitz erzählte, hat auch mich überrascht. Dass meine Familie so ratlos ist, wusste ich nicht, sonst hätte ich meine Hilfe schon viel früher angeboten. Doch der Zar hat sich nicht umsonst explizit an mich gewandt. Ich werde sein Vertrauen nicht enttäuschen. Andere mögen vor einer solchen Aufgabe zurückschrecken – ich jedoch werde daran wachsen.«
»Olly«, sagte Karl in seltsamem Ton. »Willst du etwa wirklich –«
Sie fixierte ihn mit einem Blick, der ausdrückte: Wage es, mich aufzuhalten!
»Wera bleibt.«
Wie aufs Stichwort ging die Tür auf, und Cäsar Graf von Beroldingen erschien mit Wera auf dem Arm.
»Eure Hoheit – hier haben Sie die kleine Ausreißerin wohlbehalten wieder!« Lächelnd setzte er das strampelnde Mädchen ab. »Wir haben sie auf dem brachliegenden Areal zwei Straßen weiter gefunden. Sie spielte dort.«
Als wäre nichts gewesen, kam Wera auf Olly zugerannt.
»Schau nur, was ich entdeckt habe: eine Schnecke in ihrem Haus. Ist die nicht furchtbar schleimig?«
3. KAPITEL
Zwei Scheiben Braten, Kartoffeln, Gemüse, etwas Fisch und Sülze und zum Nachtisch ein Stück Schokoladenkuchen – Karl und Olly staunten nicht schlecht, wie viel ein kleines Mädchen essen konnte. Ihr guter Appetit hielt sie nicht davon ab, ausführlich und laut die Eindrücke ihres »Ausflugs« wiederzugeben: Die Häuser in Stuttgart seien doch recht ärmlich im Vergleich zu den Petersburger Prachtbauten. Und Flüsse gäbe es wohl auch nicht, und warum trugen die Menschen keine Pelze, jetzt, im Winter? Rentiere habe sie auch keine gesehen, fügte sie enttäuscht hinzu. Ob die Samojeden denn hier in der Stadt kein Winterlager unterhielten?
Rentiere in Stuttgart? Bei ihnen gäbe es höchstens eine Menge Rindviecher!, antwortete Karl lachend.
Satt und müde ließ sich Wera nach dem Essen anstandslos von Evelyn ins Bett bringen. Olly und Karl schauten den beiden erleichtert nach. Bei einem Glas Wein kamen sie zu dem Ergebnis, dass alles nur halb so schlimm gewesen war. Dr. Haurowitz konnte so bald wie möglich seine Sachen packen und abreisen. Dass er sie so unnötig erschreckt hatte!
Am nächsten Morgen erwachte Olly voller Zuversicht und gut gelaunt. Ihr Blick fiel aus dem Fenster, wo Stuttgart im Glanz der Wintersonne so appetitlich wirkte wie ein frisch geschälter Apfel. Sonnenschein – ein gutes Omen für Weras ersten Tag in Stuttgart.
Am liebsten wäre Olly noch im Nachthemd zu Wera ins Nebenzimmer gegangen, doch Evelyn hatte angeboten, sich um das Kind zu kümmern. Olly solle wie jeden Morgen bei einer ersten Tasse Tee in Ruhe zu sich kommen, hatte sie gemeint.
Olly streckte ihre Arme in die Höhe und dehnte sich wie eine Katze. Während sie das belebende Aroma ihres Morgentees genoss, ging sie in Gedanken die Pläne für den Tag durch: Zuerst würden sie hinüber ins Schloss gehen, um Wera dem König vorzustellen. Olly graute vor diesem Besuch, aber er war unvermeidlich. Sie würde ihn so kurz wie möglich halten. Als Nächstes war ein kleiner Empfang im Kronprinzenbau geplant, bei dem Wera Karls Schwestern und deren Kinder kennenlernen sollte. Olly hatte den Koch angewiesen, hierfür schwäbische und russische Spezialitäten zuzubereiten. Bei Blinis und Maultaschen würden die anfänglichen Hemmungen sicher bald verlorengehen. Hoffentlich machten es Marie und Katharina der Kleinen nicht allzu schwer. Und hoffentlich bekam Wera nicht ausgerechnet bei diesem ersten Treffen einen »Anfall«. Olly hatte zwar noch immer keine Ahnung, was Dr. Haurowitz damit meinte, aber sie wollte es auch nicht unbedingt heute herausfinden.
Ihr Tee war nur noch lauwarm, und auf seiner Oberfläche hatte sich eine Haut gebildet. Olly stellte die Tasse fort. Wenn nur Fürst Gortschakow noch hier wäre!, dachte sie nicht zum ersten Mal. Obwohl Sascha den ehemaligen russischen Gesandten schon vor Jahren nach Russland zurückbeordert hatte – Fürst Gortschakow war inzwischen zum Außenminister und Kanzler von Russland aufgestiegen –, vermisste Olly ihren alten Freund und Ratgeber noch immer. Er war es gewesen, der ihr in ihrer Anfangszeit in Stuttgart geholfen hatte, so manche diplomatische Hürde zu nehmen. Wann immer die Lasten auf ihren Schultern sie zu erdrücken drohten, hatte er ihr neuen Mut zugesprochen. Er und Eve.
Was hätte der alte Fürst ihr für den heutigen Tag geraten? Hätte er lachend gemeint, sie würde sich unnötige Sorgen machen? Hätte er seinen Lieblingsspruch, »Vergessen Sie nicht, dass Sie eine russische Großfürstin sind«, wiederholt? Seit jeher war Gortschakow nämlich der Ansicht gewesen, dass sich sämtliche Probleme in Luft auflösten, solange Olly nur recht herrschaftlich auftrat. Kopf hoch, Kinn nach vorn, der Blick geradeaus. Dass ihr dieses Auftreten den Ruf eingebracht hatte, unnahbar und arrogant zu sein, hatte Fürst Gortschakow nicht bedacht.
Unnahbar und arrogant! Olly lächelte traurig. Was wussten die Menschen schon? Manchmal half es eben, sich die eigene Angst und Unsicherheit nicht anmerken zu lassen, sondern so zu tun, als wäre man über alles erhaben. Mit Schwung setzte Olly beide Beine auf den Boden. Sie würde sich auch heute zu schützen wissen. Und wehe, jemand wagte es, ihrem Kind gegenüber unfreundlich zu sein!
»Du bist also Ollys Patenkind.« Obwohl der König bis zum Kinn zugedeckt im Bett lag, gelang es ihm, Wera von oben bis unten zu mustern, was diese stocksteif und mit hocherhobenem Kopf über sich ergehen ließ. Olly applaudierte ihr im Stillen. Nur nicht Bange machen lassen.
»So ein hässliches Kind wie dich habe ich noch selten gesehen«, sagte der König missmutig und spuckte eine Portion blutigen Schleim in die dafür bereitgestellte Schüssel.
»Wilhelm!« Königin Pauline, die neben dem Bett stand, sah empört aus.
»Vater!« Auch Karl war entsetzt. Hilfesuchend drehte er sich zu Olly um, doch ihr hatte es die Sprache verschlagen. Wie konnte Wilhelm nur? Es hätte nicht viel gefehlt und sie hätte dem alten Mann für seine Gemeinheit eine Ohrfeige verpasst. Stattdessen nahm sie Weras Hand und wollte auf dem Absatz kehrtmachen, aber das Mädchen hatte etwas anderes im Sinn.
Stirnrunzelnd beobachtete Olly, wie Wera näher ans Bett herantrat. Nun war sie es, die den König einer eingehenden Begutachtung unterzog. Ihr Gesicht war dabei höchstens zwei Handbreit von dem des alten Mannes entfernt. Schließlich schaute sie dem König trotzig in die Augen.
»Besonders hübsch sind Sie mit Ihrem grauen Bart und den aus der Nase wachsenden Haaren aber auch nicht!«, sagte sie und zog eine Grimasse.
Pauline gab einen langen Zischlaut von sich.
Karl hielt sich eine Hand auf den Magen, als würde er von schrecklichen Schmerzen geplagt.
Olly hingegen hatte Mühe, ein Schmunzeln zu unterdrücken. Nie, niemals hätte sie ein solches Auftreten dem König gegenüber gewagt. Alle waren derart vom Donner gerührt, dass sie im ersten Moment gar nicht auf den kranken Mann in seinem Bett achteten.
König Wilhelm lachte und lachte und hörte gar nicht mehr auf. »Du bist mir vielleicht ein Lumpentier!«, sagte er, während ihm Tränen über die Wangen liefen. »Schneid hat die Kleine jedenfalls, das gefällt mir. Aber werde bloß nicht allzu frech!«, sagte er zu Wera und hob drohend den Zeigefinger. Dann brach er erneut in Gelächter aus.
»Dein Vater ist wirklich sehr lustig«, sagte Wera kurze Zeit später zu Karl, während sie das Kopfsteinpflaster des Schlossplatzes in einem nur ihr bekannten Muster hüpfend überwand.
»Wenn die Kleine meinen Vater für lustig hält, wird sie alle anderen, die sie heute noch kennenlernt, wahrscheinlich heiraten wollen«, murmelte Karl Olly ins Ohr. Lachend betraten sie das Kronprinzenpalais, wo sich im großen Saal schon die ersten Gäste eingefunden hatten.
*
Eigentlich hatte der Tag ganz gut begonnen: Evelyn war mit einer großen Tasse Kakao ins Zimmer gekommen und hatte ihr beim Trinken zugeschaut. Danach hatte sie lediglich darauf bestanden, dass sich Wera den Mund abwusch. Erleichtert darüber, sich vor der fremden Frau nicht ausziehen zu müssen, hatte sich Wera klaglos in ein Kleid stecken lassen, das ihre Tante für sie besorgt hatte: hellblau mit viel Spitze, Rüschen und kleinen Perlmuttknöpfen. Wera fand das Kleid wunderschön. Was für ein Jammer, dass ihre Schwester Olgata es nicht sehen konnte, sie wäre bestimmt vor Neid erblasst!
Leider hatte sie während des Frisierens mit der Bürste zwei Knöpfe abgerissen. Sie wollte sie noch auffangen, doch zu spät: Das feine Perlmutt zersplitterte auf dem Marmorboden. Evelyn hatte säuerlich dreingeschaut, aber nichts gesagt. Immerhin.
Das Frühstück war fein gewesen, es gab ein geschlungenes Gebäck, das Olly »Brezel« nannte. Wera nahm sich vor, ihren Eltern davon zu berichten. Bestimmt würde der Hofbäcker in Petersburg so etwas auch hinbekommen.
Auch der Besuch bei Karls Vater war in Ordnung gewesen. Im Krankenzimmer waren ihr alle schrecklich nervös vorgekommen. Als Olly ihren Schwiegervater begrüßte und Wera vorstellte, hatte sogar ihre Stimme anders geklungen: quietschend und künstlich. Und Karl hatte ständig seine Zunge von innen gegen die rechte Wange gedrückt, als habe er Zahnweh. Als Wera ihn danach fragte, hatte er nur abwesend den Kopf geschüttelt. Nur der König war die Ruhe selbst. Und er hatte ein Lachen wie Jurij, der stets gutgelaunte Leibkutscher ihres Vaters. Laut und aus voller Brust. Hohoho!
All das würde sie ihren Eltern erzählen. Hoffentlich kamen sie bald, denn sich so viel zu merken war ziemlich anstrengend. Eigentlich wäre ich jetzt lieber ein wenig allein, anstatt noch mehr Leute zu treffen, dachte Wera bei sich, während sie ihrer Tante und dem Onkel in den großen Salon folgte.
Karl hatte vier Schwestern, und drei davon waren gekommen, um sie, Wera, zu begrüßen. Die vierte war Königin der Niederlande und hatte keine Zeit für Wera. Was ihr nur recht war, denn die Begrüßungszeremonie dauerte so schon eine halbe Ewigkeit! Mit jeder Hand, die sie schüttelte, mit jedem Knicks, den sie sich abrang, wurde Wera müder und unruhiger.
Prinzessin Katharina war ungefähr in Ollys Alter und fand sich sehr wichtig. Ständig fiel sie allen anderen ins Wort, ständig hieß es: Wily hier und Wily da.
Wera fand Katharina gar nicht nett und ihren Sohn Wily auch nicht. Wie er sie anstarrte! Wera hasste es, wenn Menschen sie so anschauten. Mit seinen fünfzehn Jahren tat Wily schrecklich erwachsen, dabei hatte er ein Bilderbuch unter den Arm geklemmt, in dem eine Geschichte von Hasen und Rehen erzählt wurde. Wera fand das ziemlich kindisch. Und das würde sie ihm später auch sagen.
Karls Schwester Marie war uralt und hatte ein verbissenes Gesicht. Sie sprach nicht viel, sondern schaute nur mürrisch drein. Kinder hatte sie nicht. Die Hand, die sie Wera reichte, war kalt und feucht wie ein Fisch.