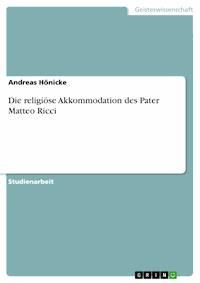Die Sächsische Gesandtschaft in München und ihre Berichterstattung von 1918-1930 E-Book
Andreas Hönicke
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Note: 1,3, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Gesandtschaften werden in der einschlägigen Literatur als Institutionen beschrieben, die unter Beachtung diplomatischer Reglements Verbindungen zwischen zwei Staaten auf- und ausbauen. Die Souveränität sowohl des entsendenden als auch des empfangenden Staates bildet die Voraussetzung für eine privilegierte Sonderstellung des Gesandten und garantiert die ungehinderte Erfüllung seines Auftrages. Einschränkungen der einzelstaatlichen Hoheit im Zuge einer bundesstaatlichen Vereinigung stellen demzufolge die Ausübung des diplomatischen Verkehrs in Frage. Mit der Vereinigung der deutschen Einzelstaaten zu einem Staatenbündnis im Jahre 1871 und einer weiteren Beschneidung einzelstaatlicher Souveränität durch die Weimarer Reichsverfassung von 1919 geriet deshalb die gesandtschaftliche Praxis auf den Prüfstand. Die Sächsische Gesandtschaft in München ist innerhalb dieser veränderten politischen Rahmenbedingungen in bisherigen Publikationen nicht untersucht und dargestellt worden. Im Rahmen der Arbeit wurden folgende wesentliche Fragen erörtert: 1. Inwiefern äußerte sich die diplomatische Sonderstellung der sächsischen Vertretung vor dem Hintergrund der bundesstaatlichen Verfassung? 2.Welche personellen und materiellen Faktoren bestimmten den Dienst der Gesandtschaft? 3. Lassen sich im Betrachtungszeitraum charakteristische Merkmale und Unterschiede in der Berichterstattung der sächsischen Vertretung feststellen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Page 1
Page 5
I. Einleitung
Unter dem Begriff „Diplomatie“ sind all diejenigen Organe einer Staatsgewalt zusammenzufassen, denen die Pflege auswärtiger Beziehungen eines Staates als amtliche Aufgabe übertragen ist.1Gesandtschaften werden in der einschlägigen Literatur als Institutionen beschrieben, die unter Beachtung diplomatischer Reglements Verbindungen zwischen zwei Staaten auf- und ausbauen.2Die Souveränität sowohl des entsendenden als auch des empfangenden Staates bildet die Voraussetzung für eine privilegierte Sonderstellung des Gesandten und garantiert die ungehinderte Erfüllung seines Auftrages. Einschränkungen der einzelstaatlichen Hoheit im Zuge einer bundesstaatlichen Vereinigung stellen demzufolge die Ausübung des diplomatischen Verkehrs in Frage.3Mit der Vereinigung der deutschen Einzelstaaten zu einem Staatenbündnis im Jahre 1871 und einer weiteren Beschneidung einzelstaatlicher Souveränität durch die Weimarer Reichsverfassung von 1919 geriet deshalb die gesandtschaftliche Praxis auf den Prüfstand.
Die Sächsische Gesandtschaft in München ist innerhalb dieser veränderten politischen Rahmenbedingungen in bisherigen Publikationen nicht untersucht und dargestellt worden. Dabei bietet sich diese einzelstaatliche Vertretung als Untersuchungsgegenstand außerordentlich an, da besonders Sachsen auf die Beibehaltung des Gesandtschaftsrechtes unter der Weimarer Reichsverfassung großen Wert legte.4In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Inwiefern äußerte sich die diplomatische Sonderstellung der sächsischen Vertretung vor dem Hintergrund der bundesstaatlichen Verfassung? Welche personellen und materiellen Faktoren bestimmten den Dienst der Gesandtschaft? Lassen sich im Betrachtungszeitraum charakteristische Merkmale und Unterschiede in der Berichterstattung der sächsischen Vertretung feststellen?
Da sich die Fragestellung auf die bundesstaatlichen Verhältnisse der Weimarer Republik bezieht, werden die personell und politisch bedingten Veränderungen der Gesandtschaft von der Novemberrevolution 1918 bis hin zur endgültigen Schließung 1930 dargestellt. Die sächsische Vertretung hatte ihren Sitz und Tätigkeitsschwerpunkt in München. Daher bleibt der Dienst im Bereich der Nebengesandtschaften in der vorliegenden Studie weitgehend unberücksichtigt. Die Untersuchung der Gesandtschaft erfolgt vorrangig unter einem
1Zorn, Philipp: Deutsches Gesandtschafts- und Konsularrecht auf der Grundlage des allgemeinen
Völkerrechts, in: Stier-Somlo, Fritz (Hrsg.): Handbuch des Völkerrechts, Bd. 3, Teilbd. 2, Berlin, Stuttgart,
Leipzig 1920, S. 1.
2Nüsslein, Franz: Gesandtschaftsrecht, in: Schlochauer, Hans-Jürgen (Hrsg.): Wörterbuch des Völkerrechts,
Bd. 1, Berlin 1960, S. 670.
3Zorn, Philipp, Gesandtschafts- und Konsularrecht, S. 10-11.
4Abschrift eines Schreiben des Sächsischen Ministerpräsidenten Gradnauer an die Sächsische Gesandtschaft
Berlin vom 23.12.1919, Sächsisches Hauptstaatsarchiv (SächHStA), Gesandtschaft München 369.
Page 2
Kapitel III thematisiert die rechtlichen Grundlagen, auf die sich Organisation und Dienst der Sächsischen Gesandtschaft stützten. Dabei ist vor dem Hintergrund der bundesstaatlichen Verfassung zu beleuchten, inwieweit diplomatische Gepflogenheiten Anwendung fanden und welchen Zweck sie erfüllten. Der theoretischen Darstellung der gesandtschaftlichen Aufgaben schließt sich die Betrachtung der praktischen Umsetzung im täglichen Dienst und der dabei zu beachtenden Vorschriften an. Die Ausführungen zum Personal der sächsischen Vertretung konzentrieren sich vorrangig auf biographische Elemente der Gesandten. Neben Fakten zu Herkunft und beruflichem Werdegang, soll dieser Abschnitt auch einen Eindruck von der Persönlichkeit des Diplomaten vermitteln, welche für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Bayerischen Regierung von großer Bedeutung war. Angaben zu Angestellten und Beamten der Vertretung, welche den Gesandten bei der Erfüllung seines Auftrages unterstützten, runden die Betrachtungen des Personals ab. Die Rekonstruktion der Unterbringungsverhältnisse dient dazu, das entsprechende Arbeitsumfeld der sächsischen Vertretung sowie in diesem Zusammenhang auftretende Probleme zu verdeutlichen. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Schilderung der Umstände, welche innerhalb des betrachteten Zeitraumes dazu führten, dass die bayerisch-sächsischen Beziehungen mehrmals abgebrochen und wieder aufgenommen wurden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Vorgänge hinter den offiziellen politischen Kulissen sowie personelle und finanzielle Faktoren, welche die Entwicklung der diplomatischen Vertretung maßgeblich beeinflussten. In Kapitel IV erfolgt die Analyse der allgemeinen politischen Berichterstattung, in der die hauptsächliche Aufgabe des sächsischen Gesandten bestand. Das Ziel ist dabei nicht die Rekonstruktion der bayerischen Geschichte anhand der Berichtsinhalte, sondern eine Charakterisierung der Berichterstattung hinsichtlich ihrer Erscheinungsform. Im Rahmen
Page 3
Eine wissenschaftliche Untersuchung der sächsischen Vertretung ist in der bisher publizierten Forschungsliteratur für den betrachteten Zeitraum nicht verfügbar. Aufgrund des somit fehlenden verwertbaren Materials war es erforderlich, zur Bearbeitung der Fragen eine dafür geeignete Basis zu schaffen. Der arbeitsintensivste Teil dieser Studie bestand in der Dokumentation und Auswertung der relevanten Schriftstücke. Umfangreiche Recherchen zur Zusammenstellung der erforderlichen Informationen erfolgten in den Hauptstaatsarchiven Dresden und München. Für den organisationsgeschichtlichen Teil dieser Studie wurden vornehmlich Akten des Hauptstaatsarchives Dresden aus dem Bestand der Gesandtschaft München analysiert. Er beinhaltet den gesamten Schriftverkehr der Vertretung sowohl mit den sächsischen als auch den bayerischen Behörden. Die für den betrachteten Zeitraum relevanten Dokumente sind vollständig und in guter Qualität verfilmt. Gleiches gilt für den Bestand des Sächsischen Außenministeriums, aus dessen Personalakten unter anderem die
Page 4
Verwertbares Material befindet sich außerdem im Bayerischen Hauptstaatsarchiv. Zur Sächsischen Gesandtschaft existiert ein selbständiger Akt im Bestand des Bayerischen Außenministeriums, der wertvolle Informationen zum Gesandten Gottschald enthält. Ferner dazu wurde auch der persönliche Nachlass des Geschäftsträgers Maximilian von Dziembowski im Hauptstaatsarchiv München auf relevantes Material überprüft. Da die darin enthaltenen Schriftstücke hauptsächlich nach seinem Dienst bei der Sächsischen Gesandtschaft abgefasst sind, konnten sie lediglich als Ergänzung hinzugezogen werden. Die Verwendung von Literatur beschränkt sich innerhalb dieser Studie vorrangig auf Anmerkungen zur allgemeinen Entwicklung der innerdeutschen Gesandtschaften. An erster Stelle ist hierbei der Aufsatz von Hans-Joachim Schreckenbach5zu nennen, der den Bedeutungswandel der diplomatischen Ländervertretungen nach 1867 thematisiert. Darauf aufbauend äußert sich Wolfgang Benz6ausführlich zur Debatte um das Gesandtschaftsrecht zwischen Ländern und Reich in den Anfangsjahren der Weimarer Republik. Der Bearbeitung des gesandtschaftsrechtlichen Teiles dieser Studie wurden vor allem die juristischen Abhandlungen Wahls7und Döhrings8zu Grunde gelegt, welche diese Thematik hauptsächlich vor dem Hintergrund der bundesstaatlichen Weimarer Reichsverfassung beleuchten. Als Ergänzung dazu fungieren zum Einen die allgemeinen gesandtschaftsrechtlichen Ausführungen Zorns9zum Anderen Eschs10Betrachtung des einzelstaatlichen
5Schreckenbach, Hans-Joachim: Innerdeutsche Gesandtschaften 1867-1945, in: Archivar und Historiker.
Studien zur Archiv- und Geschichtswissenschaft. Festschrift für Heinrich Otto Meisner zum 65. Geburtstag
(=Schriftenreihe der Staatlichen Archivverwaltung, Bd. 7), Berlin 1956, S. 404-428.
6Benz, Wolfgang: Süddeutschland in der Weimarer Republik. Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 1918-
1923 (=Beiträge zu einer historischen Strukturanalyse Bayerns im Industriezeitalter, Bd. 4), Berlin 1970.
7Wahl, Kurt H.: Die Deutschen Länder in der Aussenpolitik (=Tübinger Abhandlungen zum öffentlichen
Recht, Bd. 22), Stuttgart 1930.
8Döhring, Erich: Das Gesandtschaftsrecht der deutschen Einzelstaaten unter der Verfassung von Weimar,
Halle(Saale) 1928.
9Zorn, Philipp, Gesandtschafts- und Konsularrecht, 1920.
10Esch, Otto: Das Gesandtschaftsrecht der Deutschen Einzelstaaten, Bonn 1911.
Page 5
11Large, David Clay: Hitlers München. Aufstieg und Fall der Hauptstadt der Bewegung, München 1998.
12Maser, Werner: Der Sturm auf die Republik. Frühgeschichte der NSDAP, Stuttgart 1973.
Page 6
-6-II.Innerdeutsche Gesandtschaften bis 1920
1. Die Entwicklung des deutschen Gesandtschaftswesens bis 1918
In Deutschland begann die Entwicklung des Gesandtschaftswesens als „aus dem Lehnswesen in sich gefestigte, kräftige Splittergewalten“13entstanden. Diese Kleinststaaten waren um ihrer Existenz willen angehalten, sich gegen andere Stammesgebilde zu behaupten. Den jeweiligen Herrschern standen dazu eine Reihe völkerrechtlicher Handlungsoptionen offen. Neben dem Abschluss von Bündnissen, war dies vor allem das Recht Kriege zu erklären, zu führen und Frieden zu schließen. Daraus resultierende diplomatische Aufgaben und Kontakte wurden zunächst von angelegenheitsspezifischen, im Lauf der Entwicklung auch von ständigen Gesandten bewältigt.14
Einen Entwicklungsschub verzeichneten die Gesandtschaften durch die Ergebnisse des Westfälischen Friedens, als die deutschen Staaten aufgrund der Verleihung völliger Souveränität eine uneingeschränkte völkerrechtliche Handlungsfähigkeit erhielten. Das beinhaltete vor allem die Option, Beziehungen zu anderen inner- und außerdeutschen Staaten aufzubauen, zu pflegen, zu reduzieren oder einschlafen zu lassen soweit die Interessen des Reiches davon nicht unberührt blieben.15Infolge der Eröffnung dieser Möglichkeiten entstand ein dauerhaftes, stark verzweigtes Netz diplomatischer Beziehungen der Einzelstaaten untereinander und mit dem Ausland. Eine einheitliche Vertretung der Interessen Gesamtdeutschlands konnte nicht verzeichnet werden. Der Kaiser galt zwar rechtlich gesehen als Repräsentant der Reichsaußenpolitik, was das aktive und passive Gesandtschaftsrecht einschloss, allerdings hatte er für jede diesbezügliche Entscheidung die Reichsstände zu befragen.16
Die einzelstaatlichen Gesandtschaften überlebten weitestgehend alle nationalen Bestrebungen wie zum Beispiel die Gründung des Deutschen Bundes 1815 oder den Versuch der Errichtung eines Nationalstaates im Zuge der Revolution von 1848/49.17Mit der Gründung des norddeutschen Bundes 1866/67 und des Deutschen Reiches 1871 änderte sich diese Situation gravierend. Die deutschen Einzelstaaten bündelten ihre auswärtige Politik unter Führung des
13Wahl, Die Deutschen Länder, S. 15.
14Ebenda, S. 17.
15Schlögl, Sabine: Die bayerische Gesandtschaft in Berlin im 20. Jahrhundert, in: Rumschöttel, Hermann
(Hrsg.): Franz Sperr und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Bayern (=Zeitschrift für
bayerische Landesgeschichte, Beiheft 20), München 2001, S. 224.
16Wahl, Die Deutschen Länder, S. 18.
17Schreckenbach, Innerdeutsche Gesandtschaften, S. 404.
Page 7
Gesetzgebungskompetenzen der Länder an das Reich24, welche sonst Gegenstand von Verhandlungen zwischen der Gesandtschaft und dem Empfangsstaat bildeten, verkleinerte sich das Aufgabenspektrum der innerdeutschen Vertretungen. Die Gesandtschaften konzentrierten ihre Arbeit neben der Pflege dynastischer Beziehungen nun vorwiegend auf den wirtschafts- und kulturpolitischen Bereich.25Zusätzlich waren sie wichtige Instrumente der Landesregierungen zur Koordination einer gemeinsamen Politik gegenüber den Organen des Reiches und zur Teilnahme am Willensbildungsprozess. Besondere Bedeutung erlangten die bei Preußen beglaubigten Gesandten, welche im Regelfall dem Bundesrat als
18Verfassung des Deutschen Reiches vom 16.04.1871 (aRV), Reichsgesetzblatt (RGBl), 1871, Nr. 16, S. 69.
Die Grundlage für die gemeinsame Außenpolitik bildete Artikel 11 aRV.
19Esch, Gesandtschaftsrecht, S. 36-46.
20Schreckenbach, Innerdeutsche Gesandtschaften, S. 404.
21Esch, Gesandtschaftsrecht, S. 64.
22Schreckenbach, Innerdeutsche Gesandtschaften, S. 405.
23Schlögl, Die bayerische Gesandtschaft, S. 226.
24Art. 4 aRV, RGBl, 1871, Nr. 16, S. 65-66.
25Esch, Gesandtschaftsrecht, S. 97-101. Der Schwerpunkt lag dabei auf folgenden Angelegenheiten:
Landessteuern, Zölle, Lotteriewesen, Militärfragen, Post- und Telegrafenwesen, Grenzstreitigkeiten und
gemeinschaftliche Verkehrsprojekte.
Page 8
Aufgrund der geschmälerten Bedeutung entschlossen sich vor allem kleinere Staaten ihre kostspieligen Gesandtschaften einzuziehen, einen Gesandten gleichzeitig bei mehreren Ländern zu akkreditieren oder sich durch einen gemeinsamen Gesandten vertreten zu lassen.27Zwischen 1867 und 1914 wurden 11 innerdeutsche Gesandtschaften, darunter sieben selbständige Vertretungen, gänzlich eingezogen.28Das Bestreben des Reiches immer mehr Kompetenzen an sich zu ziehen, gipfelte im Verlauf des I. Weltkrieges, der die Errichtung straff zentralisierter Organisationsstrukturen erforderte.29
2. Die Debatte um das Gesandtschaftsrecht 1919/1920
Mit der Gründung der Republik und der Schaffung einer neuen Verfassung entbrannte zwischen den Ländern und dem Reich ein zähes Ringen um den Fortbestand der Gesandtschaften. Die Nationalversammlung sah sich vor die Frage gestellt, ob sie den Einzelstaaten das Gesandtschaftsrecht belassen oder es ihnen aberkennen sollte. Obwohl die Mehrheit der Abgeordneten gegen die Beibehaltung stimmte, wurde in der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 (WRV) kein ausdrückliches Verbot ausgesprochen.30Die Artikel 6 und 78 regelten lediglich die deutschen Beziehungen zu den auswärtigen Staaten.31Dem Reich wurde dabei die Monopolstellung bezüglich internationaler diplomatischer Kontakte eingeräumt und damit den wenigen, noch bestehenden Auslandsgesandtschaften der Länder der rechtliche Boden entzogen. Bayern und Sachsen zogen daraufhin Anfang 1920 ihre noch verbliebenen Auslandsvertretungen ein.32Gemäß der damaligen staatsrechtlichen Lehrmeinung stellten die innerdeutschen Gesandtschaften keine außenpolitischen Institutionen dar und so blieben diese Organe der Länder vorerst weiter bestehen. Die Gründe für das doppelte Spiel der Nationalversammlungsabgeordneten, welche zum Einem auf die Abschaffung jeglicher
26Döhring, Gesandtschaftsrecht der Einzelstaaten, S. 52-53.
27Esch, Gesandtschaftsrecht, S. 67. Die Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck ließen sich beispielsweise
von einem gemeinsamen Gesandten in Preußen vertreten. Mecklenburg-Strelitz übertrug seine Vertretung
auf den Gesandten Mecklenburg-Schwerins.
28Schreckenbach, Innerdeutsche Gesandtschaften, S. 425-428. Übersicht der innerdeutschen Gesandtschaften
von 1867 bis 1945.
29Ebenda, S. 407.
30Wahl, Die Deutschen Länder, S. 93.
31Art. 6 und 78 WRV, RGBl, 1919, Nr. 152, S. 1384 und 1398.
32Benz, Wolfgang: Bayerische Auslandsbeziehungen im 20. Jahrhundert. Das Ende der auswärtigen
Gesandtschaften Bayerns nach dem I. Weltkrieg, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 32 (1969),
S. 979-986. Bayern hatte zum Ende des I. Weltkrieges formell beglaubigte Gesandtschaften in Wien, Bern,
Petersburg, Rom (beim Quirinal). Sachsen hingegen hatte nur noch einen Vertreter in Wien. Die Auflösung
der bayerischen und sächsischen Auslandsgesandtschaften wurde Ende Februar 1920 abgeschlossen.
Page 9
33Wahl, Die Deutschen Länder, S. 93-94.
34Schreckenbach, Innerdeutsche Gesandtschaften, S. 408.
35Esch, Gesandtschaftsrecht, S. 67-68.
36RGBl, 1919, Nr. 152, S. 1386.
37Benz, Süddeutschland, S. 199-204.
38Schlögl, Die bayerische Gesandtschaft, S. 229.