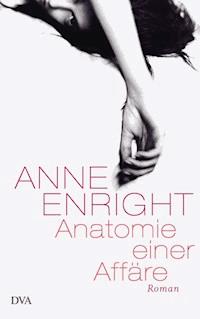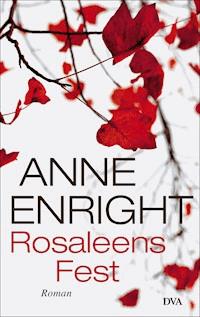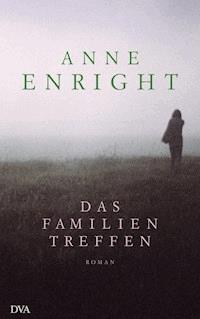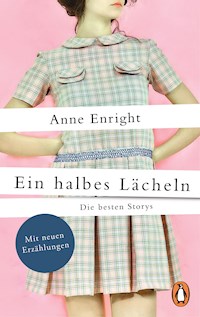3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein berührender Roman über die unerfüllte Liebe einer Tochter zu ihrer Mutter
Norah blickt zurück auf das Leben ihrer Mutter, der einst gefeierten Schauspielerin Katherine O’Dell: Von irischen Dorfbühnen hat sie es bis nach Hollywood geschafft. Doch mit zunehmendem Alter verblasste ihr Ruhm, sie betäubte sich mit Alkohol und Tabletten, bis es eines Tages zu einem bizarren Skandal kam: Ohne Vorwarnung schoss sie auf einen Filmproduzenten. Jeder Augenblick in Katherines Leben war große Geste, und Norah war ihr Publikum. Wer aber war diese Frau wirklich, die alles für die Kunst gab und wenig für ihre Tochter? Ein eindringlicher Mutter-Tochter-Roman, frappierend ehrlich, scharfzüngig und augenzwinkernd erzählt. »Eine hellsichtig-wütende Liebeserklärung an die Mutter.« Der Tagesspiegel
- Ein berührender Roman über die unerfüllte Liebe einer Tochter zu ihrer Mutter
- Anne Enrights Romane sind Bestseller: über 200.000 verkaufte Bücher in den deutschsprachigen Ländern
- »Ein brillantes Roman-Porträt.« WAZ
- »Lässt einen beim Lesen manchmal regelrecht aufjubeln.« Spiegel Online
- »Enright ist eine Spezialistin für schwierige Familienangelegenheiten.« SWR Bestenliste
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ein großer Roman über die unstillbare Sehnsucht nach Anerkennung
Kann man seine Mutter wirklich kennen? Norah blickt zurück auf das Leben ihrer Mutter, der einst gefeierten Schauspielerin Katherine O’Dell, die es von den irischen Dorfbühnen bis nach Hollywood geschafft hat. Doch mit zunehmendem Alter verblasste ihr Stern, sie betäubte sich mit Alkohol und Tabletten, bis es eines Tages zu einem bizarren Skandal kam: Ohne Vorwarnung schoss sie auf einen Filmproduzenten. Jeder Augenblick in Katherines Leben war große Geste, und Norah war ihr Publikum. Wer aber war diese Frau, die alles für die Kunst gab, deren Beziehungen kalt waren – und warum erzählte sie Norah nie, wer ihr Vater ist?
»Die Schauspielerin« ist ein eindringliches Buch über die so starke und doch auch so verwundbare Beziehung zwischen Mutter und Tochter – frappierend ehrlich, scharfzüngig und augenzwinkernd erzählt.
Anne Enright, 1962 in Dublin geboren, zählt zu den bedeutendsten englischsprachigen Schriftstellerinnen der Gegenwart und wurde 2015 zur ersten Laureate for Irish Fiction ernannt. »Das Familientreffen« wurde unter anderem 2007 mit dem renommierten Booker-Preis ausgezeichnet, ist in gut dreißig Sprachen übersetzt und weltweit ein Bestseller. Für »Anatomie einer Affäre« (2011) erhielt sie die Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction und für »Rosaleens Fest« (2015) den Irish Novel of the Year Prize. »Die Schauspielerin« ist ihr siebter Roman.
»Anne Enright ist die wichtigste literarische Chronistin des zeitgenössischen irischen Lebens.« The Observer
»Anne Enright ist eine großartige Autorin literarischer Prosa und gleichzeitig … eine scharfe und satirische Aphoristin, die häufig mehr verbirgt, als sie zu zeigen bereit ist.« James Wood im New Yorker
»Anne Enrights Stil ist so scharf und brillant wie Joan Didions; ihr Verständnis vom Menschsein so umfassend wie Alice Munroes; ihre Vision von Irland so mutig und originell wie Edna O’Briens.« Colm Tóibín
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
ANNE ENRIGHT
DIE SCHAUSPIELERIN
Roman
Aus dem Englischen von Eva Bonné
»Wie auch immer, in dem Maße, in dem ich Beifall spendete, schien mir auch die Berma besser gespielt zu haben.«
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust
Die Leute fragen mich: »Wie war sie?«, und ich versuche zu verstehen, was genau sie damit meinen. Wie war sie als normaler Mensch, wenn sie Pantoffeln trug und Marmeladentoast aß? Als Mutter, als Schauspielerin? – Das Wort »Star« verwendeten wir nicht. Die meisten Leute wollen wissen, wie sie war, bevor sie verrückt wurde, gerade so, als könnte auch ihre eigene Mutter über Nacht schlecht werden wie eine Flasche Milch, die nicht in den Kühlschrank zurückgestellt wurde. Oder als wären sie insgeheim selbst ein bisschen schräg.
Wenn sie mit mir reden, passiert etwas. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Es arbeitet langsam in ihnen; ein wachsendes Staunen, als würden sie nach vielen Jahren einen alten Schwarm wiedererkennen.
»Du hast ihre Augen«, sagen sie.
Die Leute haben sie geliebt. Fremde, meine ich. Ich habe gesehen, wie sie sie angeschaut und genickt haben, ohne ein einziges ihrer Worte zu hören.
Und ja, ich habe ihre Augen. Zumindest habe ich die gleiche Augenfarbe wie meine Mutter, ein Haselnussbraun, das in ihrem Fall auch gern einmal grün genannt wurde. Tatsächlich haben Journalisten meiner Mutter in die Augen geblickt und dann ganze Absätze über Moore und Felder verfasst. Außerdem haben wir die gleiche Art zu blinzeln, langsam und liebevoll, als dächten wir an etwas sehr Schönes. Ich kann das, weil sie es mir beigebracht hat. »Denk an Kirschblüten«, sagte sie, »die im Wind davonwehen.« Was ich manchmal tatsächlich tue.
Solche Gaben hat sie mir vermacht, Katherine O’Dell, bekannt aus Film und Fernsehen.
»O Mutter mein, wie geht es dir?«
»Ging mir nie besser«, pflegte sie zu antworten, und wenn sie mich ansah, trieben ganze Baumladungen von Kirschblüten vorbei.
In der Küche unseres Hauses am Dartmouth Square (wo anscheinend alles Wichtige in meinem Leben passierte) saß ein Mann, der jemanden kannte, der mit Marilyn geschlafen und sich danach, wie er erzählte, »nie wieder gewaschen« hatte. Eines Abends kam ich, noch ein Kind, die Treppe herunter und hörte ihn das sagen, und er war ein so netter alter Mann, dass es mich auf ewig besudelte. Wenn die Leute mich also fragen: »Wie war sie?«, würde ich am liebsten antworten: »Eigentlich ziemlich reinlich«, um dann hinzuzufügen: »… für damalige Verhältnisse.«
Also gut. Hier ist sie, Katherine O’Dell, wie sie Frühstück macht, wie sie dem Kühlschrank und den anderen Schränken – von einigen ist sie entzückt, von anderen enttäuscht – ein Frühstück abtrotzt. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier ist sie! Ja! Die Marmelade. Die Sonne scheint zum Fenster herein, Zigarettenrauch steigt auf und verzwirbelt sich zu einer eleganten Doppelhelix. Was soll ich sagen? Wenn sie Marmeladentoast aß, war sie wie jeder andere Mensch, der Marmeladentoast isst; wobei die Linie zwischen Lippenrot und Haut, wie auch immer sie genannt wird, bei ihr sehr ausgeprägt war, selbst wenn man sie nicht auf einer vier Meter hohen Kinoleinwand sah.
Hier ist sie also. Sie isst Toast. Sie hat es eilig, hält sich die Scheibe an den Mund, beißt hinein, kaut und beißt noch einmal zu. Sie schluckt. Sie wiederholt den Vorgang drei oder vier Mal, dann legt sie den Brotrest auf den Teller. Sie nimmt ihn für einen letzten Bissen hoch, lässt ihn wieder sinken. Nun kommt es zu einem kurzen Hin und Her, das der Toast verliert; ein knappes Abwinken, ein kurzer Schlenker der Verweigerung oder des Begehrens. Nein, sie möchte keinen Toast mehr.
Sie greift zum Telefonhörer und wählt. Alles war »wunderbar!«, solange sie an diesem Telefon hing, ein beiges Ding an der Küchenwand mit einer langen, ausgeleierten Schnur, unter der man sich hindurchducken musste, während sie rauchend auf und ab ging, »wunderbar!« sagte und mir Zeichen gab, indem sie einen Finger ausstreckte, die Hand drehte und auf ihren Kaffee zeigte oder auf ein Glas Wein, das außer Reichweite stand.
»Einfach wunderbar«, sagte sie.
Oder sie unterhält sich mit mir, einem Mädchen von acht oder neun Jahren in einem rosa Baumwollkleid, das sie aus Amerika mitgebracht hat. Sie bezieht den Hund mit ein, der wie ein Hund in einem Film unter dem Tisch sitzt und auf Reste und Krümel hofft. Meistens legt sie den Kopf zurück und spricht mit der Stelle, wo Wand und Decke aneinanderstoßen. Ihr Blick wandert an der Kante entlang, als suchte sie dort oben nach Ideen oder nach Gerechtigkeit. Ja, das ist es, was sie will. Kurz senkt sie das Kinn, um sich eine weitere Zigarette anzuzünden. Sie atmet aus.
Der Toast wird nun völlig ignoriert. Für sie ist der Toast jetzt gestorben. Der Stuhl wird zurückgeschoben, die Zigarette allen Erstes auf dem Teller ausgedrückt. Meine Mutter steht auf und geht weg. Jemand anders wird sich darum kümmern, denn, ich hatte es bereits erwähnt, meine Mutter war ein Star. Nicht nur auf der Leinwand oder auf der Bühne, sondern auch am Frühstückstisch war meine Mutter Katherine O’Dell ein Star.
Etwa eine Stunde später steht sie wieder in der Küche und sagt: »Gott verdammt, Gott verdammt.« Sie klappert mit dem Geschirr. Vielleicht wirft sie den Toast zum Fenster hinaus, oder sie zerbricht einen Teller am Rand der Spüle. Denn Kitty ist nicht da. Kitty kauft fürs Abendessen ein, sie hat ihren freien Tag, sie pflegt ihre krebskranke Schwester. Kitty ist nie da, wenn man sie braucht, obwohl sie doch die ganze Zeit da ist. Wenn sie dann zurückkommt, mit Einkäufen bepackt oder traurig, je nachdem, ist der Teller nur versehentlich zerbrochen und Kitty ein Schatz, den es zu hofieren und zu verwöhnen gilt. Unsere Haushälterin Kitty hatte täglich eine Putzhilfe, sie hatte den neuesten Teppichkehrer und eine der ersten Geschirrspülmaschinen im Land. Der Geschirrspüler wurde rechtzeitig zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag angeliefert, es gibt sogar ein Foto davon: Meine Mutter öffnet die Klappe und steht in einer Dampfwolke, während Kitty im Hintergrund gedankenverloren am großen Spülstein lehnt.
Zu dem Anlass steckte meine Mutter mich in ein Kleid. Rosa Baumwolle aus Amerika, Schürzenkleider mit drei Knöpfen und ausgestellte Hängerchen über knochigen, aufgeschlagenen Knien sind Vergangenheit. Ich bin einundzwanzig Jahre alt. Meine Arme sind weich und weißgefleckt; ich bin zu groß. An meinem Geburtstag präsentiere ich mich in Sumpfgrün und kränklichem Rosa, mein langer Tüllrock ist mit Tüllpompons besetzt. Meine Mutter – da ist sie, sie hält die Geburtstagstorte in die Höhe – trägt Schwarz. Vor ihr haben sich ein paar Menschen versammelt, darunter auch ich. Die Leute auf diesem zweiten Foto haben etwas Übereifriges. Im Laufe der Jahre habe ich sie oft betrachtet – ihre scheckigen Wangen, die aufgerissenen Augen – und mich gefragt, was sie fühlen.
Ehrfurcht.
Man könnte sie ewig ansehen.
Durch eine Maske des Entzückens verfolgen ihre Augen meine Mutter, doch ihr Blick verrät kein Begehren, sondern eher so etwas wie Unglück. Das eine oder andere Lächeln wirkt schmerzlich bemüht, als könnte es jederzeit in Neid umschlagen. Vor allem bei den Frauen. Zwecklos, es zu leugnen – besonders die Frauen hatten in der Gegenwart meiner Mutter Schwierigkeiten mit sich selbst.
Und inmitten von alldem mein eigenes Gesicht mit einundzwanzig; es fürchtet das Rampenlicht und wird doch zugleich versüßt durch ihre Aufmerksamkeit. Die Kerzenflammen auf der Torte sind klein und aufrecht. Ich werde vom Blick meiner Mutter gehalten, während um uns herum die Eiferer und die Wilden toben. Vielleicht ist es auch nur der Alkohol, der sie so aussehen lässt. Um uns herum die Gesichter der Menge.
Die Party war furchtbar, wenigstens für mich. Ich hatte im Sommer meinen Collegeabschluss gemacht, und die meisten meiner Freunde waren inzwischen weggezogen. Ich hatte ein paar Kommilitoninnen eingeladen, sie kamen zu früh und in geborgten Kleidern und wirkten verunsichert durch den vielen Krempel in unserem Haus, oder vielleicht auch durch dessen Größe. Sie setzten sich oben ins Wohnzimmer, einen mit Möbeln aus dem Fundus verschiedener Dubliner Theater eingerichteten Raum, in dem man sich unweigerlich fühlte wie eine Figur aus einem Stück, nur welche, war unklar. Ein Chesterfieldsofa aus marineblauem Samt, ein geschnitzter Holzstuhl, der einer Borgia alle Ehre gemacht hätte, ein kleiner, bunt bemalter Hocker aus Skandinavien. Wir nahmen auf diesen ausgemusterten Episoden Platz und tauschten eigene kleine Leidensgeschichten aus – von unzuverlässigen Freunden, hinterhältigen Freundinnen oder Müttern, die der reinste Albtraum waren. Immerhin sprachen meine Kommilitoninnen über ihre Mütter; ich war in der Hinsicht eher zurückhaltend. Allerdings wurden meine Bemühungen an jenem Abend, je mehr der Whiskey floss und je höher der Geräuschpegel stieg, ein wenig von der Tatsache durchkreuzt, dass sie, die Berühmtheit, unter in der Küche zu hören war.
Es war schwierig, einen eigenen Ton zu finden.
Nach zehn trudelten ein paar Theatertypen vom College ein und setzten sich zu uns. Jemand dimmte das Licht und drehte die Musik auf, Melanie und der Leiter der Laienspielgruppe standen knutschend neben der Badezimmertür. So war das im Spätsommer 1973, überall wurde einem aufgelauert. Man ging kurz raus, um sich die Haare zu kämmen, und fand sich prompt in einem Menschenknäuel an die Wand gedrückt wieder.
Irgendwann gegen Mitternacht trafen die Nachzügler von der Vorstellung im Gate ein und versammelten sich um das Klavier, und ab dann wurde getrunken und gesungen wie an so vielen Samstagabenden am Dartmouth Square. Ein paar Freunde meiner Mutter kamen herauf und wurden von meinen Gästen ignoriert, weil sie alt waren. Vielleicht wirkten damals auch einfach alle Männer alt, mit ihren ausgebeulten Sakkos und ihren Zigaretten. Es gab keinen Unterschied zwischen fünfundzwanzig und fünfundvierzig, jeder trug Krawatte.
Über die Jahre empfing meine Mutter in ihrer großen, alten Küche eine wechselnde Gruppe von hochgewachsenen, trinkfesten Männern. Alle waren gute Gesellschafter, einige ziemlich berühmt. Sie kamen zu ihr auf der Suche nach Zuflucht, nach Austausch, Ausgelassenheit und einer Art von Anerkennung, wie sie ein anständiger Mann damals von der eigenen Familie nicht erwarten konnte. Das waren die Männer, die meine Kindheit verzaubert hatten. Sie steckten mir Pfundnoten zu, rezitierten vor dem Schlafengehen Yeats und nahmen mich auf den Schoß, um mich zu necken oder sich mit mir zu verbünden. Siehst du den da drüben, er hat für den Papst gesungen. Einige von ihnen habe ich geliebt, und manche – möglicherweise eine kleine Rache an meiner Mutter – hatten mich aufrichtig gern.
Später dann hörte ich auf, sie zu lieben, beziehungsweise konnten sie mich, als ich einundzwanzig war, nicht mehr begeistern. Womöglich waren sie ein nicht mehr ganz so glamouröser Haufen wie früher. Immer dieselben Typen in Begleitung ihrer raffgierigen Gattinnen. Oder sie schleppten junge Frauen an, die entweder Touristinnen waren – man erkannte sie am Strickpullover – oder zu intelligent oder viel zu betrunken. Die Männer, denen sie ihre Häkelmützen aufsetzten, waren Theaterleute, Intellektuelle, Musiker oder Schriftsteller – jeder schrieb, auf die eine oder andere Weise –, und alle waren zumindest in den eigenen Augen ziemlich wichtig. Sie redeten über ihre Jobs bei der Irish Times oder »draußen am University College«. Arbeiten Sie draußen am UCD? Dabei lag das College keine drei Kilometer die Straße runter. Hughie Snell arbeitete »draußen in Montrose«, also beim Fernsehen; dass sie alle in keiner anderen Hinsicht »draußen« waren, verstand sich von selbst.
Ihr Stichwortgeber war Niall Duggan, ein lauter, altmodischer Kerl, der mit verballhorntem Irisch und spontanem Latein um sich warf – sic transit –, das stets heftige Zustimmung erntete, carpe, ja, carpe, in der Tat. Gehobener Nonsens, ziemlich steif, der jedoch ohne Anzüglichkeiten und ohne Frauenverachtung auskam. Und eigentlich auch ohne Frauen, wenn ich heute darüber nachdenke. Außer unter vier Augen, wo Duggan ziemlich vulgär sein konnte.
Schwer zu erklären.
Alles war Anspielung. Silent O’Boyle zum Beispiel hatte seinen Spitznamen einem Lied von Thomas Moore und einem Zwischenfall auf der Herrentoilette der Palace Bar zu verdanken.Silent, oh Moyle, be the roar of thy water. Alles war ebenso seicht wie seltsam veredelt, und selbst ihre Lüsternheit war gekünstelt. Silent O’Boyle erzählte meiner rechten Brust etwas über die Wunder von Baudelaire, bevor er sich – nur für den Fall, dass sie sich ausgeschlossen fühlte – mit einem neckischen Bonmot über den jungen Rimbaud an die linke wandte. Duggan fragte mich: »Würdest du dich jemals auf diese Figur von Faulkner einlassen? Was ist mit Salinger? Ja, würdest du. Du würdest diesen unglücklichen Langweiler vögeln, und dann wäre die amerikanische Literatur, lass mich bitte ausreden, dann wäre die amerikanische Literatur für immer verändert. Du würdest ihm das Leben retten und sein Werk zerstören. Da liegt das Problem, verstehst du? Darin besteht die Niedertracht.« In meinem ersten Jahr an der Uni versprach mir Duggan, der natürlich einer meiner Dozenten war, erstklassige Noten im Tausch gegen meine Jungfräulichkeit. Meine Mutter sagte: »Sie würde sich nie mit weniger als all deinen weltlichen Gütern zufriedengeben, Niall«, und dann fügte sie hinzu: »Lass das Kind in Ruhe.«
Sie tranken, bis ihre Augen, Gelee gleich, blind für die eigene Unmöglichkeit wurden. So habe ich es damals erlebt, mit einundzwanzig, als ich noch keinen Alkohol trank, weil er mir nicht schmeckte. Sollten diese Männer mich doch anglotzen, so viel sie wollten; sie waren alt, und ich war längst in dich verliebt.
Im passenden Moment sang Mutters Freund Hughie Snell mit seinem hohen, näselnden Tenor:
»Schwärmt And’rer Herz und And’rer Mund
Von süßem Liebestraum.«
Er schien sich um die Töne zu krümmen; sein Mund wölbte sich um die Vokale und schob sie wunderbar gepresst heraus.
»Du denkst an unser Glück zurück,
Gewiss, dann denkst du mein!«
Diese Arie aus Balfes Zigeunerin war angeblich (wir konnten es schon nicht mehr hören) ein Lieblingsstück des jungen Jimmy Joyce gewesen. Hughie behauptete, hoffnungslos in meine Mutter verliebt zu sein, was die anderen ihm durchgehen ließen, weil er eindeutig schwul war. Er legte all seine Seelenqualen in die wirklich hübsche Melodie, und seine Stimme holte die weite Nacht herein.
Selbst die Collegetypen verstummten. Ich lehnte mich mit Tränen in den Augen an die Wand und dachte an dich, wie du auf Interrailtour durch den Frühherbst tingelst, zusammen mit deiner englischen Olivia. Ich fragte mich, wo du bist: Pisa, Verona, Bratislava? Du hattest mich verlassen, diesmal endgültig. Unsere Liebe, sagtest du, sei unerträglich. Oder doch nicht. Du brauchtest einfach nur Urlaub, und Olivia war die perfekte Reisebegleitung. Nichts sprach gegen Olivia.
Du hast mir nie erzählt, wie es war. Keine Anekdoten von verdreckten Eisenbahnwaggons oder italienischen Pensionen mit rosa gerüschten Lampenschirmen. Und du hast mir auch nie erzählt, wie sie im Bett war, obwohl ich dich oft gefragt habe (ich dachte, sicher kennt sie einen Trick). Du hast nur gelächelt und gesagt: »Anders als du.«
Hughie Snell schob die letzte Note durch die geschürzten Lippen und zog die Augenbrauen hoch, als wäre er selbst überrascht über ihre Länge. Nach dem Applaus stimmte der Pianist eine einfache Melodie auf den hohen Tasten an, und sein Ruf wurde von einer Stimme auf der Treppe beantwortet. Wir drehten uns zur Tür um und sahen ein schwankendes gelbes Licht, gefolgt von den hellen Flammen einer Geburtstagstorte. Meine Mutter betrat das Zimmer und kam langsamen und gemessenen Schrittes auf mich zu. Sie prozessierte. Sie hatte sich für einen herrlichen alten Evergreen entschieden: »Que sera, sera.«
Du musst wissen, dass sie zu dem Zeitpunkt nur noch selten sang, und schon gar nicht auf der Bühne. »Ich bin zu alt dafür«, sagte sie und dachte dabei vielleicht an eine frühere makellose, unmöglich zu wiederholende Leistung, die das Publikum in London, New York oder Dublin von den Sitzen gerissen hatte. Aber meine Güte: Meine Mutter besaß eine Stimme, die von überall zu kommen schien. Sie rutschte ihr aus dem Mund und hallte aus der hintersten Ecke des Raumes wider. Katherine O’Dell sang nicht, sie zog das Lied vielmehr aus den Wänden. Sie rief es ins Leben, und die Luft war aufgeladen mit Klang.
Danach – Noch nicht auspusten! – rückten wir für das Foto zusammen. Der Gesellschaftsreporter der Evening Press hatte einen Fotografen mitgebracht. Mama zeigte der Kamera ihren Rücken und ihr Gesicht im Dreiviertelprofil. Alles war inszeniert. Kein Zweifel – die Torte, die Prozession, der Schnappschuss, all das war sorgfältig geplant. Ich weiß es. Aber ich weiß auch, dass meine Mutter an diesem Abend für mich allein gesungen hat.
Danach stimmten die anderen »Happy Birthday« an, ich blies die Kerzen aus. Die Torte war von Tea Time Express und mit Sahne gefüllt.
Wenn ich mir das Bild heute ansehe, erkenne ich, dass mein Kleid, dieses schreckliche Ding aus olivgrauem Tüll, in Wahrheit wunderschön war. Es machte mich blass und interessant. Das Kleid meiner Mutter war ein absoluter Klassiker: weiter Rock, schmale Taille, Dreiviertelärmel. Es hatte einen mit weißem Satin unterfütterten U-Boot-Ausschnitt, der, als sie sich von der Kamera wegdrehte, in einem rückseitigen Kragen mit zwei weißen, puritanischen Dreiecken auf den Schulterblättern auslief. Jede Menge nackte Haut. Frühe Fünfzigerjahre, würde ich tippen. Möglicherweise Dior.
Die Schlagzeile lautet: »Hausbesuch bei Katherine O’Dell«, und da ist noch ein zweites, kleineres Bild, das Mutter mit der neuen Spülmaschine zeigt, »vermutlich eine der ersten in Irland!«, und ihr strahlender Blick sagt: »Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Ding bedient.«
»Katherine O’Dell genießt ihre frisch modernisierte Küche am eleganten Dubliner Dartmouth Square.«
Ich habe nur wenige Zeitungsausschnitte aufbewahrt. Weißt du, ich vermisse meine Mutter jeden Tag, aber ich schaffe es bis heute nicht, diese verdammten Artikel zu lesen. Sie sind unlesbar. Dieser hier – den ich besonders schätze! – wurde von einem giftigen kleinen Säufer geschrieben, der überall in der Stadt mit Smoking und Fliege unterwegs war. Er hatte ein Auto und einen Fahrer, und die Damen aus der Mittelschicht fingen allen Ernstes zu kreischen an, wenn er zu ihren Partys und Empfängen erschien. Um drei Uhr morgens ließ er sich dann zurück nach Burgh Quay chauffieren, setzte sich hin wie Rodins Denker und produzierte so etwas wie das hier:
»Nach ihrem jüngsten Triumph am Broadway nahm sich Katherine O’Dell diese Woche etwas Zeit, um mit unserem Kolumnisten Terry O’Sullivan über ihr Leben auf und abseits der Bühne zu plaudern. Vor Kurzem hat sie sich eine Geschirrspülmaschine angeschafft, ›die erste in ganz Irland, glaube ich jedenfalls‹. Auf diese Idee, sagt die weitgereiste Muse so unterschiedlicher Schriftsteller wie Samuel Beckett und Arthur Kopit, sei sie in Amerika gekommen, wo derlei Hausgeräte weit verbreitet sind. Der Ruf aus Hollywood? Dieser Tage ein wenig leiser. ›Für mich gibt es nichts, was dem Nervenkitzel eines Bühnenauftritts gleichkäme.‹«
Unter dem Tortenbild schreibt er:
»Die Volljährigkeit. Hochkarätige Gäste der Geburtstagsfeier von Tochter Carmel, darunter Christopher Cazenove kurz nach einer Vorstellung im Gate Theatre, Schauspielkollege Hughie Snell, Filmproduzent Boyd O’Neill sowie Architekt Douglas Kelly mit Ehefrau Jenny und Tochter Máire, die ihr Studium am University College soeben mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Máire strebt eine Karriere in der Touristikbranche an.«
Máire ist natürlich die Hübscheste von allen. Sie hat keine Karriere in der Touristikbranche gemacht, sie hat geheiratet und ist nach Monkstown gezogen. Abgesehen davon hat der Reporter meinen Namen falsch verstanden, und das auf meiner eigenen Geburtstagsfeier. Ich weiß nicht, woher er das hat, aber ich heiße nicht Carmel. Mein Name ist Norah FitzMaurice.
Ich überfliege den Ausschnitt und frage mich, warum ausgerechnet er überdauert hat und so viel anderes verloren und verschwunden ist. Das Foto war damals gestellt, doch irgendwie haben die Jahre ihm mehr Wahrheit verliehen: Katherines elegant entblößter Rücken, die geröteten, ihr zugekehrten Gesichter, ich (auf Tortenhöhe, möglicherweise saß ich auf einem Stuhl), wie ich treuherzig zu ihr aufblinzele. Ihr edles Profil neigt sich zu mir hinunter.
Überschrift und Artikel suggerieren dasselbe: die Schauspielerin und das Kind in ihrem Schatten. Das Foto bekräftigt eine Lüge, derzufolge ich eine schlechte Kopie meiner Mutter war und sie – im Gegensatz zu mir – zeitlos. Die Ikone hat etwas allzu Menschliches hervorgebracht. Aber so war es nicht zwischen uns. So haben wir uns nie gesehen.
Das Kleid, möglicherweise von Dior, war hinreißend, das kann ich jetzt erkennen, aber wenn ich mich recht erinnere, trug sie an jenem Abend ein Haarteil, für das ich mich schämte. Sie färbte sich die Haare zu einer Zeit, als keine Frau sich die Haare färbte, oder wenigstens nicht so dunkel, und ihr Gesicht war, das sagte sie selbst, nicht mehr existent. Katherine O’Dell war fünfundvierzig Jahre alt, aber nicht auf eine Weise, wie die Leute heutzutage fünfundvierzig sind. Sie rauchte dreißig Zigaretten am Tag und trank ab sechs Uhr abends, mit offenem Ende. Meine Mutter aß niemals Gemüse, es sei denn, sie war auf Diät; ich glaube, sie besaß kein einziges Paar flache Schuhe. Sie redete den ganzen Tag, und gegen Abend, wenn ihre Wangen vom Wein aufgedunsen waren und ihre Augen sehr grün, wurde sie verbittert.
Sie posiert, als würden sie und ihr Küchengerät fürs Life-Magazin abgelichtet, aber in Wahrheit war Katherine O’Dell mit fünfundvierzig Jahren fertig. Beruflich. Sexuell. Wenn eine Frau damals dreißig wurde, ging sie nach Hause und zog die Tür hinter sich zu.
Folglich ist es meiner Mutter hoch anzurechnen, dass sie sich weigerte, klein beizugeben und zu sterben. Dass sie eine Party schmiss, mir ein Kleid von Ib Jorgensen spendierte und ihre alten Kisten und Truhen durchwühlte auf der Suche nach einem Teil, in das sie noch hineinpassen würde, ein letztes Mal.
Während ihrer Schwangerschaft hatte das Kleid für einen ziemlichen Wirbel gesorgt. Als wir uns für meine Party bereitmachten, erzählte sie davon. Sie zupfte am Stoff unterhalb der hohen Taille und sagte: »Sieh mal. Platz für zwei.«
Da waren wir, vor ihrem Schlafzimmerspiegel, ich außerhalb des Kleides, während sie sich an mich innerhalb des Kleides erinnerte, in ihrem Bauch. Sie erzählte mir, sie habe in der Schwangerschaft nur ein paar zusätzliche Zentimeter Stoff gebraucht, mehr nicht. Und eine höhere Büste. »Man kürzt die BH-Träger, und alles rutscht nach oben!«, sagte sie. Hoch, hoch, hoch damit! Muss ja keiner wissen.
Sie erklärte mir nicht, wozu man so etwas verheimlichen sollte, und ich fragte nicht nach. Ich wusste, ich war ihr geheimes Glück.
»Hoch! Hoch! Hoch damit!«, sagte sie und steckte mir die Haare auf dem Kopf zusammen.
Ich war das Beste überhaupt.
»Du bist wunderhübsch«, sagte sie, als ich einen sumpfgrünen Tüllpompon aus meinem Schoß hob und wieder fallen ließ.
Übrigens hatte ich mein Studium mit Auszeichnung beendet. Nicht, dass das jetzt wichtig wäre. Kein bisschen. Aber später an dem Abend behauptete Duggan, es liege allein an meinen Titten. Vielleicht ärgerte er sich über die Torte. Er sagte, meine Titten sähen wirklich clever aus.
»Verpiss dich, Niall«, sagte ich.
Auch das kann ich mir nicht erklären, den Umstand, dass ich mich so zu ihm hingezogen fühlte. Egal, wer sonst noch im Raum war, er war stets derjenige, mit dem ich reden wollte.
»Vorstellungskraft ist Mord«, sagte er. »Aber das weißt du, nicht wahr? Dieses Wissen hast du im Urin.«
»Vorstellungskraft ist Vorstellungskraft«, sagte ich.
»Wen wirst du heute umbringen?«, fragte er und zeigte auf die Leute hinter sich.
»Wie wäre es mit dir, Niall? Wenn du möchtest, bringe ich dich um.«
»Hast du schon, mein Liebling. Ist längst passiert.«
Und in der Tat: Die Haut, durch die er schwitzte, war so weiß und dick, dass er praktisch tot aussah.
Er war erst achtundvierzig. Unfassbar. Ich musste es nachrechnen, weil ich es nicht glauben konnte. Niall Duggan betrank sich, nüchterte aus und trank weiter, er belästigte seine Studentinnen oder herrschte sie an, er hinterging seine Kollegen und schanzte seinen mäßig talentierten Freunden Jobs zu. Als ich einundzwanzig war, dachte ich, er wäre mehr oder weniger am Ende, doch er lebte weiter und machte sich ungeniert breit, noch dreißig Jahre lang.
Meine Mutter starb 1986. Ich kann es gleich verraten: Sie wurde nur achtundfünfzig Jahre alt.
Ich erinnere mich, dass ich ihre Nähe am Abend meines einundzwanzigsten Geburtstages kaum ertragen konnte. Sie beulte sich von innen durch das schwarze Kleid, ihre Röllchen drohten, die Taillennaht zu sprengen, und die ganze Aufmachung roch nach Mottenkugeln. Wir schrieben die Siebzigerjahre, Schwarz war hoffnungslos aus der Mode und »vintage« waren ausschließlich Autos. Ihr Kleid war eine Kostümierung, die sie, wie ich fand, dement aussehen ließ. Nun ist es raus. Wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, dass sie verrückt war? Zumindest in dem Maße, in dem alle Mütter nach Ansicht ihrer Töchter verrückt sind?
Ab einem bestimmten Alkoholpegel erschlafften die Gesichter, der Raum füllte sich mit Schwere. Leute wiederholten sich ständig oder verschwanden einfach. Gerade, als es zäh wurde – in einer Ecke wurde gestritten, draußen auf dem Treppenabsatz weinte eine Frau –, hob eine neue Musik an. Die Party hatte sich nach unten in die Küche verlagert. Ein paar Musiker waren nach dem letzten Set im benachbarten Pub herübergekommen und saßen nun um den Tisch, erste süße Klänge von Mandolinensaiten, Bruchstücke der nächsten Lieder, ein Vorgeschmack.
Abende wie dieser kamen um die Politik nie ganz herum. Der Erfahrung nach sympathisierte ein Gast umso stärker mit der republikanischen Sache, je später er eintraf, und besagte Musiker waren die Letzten gewesen, eine kleine Gruppe von Männern mit Wildlederjacke, breiter Krawatte und abenteuerlicher Gesichtsbehaarung – übrigens auch zu bestaunen auf dem Cover ihres ersten Albums, das später im selben Jahr erscheinen sollte. Sie trugen Koteletten und lange Hufeisenbärte, einem von ihnen sprossen kleine, perückengleiche Büschel aus den Wangen. Wenn man alles zusammenfügen würde, dachte ich, hätte man einen kompletten Bart.
In der Stille nach jedem Song warteten wir auf Máire Rahilly, als wäre das Warten an sich eine Aufgabe. Komm schon. Natürlich wirst du. Neben der Sängerin Máire wirkte meine Mutter geradezu provinziell. Máires schneidende Stimme ging einem durch Mark und Bein, sie war bewegte Trauer und pure Wildheit. Und als sie dann endlich den Kopf hob, sang sie auf Irisch. Meine Collegefreundinnen hörten es, zuckten zusammen und schauten sich um wie auf der Suche nach einer Ausrede zu gehen.
Aber niemand ging. Während der Abende am Dartmouth Square ist niemand je gegangen oder hinausgeworfen worden. Man verabschiedete sich nicht, man schmolz dahin. Und obwohl meine Mutter ständig einen Drink in der Hand hatte, wurde sie an Abenden wie diesen auf wundersame Weise immer nüchterner. Die Gerüchte der folgenden Tage handelten nie von Katherine O’Dell als Prospera im Sturm der Illusionen und des Alkohols. Nein, sie war Gastgeberin und Komplizin, sie war diejenige, die sich zurückhielt und dem Laster freien Lauf ließ.
An große Vorbereitungen kann ich mich nicht erinnern, und auch wegen der Gästeliste zerbrachen wir uns nicht den Kopf. Wenn meine Mutter zehn oder zwölf Leute anrief, tauchten sechzig oder hundertsechzig auf, und alle kannten einander zumindest dem Namen nach. Manche waren erbitterte Feinde, selbst der Gastgeberin. Ich lernte früh, meine Mutter zu retten. Da lehnte sie mit verdrehten Augen an der Wand, in die Enge getrieben von einem alten Schulfreund: »Ich konnte dich nie leiden, Katherine, all die Jahre nicht. Keine Ahnung, warum. Ich habe versucht, dich zu mögen, aber es gelingt mir einfach nicht.«
Dublin war damals eine kleine Stadt, selbst die Gehässigkeiten waren klein, doch der Klatsch war erstaunlich. Ich weiß, er war nicht gesund, aber ich vermisse ihn trotzdem. Inzwischen leben wir alle sehr losgelöst voneinander, anders ausgedrückt: vernünftig.
Obwohl er auch auf dem Foto ist, habe ich an Boyd O’Neill an jenem Abend kaum Erinnerungen. Er war groß. Er hatte die Angewohnheit, sich in der Menge treiben zu lassen. Zur Geisterstunde stand er meist in irgendeiner Ecke und diskutierte mit seinem alten Sparringpartner Niall Duggan. Die beiden waren wie zwei Kampfhähne: der beeindruckende, hochgewachsene O’Neill in Rollkragenpullover und Sakko, der kleinere Duggan ein Chaot im schäbigen Anzug. Der eine ein hoher Bogen, der andere ein tiefes Knurren in Bodennähe. In meinen Träumen erscheinen sie mir manchmal als Karikatur aus Dublin Opinion, lächerliche Eitelkeit und Slapstick-Gewalt, dabei waren sie nicht ungefährlich. Sie gingen einem unter die Haut.
Man konnte sich nur schwer dagegen wehren, aber Boyd O’Neill habe ich ohnehin nie viel Raum gegeben. Abgesehen davon war er zu gutaussehend für mich. Ich fühlte mich eher zu Duggan hingezogen, der die seltene Fähigkeit besaß, in den Kopf seines Gegenübers zu kriechen, er mit seinen grauen Glupschaugen, und anschließend kämpfte er sich durch die Haut wieder ins Freie. Ich war eine junge Frau, die besser aussah, als sie ahnte, aber ich glaube nicht, dass Niall Duggan mich wirklich besitzen oder penetrieren wollte, vielmehr schien er ich sein zu wollen. Oder er wollte aufhören, ich zu sein.
Gibt es so was?, würde meine Tochter fragen. Sagt man das jetzt so?
Ich glaube, er fand das alles furchtbar. Es war furchtbar, dass er, wenn er mit einer klugen Frau von einundzwanzig Jahren sprach, sich selbst nicht mehr denken hören konnte vor lauter Geschrei in seinem Kopf.
Wenn der Abend sich dann dem Ende zuneigte und man wieder nach oben ging, um irgendeine verlorene Jacke oder Tasche zu suchen, wirkte das Wohnzimmer leer und verwüstet. Die Möbel standen schief, und die Silhouetten von Flaschen und Gläsern ragten von Tischen und Anrichten auf wie eine Miniaturskyline. Es war sagenhaft. Am nächsten Morgen würde Kitty sich einen Weg hindurchbahnen, mit Kehrschaufel und Besen hantieren, die Glasscherben ignorieren und den Inhalt der Aschenbecher weder zur Kenntnis nehmen noch verurteilen. Meine Mutter gab vor, sich zu schämen, aber ich wusste, dass Kitty sich keine Gedanken um unseren Lebenswandel machte. Die Details interessierten sie nicht, sie hatte ihre eigenen Probleme.
Aber ich greife vor.
Wie hinlänglich bekannt ist, wurde meine Mutter im Jahr 1980 nach einem tätlichen Angriff auf ebenjenen Boyd O’Neill – einen Filmproduzenten, dessen Bekanntheit sich wohl auf Irland beschränkte – in das Central Mental Hospital eingeliefert. Sie hatte ihm in den Fuß geschossen und im selben Moment hundert Dubliner Pointen in die Welt gesetzt. Doch in Wirklichkeit war die Sache furchtbar verstörend, nicht zuletzt für O’Neill selbst, der ohne Rücksicht auf seinen guten Ruf eine Anklage wegen versuchten Mordes anstrebte. Der Auftritt meiner Mutter nach ihrer Verhaftung ließ die Verteidiger Hoffnung schöpfen – er war so schlecht, dass wir ihn unweigerlich für echt halten mussten. Sie lachte im unpassenden Moment, sang vor sich hin und raufte sich die Haare. Als der Fall schließlich vor Gericht kam, hatten wir nicht nur einen, sondern zwei wohlwollende Psychiater gefunden, die sie für wahnsinnig erklärten; sie verließ das Gericht im selben weißen Kleinbus, in dem sie gekommen war. Drei Jahre später wurde sie mit Medikamenten vollgepumpt aus der Anstalt entlassen, eine geschrumpfte, unheilbar kranke Frau, unsichtbar für die Passanten auf der Straße.
O’Neill – und es ist mir wichtig, das zu erwähnen – musste in den darauffolgenden Jahren immer wieder ins Krankenhaus. Er verbrachte fast so viel Zeit in Heilanstalten wie meine Mutter. Was in den Zeitungen als Verlust eines großen Zehs dargestellt wurde, war in Wahrheit eine blutige, von Splittern durchsetzte Wunde, die in einer fünfstündigen Operation zusammengeheftet wurde und sich anschließend zu heilen weigerte. Während die Ärzte das Problem an seinem rechten Bein aufwärtsjagten, kam es zu vier Amputationen. Er ernährte sich praktisch von Antibiotika. Er konnte nie wieder arbeiten. Die letzte, erfolgreichste Amputation endete knapp unterhalb des Knies, aber er kam mit der Prothese nicht zurecht und konnte wegen der Phantomschmerzen nicht mehr schlafen. Meine verrückte Mutter schoss Boyd O’Neill in den Fuß, und die ganze Welt fand es irgendwie komisch. Aber »komisch« ist nicht das richtige Wort. Beziehungsweise ist es eben nur ein Wort. Wenn man sich mal überlegt, was passiert war.
Als der Vorfall sich ereignete, war ich achtundzwanzig. Ich hielt noch ein Jahr oder länger durch, aber dann kam der Tag, an dem ich es nicht zur Arbeit schaffte. Ich behauptete, ein Buch zu schreiben, und dann schrieb ich es wirklich. Ich habe geschrieben, nicht nur dieses eine, sondern viele Bücher. Aber ich habe nie aufgeschrieben, was ich hätte aufschreiben sollen, was danach schrie, aufgeschrieben zu werden: die Geschichte von meiner Mutter und von Boyd O’Neills Wunde.
Vor ein paar Monaten erhielt ich eine Mail von einer Frau namens Holly Devane. Sie wollte mich zu meiner Mutter interviewen, die Sorte Anfrage, die ich früher abgelehnt hätte. Aber inzwischen war ich, was Interviews anging, ein bisschen wehmütig geworden; das letzte war schon eine Weile her, außerdem bedauerte ich mein – wie ich es empfand – langanhaltendes Versagen auf diesem speziellen Gebiet. Als Romanautorin, meine ich. Nicht, dass es irgendwen interessiert hätte. Es wurden trotzdem Rezensionen geschrieben, die Bücher verkauften sich mehr oder weniger. Es war nur ein kleiner Schmerz, und einer von der banalsten Sorte.
Also lud ich Holly Devane zu uns nach Bray ein. Ich schickte ihr eine Wegbeschreibung, weil kein GPS zu uns führt, einer der vielen Vorteile dieses kleinen Küstenortes. Manche Kreuzungen und Sackgassen sind uralt und so versteckt, dass nur die Einheimischen sie kennen.
Am Vormittag ihres Besuchs verschaffte ich mir einen kurzen Überblick über mein Leben und war zufrieden. Ich rückte Bilderrahmen gerade und fuhr mit einem Staubtuch über alle Zierleisten. Ich wappnete mich, mit anderen Worten, gegen die Anschuldigungen, die möglicherweise gegen mich erhoben werden würden. Oder auch nicht. Manchmal werfen sie einem nichts vor. Sie versuchen gar nicht erst, mir etwas zu entlocken oder mich aus etwas heraus – meinem Schneckenhaus, meiner Selbstzufriedenheit. Manchmal machen sie sich nicht die Mühe, ihr Gegenüber zu hinterfragen (was sicher viel Energie kostet, zumindest glaubte ich das früher), sie wollen einfach nur ein normales Gespräch führen, sich ein paar Notizen machen und wieder gehen. Und hinterher schreiben sie irgendwelche verqueren Monstrositäten, nur um einen auf Trab zu halten.
Aber du weißt schon. Nicht immer.
An einem stürmischen, kalten Frühlingstag tauchte Holly Devane vor meiner Tür auf. Ihr Auto stand an der Mauer zum Nachbargrundstück, weniger geparkt als einfach zurückgelassen. Auf mich wirkte sie wie ein Kind: dunkle Cabanjacke, Strickmütze, Schal, dünnes blondes Haar. Sie stehe, wie sie mir zwanzig Minuten später erklärte, »nicht so« auf Männer. Sie sei »echt nicht« dies, sondern »mehr so« das. Obwohl sie »manchmal echt« Lust auf Männer habe und, wie sie sagte, gelegentlich mit einem Mann ausgehe, spiele sich das nie auf die »also, heteronormative« Weise ab.
Ich fragte mich, wie ein Gespräch über meine Mutter diese Wendung hatte nehmen können, und dann auch noch so schnell. Im Kamin brannte ein Feuer, das Kaffeepulver in der Kanne auf dem Tablett musste nur noch hinuntergedrückt werden, die Haferkekse daneben sahen aus, als hätte ich sie selbst gebacken. Holly hatte einen Stuhl zu sich herangezogen und eine kleine, flache Videokamera daraufgesetzt, oder vielleicht war es auch nur ihr Handy, um aus einem zutiefst unschmeichelhaften Winkel aufzunehmen, was immer ich sagen würde. Am Ende vergaß sie, das Gerät einzuschalten. Aber sie war toll, sie war höflich und clever und sprühte vor Begeisterung; aus ihr wäre, fand ich, eine großartige Englischlehrerin geworden. Außerdem hatte sie sich gut vorbereitet. Sie schrieb ihre Doktorarbeit über meine Mutter, was mein Herz einen kleinen Hüpfer machen ließ in der Hoffnung, Katherine O’Dell könnte damit gut bedient sein. Also betrachtete ich die junge Frau aufmerksam, während ich vorgab, sie nicht zu betrachten: ihren durchtrainierten, angespannten kleinen Körper, ihre blühende, der Dummheit so nahe Intelligenz. Ihre Jugend.
Holly führte noch keinen Titel, doch sie hoffte sehr, ihre Doktorarbeit eines Tages in Buchform zu veröffentlichen. Als ich das Wort »Buch« hörte, schob ich ihr den Teller mit den Haferkeksen hin, aber sie lehnte ab. Sie stellte mir eine Frage und dann noch eine. »Ach, das«, sagte ich, »nun ja, das war bloß«, und merkte erst etwa zwanzig Minuten später (nach der Aussage über Heteronormativität), dass mit »Katherine O’Dell« natürlich »Holly Devane« gemeint war, genauer gesagt Holly Devanes Verweigerung des Heteronormativen, was immer das sein sollte; Adam und Eva im Garten Eden und die sich anschließenden vierzigtausend Jahre Schwachsinn.
»Was für eine Mutter war sie?«
»Na ja«, sagte ich. »Sie war meine Mutter.«
Wie viele andere zuvor beschnüffelte das Kind mich nach Spuren mütterlicher Grausamkeit, nach Narzissmus und Vernachlässigung. Es war ein Leichtes, sie diesbezüglich zu enttäuschen. Ich verfügte über eine gewisse Übung darin, nicht nur gegenüber Journalisten – meine Mutter war jahrelang von einer bestimmten Sorte irischer Schwuler verehrt worden. Aber Hollys Ansatz war neu. Sie wollte wissen, wie meine Mutter ihre Weiblichkeit in Szene gesetzt habe, womit ihr sexuelles Auftreten gemeint war, ein Thema, über das ich nicht allzu lange nachdenken wollte.
»Sie hat mit Männern geschlafen«, sagte ich.
Auf einmal wusste ich nicht mehr, warum ich dieses Mädchen in mein Haus gelassen hatte. Da saß ich, wieder einmal, verstrickt in die Neugier eines fremden Menschen, und in diese Lage gebracht hatte mich nur meine Einsamkeit, besser gesagt die Einsamkeit meiner Mutter, dieses klaffende Gefühl von Grab. Meine Mutter war schon so lange tot, aber ich würde selbst heute noch alles dafür geben, sie aus der Kälte hereinzuholen.
Meine Gedanken und der stechende Schmerz, den sie verursachten, lenkten mich von Holly Devane ab, die gerade erzählte, sie sehe in meiner Mutter kein Spiegelbild, sondern eine Schau-spielerin (affektiert zerteilte sie das Wort in zwei Silben). Sie werde meine Mutter in all ihrer radikalen Subjektivität darstellen, womit gemeint sei, dass sie sie entmystifizieren und als Wesen in der Welt darstellen wolle. Als eine Person, die handelt.
»Und auf Leute schießt«, sagte ich.
»Ja. Auch das«, sagte Holly, und dann schwieg sie kurz.
Ich rechnete mit einer Frage zu den damaligen politischen Verhältnissen. Mitte der Siebzigerjahre hatte meine Mutter sich in New York und Boston mit Männern von der IRA umgeben – hauptsächlich, das sollte Holly Devane unbedingt wissen, aus heteronormativen Gründen. Mit Waffen oder mit Terrorismus hatte sie nichts am Hut, auch wenn ihr Verhalten in Dublin seinerzeit für einen gewissen Skandal gesorgt hatte. Oder vielleicht wäre »Unbehagen« das treffendere Wort. Irischstämmigen Amerikanern nostalgische Rebellenlieder vorzusingen, war zwar schön und gut, aber nach einem Knieschuss oder einer Bombenexplosion in einem Belfaster Krankenhaus aufzuwachen, hatte dann eben gar nichts Nostalgisches mehr. Für die meisten Leute war die Romantik damit recht schnell verpufft. Nicht so für meine Mutter, die an ein Vereintes Irland glaubte, um jeden Preis.
Ich holte tief Luft, um es Holly Devane zu erklären, doch ich merkte, es war zu kompliziert.
»Ich glaube, sie hat sich einfach nur für die Publicity einspannen lassen«, sagte ich.
Holly blinzelte. Sie war zu jung, um sich an den Bürgerkrieg zu erinnern, und für Nordirland interessierte sie sich nicht. Sie interessierte sich nicht einmal für die IRA. Stattdessen nahm sie etwas unbeholfen Anlauf und hob zu der mittlerweile fast obligatorischen Frage an.
»Eins würde ich gern wissen. Es tut mir leid, Sie das fragen zu müssen. Aber ich dachte mir, es wäre vielleicht … Sie wissen schon … angemessen. Halten Sie es für vorstellbar, dass sie als Kind missbraucht wurde?«
»Nein«, sagte ich, »überhaupt nicht. Aber ich bin froh, dass Sie mich das gefragt haben.«
Irgendwie wurde ich sie los. Herzlichkeit an der Tür. Versprechungen, die ich nicht einhalten würde. Der Impuls, sie zu schubsen, als sie mir auf dem Weg zum Gartentor den Rücken zukehrte, oder sie in letzter Minute zurückzurufen. Und vier Stunden später dann der Streit, weil du gesagt hast, ich solle das verdammte Buch doch selbst schreiben.
Nach dem Essen waren wir in der Küche. Die untergehende Sonne leuchtete durch die Pflanzen auf dem Fensterbrett über der Spüle, Chili in einem gelben Blechtopf und Koriander aus dem Supermarkt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt glühte die Scheibe dahinter wie eine silbrige Membran aus Staub und Dreck, sodass man vor lauter Schmutz nicht mehr nach draußen sehen konnte.
Meine Laune war wirklich nicht besonders gut.
»Warum schreibst du es nicht selbst?«, hast du gefragt.
Und zwar – falls ich dich darauf hinweisen darf – in keinem netten Ton. Nicht mit der Engelsgeduld eines Mannes, der mit einer Schriftstellerin verheiratet ist. Nein. Dein Tonfall zeugte von bodenloser Gereiztheit, als könne sich meine Unfähigkeit, dieses Buch zu schreiben, durchaus mit meiner Unfähigkeit messen, den Geschirrspüler einzuräumen. Womit du in dem Moment beschäftigt warst.
Ich aß den letzten Haferkeks und ließ mich über die verblüffende Jugendlichkeit von Holly Devane aus, woraufhin wir uns beide noch älter fühlten. Ich hatte den Geschirrspüler nur deswegen nicht eingeräumt, weil die Trauer um meine Mutter mir kurzzeitig jede Hausarbeit unmöglich machte, sodass du zum Märtyrer meiner Inkompetenz in dieser und anderen Fragen wurdest. Zu allem Überfluss musste die blöde Auflaufform eingeweicht werden, was dich unter den gegebenen Umständen (sich dem Alter nähern, allein einen Geschirrspüler einräumen) zusätzlich belastete.
»Warum schreibst du es nicht einfach selbst?«, hast du gefragt.
»Was denn?«
»Ich meine ja nur.«
»Was soll ich denn deiner Meinung nach schreiben?«
Du hast beide Hände in die Höhe gehoben.
Später bin ich mitten in der Nacht aufgewacht. Du hast nicht geschlafen. Ich habe dich schlucken hören, ein leises, verräterisches Glucksen in der Dunkelheit.
Da waren wir nun.
Es war gegen vier Uhr morgens. Die Nacht war hell, das Zimmer und seine dunklen Silhouetten gut zu erkennen. Ich habe die Augen zugemacht, um wieder einzuschlafen. Du lagst auf dem Rücken, das Gesicht der Decke zugekehrt. Nach einer Weile hast du wieder geschluckt.
Früher war es ein Zeichen des Verlangens. Als wir neunzehn oder zwanzig waren und noch ganz am Anfang, saßen wir oft nebeneinander auf dem Sofa und unterhielten uns, und wenn uns die Themen ausgingen, starrten wir beiläufig und nachdenklich vor uns hin. Wir schafften es, eine ganze Weile nach oben und nach rechts und links zu schauen, als dächten wir über die Vorhänge nach, bis die Täuschung durch dein knackendes, gurgelndes Schlucken zerstört wurde. So winzig und doch so laut. Ich wusste genau, was es zu bedeuten hatte. Bald würden wir beide nackt sein – daran hast du gedacht, und du hast dich gefragt, wie du es beschleunigen könntest. Und noch bevor ich es verhindern konnte, musste ich selbst schlucken.
Aber nun war es vier Uhr morgens in Bray im County Wicklow, und wir waren nicht mehr zwanzig. Du hast nicht an Sex gedacht, als du mitten in der Nacht wachlagst. Es war nicht meine Nähe, die dir in der Dunkelheit auflauerte.
Sondern etwas anderes.
Es sollte ein eigenes Wort dafür geben, sagst du, wenn man weiterschlafen will, obwohl man zur Toilette muss. Das Bedürfnis, nachts aufzustehen, ist neu, es bedeutet, dass du die mittleren Jahre erreicht hast oder Schlimmeres, deswegen klammerst du dich an den Schlaf, als wäre er die Jugend selbst. Du möchtest nicht aufwachen, obwohl du längst wach bist. Du redest dir ein, dass du, solange du absolut reglos liegen bleibst, nicht sterben musst.
»Bist du wach?«, frage ich.
»Oh, Mann.«
Du raffst dich auf und wankst hinaus, vorbei an der Tür, hinter der unser riesengroßer Teenagersohn zehn Stunden am Stück schläft, vorbei auch am Zimmer seiner Schwester, das unter der Woche neuerdings leer steht. Du spülst und drehst den Hahn auf. Das Wasser strömt durch die Wände und verstummt erst, als du unter der warmen Decke liegst, dich zu dem Kuss umgedreht hast, der dem Schlaf vorausgeht, und wieder eingeschlafen bist. Einfach so. Während ich wachliege und über das Leben nachdenke, das wir uns eingerichtet haben, darüber, wie einfach es war und wie unvorhergesehen. Und da löst sich noch etwas aus der Dunkelheit.
Mein Buch.
Am darauffolgenden Morgen buchte ich im Internet einen billigen Flug nach London-Gatwick. Beim Datum zögerte ich kurz. Dreiundzwanzigster April. Ich würde am Geburtstag meiner Mutter fliegen (falls eine Tote überhaupt Geburtstag haben kann), und zwar nach London, weil sie – das ist die schonungslose Wahrheit – von dort stammte. Jawohl. Katherine O’Dell, die irischste Schauspielerin aller Zeiten, war genau genommen Britin.
Sie war in London zur Welt gekommen und hatte dort auch ihre Kindheit verbracht, trotz der roten Haare, des karierten Schultertuchs und der Gedichte. Und trotz der Rebellenlieder:
»Die See, oh, die See, ist die grá geal mo chroí
Lang mag sie bleiben zwischen England und mir.«
Ein paar Wochen später blickte ich aus dem Flugzeug auf die ferne, funkelnde Oberfläche der Irischen See hinunter, hier und dort schräg zerteilt vom Bug eines winziges Bootes.
»Gott sei Dank ist ringsum nichts als Wasser.«
Niemand ahnte, wo sie zur Welt gekommen war, und niemand durfte es je erfahren; es war ein großes und kompliziertes Geheimnis. Als ich die glatte blaue Fläche überquerte, fragte ich mich, wozu sie den ganzen Aufwand betrieben hatte.
Natürlich hat sie nie ihr Alter verraten, das könnte also einer der Gründe gewesen sein. Solange niemand erfuhr, wo sie geboren wurde, würde auch niemand wissen, wo ihre Geburtsurkunde zu finden war. Sie war Schauspielerin, solche Dinge lagen ihr.
Sie hat über ihr Alter stets geschwiegen, aber ich werde das Schweigen jetzt brechen. Jetzt, da der Tod die Uhr zertrümmert hat, die sie ein Leben lang zurückdrehen wollte. Ich hasse es, sie festzunageln. Ehrlich gesagt fühle ich einen stechenden Schmerz des Verrats, wenn ich der Welt offenbare, dass sie im April des Jahres 1928 in Herne Hill geboren wurde, einem Vorort von London. In der örtlichen Kirche Saints Philip and James taufte man sie auf den Namen Katherine Anne FitzMaurice.
Später, als Schauspielerin, würde sie den Mädchennamen ihrer Mutter annehmen, Odell, aus dem in Amerika das irischer klingende O’Dell wurde. Etwa zur selben Zeit verfärbte ihr Haar sich rot vor lauter Sehnsucht nach der alten Heimat.
Meine Mutter war eine begabte Hochstaplerin. Sie war auch eine Künstlerin, eine Rebellin und eine Romantikerin; man durfte sie nennen, wie man wollte, solange man sie keine Engländerin nannte, denn das wäre eine schlimme Beleidigung gewesen. Und außerdem, leider, die Wahrheit.
Nachdem das Flugzeug in Gatwick gelandet war, nahm ich einen Zug zur Victoria Station und von dort einen weiteren Zug nach Herne Hill, und England machte auf mich einen guten Eindruck. Klackedi-klack, klackedi-klack, unterwegs mit dem wunderbaren englischen Nahverkehr. Mehr als nur einen guten Eindruck. Die gepflegten Gärten, die überwiegend hübschen Reihenhäuser, die morgendliche Ansammlung der frisch gewaschenen, ausnahmslos höflichen Pendler. Falls meine Mutter davor weggelaufen war, konnte ich sie nicht verstehen.
Die Siedlung war mühelos zu finden. Milkwood Road, eine bescheidene Häuserzeile mit gelber Backsteinfassade, liegt etwa fünf Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Heute trennt sie ein Gewerbegebiet namens Mahatma Gandhi Industrial Estate von den Bahngleisen, aber im Jahr 1928 wird man einen freien Blick auf die vorbeirollenden Züge gehabt haben. Das Haus, in dem Katherine geboren wurde, steht an der Abzweigung zur Poplar Road. Ich lief bis zur Gabelung und dann an der schrägen Mauer hinter dem Haus entlang. Einen nennenswerten Garten gab es nicht, weder vor dem kleinen Gebäude noch dahinter. Meine Mutter wurde im April geboren. Sie hegte eine lebenslange Schwäche für Magnolien, und im Frühling war sie stets hingerissen von den Glyzinien am Dartmouth Square. Vor meiner spontanen Pilgerreise nach Herne Hill hatte ich mich oft gefragt, ob ihre Sehnsucht nach Blüten aufrichtig oder gekünstelt war, aber als ich nun zu den Fenstern mit den verdreckten Stores aufblickte, musste ich mir eingestehen, dass ich so schlau war wie zuvor.
Ihre Eltern waren rastlose Schauspieler, die von einer Unterkunft zur nächsten zogen; das Haus, in dem sie 1928 wohnten, schien immer noch ein Mietobjekt zu sein. Ich ging zur Vorderseite, holte tief Luft und trat durch die Aussparung in dem niedrigen Mäuerchen, um anzuklopfen. Oder wenigstens die Tür zu berühren. Ich spürte das warme Holz und fühlte mich geerdet, als hätte sich eine Spannung entladen.
Hier war sie zur Welt gekommen.
Am Abend des 23. April stand ihr Vater Menton FitzMaurice im Daly’s auf der Bühne, einem Theater am Leicester Square. Ihre Mutter hatte ein Zwicken gespürt und die eine oder andere Wehe, was Fitz auf seinem Weg zum Bahnhof einer Nachbarin gegenüber auch erwähnte; doch anscheinend vermittelte er keinen Eindruck von Dringlichkeit, denn als die Frau nach meiner Großmutter sehen wollte, saß die schon gebärend auf der Treppe. So wurde es mir immer erzählt. Dass die Haustür offen stand und sich draußen vor der Tür die Nachbarskinder versammelt hatten, während meine Großmutter sich mit emporgerecktem Bauch am Treppengeländer festklammerte und tiefe, tierische Laute abwechselnd von sich gab oder unterdrückte. Ich sehe sie vor mir wie eine Zeitungskarikatur: Sie hat die Absatzstiefeletten von sich gestreckt, und ihr Hut (die alberne Feder hängt abgeknickt herunter) sitzt schief. In dieser illustrierten Version der Geschichte sind ihre Röcke so durcheinander, dass weder Blut zu sehen ist noch Fruchtwasser. Und auch nicht der aufdringliche Kopf meiner Mutter, ihre zusammengepresste Schädelkuppe, die sich durch das nachgiebige Fleisch schiebt, als meine Großmutter ein paar Stufen abwärtsrutscht oder -kracht und den Arm zurückreißt, während die Kinder mit ernstem Blick unten am Gartentor stehen.
Mein Großvater spielt derweil den Grafen Below in einem entzückenden Stück mit dem Titel Die Zaunrosendame. Als meine Großmutter sich streckt und stöhnt, posiert und deklamiert er in Husarenwams und hochtaillierter Hose. Mein Großvater Fitz war unbestreitbar schön – irgendwann muss es gesagt werden, und warum nicht jetzt, wo die Füße seiner Frau gerade auf der untersten Stufe Halt finden, ihn wieder verlieren und meine Mutter in die Welt und auf die Treppe hinausschießt. In Rückenlage. Meine Großmutter wühlt in den Röcken, und da ist auch schon Katherine Anne, mit dem Gesicht nach oben und längst in Bewegung, aufgefangen von der Nachbarin, die am Fuß der Treppe kniet. Heraus kommt sie, im hohen Bogen, heraus und herunter. Die Nachbarin ruft: »O Gott im Himmel, halten Sie still, nicht pressen«, aber meine Großmutter presst, die Plazenta klatscht auf die unterste Stufe und gibt dem Baby Bodenhaftung. Die Nachbarin hebt es in die Höhe, dreht sich um und zeigt es der Hebamme, die sich einen Weg durch die Kinder gebahnt hat und in diesem Moment das Haus betritt.
»Sehen Sie, ein Mädchen!«
Die Zaunrosendame ist ein musikalisches Lustspiel, eins von der in Pastellfarben ausgestatteten Sorte, wo die Männer wie Spielzeugsoldaten aussehen und die Damen Sommerkrinoline tragen. Die Handlung ist eine fröhliche Überarbeitung der biblischen Geschichte von Judith und Holofernes, bloß dass Judith den Feind in diesem speziellen Fall nicht köpft, sondern den stattlichen Eindringling (gespielt von meinem Großvater) küsst und anschließend den Dolch fallen lässt. Sie ist verliebt. Er auch. Sicherlich die bessere Art und Weise, einen Krieg zu beenden. Ich weiß nicht, was zum Schluss mit dem Dolch geschieht; vielleicht hängen sie ihn übers Ehebett.
Die Kritikerin vom Spectator