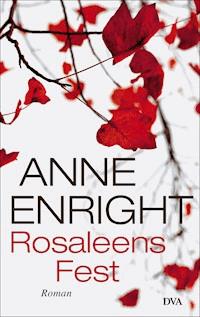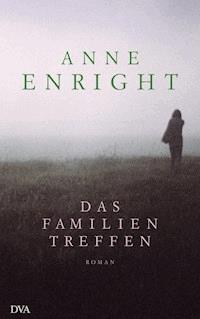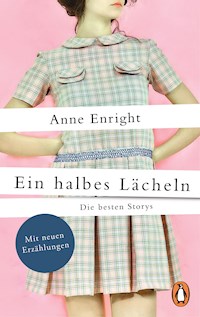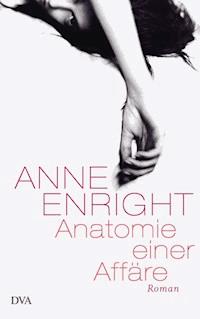
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine verhängnisvolle Affäre – leidenschaftlich und schockierend offen
Es ist nicht Liebe auf den ersten Blick, als Gina den Familienvater Seán Vallely bei einem Gartenfest kennenlernt. Doch dann treffen sie sich zufällig wieder, trinken zu viel, landen im Bett – und verfallen einander. So beginnt eine verhängnisvolle Affäre, die jahrelang vor den Ehepartnern geheim gehalten wird. Anfangs eine Beziehung voller Leidenschaft und Glück, hält langsam das Schweigen Einzug, Gewissensbisse, Vorwürfe, Schuld – ist es Liebe? Und darf man für diese Liebe das Seelenheil seines Kindes opfern?
Anne Enright ist für die schonungslose Unerbittlichkeit bekannt, mit der sie Beziehungslügen seziert – da reicht eine Geste, ein Blick, und schon ist klar: Die Liebenden steuern in den Abgrund der Alltagsnormalität. Mit Anatomie einer Affäre ist der Irin ein würdiger Nachfolger ihres preisgekrönten Romans Das Familientreffen gelungen: schockierend offen, scharfsinnig und von einer psychologischen Präzision, die kein Entrinnen zulässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Anne Enright
Anatomie einer Affäre
Roman
Aus dem Englischen vonPetra Kindlerund Hans-Christian Oeser
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2011 by Anne Enright
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Gestaltung und Satz: DVA/Brigitte Müller
ISBN 978-3-641-07264-3V002
www.dva.de
Vorwort
Hätte es das Kind nicht gegeben, wäre vielleicht nichts von alledem passiert; doch die Tatsache, dass ein Kind daran beteiligt war, machte es so viel schwieriger zu verzeihen. Natürlich gibt es da gar nichts zu verzeihen; doch die Tatsache, dass ein Kind darin verwickelt war, flößte uns das Gefühl ein, es gebe kein Zurück mehr, es gehe um etwas Wichtiges. Die Tatsache, dass ein Kind betroffen war, bedeutete, dass wir uns ehrlich mit uns selbst auseinandersetzen, die Sache zu Ende bringen mussten.
Als es anfing, war sie neun, aber das spielt kaum eine Rolle. Ich meine, ihr Alter spielt kaum eine Rolle, weil sie schon immer etwas Besonderes war – sagt man nicht so? Sicher, alle Kinder sind etwas Besonderes, alle Kinder sind schön. Ich muss zugeben, dass ich Evie schon immer ein bisschen eigen fand; etwas Besonderes war sie also auch im altmodischen Wortsinn von »sonderlich«. Ihre Schönheit hatte etwas merkwürdig Exzentrisches an sich. Sie ging auf eine gewöhnliche Schule, doch schon damals war sie von einer gewissen Ambivalenz umgeben, einer Ahnung unausgesprochener Dinge. Selbst die Ärzte – gerade die Ärzte – beließen es bei einem vagen »Abwarten«.
Es gab also viele Sorgen um Evie – zu viele, fand ich, denn sie war ja auch ein reizendes Kind. Als ich sie besser kennenlernte, sah ich zwar, dass sie unleidlich sein konnte oder einsam; ich bezweifelte, dass sie glücklich war. Damals aber, als Neunjährige, hielt ich sie für eine schöne, klare kleine Person und für eine Art Geschenk.
Und als sie sah, wie ich ihren Vater küsste – als sie sah, wie ihr Vater mich küsste, in seinem eigenen Haus –, da lachte sie und wedelte mit den Händen. Ein schrilles, unvergessliches Johlen. Es war, dachte ich später, vor allem ein Lachen der Erkenntnis, zugleich aber eines der Gehässigkeit oder dergleichen – Schadenfreude vielleicht. Und ihre Mutter, die unten an der Treppe stand, rief: »Evie! Was machst du da oben?« Da blickte das Kind über die Schulter. »Los, komm jetzt runter.«
Wundersamerweise bewirkte die Stimme ihrer Mutter, so beiläufig und beherrscht, dass Evie glaubte, es sei alles in Ordnung, ungeachtet dessen, dass ich ihren Vater geküsst hatte. Und das nicht zum ersten Mal – obwohl ich diesen Kuss inzwischen als den ersten richtigen ansehe, als das erste offizielle Ereignis unserer Liebe: am 1. Januar 2007, als Evie mehr oder weniger noch ein Kind war.
I
There Will Be Peace in the Valley
Ich bin ihm im Garten meiner Schwester in Enniskerry begegnet. Dort sah ich ihn zum ersten Mal. Es hatte nichts Schicksalhaftes an sich, auch wenn ich das Licht des Spätsommers und die Aussicht hinzufüge. Ich stelle ihn ans untere Ende des Gartens meiner Schwester, nachmittags, zu dem Zeitpunkt, wenn der Tag sich zu neigen beginnt. Vielleicht um halb sechs. Es ist halb sechs an einem Sommersonntag in Wicklow, als ich Seán zum ersten Mal sehe. Er steht dort, wo das untere Ende des Gartens meiner Schwester ins Ungefähre übergeht. Gleich wird er sich umdrehen – aber das weiß er noch nicht. Er betrachtet die Aussicht, und ich betrachte ihn. Die Sonne hängt tief und wunderhübsch am Himmel. Er steht dort, wo der Berghang allmählich zur Küste hin abfällt, und hat das Licht im Rücken, es ist genau die Tageszeit, wenn sämtliche Farben ihre volle Strahlkraft entfalten.
Das ist nun schon einige Jahre her. Das Haus ist neu, und dies ist die Einweihungsparty meiner Schwester oder jedenfalls ihre erste Party, ein paar Monate nach dem Einzug. Als Erstes entfernten sie den Holzzaun, um einen Blick aufs Meer zu erhaschen, darum wirkt die Rückseite des Hauses wie eine Zahnlücke in der Reihe von Neubauten, den Ostwinden und neugierigen Kühen ausgesetzt; an diesem Nachmittag ein kleines Bühnenbild des Glücks.
Neue Nachbarn sind gekommen und alte Freunde und ich, mit ein paar Kisten Wein und dem Grill, den sie auf ihre Geschenkliste gesetzt und am Ende doch selbst gekauft hatten. Er steht auf der Terrasse, ein grünes Ding mit einem schwenkbaren Kübel als Deckel. Mein Schwager Shay – ich glaube, er trägt sogar eine Schürze – fuchtelt mit einer hölzernen Zange über Lammsteaks und Hühnerschenkeln und ploppt mit der freien, in die Luft gereckten Hand Dosenbier auf.
Fiona erwartet von mir, dass ich ihr helfe, weil ich ihre Schwester bin. Sie kommt mit einem Armvoll Teller an mir vorbei und wirft mir einen finsteren Blick zu. Dann fällt ihr ein, dass ich Gast bin, und sie bietet mir einen Chardonnay an.
»Ja«, sage ich. »Ja, danke, liebend gern«, und wir unterhalten uns wie Erwachsene. Das Glas, das sie füllt, hat die Größe eines Schwimmbeckens.
Wenn ich daran denke, könnte ich heulen. Es muss 2002 gewesen sein. Da war ich nun nach drei Wochen Australien zurückgekehrt und war verrückt – richtig verrückt – nach Chardonnay. Meine Nichte Megan muss vier gewesen sein, mein Neffe knapp zwei: entzückende kleine Hosenmätze, die mich anschauen, als warteten sie auf einen Witz. Auch von ihnen sind Freunde da. Überall rennen Kinder herum; schwer zu sagen, wie viele – ich vermute, dass sie die klonen, unten in der Gästetoilette. Immer geht eine Frau mit einem Knirps hinein und nestelt beim Herauskommen an zweien herum.
Ich sitze an der Glaswand zwischen Küche und Garten – es ist wirklich ein hinreißendes Haus – und beobachte das Leben meiner Schwester. Die Mütter drängen sich um den Tisch, auf dem das Essen für die Kinder steht, während die Männer ihre Drinks draußen im Freien schlürfen und himmelwärts spähen, als hielten sie Ausschau nach Regen. Ich komme mit einer Frau ins Gespräch, die neben einem Teller Schoko-Rice-Krispie-Törtchen sitzt und sich gedankenverloren durch sie hindurchfuttert. Bedeckt sind sie mit Minimarshmallows. Eben will sie sich ein Törtchen in den Mund schieben, da weicht sie plötzlich erstaunt zurück.
»Huch, pink!«, sagt sie.
Ich weiß nicht, worauf ich damals gerade wartete. Mein Freund Conor musste jemanden nach Hause gebracht oder abgeholt haben – ich kann mich mehr erinnern, weshalb er noch nicht zurück war. Bestimmt war er mit dem Wagen unterwegs. Gewöhnlich war er derjenige, der fuhr, damit ich etwas trinken konnte. Einer von Conors Vorzügen, muss ich sagen. Dieser Tage fahre ich selbst. Aber auch das ist ein Fortschritt.
Und ich weiß nicht, wieso ich mich an die Schoko-Rice-Krispie-Törtchen erinnere, außer dass mir »Huch, pink!« als das Witzigste vorkam, was ich je gehört hatte, und wir uns vor Lachen nicht mehr einkriegen konnten, ich und die namenlose Nachbarin meiner Schwester – besonders sie wurde von Heiterkeit so geschüttelt, dass nicht zu erkennen war, ob sie sich nun vor Ausgelassenheit oder vor Blinddarmschmerzen krümmte. Mittendrin schien sie von ihrem Stuhl zu rutschen. Sie rollte zur Seite, und ich sah sie lachend an. Dann startete sie ohne Vorwarnung plötzlich durch und stürmte durch die Glastür auf meinen Schwager zu.
Der Jetlag hatte zugeschlagen.
Ich weiß noch, wie eigenartig das war. Diese Frau, die geradewegs auf Shay zuraste, der seelenruhig weitergrillte; das zischende Fleisch, die Flammen; mein Grübeln: »Ist es schon Abend? Wie spät ist es eigentlich?« – während das Schoko-Rice-Krispie-Törtchen auf meinen Lippen starb. Die Frau bückte sich, als wollte sie Shay bei den Schienbeinen packen, doch als sie sich aufrichtete, hielt sie auf einmal ein lebhaftes kleines Kind in den Armen und rief: »Weg da, ist das klar? Weg mit dir!«
Der Junge blickte um sich und nahm den jähen Szenenwechsel mehr oder weniger gleichmütig hin. Drei, vielleicht vier Jahre alt. Sie setzte ihn auf dem Rasen ab und holte zu einer Ohrfeige aus. So schien es mir jedenfalls. Sie hob die Hand gegen ihn und dann plötzlich gegen sich selbst, als wollte sie eine Wespe vor ihrem Gesicht verscheuchen.
»Wie oft muss ich dir das noch sagen?«
Shay reckte den Arm, um eine Dose Bier aufzumachen, das Kind lief davon, und die Frau stand einfach da und fuhr sich mit ihrer unberechenbaren Hand durchs Haar.
Das war die eine Sache. Es gab noch andere. Da war Fiona, mit ihren hektisch geröteten Wangen und den Augen, die unversehens feucht wurden von dem ganzen Trallala des Weineinschenkens, von fröhlichem Gelächter und ihrem Dasein als wunderschöne Mutter Schrägstrich Gastgeberin in ihrem wunderschönen neuen Haus.
Und da war Conor. Mein Liebster. Der sich verspätet hatte.
Es ist 2002, und schon jetzt raucht keiner mehr von diesen Leuten. Ich sitze allein am Küchentisch und halte Ausschau nach jemandem, mit dem ich reden könnte. Die Männer im Garten wirken auch nicht interessanter als zum Zeitpunkt meiner Ankunft – in ihren kurzärmeligen Hemden und ihren Hosen, die »Wir sind Freizeithosen« schreien. Ich komme gerade aus Australien. Mir fallen die Typen ein, die man zur Mittagszeit am Hafen von Sydney entlanglaufen sieht: eine endlose Reihe joggender Männer, fit und gebräunt, Männer, bei denen man kehrtmachen könnte, um ihnen zu folgen, ohne sich bewusst zu sein, dass man ihnen folgt; so wie man sich eines dieser verdammten Schoko-Rice-Krispie-Törtchen greift und nicht merkt, dass man es isst, bis man das Marshmallow entdeckt.
»Huch, pink!«
Ich brauche dringend eine Zigarette. Ihre Kinder hätten noch nie eine zu Gesicht bekommen, hatte Fiona mir erzählt – Megan sei in Tränen ausgebrochen, als ein Elektriker sich im Haus eine ansteckte. Ich ziehe meine Handtasche von der Stuhllehne und schlendere zur Türschwelle, vorbei an Shay, der mir mit einem Stück Fleisch zuwinkt, vorbei an regengebleichten Dreirädern und fröhlichen Vorstädtern, hinunter zu der Stelle, wo, angebunden an ihren viereckigen Pfahl, Fionas kleine Eberesche steht und der Garten sich in einen Berghang verwandelt. Hier steht ein kleines Blockhaus für die Kinder. Es ist aus braunem Plastik: eigentlich ein bisschen eklig – die Balken sehen so künstlich aus, ebenso gut könnten sie aus Schokolade sein oder aus einer Art gummierter Kacke. Hinter diesem Ding lungere ich herum und bin so bemüht, respektabel dabei auszusehen – lehne mich gegen den Zaun, glätte meinen Rock, krame verstohlen in meiner Handtasche nach Fluppen –, dass ich ihn erst sehe, als die Zigarette bereits angezündet ist. So fällt mein erster Blick auf Seán (hier, in dieser Geschichte über Seán, die ich mir selbst erzähle) durch eine sich verdichtende Dunstwolke hindurch: sein Körper, die Figur, die er vor der Aussicht abgibt, verschleiert vom Rauch einer lang entbehrten Marlboro Light.
Seán.
Einen Augenblick lang ist er vollkommen er selbst. Gleich wird er sich umdrehen, aber das weiß er noch nicht. Er wird sich umdrehen und mich erblicken, so wie ich ihn erblicke, und danach wird viele Jahre lang nichts passieren. Es gäbe auch keinen Grund dafür.
Es fühlt sich wirklich wie Abend an. Das Licht ist wundervoll und grundverkehrt – es ist, als müsste ich den ganzen Planeten in meinem Kopf drehen, um in diesen Garten zu gelangen, in diesen Abschnitt des Nachmittags und zu diesem Mann, diesem Fremden, neben dem ich jetzt schlafe.
Eine Frau kommt hinzu und redet leise mit ihm. Er hört ihr über die Schulter hinweg zu, dann wendet er den Kopf noch weiter, um ein kleines Mädchen zu betrachten, das sich hinter den beiden herumdrückt.
»Mein Gott, Evie«, sagt er. Und seufzt – denn nicht das Kind irritiert ihn, sondern etwas anderes; etwas Größeres und Schmerzlicheres.
Die Frau geht zurück, um Evies verschmiertes Gesicht mit einer Papierserviette abzuwischen, die auf der klebrigen Haut zerfusselt. Seán beobachtet dies einige Sekunden lang. Und dann blickt er zu mir herüber.
Diese Dinge passieren ständig. Man begegnet dem Blick eines Fremden, sieht einen Moment zu lange hin, schaut dann weg.
Ich war gerade aus den Ferien zurück: eine Woche bei Conors Schwester in Sydney, dann nach Norden zu diesem sagenhaften Ort, wo wir Sporttauchen lernten. Meiner Erinnerung nach lernten wir dort auch, wie man nüchtern Sex hat – ein simpler, aber guter Trick. Es war, als würde man eine zweite Haut abstreifen. Vielleicht konnte ich deshalb Seáns Blick standhalten. Ich war gerade am anderen Ende der Welt gewesen. Für meine Verhältnisse sah ich ziemlich gut aus. Ich war verliebt – richtig verliebt – in einen Mann, den ich bald zu heiraten beschließen würde, sodass ich es nicht mit der Angst zu tun bekam, als Seán mich ansah.
Vielleicht hätte ich es mit der Angst zu tun bekommen sollen.
Und ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wie Evie an jenem Tag aussah. Sie muss vier gewesen sein, aber ich weiß nicht, wie viel davon noch in dem Mädchen steckt, das ich heute kenne. An jenem Nachmittag sah ich lediglich ein Kind mit einem verschmutzten Gesicht. Insofern ist Evie nur eine Art Schmierfleck auf einem ansonsten vollkommen klaren Bild.
Denn es ist schon verblüffend, wie viel ich mit diesem ersten flüchtigen Blick begriff – wie viel ich, im Nachhinein betrachtet, hätte wissen müssen. Alles ist da: die erste Regung meines Interesses an Seán, die ganze Sache mit Evie; daran erinnere ich mich noch sehr deutlich, ebenso an die akkurate und unerschütterliche Höflichkeit seiner Frau. Ich wusste sie sofort einzuschätzen, und nichts von dem, was sie später tat, hat mich je überrascht oder widerlegt. Aileen, die nie ihre Frisur änderte, die damals Größe 36 hatte und diese für alle Zeiten beibehalten wird. Über die Brücke der Jahre hinweg könnte ich Aileen jetzt zuwinken, und sie würde mich mit mehr oder weniger demselben Blick wie damals bedenken. Denn auch sie durchschaute mich. Auf Anhieb. Und obwohl sie lächelte und sich korrekt verhielt, entging mir nicht ihre innere Anspannung.
Aileen, so könnte man sagen, hat sich nicht weiterentwickelt.
Was mich betrifft, bin ich mir auch nicht so sicher. Irgendwo oben am Haus gibt die Marshmallow-Frau ein zu heftiges Lachen von sich, Conor hält sich woanders auf, Aileens Papierserviette in geschmackvollem Limettengrün wird bald auf Evies klebriger Haut ihre Fetzen hinterlassen und Seán in meine Richtung blicken. Aber noch nicht. Im Augenblick atme ich nur aus.
Love Is Like a Cigarette
Beginnen wir mit Conor. Conor ist einfach. Sagen wir, er ist bereits eingetroffen, an jenem Nachmittag in Enniskerry. Als ich wieder in die Küche gehe, ist er da, hängt herum, hört zu, amüsiert sich. Conor ist klein und kräftig, und im Sommer 2002 ist er das, was ich mir unter Spaß vorstelle.
Conor zieht sein Jackett nie aus. Unter dem Jackett ist eine Strickjacke, dann kommt ein Hemd, danach ein T-Shirt und darunter eine Tätowierung. Den breiten Riemen seiner Tasche hat er um die Brust geschlungen, sodass alles gut festgezurrt ist. Er schnorrt. Dieser Mann hört nie auf, seine Umgebung zu erkunden, als wäre er auf Nahrungssuche. Wenn Speisen in der Nähe sind, wird er sie verzehren – aber ordentlich, auf kluge, aufmerksame Art. Seine Augen wandern über den Fußboden, und wenn er aufblickt, dann mit großem Charme: Etwas, was du gesagt hast, erweckt sein Interesse, er findet dich witzig. Der Typ mag geistesabwesend wirken, aber er ist immer bereit, sich zu amüsieren.
Ich habe Conor geliebt, also weiß ich, wovon ich rede. Er stammt aus einer Familie von Ladenbesitzern und Gastwirten in Youghal, daher gefällt es ihm, Leute zu beobachten und zu lächeln. Das mochte ich an ihm. Und ich mochte seine Tasche, sie war modisch, und auch seine Brille war modisch, mit dickem Rand wie in den Fünfzigern. Und er rasierte sich den Kopf, was ich normalerweise gar nicht mag, aber ihm stand es, denn seine Haut war braun und sein Schädel ansehnlich. Sein Hals war breit, sein Rücken gewölbt, von den Schultern abwärts sprossen Haare. Was soll ich sagen? Bisweilen überraschte es mich, dass der Mensch, den ich liebte, so fantastisch männlich aussah, dass seine Muskelschichten mit straffen Fettschwarten bedeckt waren und sein ganzer Körper – sämtliche eins fünfundsiebzig, Gott steh uns bei – mit Haaren bekräuselt, sodass seine Konturen verschwammen, wenn er sich auszog. Niemand hatte mir gesagt, dergleichen könnte einem gefallen. Aber mir gefiel es.
Conor hatte gerade seinen Master in Medienwissenschaften gemacht und war auf dem besten Weg zum Computerfreak. Auch ich war irgendwie im IT-Bereich tätig, ich arbeite meist mit europäischen Firmen, übers Internet. Sprachen sind mein Ding. Leider nicht die romanischen, ich habe es mehr mit den Bierländern als mit den Weinländern. Dabei finde ich Umlaute richtig sexy, weil man die Lippen dabei so schürzen muss. Und diese ganzen skandinavischen »ü«-, »ö«- und »ä«-Laute verursachen mir eine Gänsehaut. Einmal war ich mit einem Norweger namens Axel zusammen, nur um ihn »snøord« sagen zu hören.
Aber mit Conor bin ich ausgegangen, weil es Spaß machte, und verliebt habe ich mich in ihn, weil es das einzig Richtige war. Wie ist das möglich? Dass er in all der Zeit, als ich ihn kannte, nicht ein einziges Mal grausam war?
Es bedurfte keiner großen Entscheidung, ein Haus zu kaufen, es war einfach sinnvoll. Australien war unsere letzte große Sause, danach ging alles für Anzahlungen, Hypothekenversicherungen, Stempelsteuern und Anwaltsgebühren drauf – Allmächtiger, die haben uns ausgenommen, bis wir quiekten. Ich kann mich nicht entsinnen, wie sich das auf unsere vermeintliche Liebe ausgewirkt hat. An die Nächte erinnere ich mich nicht. Unsere Liebe fand ohnehin eher bei Tag statt; Conor ging regelmäßig zum Windsurfen am Seapoint, und wenn er zurückkam, roch er nach Pommes frites und Meer. An Samstagnachmittagen stapften wir in den Häusern anderer Leute herum: Fünf-Zimmer-Doppelhaushälfte, viktorianisches Reihenhaus, Penthousewohnung. Wir standen vor Kaminsimsen aus den Dreißigerjahren und betrachteten sie mit halb zugekniffenen Augen. Oder wir wanderten in verschiedene Zimmer, jeder für sich, um uns besser vorstellen zu können, wie es sich dort leben ließ: eine durchbrochene Wand, ein beseitigter Geruch, weniger unbewohnt wirkende Räumlichkeiten.
So hielten wir es einige Monate lang. Wir wurden ziemlich gut darin. Ich konnte ein x-beliebiges Dreckloch betreten und auf Anhieb ein tabakbraunes Ledersofa an die längste Wand klatschen. Sobald jemand »Doppelhaushälfte aus den Fünfzigerjahren« sagte, ließ ich einen Retrolampenschirm herabbaumeln, setzte einen Eames-Designersessel darunter und knipste das Licht an. Aber ich wusste nicht, wie sich mein Leben in diesem Sessel anfühlen würde, wie ich mich darin fühlen würde. Zweifellos besser. Ich war mir sicher, dass ich mich ernsthaft und doch verspielt, erwachsen und doch glücklich fühlen würde, irgendwie wäre ich erfüllt. Andererseits aber, wie ich zu Conor sagte.
»Andererseits.«
Wenn wir uns zum Abschluss dieser langen Samstage liebten, hatten wir den Eindruck, als würden wir einander zurückerobern, nachdem wir uns vorübergehend abhandengekommen waren.
Man betritt das Haus eines Fremden, und es ist spannend, das ist alles, und hinterher ist man leicht angeschmuddelt. Ich spürte es, in den verlassenen Secondhandküchen und in meinen Sonntagsbeilagenträumen. Ich spürte, wie es dahinschwand, in den Augenblicken nach dem Erwachen, wenn mir klar wurde, dass wir kein Haus mit Meerblick gekauft hatten und vermutlich auch nie eins kaufen würden. Ein Haus, das mit jedem Blick nach draußen dein Leben reinigt – eigentlich schien das nicht zu viel verlangt, aber anscheinend war es das doch. Es war viel zu viel verlangt. Ich ging die Zahlen durch, von oben nach unten und von rechts nach links, und konnte es nie fassen, was unter dem Strich herauskam.
Unter dem Strich kam heraus, dass wir dorthin zurückmussten, wo wir begonnen hatten, ehe wir ganz und gar durchgeknallt waren. Unter dem Strich stand nicht so sehr ein Haus als vielmehr eine Geldanlage; ein Häuschen nicht zu weit außerhalb, in dem man sich gerade eben noch umdrehen konnte.
Und genau das fanden wir denn auch: ein Reihenhäuschen in Clonskeagh, für dreihundert Riesen. Wir griffen als Letzte zu, kauften direkt vom Bauplan und leerten, um zu feiern, eine Flasche Krug – für sage und schreibe hundertzwanzig Euro.
Keinen geringeren Champagner als Krug.
Der war lecker.
Damals liebte ich Conor. Ich liebte ihn wirklich – ihn und all die Varianten von ihm, die ich mir ausgemalt hatte, in jenen Häusern, in meinem Hirn. Ich liebte sie alle. Und ich liebte etwas Wesentliches: das Gespür für ihn, das ich mit mir herumtrug und das sich jedes Mal bestätigte, wenn ich ihn sah – oder einige befremdliche Sekunden später. Wir kannten einander. Unser wirkliches Leben fand in unseren Köpfen statt; unsere Körper waren lediglich die Orte, an denen wir spielten. Vielleicht sollten alle Liebenden so sein – nicht diese liebestrunkenen, schwachsinnigen Fremden wie Seán und ich, Darsteller in einem leeren Zimmer.
Wie auch immer. Bevor unser Leben eine Ödnis aus Langeweile, Wut und Betrug wurde, liebte ich Seán. Ich meine Conor.
Bevor unser Leben eine Ödnis aus Langeweile, Wut und alledem wurde, liebte ich Conor Shiels, dessen Herz so beständig und dessen Körper so fest und warm war.
Am Wochenende nach der Vertragsunterzeichnung fuhren wir zu dem unvollendeten Haus und nahmen es in Augenschein. Anschließend setzten wir uns auf den Zementboden und hielten uns an den Händen.
»Hör mal«, sagte er.
»Was?«
»Hör das Geld.«
Der Wert des Hauses steige Tag für Tag um fünfundsiebzig Euro, sagte er, das mache – unter flackernden Augenlidern stellte er die Berechnungen an – etwa fünf Cent pro Minute. Was, wie ich fand, nicht viel war. Was fast lächerlich war, nach allem, was wir durchgemacht hatten. Dennoch, man konnte es beinahe fühlen, ein Schieben in den Wänden; aus dem Toaster würden Fünfer springen, das Holz der neu verlegten Dielen würde Papiergeld absondern und zu sprießen beginnen.
Und aus irgendeinem Grund hatten wir fürchterliche Angst.
Versuchen Sie nicht, mich vom Gegenteil zu überzeugen.
Das Haus fügte sich wie ein Legoklotz in das des Nachbarn, wo sich die Tür zum Erdgeschoss befand. Das brachte mich ein bisschen aus der Fassung – die Tatsache, dass das Haus, bevor man zum ersten Stock gelangte, nur ein halbes war. Als hätte das Gebäude einen Schlaganfall erlitten.
Nicht dass das ein Problem war, jedenfalls keines, das als solches zu erkennen war. Ich hatte nur nicht damit gerechnet. Bis heute träume ich von diesem Haus: wie ich die Stufen hinaufsteige und die Eingangstür öffne.
Am Tag unseres Einzugs saß Conor zwischen den Kisten, hämmerte wie ein wahnsinniger Organist auf seinen Laptop ein und verfluchte die Internetverbindung. Ich beschwerte mich nicht. Wir brauchten das Geld. In den darauf folgenden Monaten drehte sich alles um die Arbeit, und in dem kleinen Häuschen hatte unsere Liebe etwas Fieberhaftes und Einsames an sich (werd bloß nicht sentimental, weise ich mich zurecht, die Steckdosen in der Wand wackelten jedes Mal, wenn man einen Stecker hineinsteckte). Wir klammerten uns aneinander. Sechs Monate, neun – ich weiß nicht, wie lange diese Phase anhielt. Hypothekenliebe. Vögeln bei 5,3 Prozent Zinsen. Bis wir eines Tages beschlossen, zwei Autokredite aufzunehmen und von dem Geld stattdessen zu heiraten.
Wrumm wrumm.
Es war das Unsinnigste, was wir – er oder ich – je getan hatten, und stellte sich als überraschend vergnüglich heraus. Die Hochzeit fand nach viel Aufregung und diplomatischen Zwischenfällen an einem herrlichen Apriltag statt: Kirche, Hotel, Blumengesteck, das ganze Drum und Dran.
Aus Youghal reisten ungefähr siebenhundert von Conors Cousins und Cousinen an. So etwas hatte ich noch nicht erlebt: wie sie Runden ausgaben, vor dem Spiegel ihre kleinen Hüte zurechtrückten und das Gewicht des Hotelbestecks prüften, als sie es in die Hand nahmen, um damit zu essen. Sie behandelten den Tag wie eine berufliche Pflichtveranstaltung und tanzten bis um drei Uhr morgens. Conor meinte, ebenso gut hätte es auch ein Begräbnis sein können – die jagen in Rudeln, sagte er. Und meine Mutter, die, wie sich herausstellte, »schon immer für diesen Tag gespart hatte«, führte eine hochzeitserfahrene Truppe Angehöriger der Dubliner Mittelschicht an, viele davon alt, alle vollkommen glücklich, wie sie schwatzend dasaßen und an ihren seltsamen Drinks nippten: Campari, Whiskey mit roter Limo, Harveys Bristol Cream. Wir waren nur ein Vorwand. Das wussten wir, als wir nach oben gingen, unsere Klamotten von uns schleuderten und einander, an die Schlafzimmertür gepresst, nach Strich und Faden durchfickten. Wir waren nebensächlich. Frei.
Meine Mutter ist im Fotoalbum (fünfhundert Euro, in cremefarbenes Leder gebunden, jetzt gammelt es unter der Küchentheke in Clonskeagh vor sich hin). Sie trug ein lila-graues Kostüm und, man glaubt es kaum, einen Fascinator-Haarschmuck in Grau und Mauve, samt Gesichtsnetz und diesen albernen schwarzen Federn, die sich nach außen wölben und mit wippenden schwarzen Tupfern verbunden sind. Sie steht neben mir. Winzig. Ihr Haar eine Art Mysterium; hinten hatte sie es irgendwie aufgesteckt. Der Lieblingsfilm meiner Mutter war Begegnung, sie wusste, wie man unter einem Schleier weint. Und für ihre Frisur gab sie immer Geld aus. Selbst wenn sie pleite war, hatte sie eine Art, die Leute davon zu überzeugen, dass es möglich war, sie zu verschönern, und sie taten ihr Bestes. Bei Friseuren zahlt es sich aus, seine Launen daheim zu lassen, sagte sie immer.
Sie weigerte sich rundheraus, mich zum Altar zu führen, und traf stattdessen eine Vereinbarung mit dem Bruder meines Vaters; einem Mann, den ich, seit ich dreizehn war, nicht mehr gesehen hatte. Ich dachte, wir würden uns wenigstens am Vortag treffen, aber er tauchte erst am Hochzeitsmorgen auf, direkt vom Flughafen, und als alle anderen in der ersten Limousine losfuhren, blieben wir allein im Wohnzimmer zurück und schauten einander an, während der Chauffeur draußen faulenzte.
Dies war der merkwürdigste Augenblick an einem ohnehin merkwürdigen Tag. Ich stand bibbernd am Fenster, in meinem zinnfarbenen Seidenkleid von Alberta Ferretti, seitlich am Kopf war eine verrückte Kreation von Philip Treacy befestigt (man könnte sie sogar einen Fascinator nennen), und jedes Mal, wenn ich aufbrechen wollte, blickte dieser Typ auf seine dicke Uhr und sagte:
»Lass sie warten. Du bist die Braut.«
Schließlich, zu einem mysteriös festgesetzten Zeitpunkt, überquerte er den Wohnzimmerteppich, fasste mich bei den Schultern und sagte: »Weißt du, an wen du mich erinnerst? An meine Mutter. Du hast ihre zauberhaften Augen.«
Dann bot er mir nach alter Schule den Arm und geleitete mich hinaus zur Limousine.
War das der gruseligste Moment? Der langsame Marsch zum Traualtar, am Arm dieses alten Knackers, der seinem Aussehen nach zu schließen seit 1965 keine Gefühle mehr ausgedrückt hatte? Ich weiß es nicht. Außerdem hat die Kirche, die ebenso gut auch einen florierenden Handel mit Kirschblüten hätte treiben können, ein äußerst kurioses Kruzifix aufzuweisen, das hoch über dem Altar hängt. Ein riesiges Ding aus Holz. Die nicht übermäßig blutrünstige Christusgestalt hängt nicht nur auf der Vorderseite des Kreuzes, sondern auch auf der Rückseite – dies für Leute, die hinter dem Altar landen. Und während der gesamten Zeremonie war ich abgelenkt, so wie mich dieser doppelte Jesus, Rücken an Rücken wie sein eigenes Spiegelbild, schon als Kind abgelenkt hatte. Als ich so dastand, in meiner zweihundertzwanzig Euro teuren Unterwäsche, vom Kleid ganz zu schweigen, wollte ich nur sagen: »Was haben die sich dabei nur gedacht?« Das war lediglich eine abgeschwächte Version der Gedanken, die mir in dieser Kirche schon immer durch den Kopf geschossen waren – jene formlosen Obszönitäten, die mich während meiner Schulzeit geplagt und vermutlich mit dem Begräbnis meines Vaters begonnen hatten, als ich dreizehn war. Nun stand ich vollkommen erwachsen an genau der Stelle, wo einst sein Sarg aufgebahrt war (sein Geist wehte kopfüber durch meine Wirbelsäule), und bereute, ein Bustier gewählt zu haben statt eines Taillenformers. Und der Priester fragte:
Willst du?
Und ich antwortete:
Ja.
Und Conor lächelte.
Draußen schien die Sonne, der Fotograf winkte, und die glänzenden schwarzen Karossen auf dem Kirchhof stupsten einander an.
Wir ließen es uns gut gehen. Die siebenhundert Cousins und Cousinen aus Youghal und mein Onkel aus Brüssel. Infolgedessen hatten wir, Conor und ich, ungeheure Mengen an Sex und Flitterwochen in Kroatien (billig nach all dem Geprasse), und eines Morgens wachten wir wieder in Clonskeagh auf: verkatert, übermütig und furchtlos.
Im Jahr darauf, in den beiden Jahren darauf, war ich glücklicher, als ich je gewesen war.
Das weiß ich. Trotz der Verbitterung, die folgen sollte, weiß ich, dass ich glücklich war. Wir schufteten wie wild und feierten, wann immer wir konnten. Meist fielen wir nach einem harten Arbeitstag ins Bett, nachdem wir zuvor noch rasch etwas hinuntergekippt hatten. Chardonnay lag damals schon hinter mir – nennen wir es die Sauvignon-Blanc-Jahre.
Conors Einkünfte schnellten jäh in die Höhe, als er ein Reiseunternehmen an Land zog, das online gehen wollte. Mittlerweile arbeitete er mit anderen Leuten zusammen, man könnte sogar sagen: für andere Leute – aber ich weiß nicht, ob ihn das kümmerte. Das Internet war wie geschaffen für Conor und sein Interesse an allem und jedem, ohne sich auf irgendetwas festlegen zu können. Er verbrachte Stunden – Tage – vor dem Bildschirm, dann sprang er plötzlich vom Stuhl auf, lief in die Stadt, radelte zum Forty Foot, wo er schwamm: im kalten und im warmen Meer, unter heftigem Planschen und Platschen. Bei Conor war alles immer ein bisschen zu viel. Er trug zu viele Kleidungsstücke, und wenn er nackt war, stieß er tiefe Seufzer aus, rieb sich die Brust und furzte gewaltig, während er pinkelnd im Badezimmer stand. Und am Ende ƒhabe ich es ihm irgendwie nicht mehr abgenommen. Am Ende habe ich ihm – und das mag eigenartig klingen – überhaupt nichts mehr abgenommen, hielt alles für gespreiztes Getue, heiße Luft.
Sunny Afternoon
Doch das kam später. Oder vielleicht war es auch schon passiert, vielleicht passierte es die ganze Zeit. Womöglich wären wir für den Rest unseres Lebens auf diesen Parallelspuren von Glauben und Nicht-Glauben nebeneinander hergelaufen. Ich weiß es nicht.
Doch da wir, Conor und ich, uns im Düsentempo bewegten, waren wir glücklich, vernünftig verheiratet, verheiratet, verheiratet. Als ich Seán das nächste Mal sah, hatte ich ihn vollkommen vergessen. Das war 2005. Da wir unsere Hypothek abtragen mussten, saßen wir einen weiteren Sommer zu Hause fest und fuhren an einem Feiertag nach Brittas Bay, um Fiona zu besuchen.
Sie verbrachte vier oder fünf Wochen dort mit den Kindern, während Shay hinzukam, wann immer es ihm möglich war – das heißt, wann immer es ihm passte. Dazu muss man wissen, dass Shay damals in Geld schwamm, sodass die beiden nicht nur ein Haus in Enniskerry, also praktisch auf dem Land, besaßen, sondern noch dazu, nur ein paar Meilen enfernt, dreißig Minuten mit dem Auto, einen Wohnwagen auf einem piekfeinen Stellplatz am Meer. Das waren mal eben – keine Ahnung – ein-, zweihundert Riesen für einen Haufen Schrott auf einem Campingplatz am Strand. Normalerweise würde mich so etwas nicht neidisch machen, nur konnte ich gerade nicht mit zweihundert Riesen um mich werfen, und nichts stachelt den Neid stärker an als Dinge, die man ohnehin nie haben wollte.
Wir standen früh auf und fuhren die N11 entlang, Conor mit seiner Windsurferausrüstung und ich mit ein paar Flaschen Rotwein und einer Menge Steaks, die ich mir für den Grill gegriffen hatte. Als wir ankamen, überreichte ich Fiona das Fleisch: eine pralle weiße Plastiktüte, deren Innenseite mit Blut befleckt war, das sich bräunlich verfärbte.
»Uuh!«, sagte sie.
»Im Geschäft kam’s mir noch wie ’ne gute Idee vor.«
»Es war eine gute Idee«, sagte sie. »Was ist es denn?«
»’n Arsch in ’ner Tüte«, sagte Conor. Und genauso sah es auch aus, was da so baumelte.
»Steaks aus der Lammkeule«, sagte ich.
Megan, meine Nichte, fing an zu lachen. Sie muss fast acht gewesen sein, und ihr kleiner Bruder Jack, der fünf war, rannte brüllend im Kreis herum. Conor lief hinter ihm her, machte einen Buckel und fuchtelte mit den Händen, bis er den kreischenden Jungen eingefangen und zu Boden geworfen hatte, wobei er (in etwa) ausrief: »Harr, harr, ich bin der Arsch, harr, harr.«
Ich glaubte schon, Jack würde sich übergeben und dies wäre unser Ende als fröhliche Feiertagsfamilie, aber Fiona warf den beiden nur einen festen Blick zu. Dann sagte sie: »Ich hoffe, ich habe Platz«, bevor sie die kleine hölzerne Treppe hinaufstapfte und im Wohnwagen verschwand.
Als ich ihr nachging, hockte sie auf den Knien und stopfte das Fleisch wie ein Kissen in das unterste Kühlschrankfach. Neben ihr auf dem Fußboden lag ein Haufen Salat und Gemüse.
»Gott, diese Bude.«
»Ist doch schön«, sagte ich.
»Absteige sur mer.«
»Ach«, sagte ich – weil ich nicht recht wusste, was ich damit anfangen sollte. Ich schaute mich um. Die Plastiktrennwände hatten eine Art integriertes Tapetenmuster, und wenn man herumlief, bebte alles ein wenig. Aber es war auch hübsch. Ein Spielzeughaus.
»Die Frau drei Wohnwagen weiter hat hölzerne Fensterläden. «
»Es soll doch gar nicht zu echt wirken«, sagte ich.
»Hast du ’ne Ahnung«, erwiderte sie.
Wie sich herausstellte, dachte Shay über ein echtes Ferienhaus in der Nähe von Gorey nach, vielleicht würden sie sich auch auf dem Kontinent umsehen, wahrscheinlich in Frankreich. Das erzählte Fiona nach zu viel Sonne und Wein, später, als es mehr Zuhörer gab. Doch am Morgen, als sie wieder auf einem vor Sand schlüpfrigen Fußboden vor dem kleinen Kühlschrank kniete, hatte ich Mitleid mit ihr, meiner ach so hübschen Schwester, die stets von der Frau drei Wohnwagen weiter ausgestochen werden würde.
Im Lauf des Tages besserte sich das Wetter. Die Wolken zogen aufs Meer hinaus, und ihre Schatten bewegten sich finster und scharf umrissen über das Wasser. Besser als jede Glotze. Wir saßen mit unseren großen Sonnenbrillen im Freien und wackelten mit unseren türkis und marineblau lackierten Zehen. Fantastisch. Ich hätte unsere Mutter mitbringen sollen, die hätte es genossen, doch die Idee war mir nicht gekommen. Warum, weiß ich nicht.
Conor stand auf der Grünfläche in der Mitte des Campingplatzes, schleuderte Frisbees für die Kinder und behandelte sie wie Haustiere.
»Such!«, rief er. »Such!«
»Das sind doch keine Hunde, Conor«, sagte ich, als die Kinder die Gesichter ins Gras steckten und versuchten, das Frisbee mit den Zähnen aufzuheben.
»Sitz!«, rief Conor. »Pfötchen!«
Ich war nicht der Kinder wegen besorgt, sondern wegen ihrer Mutter. Aber Fiona warf mir einen ihrer gemessenen Blicke zu und sagte: »Hübscher Trick.«
Es gab hier irgendeinen Verhaltenskodex, und ich habe ihn nie ganz durchschaut.
Ein weiteres Mädchen kam hinzu. Sie und Megan hüpften kurz voreinander herum, dann rannte auch sie hinter dem Frisbee her, vor und zurück, mit zum Scheitern verurteilten Sprüngen.
»Nein, hier. Nein, hier. Nein, wirf ihn zu mir.«
Und sie stolperte über ihre geblümten Flipflops und weinte. Oder jaulte, genauer gesagt. Es war ein interessantes Geräusch, selbst hier im Freien. Wenn sie Luft holte (oder zu ersticken drohte), brach es ab und setzte danach von Neuem ein, noch schriller als zuvor.
Eins muss man Conor lassen, diesmal rannte er nicht zu ihr, um sie zu kitzeln und »Harr, harr, ich bin der Arsch« zu rufen. Dies war ein solides Mädchen, so rund wie groß, von schwer zu schätzendem Alter. Es war nicht auszumachen, ob sich unter ihrer Wickelstrickjacke kleine Brüste oder größere Fettansammlungen befanden – das Pink der Jacke bestand jedoch darauf, dass sie noch ein Kind war.
Eine Frau überquerte die Grasfläche und redete leise auf sie ein, dann wartete sie und sprach erneut. Soweit ich sehen konnte, wurde es dadurch nur noch schlimmer. Megan und Jack schauten zu, in einem Zustand unbehaglichen, verstohlenen Entzückens. Sie liebten Krisen, diese zwei. Was wiederum mir zu denken gab: Wie viel Gebrüll und Aufruhr mochten sie zu Hause erleben?
Fiona hatte sich halb aus ihrem Stuhl erhoben, wirkte aber unsicher. Selbst der Vater des Kindes hielt sich zurück. Auf dem Weg vom Parkplatz war das Mädchen vorausgelaufen. Nun stand er ein Stück abseits und wartete darauf, dass der Anfall verebbte. Ich weiß noch, wie ich dachte, jemand solle sich endlich erwachsen verhalten: sich vorstellen, Getränke anbieten. Also winkte ich. Und er zuckte mit den Achseln und kam herüber, und einen Augenblick lang schien es, als sei der Rest der Welt in ein Zeitlupentempo verfallen, und wir stünden daneben, frei.
Es war Seán. Natürlich. Besser aussehend, als ich ihn in Erinnerung hatte, gebräunt und mit längerem, gelocktem Haar. Von vorn betrachtet sogar ein bisschen frech, ein bisschen zu ironisch. Als würde er mich kennen, was, wie ich ihm unbedingt sagen wollte, nicht der Fall war. Jedenfalls noch nicht. Wir waren also schon beim »Und, was ist?« angelangt, noch bevor sein Hosenboden die gestreifte Baumwollbespannung des Klappstuhls berührte.
Wenn ich mir all das in Erinnerung rufe – die Unmittelbarkeit des Ganzen, das kopulatorische Knistern in der Luft –, verblüfft es mich, dass fast ein weiteres Jahr verging, ehe wir zur dreisten Tat schritten, ehe wir die Häuser um uns her zum Einsturz brachten: das Reihenhaus, das Ferienhaus, die Doppelhaushälfte. So viele Hypotheken. Auch den Himmel zerrten wir herab, bis er uns wie ein Tuch bedeckte.
Blackout.
Vielleicht machte er es ja bei allen Frauen so.
Ich muss ein Stück zurückrudern und sagen, dass es auch andere Dinge gab, die in unserem Leben hätten vorfallen können. Wir hätten es auch heimlich tun können. Ich meine, niemand brauchte es zu wissen.
Doch dort im Tageslicht des Campingplatzes jaulte Evie noch immer, Aileen murmelte in bestimmtem, gleichmäßigem Ton etwas daher, während Fiona sich wie ein Blödel zu Seán umwandte und ihn fragte: »Meinst du, sie möchte vielleicht ein Eis?«
Seán zuckte zusammen. Unsere Kinder, deren selektives Gehör es mit dem von Fledermäusen aufnehmen konnte, kamen über den Rasen gelaufen, und Evie humpelte halbherzig-hoffnungsvoll hinter ihnen her.
»Ich fürchte, Evie isst kein Eis«, sagte Seán. »Nicht wahr, Evie?« Die Flipflops gegen die Brust gepresst, blieb sie stehen und sagte nach einer langen, fürchterlichen Pause: »Nein.«
Bei dem Gerangel, das folgte, saß er da und hielt sie im Arm. Es endete damit, dass Megan und Jack auf die andere Seite des Wohnwagens verbannt wurden, um das ihnen halb versprochene Eis dort, außer Sichtweite, zu verspeisen. Er ist nicht besonders groß, Seán. Er wiegte es, dieses umfängliche Kind, durch fernes und eingebildetes Geschlürfe und Gesauge hindurch – mir war inzwischen selbst nach einem verdammten Eis zumute –, während Fiona sich mit Aileen über Tagesmütter und Krippenpreise unterhielt und ich dachte: Wäre es nicht besser, dem Kind einfach eine zu scheuern? Wäre das nicht schneller und menschlicher?
Ich übertreibe. Natürlich.
Evie war ein relativ normales achtjähriges Mädchen, Aileen kein Ungeheuer der Besonnenheit, Seán ein Geschäftsmann mit einer zu scharfen Bügelfalte in seiner Sommerhose. Es war ein netter, langweiliger Tag. Nach dem Mittagessen zog Conor sich den Hut übers Gesicht und schob das T-Shirt hoch, um seinen braunen, behaarten Bauch in der Sonne zu wärmen. Ich faltete, wie früher in der Schule, einen Bogen Papier, sodass er sich nach Art eines Vogelschnabels mit Zeigefinger und Daumen öffnen und schließen ließ, erst vor, dann seitlich nach außen, und Megan und ich spielten Himmel und Hölle, Stell dir vor, Du stinkst, Pillepalle und, verborgen unter der letzten Lasche, Wahre Liebe. Nach langwierigen Verhandlungen durften sich Evie und Jack im Wohnwagen eine DVD anschauen. Etwas anderes schien ihnen nicht einzufallen.
Im Verlauf des Nachmittags tauchte mein Schwager Shay auf. Er blieb auf dem Rasen stehen, hielt sein Handy in die Höhe und schaltete es mit einer übertriebenen Geste aus. Dann kam er aufs Deck, küsste Fiona und warf ein Hallo in die Runde. Schließlich betrat er den Wohnwagen, stellte den Fernseher ab und ordnete, indem er nach Schwimmsachen, Badetüchern und aufblasbarem Spielzeug rief, einen Strandausflug für alle an. Unterdessen suchte Fiona – mehr oder weniger erfolgreich – fehlende Sandalen und Türschlüssel und hundert andere mysteriöse Objekte zusammen, die ihre Kinder benötigten: Wasser, Sonnencreme, einen grünen Visor für Golfer, an dem Megan hing, Jacks gelbe Plastikharke; Kinder tun einfach alles, um an dem Ort zu bleiben, an dem sie sich gerade wohlfühlen – selbst wenn sie ihre Mutter damit zur Verzweiflung treiben.
»Hast du schon mal von einer Irène Ahn Stahlt gehört?«, fragte ich Megan, die mich mit weisen Äffchenaugen betrachtete. Unterdessen las Seáns Frau Aileen Zeitung, bis endlich alle fertig waren, dann ging sie zu ihrem Auto und holte eine einzige Tasche aus dem Kofferrraum.
»Fein!«, sagte sie. »Auf geht’s!«
Conor lachte die ganze Heimfahrt über.
»Das Eis!«, sagte er. »Dieses verdammte Eis!«
Und ich intonierte: »Evie isst kein Eis, nicht wahr, Evie?«
»Herr im Himmel.«
»Anscheinend hat sie irgendwas. Das Mädchen«, sagte ich; denn das hatte mir Fiona beim Abwasch zugemurmelt.
»Was?«
»Du weißt schon, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Fiona hat nicht gesagt, was.«
Kein Zweifel, Evie war ein seltsames, gestörtes kleines Ding. Sie schien nicht dassselbe Alter oder denselben Entwicklungsstand wie Megan zu haben, obwohl sie beide um die acht waren – aber vielleicht war ich auch nur voreingenommen, weil meine Nichte solch ein kleiner Kobold war. Wäre ich mit diesen Dingen besser vertraut gewesen, hätte ich sie vielleicht auf einer Skala eingeordnet oder es wenigstens versucht. Andererseits hatte Evie ihre fünf Sinne beisammen, war hellwach, bebte geradezu vor Wachheit – nur tat sie sich mit allem so schwer. Ob daran, wie ich vermutete, ihre Mutter schuld war, könnte ich nicht mit Gewissheit sagen. Aber ich fand sie doch ziemlich unerträglich. Kann sein, dass es mit dem Fett zu tun hatte, mit diesen molligen, zum Küssen einladenden Babyhandgelenken, zu denen das Gesicht darüber und die Augen nicht passen wollten. Natürlich habe ich das nicht zu Conor gesagt. Ich meine, möglicherweise habe ich gesagt: »Ein ganz schönes Bündel«, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht gesagt habe, ihr Fett sei mir unangenehm; meine »Unfähigkeit zu lieben«, wie Megans Lehrerin dieser Tage eine Sünde definiert, gestand ich nicht ein. Im Übrigen blieb von dem leichten Verdruss, den Evies Anblick in mir auslöste, am Ende nur ein kleiner Rest zurück, etwas Gelassenes und zugleich Gespanntes.
Mitleid.
»Das arme Kind«, sagte ich. »Das liegt alles nur an ihr, weißt du«, womit ich die Mutter meinte. Und Conor sagte: »Man sollte sie beide erschießen.«
Damals schien er sie beide recht gern zu mögen. Auf unserem Treck zur kalten Irischen See hatte er mit Seán geplaudert, während Fiona ihren Kindern nachjagte, um ihnen Badesachen und Sonnencreme aufzuschwatzen, und Shay hatte eine Flasche Rotwein geöffnet, sich auf die Decke gesetzt und ganz und gar abgeschaltet – mit furchterregender Geschwindigkeit, wie ein Stromausfall in Manhattan.
»Ich finde, er sah schrecklich aus«, sagte ich im Auto zu Conor.
»Wer?«
»Mein Schwager«, antwortete ich. »Ich finde, er sah richtig scheiße aus.«
»Shay ist in Ordnung«, sagte er. »Mach dir mal um Shay keine Sorgen.«
Conor war dieser Tage etwas begriffsstutzig. Zum Beispiel fand er die ganze Verhütungsgeschichte in letzter Zeit »nicht ganz zweckdienlich«. Was für einen Zweck er meinte, ließ er offen.
Soweit ich mich erinnere, redeten wir nicht über Seán. Vielleicht war es nicht nötig. Gut möglich, dass wir den Rest der Heimfahrt in einträchtigem Schweigen verbrachten.
In seiner Badehose machte Seán – mein Ruin, mein Schicksal – keine besonders eindrucksvolle Figur. Vermutlich galt das für uns alle. Im nackten Sonnenlicht sahen wir wie gehäutet aus. Fiona, seinerzeit das schönste Mädchen in Terenure, gab sich natürlich nicht die geringste Blöße. Sie hatte eine Art, mit Sarong und Badetuch umzugehen, die eher nach Cannes passte als nach Brittas Bay, und als wir mit dem Gedanken spielten, schwimmen zu gehen, sagte sie: »Ach, ich war heute Morgen schon drin.« Denn ganz gleich, wie viel Mühe sie das alles kostete (und zwar beträchtliche, wie ich vermute) – anmerken ließ sie es sich nie.
Also waren es nur wir vier, Conor und ich, Seán und Aileen, die am Strand mit BH-Trägern und Badetüchern Houdini spielten und anschließend so taten, als beachteten wir die Körper der anderen gar nicht. Um ehrlich zu sein, gab ich mich an jenem Tag mit Seán kaum ab. Ich war zu sehr damit beschäftigt, seine Frau unter die Lupe zu nehmen; so einfallslos sie sich kleidete, so elegant und knabenhaft wirkte sie splitternackt, sie mochte noch so alt sein. Aber ihre seltsamen kleinen Brüste riefen einem »Brüste« entgegen – auf ihren kleinen knochigen Rippen sahen sie so zart aus, als wären sie eigens dort angepflanzt worden.
Seán wandte mir sein Gesicht frontal zu, wie um zu fragen, ob ich etwa ein Problem mit dem Körper seiner Frau hätte. Aber ich hatte kein Problem damit, wie sollte ich? Ich hatte genügend eigene Probleme. Zunächst einmal musste ich dafür sorgen, dass Conor vor mir stehen blieb, bis die anderen beiden in sicherer Entfernung im Wasser waren und in die andere Richtung blickten.
»Was ist?«, fragte Conor. »Was willst du denn?«
Und ich klammerte mich an ihn, faselte Unsinn und hampelte mit dem Badetuch herum.
Seán schlang die Arme um sich und rannte mit hochgezogenen Schultern und federnden Fußspitzen der Brandung entgegen. Aileen bedachte das Meer mit einem kühlen Blick, zupfte ihren Badeanzug am Po zurecht und ging langsam ins Wasser. Da warf sich Evie im letzten Moment in den Sand, packte das Bein ihrer Mutter und umschlang unter schrecklichem Flehen ihren Schenkel.
»Evie, bitte lass das.«
Währenddessen sah meine Schwester sich mit unbestimmten Blicken um und sagte laut: »Megan, was hast du mit Evie angestellt?«
Und schweigend entfernte ich mich von ihnen und lief weiter, bis das Wasser meine Oberschenkel bedeckte.
Dann schrie ich auf.