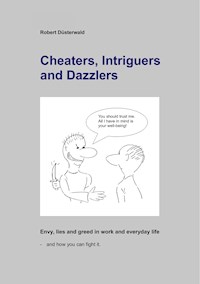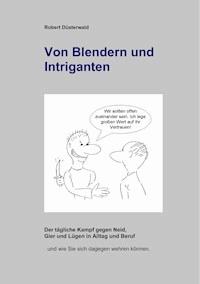Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie oft vertrauen wir den uns scheinbar Wohlgesonnenen, und wie oft werden wir gerade von ihnen enttäuscht. Nicht selten sind es Menschen aus unserer nächsten Umgebung, aus Firma, Familie und Bekanntenkreis, die uns heimlich ausnutzen, hintergehen und schaden. Nach außen hin sind sie meist freundlich, doch in Wirklichkeit verhalten sie sich egoistisch und hinterhältig. In diesem Buch erfahren Sie, was ihre Beweggründe sind und mit welchen Tricks sie arbeiten. Mit einem Fragebogen zur Erkennung falscher Freunde und mit einem Test zu Ihrer Selbsteinschätzung können Sie feststellen, ob Sie es mit unredlichen Machenschaften zu tun haben und ob Sie ein bevorzugtes Opfer sind. Im Anschluss daran lernen Sie detaillierte Beispiele dafür kennen, wie Sie sich angemessen gegen unredliche Verhaltensmuster zur Wehr setzen und mit den hartnäckigsten Fällen umgehen können. In einem weiteren Kapitel wird das Verhalten dieser Scheinheiligen in Beruf und Betrieb beschrieben und was eine Organisation tun muss, um sich davor zu schützen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Robert Düsterwald, geboren in Bonn, ist selbstständiger Unternehmensberater. Nach seinem Studium war er zunächst mehrere Jahre lang als Berater, Projektleiter und Führungskraft in Unternehmen verschiedener Branchen beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehörten u. a. die Analyse von Geschäftsprozessen und Internen Kontrollsystemen. Als Auditor kam er auch mit den Themen Ordnungsmäßigkeit, Regelkonformität und Ethik in Berührung.
Inhaltsverzeichnis
1 VORWORT
2 ETHISCHES VERHALTEN IN DER GESELLSCHAFT
2.1 S
CHEINHEILIGE UND IHR
B
LENDWERK
–
WAS IST DAS
?
2.2 E
THIK
, M
ORAL UND
G
ESELLSCHAFTSORDNUNG
3 DIE CHARAKTERISTIKA VON SCHEINHEILIGEN
3.1 D
IE
P
SYCHOLOGIE VON
S
CHEINHEILIGEN
3.2 W
ELCHE
S
CHÄDEN
S
CHEINHEILIGE ANRICHTEN KÖNNEN
3.3 W
ARUM IST JEMAND EIN
S
CHEINHEILIGER
?
4 WORAN ERKENNT MAN SCHEINHEILIGE?
4.1 W
IE WIR UNSERE
M
EINUNG ÜBER ANDERE BILDEN
4.2 D
ER
S
CHEINHEILIGEN
-T
EST
4.3 D
IE
C
HECKLISTE ZUM
S
CHEINHEILIGEN
-T
EST
4.4 A
USWERTUNG DER
C
HECKLISTE
4.5 W
AS IST
,
WENN MAN EINEN
S
CHEINHEILIGEN ERKANNT HAT
?
5 WIE WEHRT MAN SICH GEGEN SCHEINHEILIGE?
5.1 V
ORAUSSETZUNGEN
,
UM SICH ZU WEHREN
5.2 S
ECHS
G
RUNDSÄTZE ZUM
C
HARAKTER VON
S
CHEINHEILIGEN
5.3 D
ER
S
ELBSTTEST
: A
NFÄLLIGKEIT FÜR
B
ÖSWILLIGE
5.4 E
RLÄUTERUNG DER
K
RITERIEN
5.5 N
UTZUNG DER
C
HECKLISTE ZUM
S
ELBSTTEST
5.6 D
IE
C
HECKLISTE ZUM
S
ELBSTTEST
5.7 A
USWERTUNG DER
C
HECKLISTE
5.8 I
NTERPRETATION DER
E
RGEBNISSE
5.9 Z
EHN
R
EGELN ZUR
V
ERTEIDIGUNG GEGEN
B
LENDWERKEN
5.10 U
ND WIE KRIEGE ICH MICH SELBST GEÄNDERT
?
5.11 W
ENN NICHTS ANDERES HILFT
: D
IE
T
RENNUNG
5.12 D
IE
T
RENNUNG VON
I
HNEN NICHT
N
AHESTEHENDEN
5.13 D
IE
T
RENNUNG VON
I
HNEN
N
AHESTEHENDEN
5.14 F
AZIT
6 DETAILS ZUR CHECKLISTE „SCHEINHEILIGEN-TEST“
6.1 E
RLÄUTERUNG DES
K
APITELS
6.2 D
IE
V
ERHALTENSMUSTER IM
E
INZELNEN
7 BLENDWERKEN IN ORGANISATIONEN
7.1 W
ENN DER
C
HEF EIN
S
CHEINHEILIGER IST
7.2 W
ENN DER
K
OLLEGE EIN
S
CHEINHEILIGER IST
7.3 W
ENN
I
HR
/
E
M
ITARBEITER
/
IN EIN
S
CHEINHEILIGER IST
7.4 S
CHEINHEILIGE IN
F
ÜHRUNGSPOSITIONEN
7.5 T
RANSPARENZ IN DER
M
ANAGEMENTLEISTUNG
7.6 W
IE ERKENNE ICH EINE
(
UN
)
ETHISCHE
O
RGANISATION
?
7.7 D
ER
31-F
RAGEN
-C
HECK ZUR
E
THIK EINER
O
RGANISATION
7.8 W
AS BRAUCHT EINE ETHISCHE
O
RGANISATION
?
7.9 G
RUNDSÄTZE DER ETHISCHEN
O
RGANISATION
7.10 P
RÄVENTION DURCH EIN
I
NTERNES
K
ONTROLLSYSTEM
(IKS)
7.11 V
ERANTWORTUNG DES
M
ANAGEMENTS FÜR DAS
IKS
7.12 A
NFORDERUNGEN AN EIN GUTES
IKS
8 DIE ENTWICKLUNG IN DER GESELLSCHAFT
8.1 T
RENDS
,
DIE DIE
E
NTWICKLUNG BEEINFLUSSEN
8.2 F
AZIT
Hinweis: In diesem Buch wird aus Vereinfachungsgründen häufig das generische Maskulinum gebraucht. Hiermit sind jedoch alle Geschlechter gemeint.
1 Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesem Buch geht es um Menschenkenntnis, genauer gesagt, um das Verständnis bestimmter menschlicher Unzulänglichkeiten.
Es geht um das Verhalten von Mitmenschen, die sich hinter dem Rücken anderer ungerechtfertigte Vorteile erschleichen, sie aus egoistischen Motiven hintergehen und ausnutzen. Menschen, denen ihr eigenes Wohlergehen weit wichtiger zu sein scheint als das anderer.
Um ihre Ziele zu erreichen, tarnen sie sich; sie nutzen vielfältige Mittel der Manipulation, greifen zu Halb- und Unwahrheiten, halten Versprechungen nicht ein und intrigieren gegen uns und andere.
Oft werden ihre Machenschaften lange Zeit nicht durchschaut. Ihre Motive bleiben uns verborgen, aber ihr Tun kann gravierende Folgewirkungen für uns haben. Wir werden ausgenutzt, finanziell geschädigt, beruflich benachteiligt, schikaniert, hinter unserem Rücken schlechtgemacht.
Zum Teil ist das alles menschlich; aber wenn es ein gewisses Maß übersteigt, dann kann es für uns durchaus brenzlig werden.
Mit etwas Glück haben wir es nur mit einem unangenehmen Menschen zu tun, der überheblich auftritt, sich herablassend gibt und uns immer wieder kleine Lügen auftischt. Der daraus entstehende Ärger hält sich in Grenzen. Doch wenn wir Pech haben, kann ein solcher Mensch anderen das Leben ausgesprochen schwermachen. Er kann ihnen Schäden zufügen, die sie bis in den gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Ruin treiben können. Manche Opfer dieses Tuns vertrauen dem Täter sogar dann noch, wenn sie eigentlich erkennen müssten, dass er der eigentliche Grund für ihre Misere ist.
Wir müssen jedoch jederzeit damit rechnen, einem Menschen zu begegnen, der es nicht gut mit uns meint. An den unterschiedlichsten Orten treffen wir ihn an: An der Werkbank wie im Büro, im Kollegenkreis wie in der Chefetage, in unserer Familie, im Sportverein oder im Freundeskreis.
"Scheinheilige" habe ich diesen Menschentyp getauft, weil er bewusst den Anschein des Redlichen und Anständigen nutzt, um sich im Schutz dieser Fassade ungestört seinen eigenen, unrechtmäßigen Vorteil zu sichern.
Doch woran erkennen wir diesen Menschentypus eigentlich? Den meisten Menschen steht nicht auf der Stirn geschrieben, was sie wirklich denken, und wie sie wirklich zu uns stehen. Über eine gewisse Beobachtungszeit hinweg lassen sich allerdings bestimmte Verhaltensmuster erkennen, die darauf schließen lassen, wes Geistes Kind sie sind.
Dies setzt jedoch voraus, dass man auch auf kleine, scheinbar unwichtige Anzeichen achtet, die diesbezüglich wertvolle Hinweise geben können. Lässt man dann alles einmal gedanklich Revue passieren, dann ergibt sich aus einem Puzzle vieler Einzelteile ein Gesamtbild.
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen, meinen Leserinnen und Lesern, eine persönliche Hilfestellung zur Erkennung unredlicher Verhaltensweisen an die Hand geben, und ich hoffe, dass Sie mit den Tipps, wie Sie sich dagegen verteidigen können, etwas anfangen können.
Ich habe dazu u.a. einen kleinen Test entwickelt, mit dessen Hilfe Sie eine Ihnen bekannte Person auf Merkmale unredlichen Verhaltens („Scheinheiligkeit“) hin beurteilen können.
Anhand von weiteren Checklisten erfahren Sie, wie anfällig jemand für Attacken von Scheinheiligen ist, und wie sie sich in Organisationen verhalten. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie sich gegen die unredlichen Machenschaften zur Wehr setzen können.
Das vorliegende Buch ist jedoch kein wissenschaftliches Werk. Der Menschentyp, der hier beschrieben wird, existiert in dieser Reinform nicht (vgl. Kapitel 3). Auch wenn im Buch immer wieder vereinfachend von dem "Scheinheiligen" gesprochen wird, so geht es hier im Grunde nicht um einen Menschentyp, sondern um ein Modell, mit dem man unerwünschte Verhaltensmuster erkennen kann, um sich besser dagegen zu wehren.
Zu diesem Zweck beinhaltet das Buch ausschließlich eine Zusammenstellung zahlreicher persönlicher Erfahrungen und Einschätzungen, die andere und ich im Lauf mehrerer Jahre gesammelt haben. Doch ich bin überzeugt davon, dass genau das den eigentlichen Mehrwert bietet.
2 Ethisches Verhalten in der Gesellschaft
2.1 Scheinheilige und ihr Blendwerk – was ist das?
Es war nicht ganz so einfach, einen Sammelbegriff für den Menschentyp zu finden, den ich in diesem Buch beschreiben möchte.
„Betrüger“ ist ein rechtlicher Begriff – aber hier geht es vorwiegend um die, sich gerade noch im Rahmen der Legalität bewegen, obwohl sie eigentlich betrügen. Das Wort „Trickser“ greift mir zu kurz, obwohl es gerade oft wie Taschenspielertricks wirkt, wie sie andere hereinlegen.
„Blender“ habe ich sie in den früheren Ausgaben dieses Buchs genannt, aber sie blenden nicht nur kurz auf, sie schaffen regelrechte Blendwerke.
Nach einiger Überlegung habe ich mich dafür entschieden, sie mit dem Begriff „Scheinheilige“ zu bezeichnen. „Scheinheilige“ scheint mir am passendsten, denn sie geben sich den Anschein der Redlichkeit, um ihre eigentlichen Motive zu verbergen. Gern stellen sie sich auch als Held und Retter dar.
Doch wie soll man ihr Verhalten bezeichnen? „Scheinheiligen“ ist kein Verb. Da kam mir wieder der Begriff des „Blendwerks“ in den Sinn.
Denn Scheinheilige errichten manchmal ein ganzes Blendwerk aus Unwahrheiten, Täuschungen und Fallen um sich herum. Dieses böswillige Tun kann man getrost mit dem Begriff „blendwerken“ bezeichnen. Für das Verhalten des Scheinheiligen werde ich also von nun an das Wort „blendwerken“ verwenden.
Wie ist ein Scheinheiliger definiert? Ich denke, er lässt sich am besten wie folgt beschreiben:
Ein Scheinheiliger (im Buch auch „Blendwerker“ oder „Böswilliger“) ist ein uns privat oder beruflich nahestehender Mensch, der seine Interessen grundsätzlich über die anderer stellt und ihnen dadurch bewusst regelmäßig materielle oder immaterielle Nachteile zufügt.
Nach außen hin stellt er sich aber meistens als anderen wohlgesonnen dar.
Nahestehend bedeutet im privaten Umfeld, dass es sich um jemand aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis oder aus unserer Familie handelt. Nahestehend bedeutet im beruflichen Umfeld, dass es sich um einen Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzten, Kunden, Lieferanten oder einen anderen Menschen mit einem beruflichen Bezug zu uns handelt.
In beiden Fällen steht man sich relativ nah oder man hat zumindest häufigen Kontakt zueinander. Das bedeutet, hier liegt eine Situation vor, in der man sich eigentlich gegenseitig vertrauen können müsste, um besonders gut miteinander auszukommen. Der Umgang miteinander sollte respektvoll und fair sein.
Scheinheilige sind jedoch falsche Freunde, denn sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vertrauenssituation einseitig zu ihren Gunsten ausnutzen. Wir vertrauen ihnen, während sie uns misstrauen und ihre wahren Absichten verschleiern, um ihre eigenen Ziele rücksichtlos zu verfolgen.
2.2 Ethik, Moral und Gesellschaftsordnung
Das Tun der Scheinheiligen, das ich hier „blendwerken“ nenne, bezeichnet also ein Verhalten, das mit einem redlichen und ehrbaren Auftritt im Umgang mit anderen, mit Aufrichtigkeit und Verantwortung, mit Fairness oder Zuverlässigkeit nicht vereinbar ist.
Wir bewegen uns damit im ethisch-moralischen Bereich. Daher lohnt es sich, zu Beginn dieses Buches einen Blick darauf zu werfen, was diese Begriffe bedeuten, und warum Ethik in den meisten Zivilisationen einen hohen Stellenwert hat. Wenn ich Ihnen in einem späteren Kapitel dann den Begriff des Blendwerkens erläutere, werden Sie stets den Widerspruch zur Ethik erkennen.
Leider werden die beiden Begriffe, Ethik und Moral, in der Literatur nicht einheitlich und auch ein wenig abstrakt beschrieben. Ich erlaube mir deshalb einen eigenen Vorschlag zur Definition der beiden Begriffe:
Ethik – synonym: Ethos1
Ethik ist das Wertesystem einer Gruppe oder Gesellschaft, das deren Angehörigen insgesamt als anzustrebendes, wünschenswertes Ideal gilt. Das tatsächliche gezeigte Verhalten weicht in der Regel davon ab. Ethik ist insofern der Maßstab zur Beurteilung des Handelns Einzelner.
Wir unterscheiden menschliches Verhalten anhand dieses Maßstabs, indem wir es mit den Kategorien „gut“ (dem Ethos entsprechend) oder „böse“ (dem Ethos widersprechend) bewerten.
Moral
Moral spiegelt die in Bezug auf das Wertesystem gezeigten tatsächlichen Verhaltensweisen, aber auch die von den meisten Mitgliedern einer Gruppe oder Gesellschaft im Alltag akzeptierten Normen wider.
Moral bezeichnet also die im Alltag beobachtbaren Normen und Verhaltensweisen. Sie entsprechen nicht immer dem ethischen Ideal, sondern der allgemein üblichen Sitte. Eine Verhaltensweise, die dem ethischen Soll entspricht oder nahekommt, wird als ethisch oder als von hoher Moral zeugend bezeichnet. Eine Verhaltensweise, die unter der üblichen Moral liegt oder weit von ethischen Werten entfernt ist, wird als unethisch oder unmoralisch bezeichnet.
Es geht bei beiden Begriffen um die „Sinnesart“, um die Art, wie menschliches Handeln begründet und bewertet wird. Mit Ethik verfolgt eine Zivilisation das Ziel, eine einheitliche, für alle ihre Mitglieder verbindliche Grundlage des mehrheitlich als „gut“ angesehenen Handelns zu schaffen. Diese Grundlage soll dann dem Einzelnen zur Orientierung für sein eigenes Verhalten dienen. Die Gesellschaft wiederum hat damit einen Maßstab zur sittlichen Beurteilung des Handelns Einzelner und kann bei Abweichungen belohnend oder sanktionierend darauf reagieren.
Wie der Einzelne dieser ethischen Orientierung am besten nachkommen kann, das beschreibt meines Erachtens sehr anschaulich der „kategorische Imperativ“ von Immanuel Kant:
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“2
Ähnlich lautet ein altes Sprichwort:
„Was Du nicht willst, dass man Dir tu, das füg’ auch keinem anderen zu.“
Nun interessiert uns, warum solche Wert- und Moralvorstellungen als Regeln für das Verhalten aller Angehörigen einer Gruppe überhaupt aufgestellt werden. Es wäre doch zumindest einfacher, wenn jeder nur seinen eigenen Vorteil im Auge hätte, oder nicht? Stehlen z.B. geht schneller als kaufen und ist zudem eindeutig kostengünstiger, und betrügen ist meistens günstiger für den Betrüger als ehrlich zu verhandeln.
Der gesellschaftliche Konsens
Moral und Ethik sind aber keine individuellen, sondern gesellschaftliche Begriffe. Denn was falsch oder richtig ist, was vorteilhaft oder unredlich, das bestimmt eben nicht der Einzelne, sondern die Gesellschaft, also alle, die einer bestimmten Gruppe angehören. Die Gesellschaft gibt sich ein Wertesystem, an dem die einzelnen Mitglieder ihr Handeln orientieren sollen.
Warum tut die Gesellschaft das? Nun, weil es hierfür aus Sicht der Gruppe mehrere gute Gründe gibt. Dem individuellen schnellen Nutzen aus der Missachtung des Wertesystems Einzelner steht ein kollektiver Nachteil gegenüber: Mangelnder Schutz des Einzelnen vor ungerechtfertigter
Bereicherung durch Dritte mindert den Anreiz, selbst Vermögenswerte zu schaffen und ist somit volkswirtschaftlich schädlich.
Überdies ist Vertrauen die Grundlage einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Die ständige Möglichkeit, hintergangen zu werden, bewirkt jedoch eine große Unsicherheit, die den Mut und die Tatkraft aller Beteiligten beeinträchtigt.
Nehmen wir ein Beispiel: Der Händler, der im Mittelalter dem Bauern die Ware abkauft, um sie am Markt gewinnbringend wieder zu verkaufen, wird irgendwann von Räubern überfallen, die ihm seine Ware als Beute abnehmen. Wenn dies wieder und wieder vorkommt, wird er irgendwann keine Ware mehr am Markt verkaufen. Der Bauer bleibt auf seiner Ware sitzen oder verbraucht sie selbst.
Nehmen wir nun an, dass irgendwann alle Händler ausgeraubt werden, dann wird vielleicht der Bauer überleben, aber der Rest der früher von seiner Ware belieferten Bevölkerung muss verhungern, weil die Ware nicht an die Frau/den Mann kommt oder verdirbt. Der Bauer wiederum wird nur noch für den Eigenbedarf produzieren, und auch die Räuber verhungern, weil kein Überschuss mehr vorhanden ist, der geraubt werden könnte.
Für die Räuber ist ihr Raub vielleicht kurzfristig lohnender und bequemer als ehrliche Arbeit, aber nur solange, bis der Bauer keine überschüssige
Ware mehr produziert.
Zudem gehen die Räuber das Risiko ein, vom zuständigen Ordnungshüter gefasst und gehängt zu werden – auch dies könnte ein vorzeitiges Ende für das gewählte „Geschäftsmodell“ der Räuber bedeuten.
Die Gesellschaft als Ganzes ist also daran interessiert, dass der Wert schöpfende Teil der Bevölkerung vor unredlichen Angriffen durch andere geschützt wird. Dies ist die Grundlage aller Zivilisationen: Sie geben sich gewisse, auch ungeschriebene Regeln, die für den Redlichen und die gesamte Gesellschaft auf Dauer von Vorteil sind, weil Leistung sich lohnt und die Möglichkeit, anderen in der Zusammenarbeit vertrauen zu können, auch langfristige Planungssicherheit schafft.
Gesellschaftliche Anerkennung findet in der Regel auch nur derjenige, dessen Verhalten sich am Ethos der Gruppe orientiert.
Gleichwohl gibt es Zeitgenossen, die zwar die Anerkennung wollen, den dazu nötigen Aufwand aber scheuen. Da sie wissen, dass dies gesellschaftlich „geächtet“ würde, tarnen sie ihre unlauteren Verhaltensweisen. Wenn ein solcher Scheinheiliger geschickt genug darin ist, den Eindruck zu erwecken, redlich zu sein, dann träfen ihn ja bei einem Regelverstoß die dafür von der Gesellschaft vorgesehenen Strafen nicht. Doch so könnte er kurzfristig einen Vorteil auf Kosten anderer erzielen, ohne dass er hart dafür arbeiten müsste oder bestraft würde.
Solange also nicht jeder rational davon überzeugt ist, dass faires, redliches Handeln auch für ihn besser ist als unredliches, wird es Menschen geben, die durch Verschleiern ihrer Absichten ungerechtfertigte Vorteile für sich zu erzielen versuchen.
Dabei werden sie stets die möglichen Vorteile gegen die Nachteile abwägen, die ein „Erwischtwerden“, z.B. in Form von rechtlichen Konsequenzen, nach sich ziehen könnte. Je geschickter sie andere täuschen können, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie bei ihren Machenschaften entdeckt werden, und desto weniger müssen sie die daraus entstehenden nachteiligen Konsequenzen fürchten.
Um das ethische Ziel zu erreichen, bleibt der Gesellschaft nichts anderes übrig, als das Fehlverhalten Einzelner zu sanktionieren – aber vorab muss sie dazu erst einmal ihr Ethos definieren.
Ein Beispiel für Ethos: Die 10 Gebote
Vielleicht sind sie ja noch nicht ganz in Vergessenheit geraten – die Zehn Gebote. Ich jedenfalls kenne sie noch aus dem Schulunterricht und der Vorbereitung zur Kommunion sowie aus früheren sonntäglichen Gottesdienstbesuchen.
Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig!
Ehre deinen Vater und deine Mutter.
Du sollst nicht morden.
Du sollst nicht die Ehe brechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.
Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen.
Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.
Offenbar wurden schon vor mehreren tausend Jahren diese Regeln als unabdingbar erachtet, und es war offenbar nötig, sie zu kodifizieren – also scheint der Bruch dieser Regeln nicht nur heute öfter auf der Tagesordnung gewesen zu sein.
Wenn ethisches Verhalten eine Grundlage für die Sicherheit der gesamten Gesellschaft sein soll, dann muss die Gesellschaft auch darauf vertrauen können. Die Gesellschaft stellt dies meist durch eine Staatsverfassung, durch eine Justizordnung, manchmal mit Hilfe einer Religion und in der Familie über die Erziehung ihrer Kinder sicher. Damit die Regeln nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, wurden gerade in der Antike Regelverstöße mit schweren Strafen geahndet – die Todesstrafe wurde bereits bei aus heutiger Sicht sehr geringfügigen Vergehen verhängt, vielleicht auch, weil die Möglichkeiten der Aufklärung von Straftaten damals wesentlich begrenzter waren als heute, so dass nur eine grausame Bestrafung zu einer Abschreckung beitragen konnte.
Und nochmal Kant:
„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“3
1Wikipedia versteht z.B. unter Ethik Folgendes:
„Die Ethik ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst. Ihr Gegenstand ist damit die Moral insbesondere hinsichtlich ihrer Begründbarkeit und Reflexion. Cicero übersetzte als erster êthikê téchnē (die ethische Kunst) in den seinerzeit neuen Begriff philosophia moralis (Philosophie der Sitten).“
Aus Seite „Ethik“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Juli 2024, 04:55 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title= Ethik&oldid= 246383181 (Abgerufen: 22. August 2024, 09:39 UTC)
2 Der kategorische Imperativ, Immanuel Kant, 1724 – 1804.
3 Aus Immanuel Kants „Kritik der praktischen Vernunft“.
3 Die Charakteristika von Scheinheiligen
Kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Welches Verhalten ist für Scheinheilige typisch? Was kennzeichnet sie?
Ein sehr schönes Beispiel findet sich in einem Spiegel-Interview4. Dort wurde dem geschäftsführenden Vorsitzenden eines internationalen Modeunternehmens mit umstrittenem Ruf die Frage gestellt, warum die von ihm geleitete Firma wie kaum ein anders Unternehmen in seiner Branche polarisiere. Die Antwort begann mit dem Satz: „Das möchten wir auch gern wissen“. Ich denke, schöner kann man Scheinheiligkeit kaum darstellen!
Wenn wir von Scheinheiligkeit sprechen, dann muss ich darauf hinweisen, dass wir hier immer nur über das nach außen sichtbare Verhaltensmuster reden. Der tatsächliche Charakter der Menschen dahinter bleibt für uns unsichtbar. Über ihn können wir nur Vermutungen anstellen, obwohl das Verhalten sicherlich eng mit dem Charakter korreliert ist.
Wenn ich also in diesem Buch von „Scheinheiligen“ spreche, dann sind damit Menschen gemeint, die in einem bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Verhaltensmuster zeigen. Ich unterstelle aber nicht, dass der Mensch hinter diesem Verhaltensmuster immer auch einen unmoralischen Charakter hat. Das muss nicht zwingenderweise der Fall sein. Menschen können sich ändern.
Für Scheinheilige in dem o.g. Sinne ist jedoch ein ausgesprochen egoistisches Verhalten typisch. D.h., dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche in den Mittelpunkt stellen. Nun werden Sie einwenden, dass das doch bis einem gewissen Grad für alle Menschen gilt. Das stimmt. Die Natur hat es so eingerichtet, dass der Überlebenstrieb eine der wichtigsten Eigenschaften des Menschen ist. Insofern ist ein „gesunder“ Egoismus sicherlich normal.
Gleichzeitig hat die Natur Menschen aber auch mit einem sozialen Gen ausgestattet, das den Egoismus des Einzelnen einbremst und ihn befähigt, sich an als nützlich erkannte gemeinsame Regeln zu halten. Gerade bei uns nahestehenden Menschen ist gegenseitiges Vertrauen unerlässlich für das gemeinsame Überleben und ein gutes Miteinander.
Wäre das nicht so, würden Streit und Feindschaft zum Auseinanderfallen der Gemeinschaft führen, was echten Feinden der Gemeinschaft zum Sieg über die Gruppe verhelfen würde.
Vertrauen und Fairness, zumindest in der eigenen Gruppe (idealerweise, wenn auch eher unrealistisch, innerhalb der gesamten Menschheit), sind also der sinnvolle Gegenpol zum eigenen Egoismus. Das bedeutet, in einem angemessenen Rahmen auch die Rechte und Interessen anderer als gleichberechtigt anzuerkennen.
Oben haben wir aber gesagt, dass Scheinheilige die eigenen Interessen über die anderer stellen. Sie handeln also nicht sittlich-moralisch, sondern ausschließlich oder überwiegend egoistisch. Dass sie das, vor allem innerhalb des eigenen Kreises nicht zu erkennen geben dürfen, liegt auf der Hand. Sie würden ansonsten durchschaut und könnten ihre Ziele nicht oder nur noch schwer erreichen, außerdem würden sich einige Gruppenmitglieder von ihnen abwenden. Bei ihnen ist das Gleichgewicht zwischen „gesundem“ Egoismus und sozialem Verhalten gestört, so dass nun ein ungesunder, überstarker Egoismus ihr Verhalten bestimmt.
Daraus resultiert fast automatisch eine gewisse Neigung zur Unehrlichkeit. Sie täuschen Wohlwollen und Arglosigkeit vor, obwohl es ihnen nicht um gegenseitigen Respekt geht. Da aber in einem gemeinsamen Kreis zum Wohlergehen aller grundsätzlich Vertrauen vorausgesetzt wird, ist dieses Verhalten so gefährlich - Familienangehörige, Bekannte oder Kollegen müssen ein gewisses Vertrauen in andere haben, sonst funktioniert die Gruppe nicht mehr.
3.1 Die Psychologie von Scheinheiligen
Das typische Verhaltensmuster von Scheinheiligen lässt sich in der Regel auf drei Elemente zurückführen:
Unehrlichkeit
Übermäßiges Streben („Gier“) nach materiellen Gütern oder Vorteilen
Übermäßiges Streben („Gier“) nach immateriellen Gütern oder Vorteilen
Alle drei Elemente sind anderen gegenüber unredlich, ja böswillig. Scheinheiligkeit entsteht also aus dem „Dreieck der Unredlichkeit“.
Abb. 1: Das Dreieck der Unredlichkeit5
Egoismus
Egoismus als solches ist die Konzentration auf sich selbst, auf die eigenen Bedürfnisse, auf die eigenen Wünsche und Interessen. Egoismus ist per Definition rücksichtslos, denn er gehört zum Überlebenskampf. Ein gewisser Egoismus ist fürs Überleben unerlässlich.
In unserer Definition geht es aber um einen übersteigerten Egoismus. Das Individuum stellt sich und seine Bedürfnisse stets über andere und deren Bedürfnisse. Oft ist übersteigerter Egoismus auch mit einem überhöhten Selbstbild und einem Überlegenheitsgefühl anderen gegenüber verbunden. Nicht selten ist es aber auch so, dass Scheinheilige an einem Minderwertigkeitskomplex leiden und durch Neid und Vorteilsnahme dieses sie quälende Gefühl zu kompensieren suchen.
Der entscheidende Punkt ist die Kälte und Rücksichtslosigkeit hinter diesem Egoismus. Was bringt Menschen dazu, andere zu betrügen und zu übervorteilen? Bestimmten Menschen scheinen andere einfach gleichgültig zu sein. Ihre Gefühlskälte resultiert möglicherweise aus einem angeborenen oder erworbenen Mangel an Empathie, vielleicht haben auch zahlreiche negative Erfahrungen mit anderen Menschen dazu beigetragen. Jedenfalls resultiert daraus offenbar eine gewisse Unfähigkeit, oder auch ein Unwille, andere als gleichberechtigte, fühlende Wesen anzusehen.
Bei übersteigert egoistischen Menschen kreist immer nur alles um ihn/sie selbst. Andere Menschen spielen keine oder kaum eine Rolle, und ihre berechtigten Bedürfnisse und Gefühle werden oft völlig ignoriert. Manchmal sind solche Egoisten schon für nur sehr kleine Vorteile bereit, ihnen Nahestehenden nachhaltigen Schaden zuzufügen oder billigend in Kauf zu nehmen.
Wir reden beim „Blendwerken“ also von einem Verhaltensmuster, das prinzipiell blind für die Rechte und Bedürfnisse anderer ist und sich vor allem, manchmal ausschließlich, um den eigenen Nutzen kümmert. Scheinheilige sind diejenigen, die dieses Verhaltensmuster zeigen.
Das geht - per Definition- über den „natürlichen“ Egoismus, den der Mensch zum Überleben braucht, hinaus.
Unehrlichkeit
Unter Unehrlichkeit soll hier die überdurchschnittlich starke Bereitschaft verstanden werden, gegen ethisch-moralische Prinzipen, aber auch gegen allgemeine Regeln und Gesetze zu verstoßen, um sich Vorteile auf Kosten anderer zu verschaffen.
Unehrlichkeit ist ein unabdingbares Element des Blendwerkens. Ein Scheinheiliger zeigt weniger Skrupel, gegen ethisch-moralische Prinzipen, aber auch gegen Regeln und Gesetze zu verstoßen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Er nimmt das Risiko, dabei aufzufallen und bestraft zu werden, eher in Kauf, und auch die Missbilligung, die ihn trifft, wenn er bei einem Regelverstoß ertappt wird, berührt ihn meist weniger als andere.
Dieses Merkmal ist eine Folge des überstarken Egoismus. Es ist eben ein geeignetes Mittel, um schneller und einfacher in den Besitz der erstrebten materiellen oder immateriellen Vorteile zu gelangen oder mehr davon zu erlangen als auf ehrlichem Weg.
Durch die Unehrlichkeit nimmt jemand gewissermaßen die „Abkürzung“ auf dem Weg zu den erstrebten Gütern oder Vorteilen, aber auch zur Vermeidung von Nachteilen und Strafen. Man erspart sich so Mühe, Aufwand, Widerstände, Kosten usw. und muss sich nicht für das eigene Tun verantworten.
Motiv Streben nach materiellen Gütern
Das Merkmal Gier nach materiellen Gütern bezeichnet den starken Wunsch, materielle Güter in Besitz zu nehmen, aber auch, diese Güter anderen nicht zu gönnen. Dieses zentrale Motiv strebt nach materiellem Wohlstand oder finanziellen Vorteilen in allen Facetten, auch auf Kosten und zum Nachteil anderer.
Im Unterschied zum Kriminellen - wobei die Grenze fließend ist - versucht der Scheinheilige meistens, durch verschiedenste Techniken der Manipulation andere dazu zu bewegen, ihre Besitztümer freiwillig an ihn oder eine dritte Person zu übertragen.
Die Techniken dazu sind vielfältig: Vom Erzeugen eines schlechten Gewissens über das Verschweigen von wichtigen Tatsachen oder die Vortäuschung von unrealistischen Gewinnen oder Verlusten wird alles Mögliche versucht, um das Opfer auf unmoralische, aber nicht unbedingt illegale Weise um seinen Besitz zu bringen.
Motiv Streben nach immateriellen Gütern
Das Streben nach immateriellen Gütern kann ein ebenso beherrschendes Motiv sein wie das nach materiellen Besitztümern. Am häufigsten ist darunter das Bedürfnis nach Macht und Anerkennung, aber auch der Wunsch nach Aufmerksamkeit und Beachtung zu beobachten. Neid spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Das Bedürfnis nach Macht und/oder Anerkennung ist zu verstehen als der starke Wunsch, ein hohes Ansehen in der Gesellschaft zu erzielen, Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu erfahren, andere zu beherrschen und selbst möglichst unabhängig zu bleiben. Oft geht hiermit einher ein Wunsch nach Titeln und Positionen, das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, anderen voraus zu sein, gelobt und geliebt zu werden. Oder einfach nur darum, sich mächtiger als andere zu fühlen.
Menschen, die von diesem Bedürfnis getrieben sind, sind oft sehr ehrgeizig oder sogar ruhmsüchtig. Sie wollen wahrgenommen und gehört werden, unabhängig davon, ob sie etwas Interessantes zu sagen haben, sie wollen gelobt werden, auch wenn das Lob anderen zusteht, sie möchten einen wichtigen Titel tragen, obwohl damit vielleicht gar keine tatsächliche Macht verbunden ist oder der Titel ihnen gar nicht zusteht.
Andere streben Macht über andere an, nur um des eigenen Machtgefühls willen, nicht, um Dinge zu bewegen oder durchzusetzen. Im Management mancher Firmen tummeln sich einige Narzissten und Selbstdarsteller dieser Art.
Oft wirken diese Menschen besonders überzeugend, weil viele von ihnen sich anderen überlegen fühlen und tatsächlich keinen Zweifel an sich selbst kennen, obwohl es dafür - objektiv gesehen - oft gar keinen Grund gibt.
Schein ist ihnen wichtiger als Sein, vollmundig verkündete Absichtserklärungen sind ihnen wichtiger als deren Umsetzung. In den früheren Ausgaben dieses Buchs habe ich Scheinheilige noch „Blender“ genannt - auf diesen Typ trifft der Begriff wohl am besten zu.
Das Streben nach immateriellen Gütern entspringt dem Bedürfnis, sich in Bezug auf andere besser oder zumindest wohlzufühlen. Das kann auch im negativen Sinn verstanden werden. Manche Menschen halten es nicht aus, wenn es anderen bessergeht als ihnen selbst, sei es materiell, sei es von der gesellschaftlichen Stellung her oder an anderen Kriterien gemessen. Neid kann sich auf ganz viele Punkte beziehen: Eine gute Ausbildung, gutes Aussehen, Beliebtheit, Erfolg, Anerkennung, gute Beziehungen u.v.m.
Ein Neider strebt danach, das Verhältnis von immateriellen Gütern anderer in Bezug auf seine eigenen zu seinen Gunsten zu korrigieren.
Hat jemand Erfolg, versucht er, ihm diesen zu nehmen oder zumindest zu relativieren. Hat jemand eine gute Beziehung, versucht er, diese madig zu machen oder zu zerstören.
Das Ergebnis ist immer, dass sich der - insgeheim - als unterlegen ansehende Neider relativ besser fühlt, wenn es demjenigen, der objektiv oder vermeintlich über höherwertige immaterielle Eigenschaften verfügt, schlechter geht als dem Neider.
Neid und Missgunst sind destruktive Verhaltensweisen. Sie führen nicht unbedingt dazu, dass es dem Neider objektiv bessergeht, sondern oft nur dazu, dass es einem oder mehreren anderen schlechter geht. Nur relativ betrachtet geht es dem Neider besser.
Leider ist der Neid trotzdem ein häufig beobachtetes Motiv. Nicht selten kann man beobachten, dass tiefe Missgunst mit einem zuckersüßen Lächeln oder freundlichen Worten kaschiert wird.
Zu erwähnen sind auch noch diejenigen Menschen, die gern um Aufmerksamkeit heischen und ihre Umwelt gern kontrollieren. Sie lieben es, wenn andere ihren Regeln folgen, ihnen Bericht erstatten, ihnen zuhören und sich um sie kümmern - oft unter völliger Vernachlässigung eigener Interessen.
Dieser Typ liebt es, für andere Regeln einzuführen, die später nicht mehr hinterfragt werden und dann als unumstößlich gelten. Er liebt es, wenn sich alles um seine Bedürfnisse dreht und schafft es, anderen einzureden, dass das selbstverständlich ist.
Ein solches Muster zeigt sich häufig wie folgt: Er kontrolliert und beherrscht, er erlaubt und verbietet - Zufälle oder unabhängiges Handeln anderer sind diesem manchmal im Grunde recht unsicheren Menschen wenig geheuer. Die Beachtung seiner eigenen Person ist für ihn ebenso wichtig wie für den Menschentyp, dem das hohe Ansehen wichtig ist.
Der Unterschied ist nur, dass er nicht zur Selbstdarstellung neigt, sondern von anderen verlangt, ihm um jeden Preis zuzuhören, ihn zu unterhalten und sich um ihn zu kümmern, ja, ihn regelrecht zu bedienen.
Nicht zuletzt sind da noch die Zu-Kurz-Gekommenen zu erwähnen. Solche Menschen sind der festen Überzeugung, dass sie etwas Besseres im Leben verdient hätten. Ihrer Meinung nach sollten sie in der Firma eine Führungsrolle bekleiden, anstatt auf einem kleinen Sachbearbeiterposten dahinwerkeln zu müssen. Sie sind meistens der Meinung, dass andere - und nicht sie selbst - an ihrer Situation schuld sind, die sie nicht als gerecht empfinden, und unter der sie leiden.
Mangels Selbsterkenntnis kommt ihnen nur selten der Gedanke, dass sie selbst für ihre Fehler verantwortlich sein könnten - ihrer Ansicht nach waren es stattdessen immer die schwierigen Umstände, die anderen Beteiligten, die fehlenden Informationen, der unglückliche Zufall usw.
Wer ungern Verantwortung übernimmt, aber dennoch gern etwas Besseres wäre (oder sich dafür hält), leidet dauerhaft unter diesem Zustand und rächt sich dann an seiner Umwelt.
Sicher, die Beispiele, die ich hier genannt habe, treten nur selten in Reinform auf. Oft mischen sich die Motive, meistens haben Menschen, die andere übervorteilen, mehrere Motive. Dennoch gibt es bestimmte Hauptmotive, die sich in der skizzierten oder in einer ähnlichen Form bemerkbar machen.
3.2 Welche Schäden Scheinheilige anrichten können
Die Schäden, die Scheinheilige anrichten können, indem sie sich mit betrügerischen Methoden, mit Lügen, unehrlichen Vorschlägen, Zurückhaltung von Informationen usw. Vorteile auf Kosten anderer verschaffen, sind nicht zu unterschätzen.
Überall dort, wo sich Menschen begegnen, z.B. im Betrieb, im Verein, in der Familie oder im Freundeskreis, kann unredliches Verhalten seine Spuren hinterlassen:
Benachteiligungen im Beruf oder in der Freizeit
Mobbing und Diskriminierung
Verlust von Vermögen und Besitz
Entgangener Gewinn
Gestiegene Schulden
Sozialer Abstieg, Arbeitslosigkeit
Zerstörte Beziehungen, aufgegebene Freundschaften, Trennungen von früher geliebten Menschen
Ansehensverlust, Erniedrigungen und Beschämungen
Soziale Isolation und Einsamkeit
Sich-schlecht-fühlen, Schuldgefühle, Gewissensbisse
Gesundheitsschäden, z.B. Depressionen, Neurosen, Ess- und Schlafstörungen.
Abhängigkeit von einer Bezugsperson
u. v. m.
In besonders extremen Fällen kann das rücksichtslose Verhalten einzelner Menschen Familienbande zerstören, Karrieren ruinieren oder wirtschaftliche Existenzen vernichten. Manchmal kommt es zu schweren psychischen Erkrankungen oder gar zum Suizid der Geschädigten.
Nicht selten sind den Betroffenen die ihnen drohenden Gefahren oder die ihnen durch die Machenschaften des Scheinheiligen bereits entstandenen Nachteile nicht einmal bewusst. Sie vertrauen ihrem Peiniger und erkennen erst mittel- und langfristig den entstandenen Schaden, aber nicht selten glauben sie auch dann noch, dass dieser auf Zufall, auf die Umstände oder auf andere zurückzuführen sei.
Gelegentlich bedarf es erst eines unumstößlichen Beweises dafür, dass der vermeintliche Wohltäter in Wahrheit ein hintertriebener Schurke ist, dem es gelungen ist, das eigene Vertrauen - unter Umständen jahrelang - zu missbrauchen, bis die Einsicht einkehrt, gemein hereingelegt worden zu sein.
Später freilich, wenn das Übel erkannt ist, sind die zugrundeliegenden Lügen oft juristisch irrelevant oder nicht beweisbar. Das Geschehene lässt sich oft nur noch teilweise oder gar nicht mehr rückgängig machen.
3.2.1 Beispiele für Schädigungen im Alltag
Beispiel 1:
Der Geschädigte war ein langjährig tätiger Freiberufler, der sich mit einem anderen, erst seit kurzem Selbstständigen auf die Gründung einer gemeinsamen Firma eingelassen hatte. Er vertraute dem vollmundigen (aber unbewiesenen) Versprechen seines Partners, dass dieser als im Vertrieb besonders versierter Leistungsträger für beide Partner mehr Aufträge hereinholen könne, als wenn jeder für sich allein arbeitete. Die Bedingung dafür war, hälftig an der noch zu gründenden Firma beteiligt zu werden.
Der Altpartner ging darauf ein, und die Firma wurde diesen Bedingungen entsprechend gegründet. Drei Jahre später kam dem Altpartner der Verdacht, einem Hochstapler aufgesessen zu sein. Ihm war nämlich das auffallend hochtrabende Auftreten des Neuen unangenehm aufgefallen. Zudem hatte sich herausgestellt, dass sein neuer Partner in den drei Jahren weniger als ein Viertel des Umsatzes der gemeinsamen Firma erwirtschaftet hatte.
Dafür war es diesem aber sehr daran gelegen gewesen, seinen neuen Status als „Chef“ herauszustreichen. Um diesen Status zu erreichen, hatte er unter anderem mehrere schwach qualifizierte Mitarbeiter eingestellt, deren Leistungen das Unternehmen im Grunde nicht benötigte. Dafür hatten deren Gehälter jeden Monat die mühsam durch den alteingesessenen Partner erwirtschafteten Umsätze regelmäßig wieder aufgezehrt.
Aber das kurz nach der Firmengründung an der Tür des Neuen angebrachte Schild mit dem Aufdruck „Manager“ hatte nun endlich seine Berechtigung.
Darüber hinaus war es dem Hochstapler gelungen, Umsätze aus dem Geschäft mit einem Hauptkunden der gemeinsamen Firma heimlich abzuzweigen und vertragswidrig in die eigene Tasche zu wirtschaften.