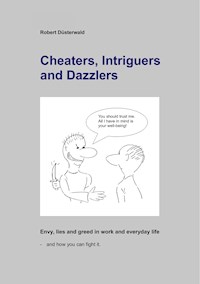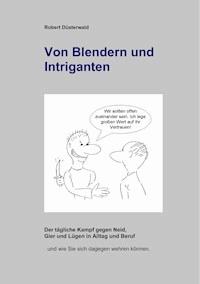Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Revision des Controllings ist ein bislang noch wenig beschriebenes Themengebiet. Dabei ist Controlling mehr als Zahlen, Daten, Fakten: es ist ein zentrales Instrument, das der Unternehmensleitung Entscheidungsgrundlagen liefert und dazu beiträgt, den Geschäftserfolg zu sichern. Mit diesem Leitfaden, der auf zahlreichen Prüfungen basiert, erhalten Revisoren einen Überblick über alle wesentlichen Prüfgebiete. Die inhärenten Risiken und die erforderlichen Kontrollen im Controlling sind in Form von Checklisten dargestellt, die Prüfungsplanung, Prüfungsziele und der Prüfungsansatz werden anschaulich beschrieben. Geschäftsleiter und Controller können das Buch zur Selbsteinschätzung nutzen. Nach der Implementierung geeigneter Verbesserungen bleibt das Controlling kein Papiertiger, sondern kann das sein, was es sein soll: ein hocheffizientes Management-Navigations-System.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Düsterwald
hat nach seinem Studium zunächst sieben Jahre im Finanzbereich sowie im operativen und strategischen Controlling Erfahrung gesammelt und war anschließend mehrere Jahre bei einer der „Big Four" Unternehmensberatungen mit der Leitung von Großprojekten beschäftigt. Danach war er acht Jahre als Senior Audit Manager in der Internen Revision eines weltweit operierenden Großunternehmens tätig.
Er ist seit einigen Jahren selbstständiger Unternehmensberater und unterstützt Geschäftsführer und Bereichsleiter mit der Beratung bei Führungsthemen und Geschäftsprozessen. Zu Themengebieten wie Revision, Controlling oder Projektmanagement hält er außerdem Vorträge und leitet Lehrgänge und Seminare.
Inhaltsverzeichnis
DAS PRÜFGEBIET CONTROLLING
1.1 Controlling – der Controlling-Begriff
1.2 Controlling im Wandel der Zeit
1.3 Controlling und Interne Revision
PRÜFFELDER IM CONTROLLING
2.1 Controlling als Prüfgebiet
2.2 Begrifflichkeiten: Prüfgebiete, Prüffelder etc.
2.3 Begrifflichkeiten: Risiken, Kontrollen, IKS
2.4 Controlling und seine Prüffelder
DIE ORGANISATION DES CONTROLLINGS
3.1 Auftrag und Organisation des Controllings
ZENTRALES CONTROLLING
4.1 Definition Zentrales und Dezentrales Controlling
4.2 Prüffeld Zentrales Controlling - Überblick
4.3 Koordination des Controlling-Prozesses
4.3.1 Berichtswesen konzipieren und koordinieren
4.3.2 Datenbereitstellung koordinieren
4.3.3 Planungsprozess koordinieren
4.3.4 Berichterstattung und Maßnahmenbesprechung
4.4 Beratung der Fachbereiche
4.5 Überwachung des Controlling-Prozesses
4.6 Unternehmenscontrolling
4.6.1 Controlling auf Gruppen- oder Konzernebene
4.6.2 Spezialgebiete des Controllings
DEZENTRALES CONTROLLING
5.1 Begriff des dezentralen Controllings
5.2 Strategische Planung
5.3 Vertriebscontrolling
5.4 Kostencontrolling
5.5 Controlling der Bereichsergebnisse
ZUSAMMENARBEIT IM CONTROLLING
PRÜFUNGSANSATZ IM CONTROLLING
7.1 Prüfungsansatz
7.2 Prüfungsziele
7.3 Prüfungsmethodik und -ablauf
7.4 Prüfungsplanung
7.5 Prüfungsvorbereitung
7.6 Prüfungsdurchführung
7.7 Berichtserstellung
7.8 Beispiele für Findings im Controlling
7.9 Nachschau
SCHLUSSBEMERKUNG
Anlage: Best Practice Beispiele im Controlling
9.1 Geschäftsordnung des Controllings
9.2 Planungskalender
9.3 Monatsbericht mit Kommentierung
Abbildungsverzeichnis
Literaturhinweise
Einleitung
Sowohl zum Controlling als auch zur Internen Revision existiert jeweils eine Vielzahl geeigneter Literaturquellen, zur Kombination beider Themengebiete ist die Literatur jedoch recht lückenhaft. Es bot sich daher an, aus der praktischen Erfahrung mit durchgeführten Prüfungen des Controllings einerseits und aus Erfahrungen aus der Mitarbeit im operativen und strategischen Controlling andererseits ein Schriftstück zu verfassen, das gewissermaßen die Brücke zwischen den beiden Themengebieten bildet.
Die Urversion dieses Buchs basiert auf dem gleichnamigen zweitägigen Seminar. Wegen des bereits erwähnten Mangels an Literatur über die Revision des Controllings ist es vorwiegend aus der Praxiserfahrung heraus und unter der Verwendung allgemein bekannten Wissens aus Controlling und Revision geschrieben.
Mitarbeitern der Internen Revision vermittelt das Buch den Überblick über das gesamte Prüfgebiet Controlling. Controller bekommen einen Eindruck davon, wie ein wirksames Controlling aussehen sollte, das den Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, aber auch an Vermögenssicherheit und Datenzuverlässigkeit entspricht. Mitglieder der Geschäftsleitung wiederum können sich einen Eindruck von den Chancen und Risiken der internen Berichterstattung verschaffen.
Heutzutage wird Controlling - neben der nahezu unvermeidlichen Nutzung von MS Excel und ähnlichen Tabellenkalkulationsprogrammen - zunehmend unter Nutzung von leistungsfähigen ERP-Programmen durchgeführt. Der Schwerpunkt im Buch liegt aber nicht so sehr auf der technischen Seite des Controllings, sondern stärker auf der fachlichen Ausgestaltung und der Zweckmäßigkeit des Controlling-Prozesses als wirksamem Instrument zur Unterstützung des Managements.
Dennoch hat es den Anspruch, möglichst viele Aspekte des Controllings zu beleuchten, um sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Controller einen schnellen Einstieg in die komplexe Materie zu ermöglichen.
1 DAS PRÜFGEBIET CONTROLLING
Controlling – ein Prüfgebiet?
So oder so ähnlich hört es sich noch immer häufig an, wenn es um die Prüfung des Controllings geht. Revisoren sind es gewohnt, Finanzprozesse zu prüfen, den Einkauf, die Lohnabrechnung, die Reisekosten oder die Informationstechnologie - einen Management-Prozess zu prüfen ist jedoch nicht immer etwas ganz Alltägliches.
Wie soll man zum Beispiel die Aussagekraft der Monatsberichte des Controllings prüfen? Kann man sagen, dass das Controlling gut aufgestellt ist, wenn allein die Daten zuverlässig sind? Was muss das Controlling eigentlich leisten, um seinem Anspruch als Management-Unterstützung gerecht zu werden? Das sind Beispiele für die Fragen, denen wir uns nachfolgend widmen möchten.
1.1 Controlling – der Controlling-Begriff
Gleich zu Beginn ist damit die Frage verbunden, was Controlling eigentlich ist: ist es Kontrolle, Herrschaft über die Unternehmensdaten, Planung, Datenbereitstellung oder vielleicht sogar alles zusammen?
Es gibt mehrere Definitionen dazu, was Controlling bedeutet. Das englische Wort „Controlling“ kommt von „to control“, d.h. etwas steuern, beherrschen, im Griff haben. Es ist also mehr als reine Kontrolle, aber auch nicht reines Unternehmertum, denn das behalten sich naturgemäß die Geschäftsführung bzw. die Eigner des Unternehmens vor.
Schauen wir einmal kurz in die Literatur:
Im „Wöhe“, einem der wohl bekanntesten betriebswirtschaftlichen Lehrbücher Deutschlands, ist Controlling (im weiteren Sinn) wie folgt definiert: „Unter Controlling ist die Summe aller Maßnahmen zu verstehen, die dazu dienen, die Führungsbereiche Planung, Kontrolle, Organisation, Personalführung und Information so zu koordinieren, dass die Unternehmensziele optimal erreicht werden“.1
Diese koordinierende Rolle muss aber keineswegs in der Hand einer eigenen Controlling-Organisation liegen. In kleineren Betrieben gibt es meist keine eigene Controlling-Abteilung; hier übernimmt die Geschäftsleitung oft ohne eine dazwischen geschaltete Controllingleitung die direkte Verantwortung für das Controlling. Manchmal führt die Geschäftsleitung das Controlling sogar selbst durch, meistens unterstützt durch einen Buchhalter oder einen anderen Mitarbeiter, der neben seinem eigentlichen Aufgabenbereich auch Aufgaben des Controllings wahrnimmt.
Wenn wir das Controlling als gesamten Prozess zur Steuerung und Koordination betrachten, dann teilen sich die Prozessschritte des Controllings in zwei Bereiche auf: erstens in die Geschäftsführung als den eigentlichen Kernbereich der Steuerung einschließlich der Strategieplanung und Entscheidungsfindung, und zweitens in die Unterstützungsprozesse zur Steuerung, die häufig von Mitarbeitern außerhalb der Geschäftsführung übernommen werden.
Abbildung 1 (eigene Darstellung): Rollenverteilung im Controlling
Man sieht, dass das Controlling eine sich wiederholende Prozesskette bildet. Erst kommt die Strategie, auf deren Basis geplant wird, dann wird die Planung umgesetzt, die Ergebnisse werden daraufhin überprüft, ob sie dem Plan entsprechen, und bei Abweichungen oder Änderungen in der Unternehmensumwelt werden Management-Entscheidungen getroffen, um den Plan schließlich doch noch zu erreichen. Danach beginnt der Zyklus von Neuem.
Dabei agiert das Unternehmen in einem dynamischen Umfeld: Markttrends, Entwicklungen in Rechtsprechung, Gesellschaft und Wirtschaft sowie technologischer Fortschritt beeinflussen die strategische Planung und damit die Steuerung der Geschäftsentwicklung.
Nicht nur dem Management, sondern auch dem Controlling kommt deshalb die Aufgabe zu, die Wechselwirkungen der Umwelt auf das Unternehmen (und umgekehrt) in seine Analysen und in die Planung mit einzubeziehen.
Abbildung 2 (eigene Darstellung:): Controlling als Anpassungsprozess
Wenn wir diesen Zyklus des Anpassungsprozesses in einer dynamischen Umwelt stärker berücksichtigen, bekommen wir eine Beschreibung des Controllings, die sich für prüferische Zwecke besser eignet als der etwas unscharfe Begriff der Koordination. Deshalb wollen wir für die Zwecke dieses Buchs nun eine eigene Definition für das Controlling festlegen.
Definition für den Zweck dieses Buchs
„Controlling beinhaltet die Planung von Zielgrößen eines Unternehmens oder eines Geschäftsbereichs auf Basis strategischer Vorgaben sowie die Bereitstellung und Analyse von Ist-Daten zum Vergleich mit dem Plan einschließlich der Ursachenanalyse und der Festlegung von geeigneten Korrekturmaßnahmen im Fall von Planabweichungen.“
Controlling ist ein Element der Unternehmensführung. Deshalb liegt der Schwerpunkt des Controllings auf der Planung von Geschäftsergebnissen sowie dem Plan/Ist-Vergleich zur Feststellung, ob die Geschäftsergebnisse dem Plan entsprechen. Es handelt sich also um eine Ex-post-Betrachtung, mit der das Ziel verfolgt wird, aus einer nicht zielkonform abgeschlossenen Periode geeignete Maßnahmen abzuleiten, um eingetretene Fehlentwicklungen zu korrigieren und möglichst in der Zukunft zu vermeiden.
Controlling in einem weiteren Sinn kann aber auch die Steuerung der Prozesse meinen, die die Produkte bzw. Dienstleistungen eines Betriebs erzeugen und somit die Voraussetzung für deren Erfolg sind. In diesem Fall sind nicht mehr die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit Gegenstand der Steuerung respektive des Controllings, sondern die Maßnahmen zur Sicherstellung ihrer erfolgreichen Erzeugung.
Zum Beispiel setzt die Zufriedenheit von Kunden mit einem bestimmten Produkt des Unternehmens eine hohe Qualität des Produkts selbst voraus. Eine hohe Produktqualität lässt sich wiederum nur über eine hohe Qualität in den Abläufen zur Herstellung des Produkts sicherstellen, die u.a. durch niedrige Ausschussquoten erzielt werden kann. An dieser Stelle beginnt der Übergang vom Unternehmenscontrolling (aus Sicht der Geschäftsleitung) zu einem „internen“ Controlling in den einzelnen Funktionsbereichen, d.h. zum Internen Kontrollsystem.
Hier setzt dann auch die Arbeit der Internen Revision an, die prüft, inwiefern die Prozessqualität zur Erzeugung der gewünschten Produkte oder Dienstleistungen des jeweiligen Bereichs durch geeignete Kontrollen, wieder verstanden als Steuerungsgrößen, doch diesmal ausschließlich bezogen auf die Prozesse innerhalb eines Bereichs, sichergestellt wird.
Solche Steuerungsgrößen und Kennzahlen liegen jedoch meist außerhalb der Betrachtung des Unternehmenscontrollings und sind dem jeweiligen Fachbereich selbst überlassen, meist ohne dass es eine unternehmensbezogene Berichterstattung dazu gibt. Bestimmte Kennzahlen allerdings sind trotzdem für die Geschäftsleitung interessant, zum Beispiel die Fluktuationsquote, der Krankenstand usw.
Die Grenze zwischen Controlling aus Sicht der Geschäftsleitung und der Steuerung der eigenen Prozessqualität durch die Fachbereiche ist nicht immer trennscharf gezogen. Wir wollen im Folgenden jedoch Controlling vor allem aus Sicht der Unternehmensleitung betrachten, d.h. diejenigen Steuerungsgrößen in den Mittelpunkt stellen, die für die Geschäftsleitung von Interesse sind, und auf die sie auch direkt einwirken kann.
Rolle der Internen Revision
Wenn Controlling den Anspruch erhebt, die Geschäftstätigkeit zu steuern, dann handelt es sich um eine Management-Aufgabe. Wir sagten schon, dass dabei unterschieden werden muss: in die eigentliche Verantwortung für diese Aufgabe, die bei der Geschäftsführung und beim Management liegt, und die operative Unterstützung, d.h. vor allem die Definition und Erhebung sowie die Analyse der dafür benötigten Informationen.
Diese Unterscheidung ist für die Interne Revision von Interesse. Die unternehmerischen Entscheidungen, die aufgrund der Controlling-Informationen getroffen werden, sind nämlich i.d.R. nicht Gegenstand der Prüfung durch die Interne Revision. Der Vorgang jedoch, der zu diesen Entscheidungen geführt hat (die Berichterstattung) und der Plan/Ist-Vergleich danach (das Controlling im engeren Sinne) sind aber wichtige Management-Unterstützungsprozesse, die klaren Regeln folgen, inhärente Risiken beinhalten und geeigneter Kontrollen bedürfen; sie können daher sehr wohl von der Internen Revision geprüft werden.
1.2 Controlling im Wandel der Zeit
Controlling hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte verändert, ebenso wie sich auch die Anforderungen an die Interne Revision verändert haben.
War Controlling früher oft eine Nebenaufgabe im Rechnungswesen, die stark auf Daten der Buchhaltung basierte, so ist Controlling heute immer öfter eine anspruchsvolle Analystenaufgabe mit dem Auftrag, die Geschäftsführung im schnell sich ändernden Tagesgeschäft zu entlasten und sie mit vorausschauenden Analysen, kritischer Kommentierung und kreativen Ideen zu unterstützen.
Auch die dafür zur Verfügung stehenden Informationssysteme haben heute eine weitaus höhere Leistungsfähigkeit und Flexibilität als noch vor ca. 20 Jahren. Die Möglichkeiten, gutes Controlling zu betreiben, sind gestiegen, allerdings hat sich die Komplexität der Anforderungen ebenso erhöht wie der Anspruch an flexible, zeitnahe Anpassungen des Controllings.
1.3 Controlling und Interne Revision
Vor dem Hintergrund, dass Controlling in einer komplexer werdenden Welt eine zunehmend wichtiger werdende Management-Unterstützung darstellt, bekommt das Themengebiet auch für die Interne Revision eine höhere Bedeutung. War früher vor allem die Zuverlässigkeit der Daten vor dem Hintergrund einer aufwendigen, oft manuellen Datenbereitstellung ein Thema, so ist heute der gesamte Prozess in den Fokus geraten:
Werden die für Entscheidungen relevanten Daten berichtet?
Sind die Berichte zeitnah, präzise, standardisiert und für den Entscheider hilfreich?
Ist das Controlling effektiv und effizient aufgestellt?
Diese Fragen stellen sich stärker als bisher, und so kommt auch auf eine moderne Interne Revision die Herausforderung zu, sich die Prozesse des Controllings nicht nur mit dem Blick auf Ordnungsmäßigkeit, sondern auch mit dem Blick auf Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und strategische Ziele anzusehen.
Oft stellt sich hierbei allerdings die Frage, inwieweit sich das Controlling und die Interne Revision, die „Schwestern“, die beide zur Unterstützung des Managements beitragen, gegenseitig unterstützen und ergänzen können, wie sich ihre Aufgaben abgrenzen, und ob die Interne Revision ihre „Nachbarin“, das Controlling, überhaupt prüfen kann oder sollte.
Schauen wir uns dazu zunächst die Tätigkeiten des Controllings und der Internen Revision einmal näher an.
Controlling
Aufgabe:
Planung, Analyse und Berichterstattung der Geschäftsergebnisse
Hauptinformationen:
Zahlen, Bilanzen, Statistiken über die Geschäftsergebnisse und ihre Treiber
Bericht an:
Geschäftsführung, Finanzvorstand, Bereichsleiter, Kostenstellenverantwortliche
Mehrwert:
"Navigationssystem" im Hinblick auf Plan und Ist, Grundlagen zum Treffen von operativen und strategischen Entscheidungen
Abbildung 3: Schwerpunkte des Controllings
Interne Revision
Aufgabe:
Prüfung der Geschäftsprozesse und ihrer Steuerung auf Ordnungsmäßigkeit, Effizienz, Effektivität usw.
Hauptinformationen:
Informationen über Prozessabläufe und ihre Kontrollen
Bericht an:
Vorstand, Geschäftsführung
Mehrwert:
Aufdecken und Abstellen von Mängeln in Geschäftsprozessen anhand des Revisionsberichts
Abbildung 4: Schwerpunkte der Internen Revision
Wie wir sehen, sind die thematischen Schwerpunkte einerseits ähnlich, andererseits sehr unterschiedlich.
Während das Controlling sich mit den Ergebnissen der Geschäftstätigkeit, mit ihrer Planung und Hochrechnung beschäftigt und darüber berichtet, ist es die Aufgabe der Internen Revision, sich mit den Prozessen zur Erzeugung der Ergebnisse der Geschäftstätigkeit zu befassen und darüber zu berichten. Beiden Aufgabengebieten gemein ist, dass sie das Management in seiner Führungsaufgabe unterstützen, die Geschäftstätigkeit überwachen helfen und darüber berichten.
Wenn es die Aufgabe der Internen Revision ist, Geschäftsprozesse im Hinblick auf inhärente Risiken zu analysieren und das Interne Kontrollsystem zu prüfen, dann zählt die Prüfung des Controllings ebenso zum Aufgabengebiet der Internen Revision wie zum Beispiel die Prüfung des Einkaufs.
Dennoch wird Controlling nicht in allen Organisationen regelmäßig geprüft. Die Gründe dafür sind oft in der Organisation oder im Selbstverständnis der Internen Revision, gelegentlich aber auch im Ansehen der Internen Revision zu suchen. Best Practice der Internen Revision ist heutzutage, dass die Interne Revision dem Vorstandsvorsitzenden bzw. dem ersten Geschäftsführer unterstellt ist.
Wenn dann die Interne Revision das Controlling, das vielleicht dem Leiter Rechnungswesen oder dem Finanzvorstand unterstellt ist, prüft, gibt es in der Regel keinen Interessenkonflikt. Anders sieht es jedoch aus, wenn beide Aufgabengebiete in der Hand eines gemeinsamen Ressortchefs liegen. Auch diese Konstellation kommt in der Praxis nicht selten vor. Dann entstehen schnell Befindlichkeiten auf Seiten der Internen Revision und des Controllings. Wie geht der gemeinsame Chef/die gemeinsame Chefin mit Prüfungsfeststellungen um, die das Controlling betreffen? Wie reagiert sie oder er im Fall einer Nachschau? Welche Eskalationsmöglichkeiten bestehen noch für die Interne Revision? Dieses Konstrukt, bei dem beide Aufgabenbereiche in einer Hand vereinigt sind, ist nicht optimal und kann in der Praxis nur durch eine sehr faire und offene Zusammenarbeit oder durch Auslagerung der Prüfung an einen Externen gelöst werden. In kleineren Organisationen lässt sich diese Konstruktion aber oft gar nicht vermeiden.
Zu erwähnen ist aber auch der umgekehrte Fall, denn die Zusammenarbeit der beiden Bereiche besteht ja nicht nur in der Prüfung des Controllings durch die Interne Revision. Auch die allgemeine Zurverfügungstellung von Informationen durch das Controlling kann eine hilfreiche Form der Zusammenarbeit darstellen.
Dies kann schon in der Prüfungsplanung geschehen, zum Beispiel durch die Lieferung von Kennzahlen über die Geschäftstätigkeit bestimmter Bereiche, durch Informationen zu eventuell geplanten Reorganisationen, über die das Controlling im Planungsprozess frühzeitig informiert ist, aber auch durch Statistiken über laufende und geplante Projekte (hilfreich für die Prüfung von Großprojekten zum Beispiel), über Beteiligungsverhältnisse (für die Prüfung von Beteiligungen) oder über Personalbestände, Fluktuation, Krankenstände und dergleichen. Generell kann das Controlling Mengengerüste und Kennzahlen liefern, die für die strategische Prüfungsplanung sehr wertvoll sein können. Umgekehrt kann die Interne Revision - unter Wahrung des Datenschutzes, in Absprache und ggf. mit Genehmigung des Managements - bestimmte Prüfungsberichte oder Auszüge davon auch dem Controlling zur Verfügung stellen.
In der Praxis hat sich eine gute Zusammenarbeit zwischen Controlling und Interner Revision jedenfalls meistens bewährt.
1 Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 24. Auflage, Franz Vahlen Verlag München 2010, S. 189.
2 PRÜFFELDER IM CONTROLLING
2.1 Controlling als Prüfgebiet
Wenn wir uns nun das Controlling näher anschauen, stellt sich zunächst die Frage, mit welcher Art Themengebiet es der Prüfer hier zu tun hat. Zunächst einmal ist Controlling ein Geschäftsprozess mit inhärenten Risiken, zu deren Bewältigung geeignete Kontrollen vorhanden sein sollten; dies gilt für das Controlling wie für jeden anderen zu prüfenden Prozess auch. Allerdings sind beim Controlling einige Besonderheiten zu beachten:
Controlling hat den Charakter eines Management-Prozesses und eine „politische“ Komponente.
Controlling ist organisatorisch frei gestaltbar und hat in der Praxis die verschiedensten Ausprägungen.
Controlling hat wenig harte Prüfungsmaßstäbe, wie zum Beispiel Gesetze, Verordnungen, Regularien.
Controlling ist ein recht umfangreiches Aufgabengebiet.
1. Controlling hat den Charakter eines Management-Prozesses und eine „politische“ Komponente.
Oben haben wir dargestellt, dass das Controlling ein Geschäftsprozess ist, der inhärente Risiken enthält und auf sein Internes Kontrollsystem hin geprüft werden kann. Der Prüfer sollte sich allerdings schon zu Beginn der Prüfung darüber im Klaren sein, dass Controlling nicht zu den operativen Geschäftsprozessen, sondern zu den Management-Prozessen zählt. Daraus resultieren einige Besonderheiten, die zu beachten sind.
Der Fokus der Prüfungsschwerpunkte kann von Prüfungen operativer Geschäftsprozesse abweichen.
Controlling enthält zum Teil interne Kontrollen, zum Teil sind aber, der Natur des Controllings entsprechend, einige Elemente des Controllings selbst Kontrollen, und das Controlling insgesamt kann als wichtiger Teil des Internen Kontrollsystems verstanden werden.
Management-Prozesse sind „politisch“.
Zu a): Der Fokus der Prüfungsschwerpunkte kann von operativen Prüfungen abweichen.
In operativen Prüfungen können die Prüfungsziele Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Zukunftssicherung je nach geprüftem Geschäftsprozess gleichermaßen eine Rolle spielen. Im Controlling kommt jedoch den Prüfungszielen Zukunftssicherung und Zweckmäßigkeit meist eine höhere Bedeutung zu als zum Beispiel dem Prüfungsziel Sicherheit.
In einzelnen Prüffeldern des Controllings kann es allerdings sein, dass der Ordnungsmäßigkeitsaspekt eine besondere Bedeutung hat, zum Beispiel im Kostencontrolling, das auch Verknüpfungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung aufweist.
Zu b): Controlling enthält zum Teil interne Kontrollen, zum Teil sind aber, der Natur des Controllings entsprechend, einige Elemente des Controllings selbst Kontrollen.
Revisoren sind gewohnt, das Interne Kontrollsystem von operativen Prozessen zu prüfen. D.h., wenn ich einen Prozess, wie zum Beispiel die Aufgabe einer Bestellanforderung an den Einkauf prüfe, dann frage ich nach den Risiken und Kontrollen dieses Ablaufs. Ein Risiko dieses Prozesses wäre zum Beispiel, dass eine nicht dienstlich begründete Bestellung aufgegeben wird, ein nicht Berechtigter die Bestellung aufgibt usw. Dazu würden sich Kontrollen wie die Genehmigung durch den Vorgesetzten, die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips oder eine Prüfung der Bestellung durch Mitarbeiter des Einkaufs anbieten. Controlling-Prozesse dagegen stellen oft schon selbst eine Kontrolle dar, zum Beispiel soll der monatliche Controlling-Bericht das Management über die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit unterrichten (eine Art der Kontrolle), damit das Management im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen ergreifen kann. Hier ist zwar eine klassische Kontrolle vonnöten, nämlich, dass ein Vier-Augen-Prinzip sicherstellt, dass der Bericht in seiner Qualität gesichert wird („Kontrolle der Kontrolle“). Aber für ein funktionierendes Controlling ist es mindestens ebenso wichtig, dass der Bericht, weil er ja selbst eine Kontrolle darstellt (genauer: ein Steuerungsinstrument), nicht nur vorhanden, sondern auch angemessen und wirksam, d.h. nützlich ist.
Wir sehen daraus, dass der Frage der Zweckgerichtetheit, der Effektivität und Effizienz der Controlling-Instrumente eine besondere Bedeutung zukommt. Die Prüfung darf sich deshalb nicht nur auf vor gelagerte (zum Beispiel ob das Controlling-Handbuch vorhanden und aktuell ist) und nach gelagerte Kontrollen (zum Beispiel, ob der Bericht vor seiner Freigabe gegengelesen und geprüft wird) beschränken, sondern muss sich stark auf den Prüfgegenstand und seine Beschaffenheit selbst richten.
Da aber oft „mehrere Wege nach Rom führen“, kann der Controller nicht einfach nach Checkliste vorgehen („die Durchsicht des Berichts ist vorgeschrieben, wird gemacht und ist dokumentiert“), sondern muss sich ausgiebig mit der Frage beschäftigen, ob das Controlling-Instrument wirklich geeignet ist, seinen Zweck zu erfüllen („der Bericht ist verständlich, zweckmäßig, adressatengerecht, kurz und knapp, behandelt alles Wesentliche und ist dazu geeignet, Entscheidungen zu ermöglichen“).
Zu c): Management-Prozesse sind „politisch“.
Man kann Controlling nicht beurteilen, ohne zu berücksichtigen, dass die Art und Ausgestaltung einer Management-Unterstützung stark von den Anforderungen und Vorgaben des Managements abhängt.
Ist zum Beispiel nur ein sehr knappes und kurzes Controlling-Instrument gewünscht, so kann dessen mögliche Ausweitung und Verfeinerung zwar durchaus von der Internen Revision als Verbesserungspotential aufgezeigt werden, aber ein „harter“ Mangel muss nicht vorliegen, wenn das Controlling insgesamt funktioniert und seinen Zweck erfüllt.
Umgekehrt kann die Interne Revision ein überbordend detailliertes, umfangreiches und personalintensives Controlling zwar kritisieren, Gehör wird sie aber wohl nur dann finden, wenn sie gute Argumente dafür findet, warum die derzeit geprüfte Form des Controllings ihren Zweck verfehlt. Immer dann, wenn es um „weiche“ Faktoren geht, die nicht zwingend für die Erfüllung der GOB (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung) oder für die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen oder behördlichen Anforderungen erforderlich sind, ist die Interne Revision mehr Gutachter oder Berater als Prüfer im eng abgegrenzten Sinne.
Aber genau hier liegt der besondere Mehrwert: Vielfach ist dem Management nicht bewusst, dass das Controlling überbordend umfangreich ist oder Teile des Controllings fehlen. Und genau dann ist die Empfehlung der Internen Revision, hier Verbesserungen einzuführen, besonders wertvoll, weil die Steuerung des Geschäfts dann besser gelingen sollte als ohne die Hebung derartiger Potentiale.
2. Controlling ist organisatorisch frei gestaltbar und hat in der Praxis die verschiedensten Ausprägungen.
Controlling als Management-Prozess ist kein operativer Ablauf, der stets festen Regeln und Anforderungen entspricht, wie zum Beispiel der Einkauf oder das Personalwesen.
Das zeigt sich schon daran, dass nirgendwo festgelegt ist, dass es zwingend ein Controlling geben muss (es mag Ausnahmen geben, aber vom Grundsatz her ist es den meisten Branchen freigestellt, ob und wie sie ihr Controlling gestalten).
Wenn es aber ein Controlling gibt, so kann der jeweilige Betrieb das Aufgabengebiet, die Organisationsstruktur des Controllings, seine IT- und Personalausstattung, die Budgets des Controllings, seine Rechte und Pflichten weitgehend frei festlegen.
Die freie Gestaltbarkeit ist bei „hart prüfbaren“ Elementen (zum Beispiel: eine eingerichtete Kostenstelle sollte nur vom Kostenstellenverantwortlichen bebucht werden können) nicht das Problem. Bei „weichen“ Faktoren aber, wie zum Beispiel der Frage, ob ein Projektcontrolling eingerichtet werden sollte, ist eine geeignete Argumentation dazu, welche Risiken das Nichtvorhandensein und welche Vorteile die Einrichtung eines Projektcontrollings mit sich bringt, unerlässlich, wenn etwas als „Mangel“ klassifiziert werden soll.
Die Freiheit der Gestaltbarkeit des Controllings bereitet auch insofern gelegentlich Schwierigkeiten, weil kein „Mustercontrolling“ als Vorbild dienen kann. Die Organisationsform des Controllings muss im Grunde ausschließlich dem Zweck des Controllings und seinem Auftrag dienen; ob es zentral, dezentral oder als Matrix aufgebaut ist, spielt dabei weniger eine Rolle. Die finale Ausgestaltung des Controllings muss sich aber an folgenden Faktoren ausrichten und dies kann die Interne Revision auch durchaus prüfen:
Größe und Art der Geschäftstätigkeit des Betriebs
Strategie des Unternehmens/Betriebs
Regionale, länderspezifische oder lokale Merkmale des Betriebs
Allgemeine Führungs- und Organisationsstruktur des Betriebs
Organisationsprinzipien des Unternehmens
3. Controlling hat wenig harte Prüfungsmaßstäbe, wie zum Beispiel Gesetze, Verordnungen, Regularien.