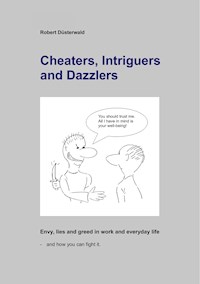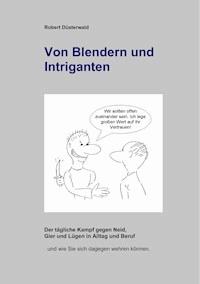Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Minderleister gibt es in fast jedem Betrieb. Ihr Verhalten kann zahlreiche unerwünschte Folgen nach sich ziehen: Unerledigte, fehlerhafte Arbeiten, frustrierte Kunden und Kollegen, teure Nachbesserungen, Rufschäden u.v.m. Doch wie erkennt man Minderleister schon frühzeitig, noch bevor es zu solchen Konsequenzen gekommen ist? Wie unterscheidet man echte, dauerhafte Minderleistung von nur vorübergehender oder stellenbezogener Minderleistung? Wie muss man als Vorgesetzter reagieren, wenn man es mit einem "echten" Minderleister zu tun hat, und was heißt es für eine Organisation, wenn viele Minderleister in ihr arbeiten? Der Autor zeigt fünf Persönlichkeitsmerkmale auf, die zusammen das "Leistungs-Pentagon" bilden und wie man sie mit dem "Pentagon-Test" erkennt. Er erläutert die einzelnen Merkmale und beschreibt Möglichkeiten zum Umgang mit Minderleistern. Zudem stellt er einen Leistungsträger-Test vor, der für die Erkennung von Talenten genutzt werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Düsterwald
ist selbstständiger Unternehmensberater. Nach seinem Studium war er zunächst viele Jahre lang als Projektleiter und Führungskraft in drei großen Unternehmen verschiedener Branchen beschäftigt.
Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Personalführung von Projektmitarbeitern und Mitarbeitern aus der Linienorganisation und hat sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, was Leistungsträger und Minderleister voneinander unterscheidet. Seine Erkenntnisse hat er in dem vorliegenden Buch zusammengefasst.
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
MINDERLEISTER UND IHRE AUSWIRKUNGEN
2.1 M
INDERLEISTUNGEN IM ARBEITSRECHTLICHEN
S
INN
2.2 E
IGENE
D
EFINITIONEN FÜR
M
INDERLEISTUNG
2.3 S
TUFEN VON
M
INDERLEISTUNGEN
2.4 T
EMPORÄRE
M
INDERLEISTUNG
2.5 P
OSITIONSBEZOGENE
M
INDERLEISTUNG
2.6 A
USWIRKUNGEN VON
M
INDERLEISTUNGEN
MINDERLEISTER ERKENNEN
3.1 F
ACHBEZOGENE
L
EISTUNGSBEURTEILUNGEN
(FL)
3.2 C
HARAKTERBEZOGENE
L
EISTUNGSBEURTEILUNGEN
(CL)
3.3 A
NSATZ DER
CL
DAS LEISTUNGS-PENTAGON
4.1 L
EISTUNGSBESTIMMENDE
P
ERSÖNLICHKEITSMERKMALE
DIE EINZELNEN PERSÖNLICHKEITSMERKMALE
5.1 R
EFLEXION
5.2 F
OKUSSIERUNG
5.3 A
NTRIEBSSTÄRKE
5.4 V
ERANTWORTUNG
5.5 G
ESUNDES
S
ELBSTBEWUSSTSEIN
DER PENTAGON-TEST
6.1 V
ARIANTEN
6.2 B
EURTEILUNGSMAßSTÄBE
6.3 N
UTZUNG DER
C
HECKLISTEN ZUM
P
ENTAGON
-T
EST
6.4 D
ER
P
ENTAGON
-T
EST
V
ARIANTE
1: M
INDERLEISTER
6.5 A
USWERTUNG DES
T
ESTS
6.6 A
NALYSE DER
E
RGEBNISSE
6.7 V
ERTEILUNG DER
E
RGEBNISSE
EINSATZMÖGLICHKEITEN DES PENTAGON-TESTS
7.1 B
EI DER
E
INSTELLUNG NEUER
M
ITARBEITER
7.2 B
EI
V
ERDACHT AUF
M
INDERLEISTUNG
7.3 A
LS
E
RGÄNZUNG ZU EINER
FL
7.4 B
EI DER
B
EURTEILUNG VON EXTERNEN
K
ONTAKTPARTNERN
7.5 A
LS
L
EISTUNGSTRÄGER
-T
EST
,
Z
.B.
BEIM
360-G
RAD
-F
EEDBACK
HARTE MINDERLEISTUNG – WAS NUN?
MINDERLEISTER IN DER BEWERBUNG ERKENNEN
REAKTIONEN AUF MINDERLEISTUNG
DER WEG BIS ZUR TRENNUNG
11.1 E
RKENNUNGSPHASE
11.2 F
ÖRDERPHASE
11.3 Z
WEITES
F
EEDBACK
11.4 A
BSCHLUSSPHASE
MINDERLEISTUNG ALS ORGANISATIONSTHEMA
12.1 O
RGANISATIONSÄNDERUNG ALS
L
ÖSUNGSANSATZ
12.2 Z
IELE EINER
O
RGANISATIONSÄNDERUNG
12.3 U
MSETZUNG EINER
O
RGANISATIONSÄNDERUNG
12.4 A
NFORDERUNGEN AN
F
ÜHRUNGSKRÄFTE
12.5 E
RFAHRUNGEN MIT
O
RGANISATIONSÄNDERUNGEN
FAZIT
NACHWORT
ANHANG I: 40 INDIKATOREN ZUR PERSÖNLICHKEIT
ANHANG II: DER LEISTUNGSTRÄGER-TEST
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1 VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Frage, ob jemand im Betrieb als Leistungsträger gelten kann, oder ob er dauerhaft nicht in der Lage ist, seinen Aufgaben gerecht zu werden, ist nicht neu. Sie kommt nahezu unvermeidlich auf jede Führungskraft zu.
Wenn Mitarbeiter die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, fällt die Leistungsbeurteilung am Jahresende schlecht aus, und es werden neue Ziele und Maßnahmen festgelegt, um sie zu erreichen. Doch wenn auch diese Ziele nachhaltig nicht erreicht werden, was dann?
Anstelle einer pragmatischen, erfahrungsbasierten Persönlichkeitsanalyse setzt meistens ein Reigen aus Feedback-Gesprächen, Fortbildungen, Coachings usw. ein, oft jedoch, ohne dass sich etwas verbessert.
Dass ein Mitarbeiter1 möglicherweise grundsätzlich niemals in der Lage ist, auch nur halbwegs ausreichende Leistungen zu zeigen, diese Erkenntnis kommt oft erst auf, wenn alle anderen Maßnahmen versagt haben, denn es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Doch sind bei einer länger andauernden „Minderleistung“ oft schon viele unangenehme Folgewirkungen eingetreten, die sich manchmal nur sehr schwer oder gar nicht mehr beheben lassen.
Daher stellt sich die Frage, an welchen Merkmalen man diejenigen frühzeitig erkennen kann, bei denen jede Liebesmüh‘ vergebens ist, weil sie ohnehin nie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen werden; auch und gerade dann, wenn sie von ihrer Ausbildung und Erfahrung her die gestellten Anforderungen eigentlich bewältigen können müssten.
Oft sind es aber gerade nicht die fachlichen Kenntnisse, der Lebenslauf oder die bislang beobachteten Arbeitsergebnisse eines Mitarbeiters, die darüber Auskunft geben, ob und wie leistungsfähig er insgesamt ist. Meiner Erfahrung nach sind es weitgehend unveränderliche Charaktermerkmale, die das Leistungspotential bestimmen. Sie sind selten direkt erkennbar, aber sie äußern sich in bestimmten, stets wiederkehrenden Verhaltensweisen, auch ohne dass damit sofort eine direkte Minderleistung verbunden sein muss.
Die Probleme mit der Leistung zeigen sich oft erst dann, wenn der Betreffende außerhalb von Routinearbeiten, in einem sehr transparenten Umfeld, auf sich allein gestellt Aufgaben bewältigen muss. Diese stellen für ihn dann eine unlösbare Herausforderung dar, während die gleichen Aufgaben von einem anderen, durchschnittlich leistungsfähigen Mitarbeiter mit einer vergleichbaren Ausbildung und Erfahrung ohne große Schwierigkeiten erledigt werden können.
Wenn es gelingt, die tief in der Psyche verankerten, leistungsbeeinflussenden Charaktereigenschaften über konkret im Betrieb beobachtbare Verhaltensweisen sichtbar zu machen, dann lässt sich daraus relativ zuverlässig ableiten, über welches grundsätzliche Leistungspotential jemand verfügt. Dabei sollte diese Art von Beurteilung des Leistungspotentials aus mehreren Gründen unabhängig von den üblichen psychologischen Selbsttests durchgeführt werden2.
Um herauszufinden, was Leistung eigentlich ausmacht und ob ein Mitarbeiter unabhängig von seiner aktuellen Position und seinen konkret erzielten fachlichen Arbeitsergebnissen dauerhaft in der Lage sein kann, die Leistungen zu erbringen, die seiner Ausbildung und Erfahrung entsprechen, habe ich aus meinen persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen heraus das „Leistungs-Pentagon“ entwickelt, das ich Ihnen in diesem Buch gerne vorstellen möchte.
1 Liebe Leserin, lieber Leser, aus Vereinfachungsgründen wird in diesem Buch einheitlich die männliche Form verwendet. Es sind darunter natürlich stets auch die Frauen gemeint - ich fand es allerdings als männlicher Buchautor höflicher, von „ihm, dem Minderleister“ als von „ihr, der Minderleisterin“ zu sprechen ().
2 Ich habe bewusst in diesem Buch keinen Bezug zu „wissenschaftlichen Werken“ hergestellt, weil der Pentagon-Test eine pragmatische, erfahrungsbasierte Alternative aus betrieblicher Sicht zu gängigen psychologischen Persönlichkeitsanalysen sein soll.
2 MINDERLEISTER UND IHRE AUSWIRKUNGEN
Zunächst einmal sollten wir uns der Frage widmen, was denn unter einem Minderleister überhaupt zu verstehen ist. Nicht jeder, der vorübergehend weniger Leistung zeigt, als von ihm erwartet wird, ist gleich ein echter Minderleister. Und nicht einmal derjenige, der dauerhaft die Anforderungen an eine bestimmte Position nicht erfüllt, muss deshalb auf jeder anderen Position versagen.
Doch bevor ich zu den selbst formulierten Definitionen für Minderleistung komme, die ich zur Grundlage meiner Ausführungen gemacht habe, schauen wir uns zunächst einmal die Verwendung des Begriffs „Minderleistung“ im arbeitsrechtlichen Kontext an.
2.1 Minderleistungen im arbeitsrechtlichen Sinn
Leider gibt es keine gesetzliche Definition von Minderleistungen und auch keinen eindeutig definierten Begriff dafür aus der Rechtsprechung.
Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil vom 11.12.2002 zwar Folgendes festgelegt: „Der Arbeitnehmer muss tun, was er soll, und zwar so gut, wie er kann. Die Leistungspflicht ist nicht starr, sondern dynamisch und orientiert sich an der Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers.“3 Gleich danach fügt das Gericht aber hinzu: „Ein objektiver Maßstab ist nicht anzusetzen.“4
Der Arbeitnehmer muss dabei seine persönliche Leistungsfähigkeit angemessen ausschöpfen. Er darf zum Beispiel die Arbeit außerhalb von üblichen Erholungspausen nicht aus privaten Interessen unterbrechen.
Zudem unterscheidet die Rechtsprechung zwischen Minderleistungen und Schlechtleistungen. Von einer Minderleistung wird i.d.R. gesprochen, wenn die von Arbeitnehmern erbrachte Arbeitsmenge unzureichend ist, also ein Fehler in der Quantität vorliegt. Die Schlechtleistung liegt hingegen bei Fehlern in der Qualität vor, d.h., wenn die Beschaffenheit der vom Arbeitnehmer erbrachten Leistung unzureichend ist.
An Kündigungen wegen mangelhafter Erfüllung des Arbeitsvertrags aufgrund von Minder- oder Schlechtleistung werden außerdem hohe Anforderungen gestellt.
Wie wir oben bereits gesehen haben, ist die Leistungspflicht nicht objektiv und starr, sondern sie orientiert sich an der Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers. Eine „objektive Normalleistung“ gibt es aus rechtlicher Sicht nicht. Dennoch: Ein Arbeitnehmer kann seine Leistung nicht selbst bestimmen, das Direktionsrecht liegt beim Arbeitgeber, und er muss außerdem seine Leistungsfähigkeit ausschöpfen.
Unterdurchschnittliche Leistungen müssen aber nicht notwendigerweise bedeuten, dass er seine Leistungsfähigkeit nicht ausschöpft5.
Dem gegenüber steht die Tatsache, dass das deutliche und längerfristige Unterschreiten des durchschnittlichen Leistungsniveaus anderer Arbeitnehmer oft für den Arbeitgeber der einzige erkennbare Hinweis ist, dass der Arbeitnehmer seine Leistungsfähigkeit nicht ausschöpft.
Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts müssen Arbeitgeber aber eine Minderleistung von mindestens einem Drittel gegenüber dem Durchschnittsniveau anderer über einen längeren Zeitraum hinweg nicht akzeptieren. Der Arbeitgeber kann in diesem Fall zur Kündigung berechtigt sein.6
2.2 Eigene Definitionen für Minderleistung
Wie wir sehen, ist es relativ schwierig, arbeitsrechtlich einen klaren und eindeutigen Eindruck davon zu bekommen, was als Minderleistung anzusehen ist.
Mein Ziel ist aber auch ein anderes: Vorgesetzte sollten nicht erst abwarten, bis es zum arbeitsgerichtlichen Prozess kommt, sondern früher erkennen, ob Mitarbeiter die an sie gestellten Anforderungen auf Dauer erfüllen können oder nicht, damit sie frühzeitig geeignete Maßnahmen treffen können. Das müssen ja nicht gleich gerichtliche Auseinandersetzungen sein. Manche Minderleister sind sogar froh, wenn der Arbeitgeber ihnen Veränderungen vorschlägt und nicht mehr die gleichen hohen Anforderungen wie vorher an sie gestellt werden.
Immerhin können wir aus dem Arbeitsrecht mitnehmen, dass es zwar keine objektiven Maßstäbe gibt, aber eine Orientierung der Beurteilung von Leistungspotentialen am durchschnittlichen Leistungsniveau erlaubt ist.
Ich schlage deshalb zum Einstieg in das Thema zwei eigene Definitionen vor: Die des „echten“ Minderleisters und die des „harten“ Minderleisters.
Echte Minderleistung
liegt dann vor, wenn unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Ausnutzung angemessener Förderungsmaßnahmen Mitarbeiter die Anforderungen verschiedener Positionen, die ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung entsprechen, dauerhaft nicht erfüllen können.
Harte Minderleistung
liegt dann vor, wenn unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Ausnutzung angemessener Förderungsmaßnahmen Mitarbeiter die Anforderungen verschiedener Positionen, die ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung entsprechen, dauerhaft nicht erfüllen wollen oder es nicht können und nicht einsehen, dass sie es nicht können.
2.3 Stufen von Minderleistungen
Die beiden Definitionen sollen der Tatsache gerecht werden, dass es nicht nur eine einzige Form der Minderleistung gibt, sondern dass sich innerhalb des Begriffs der Minderleistung weitere Unterscheidungen treffen lassen. Ich möchte Ihnen deshalb noch einige Beispiele für weitere diesbezügliche Ausprägungen geben, bevor wir uns weiter mit den beiden oben definierten Formen der Minderleistung beschäftigen.
2.4 Temporäre Minderleistung
Temporäre Minderleistung liegt vor, wenn jemand vorübergehend über einen längeren Zeitraum hinweg die Anforderungen an die eigene Stelle nicht erfüllt.
Dieser Fall dürfte nicht selten sein. Selbst der Beste hat gelegentlich eine Schwächephase, private Probleme oder besondere Verpflichtungen, die ihn daran hindern, das Leistungspotential auszuschöpfen, über das er eigentlich verfügt. Ebenso betrifft diese Definition Fälle, wo jemand noch in einer Einarbeitungsphase ist, oder besondere Umstände bei der Arbeit es ihm erschweren, seine Leistung in vollem Umfang zu erbringen.
Für mich sind dies die leichteren Fälle in der Personalarbeit.
Ich selbst hatte einmal einen Mitarbeiter, der durchaus leistungsfähig war, aber gelegentlich zu einer gewissen, nun, sagen wir, Überbetonung des „Life“ in der „Work-Life-Balance“ neigte. Als er mir nicht mehr direkt unterstellt war, sondern einem meiner Manager, bemerkte ich einen Leistungsabfall, den der neue Manager noch nicht einschätzen konnte. Daher kümmerte ich mich selbst um das Problem und sprach mit diesem Mitarbeiter. Nach einem zweistündigen Feedbackgespräch hatte ich mit freundlichen Worten deutlich gemacht, dass ich diesen Leistungsabfall sehr wohl bemerkt hätte und nun wieder die alte Leistung erwartete, da keine privaten oder beruflichen Umstände erkennbar waren, die den Mitarbeiter an einer höheren Leistung hinderten. Interessanterweise sah der Mitarbeiter nach anfänglichen Versuchen der Relativierung das Ganze am Ende des Gesprächs - mangels entlastender Argumente - durchaus ähnlich.
Nun ja, wenn es sich einfach um jemand mit einem gesunden Hang zur Faulheit handelt, der es einfach mal versucht, wenn sich die Chance bietet, der die Kritik aber sofort versteht und sie einsieht (insbesondere wenn sein Chef dafür bekannt ist, den Worten Taten folgen zu lassen), dann haben wir es gewiss nicht mit einem schweren Fall von Minderleistung zu tun…sondern einfach mit einem Filou.
2.5 Positionsbezogene Minderleistung
Positionsbezogene Minderleistung liegt vor, wenn jemand dauerhaft die Anforderungen an eine bestimmte Position nicht erfüllt. Dann erbringt der Betreffende für die spezifische Position nicht die geforderte Leistung, kann aber an anderer Stelle seinem Ausbildungsstand und seiner Erfahrung entsprechend eingesetzt werden.
Positionsbezogene Minderleistung ist ebenfalls nicht selten zu beobachten. Es kommt immer wieder vor, dass ein Mitarbeiter auf einer Position eingesetzt wird, ohne dass er selbst oder sein Vorgesetzter zu Beginn erkennen, dass der Mitarbeiter von seinem „Skill-Set“ her den Anforderungen an diese Position nicht gerecht werden kann.
Gerade junge Mitarbeiter machen sich manchmal Illusionen über die konkrete Ausgestaltung einer bestimmten Stelle. Es fehlt ihnen noch an Lebens- und Berufserfahrung, um einschätzen zu können, ob die konkrete Ausgestaltung der Stelle ihrem Leistungsspektrum tatsächlich entspricht, oder ob sie vielleicht damit überfordert sind. Aber auch Vorgesetzte, die eine Position neu besetzen wollen, handeln oft voreilig, zum Beispiel, wenn eine lange vakante Position dringend wieder besetzt werden muss.
„Dafür haben wir ja die Probezeit!“, heißt es dann, oder: „Da können wir noch ein wenig mit Fortbildung nachhelfen, wenn es nicht so klappen sollte.“ Oder stellen Sie sich nun ganz einfach diese Situation vor: Wenn ein junger akribischer und eher introvertierte Mitarbeiter, der bislang in der Buchhaltung gearbeitet hat, es nun auf einmal im Direktvertrieb versuchen möchte. Das ist nicht jedem gegeben. Doch weiß man das immer schon vorher?
Nun, wenn das so einfach wäre. Es gibt einfach Positionen, bei denen ein Mitarbeiter sowohl unterfordert sein kann, was sich höchstwahrscheinlich negativ auf seine Motivation auswirkt, als auch gleichzeitig überfordert, weil ihm trotz guten Willens und guter Ausbildung Teile des Aufgabengebiets entweder nicht liegen, er keine Freude daran hat oder er tatsächlich mit den genauen Aufgabenstellungen nicht gut umgehen kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass der gleiche Mitarbeiter nicht an anderer Stelle ganz hervorragende Arbeit leisten kann. Zum Beispiel, weil eine andere Aufgabe seinem Ausbildungs- und Erfahrungsstand viel eher entspricht oder weil sie ihn stärker motiviert und seinen ganz persönlichen Stärken, Neigungen und Interessen besser entgegen kommt.
Hier kommt es bei der Personalarbeit ganz besonders darauf an, solche Mitarbeiter nicht zu früh als Minderleister abzustempeln, sondern sie ganz im Gegenteil möglichst fair zu behandeln und ihnen eine zweite Chance zu geben.
2.6 Auswirkungen von Minderleistungen
Betrachten wir nun einmal die Auswirkungen von Minderleistungen. Werden Minderleistungen frühzeitig erkannt, so können - jedenfalls in den meisten Fällen - frühzeitig geeignete Maßnahmen getroffen werden, um entweder dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter wieder in der Lage ist, die Anforderungen zu erfüllen, oder auf andere Weise dafür zu sorgen, dass das Problem gelöst wird. In vielen Fällen werden Minderleistungen jedoch entweder nicht rechtzeitig erkannt, oder es wird zu lange versäumt, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Es kann aber auch sein, dass es ganz einfach schwierig ist, in einer bestimmten Organisation die rechtlich und betriebswirtschaftlich notwendigen Maßnahmen rechtzeitig und in angemessener Weise zu treffen oder durchzusetzen.
Häufig wird auch der Fehler gemacht, Minderleistung ausschließlich an den Arbeitsergebnissen eines Mitarbeiters festzumachen, ohne dass genau klar ist, wie diese Ergebnisse eigentlich tatsächlich zustande gekommen sind.
So passiert es nicht selten, dass Kollegen einen Minderleister in Schutz nehmen, und aus Solidarität Arbeiten von ihm übernehmen, ohne dass dies dem Chef gegenüber kenntlich gemacht wird. In gut organisierten Abteilungen ist es überdies oft so, dass Routinearbeiten auch von schwächeren Mitarbeitern einigermaßen mühelos erledigt werden können, solange keine Ausnahmen von der Regel vorkommen. Das Problem entsteht meist erst dann, oder besser gesagt, es wird dann offenkundig, wenn solche Mitarbeiter plötzlich auf sich alleine gestellt sind, keine Fragen an andere Kollegen mehr richten können und ihnen ungewohnte Entscheidungen abverlangt werden.
Sind Minderleistungen längere Zeit unerkannt geblieben, so sind oft bereits eine Reihe von Schäden eingetreten, die sich zum Teil nicht wieder beheben lassen. Besonders gravierend ist es, wenn es sich bei dem Minderleister um eine Führungskraft handelt.
Direkte Auswirkungen
Direkte Auswirkungen von Minderleistungen sind häufig Folgende:
Unerledigte, unvollständige Arbeiten
Qualitätsmängel
Zeitverlust
Ggf. Kosten für Nachbesserungen
Zusatzarbeit für frustrierte Kollegen, die die Schäden beheben müssen
Zusätzlicher Aufwand für Feedbackgespräche, Abmahnungen, Kündigungen
Indirekte Auswirkungen
Reputationsschäden, schlechter Ruf der Abteilung/Organisation
Beeinträchtigung des gesamten Betriebsablaufs durch Flaschenhälse (Minderleister)