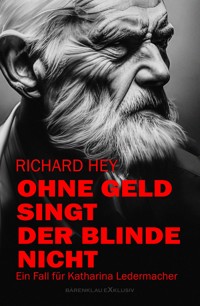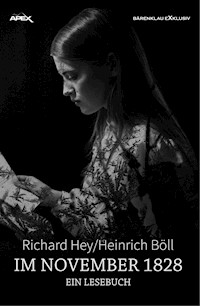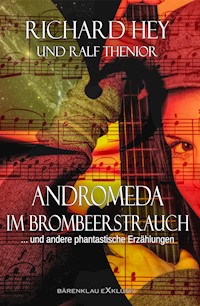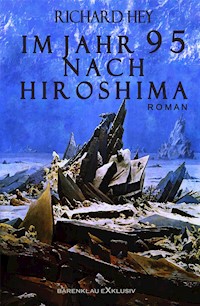Die schlafende Schöne in Formalin und andere frühe Erinnerungen – Autobiografische Momentaufnahmen E-Book
Richard Hey
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Erinnerungen, wie sie einem jeden erscheinen, gibt es keine Chronologie. Die Abfolge, Intensität, Länge und Abstände, in denen sie erfolgen, kann nicht vorherbestimmt, nicht beeinflusst werden. Manche sind klar und deutlich, als wären die Dinge erst gestern geschehen, andere sind verblasst, kaum noch zu greifen und dennoch sind es Erinnerungen an ein Leben, das uns formte, uns zu dem Menschen machte, der wir heute sind. Daher ist jede Erinnerung auch Gegenwart und oft sogar ein Stück Zukunft, denn wer aus der Vergangenheit lernt, kann Gegenwart und Zukunft beeinflussen.
Mit Distanz, wo sie nötig ist, mit Nähe, wo er sie zulassen kann, mit Witz, den er auch in gar nicht komischen Situationen zu finden wusste, mit einem großen Maß an Fantasie, die sein Leben bestimmte, erzählt Richard Hey Geschichten aus der Zeit, die ihn prägte. In Momentaufnahmen voller Poesie und Schilderungen erschreckend genau, berichtet er, wie er als Jugendlicher den Krieg erlebte und überlebte, davonkam und die ersten Jahre nach dem 8. Mai 1945 als »Neugeborener« mit Geliebter und späterer Frau verbrachte. Und warum es Hoffnung für diese Welt nur durch die Frauen geben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Richard Hey
Die schlafende Schöne in Formalin
und andere frühe Erinnerungen
– Autobiografische Momentaufnahmen –
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven, 2022
© aller Fotos im Innenteil mit freundlicher Genehmigung von Renate von Mangoldt/ Berlin, 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die schlafende Schöne in Formalin
und andere frühe Erinnerungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Mitten im Konzert
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Von Richard Hey sind folgende Romane und Kurzgeschichten ebenfalls erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
In Erinnerungen, wie sie einem jeden erscheinen, gibt es keine Chronologie. Die Abfolge, Intensität, Länge und Abstände, in denen sie erfolgen, kann nicht vorherbestimmt, nicht beeinflusst werden. Manche sind klar und deutlich, als wären die Dinge erst gestern geschehen, andere sind verblasst, kaum noch zu greifen und dennoch sind es Erinnerungen an ein Leben, das uns formte, uns zu dem Menschen machte, der wir heute sind. Daher ist jede Erinnerung auch Gegenwart und oft sogar ein Stück Zukunft, denn wer aus der Vergangenheit lernt, kann Gegenwart und Zukunft beeinflussen.
Mit Distanz, wo sie nötig ist, mit Nähe, wo er sie zulassen kann, mit Witz, den er auch in gar nicht komischen Situationen zu finden wusste, mit einem großen Maß an Fantasie, die sein Leben bestimmte, erzählt Richard Hey Geschichten aus der Zeit, die ihn prägte. In Momentaufnahmen voller Poesie und Schilderungen erschreckend genau, berichtet er, wie er als Jugendlicher den Krieg erlebte und überlebte, davonkam und die ersten Jahre nach dem 8. Mai 1945 als »Neugeborener« mit Geliebter und späterer Frau verbrachte. Und warum es Hoffnung für diese Welt nur durch die Frauen geben kann.
***
»Es gibt keine Chronologie, nur Querschnitte durch eine dicke Salamiwurst, deren Abfolge und Abstände immer willkürlich sind, egal welches wissenschaftliche System, welches sonstige Ordnungsbedürfnis oder welche Gefühlsaufwallung sie veranlassen. Dann hast du einen Haufen Salamischeiben, die du zu einer neuen Zeitwurst zusammenziehen kannst.«
(John Federbaum, Physiker)
»Es ist gerade noch hell genug, um zu sehen, dass es anfängt, dunkel zu werden.«
(Hans Arp, Maler, Bildhauer, Dichter)
RICHARD HEY, SEPTEMBER 1985
Die schlafende Schöne in Formalin
und andere frühe Erinnerungen
Autobiografische Momentaufnahmen
1.
Erinnerungen? Jede Erinnerung ist Gegenwart. Den Mann hasse ich noch heute, der mir im November 1938 an der Frankfurter Hauptwache eine Ohrfeige gab, weil ich seiner Meinung nach zu dicht am Gleis der sich nähernden Trambahn stand und seine Ermahnung nicht beachtete. Ich war zwölf und kannte mich aus, in der Breite der Wagen der Linie 23. Trotzdem trat ich, eingeschüchtert, einen halben Schritt zurück. Irgendwo in der Nähe wurden die zersplitterten Schaufenster jüdischer Geschäfte zugenagelt. Ich hör das Hämmern noch, seh noch das kantige Gesicht dieses so anmaßend um mein Leben besorgten Mannes, weiß auch noch, was ich ihm danach jahrelang wünschte: Siechtum und grauenvolle Wunden im Krieg, Krepieren und namenlos Verscharrtwerden. Oder wenigstens eine demütigende Entnazifizierung. Nun ja, da war ich schon milder. Aber nie konnte ich aufhören, ihn zu hassen, nie ist er aus meiner Gegenwart verschwunden.
*
Ständig und unabsichtlich mit Erinnerungen zu leben muss nicht notwendigerweise damit zu tun haben, dass jemand alt wird (was ich gelegentlich, leicht befremdet, an mir feststelle). Die Beatles, nur als Beispiel, Musiker voller, überwältigender, jugendlicher Gegenwart, hatten schon mit knapp über zwanzig ihre Erinnerungen (»Penny Lane«). Und Kinder, kaum auf der Welt, erinnern sich bekanntlich genauer als jeder Erwachsene. Ohne mit ihnen konkurrieren zu können: Erinnerungen begleiten mich seit eh und je. Kein Tag, keine Stunde ohne sie. Sicher geht’s auch andern so. Vorausgesetzt, sie lassen Erinnerungen zu. Aber ich brauch Erinnerungen außerdem als Handwerkszeug. Das liegt, zugegeben, meistens unordentlich herum, zwischen Vergesslichkeit und Beschönigungen. Mir genügt, dass es immer vorhanden ist, wenn ich Hilfe für meine Erfindungen suche. Doch Erinnerungen verändern sich auch, verändern sich dauernd, je nach Chemie des Körpers, dessen Gehirn sich erinnert, verändern sich schon dadurch, dass sie zitiert werden. Aber sie bleiben. Während, was geschehen ist, unwiederbringlich versinkt. Nichts wiederholt sich identisch mit sich selbst. Kein Teilchen, sagen uns die Physiker, wird, egal in welcher kommenden oder vergangenen Zeit, genau wieder dort sein, wo es jetzt ist. Damit muss leben, wer mit Erinnerungen lebt. Ich kann den Mann, der mich geohrfeigt hat, jetzt nicht mehr zur Rede stellen, kann nicht Zurückschlagen. Er bleibt mir für immer. Aber ich hab ihn verloren.
2.
Zwei Tage vor der Ohrfeige ließ meine Mutter mich und meinen jüngeren Bruder nicht zur Schule gehen. Wir wohnten damals in einer ruhigen Straße am Holzhausenpark. Vor der Nachbarvilla hatte sich eine drohende Menge versammelt. Mit Brecheisen und Balken versuchten junge Männer in das Haus einzudringen, die geschlossenen Rollläden vor den Fenstern auszuhebeln. Der alte Herr Rothschild, der hier wohnte, allein mit einem Foxterrier, war mir nicht besonders sympathisch. Oft ließ er den Hund morgens gegen die Straßenlaterne pinkeln, die neben unserm Gartentor stand. Und ich musste auf dem Weg zur Schule an der frisch angepissten Laterne vorbei.
Mein Vater, Gerichtsmediziner, war wie jeden Morgen schon früh über den Main nach Sachsenhausen gefahren, in sein Institut. Meine Mutter rief ihn an, bat ihn, schnell zurückzukommen. Das tat er denn auch, bahnte sich mit dem Wanderer-Kabriolett vorsichtig einen Weg durch die Belagerer, ging ins Schlafzimmer, zog sich um, trat dann, in brauner Amtswalteruniform samt Parteiabzeichen und Eisernem Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg, ans Gartentor, redete mit kaum erhobener Stimme, aber sehr deutlich, sehr entschieden auf die Leute ein: »Wenn Sie alle nicht sofort hier verschwinden, hole ich die Polizei.« Und tatsächlich, die Leute, der Autorität gehorchend, trollten sich. Herr Rothschild sei, hörte meine Mutter später, noch am selben Tag nach Paris entkommen. Offenbar mit Hund. Denn die Laterne blieb von da an trocken.
Dies Beispiel deutscher Schizophrenie gehört zu den unentschlüsselbaren Bildern, die mir von meinem Vater geblieben sind. Zwei Jahre später starb er, knapp achtundvierzig Jahre alt, und was immer ich danach über ihn erfuhr, ist voller Widersprüche. Als Kind fürchtete ich den Ernst, die Strenge dieses Mannes, der nie mit Vater oder Papa angeredet werden wollte, nur mit Vornamen, als wär er mein Kumpel. Doch der durchdringende Blick der großen hellen Augen des Kumpels war schwer erträglich. Besonders, wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte. Als ältester von drei Brüdern hatte ich selten ein gutes.
Und unsere junge neue Haushaltshilfe kriegte einen roten Kopf, ließ das Tablett mit Sonntagsbraten, Erbsen, Kartoffeln und Sauce aufs Parkett fallen, als mein Vater sie ansah und nur wissen wollte, ob sie an den Zucker für seinen Salat gedacht habe. Aber meine Mutter erzählte auch, er habe eines Nachts laut und falsch singend vor ihr gekniet, händeringend, armeschwenkend die Oper parodiert, aus der sie gerade gekommen waren. Und dass er gern Rheinwein trank, Rüdesheimer Berg, weiß ich noch, und gut tanzte. Aber nur mit Marie-Therese, geborene Welter.
*
Ich seh noch sein unbewegtes, ganz und gar verschlossenes Gesicht, als wir beide am Radio saßen und Hitlers Rede zum Kriegsbeginn hörten: »Ab heute fünf Uhr fünfundvierzig wird zurückgeschossen!« Um ihm zu gefallen, rief ich: »Hoffentlich dauert der Krieg lange genug, dann kann ich noch Soldat werden.« In Wahrheit hatte ich die größte Angst davor. Mein Vater reagierte nicht. Dasselbe unbewegte Gesicht hatte er gehabt, jetzt fällt’s mir wieder ein, als Hitler irgendwann Mitte der dreißiger Jahre durch Frankfurt fuhr, umsäumt von begeistert tobenden Menschenmassen. Mein Vater hob mich hoch, damit ich den Führer sehn und wie die andern »Heil!« schreien konnte. Er selbst blieb stumm. Und wieder dieses Gesicht bei der ersten Kommunion meines jüngeren Bruders, in der Kirche St. Georgen. Er bekreuzigte sich nicht, sang nicht, faltete nicht die Hände, stand nur da und sah zu, gänzlich außerhalb der Zeremonie.
Aber der Jesuitenpater, der St. Georgen Vorstand, war ein- oder zweimal bei uns zu Gast, um mit meinem Vater über psychopathologische Probleme zu diskutieren. Ein schöner alter Mann, stattlich, mit wehenden, weißen Haaren. Wie ich mir damals den lieben Gott vorstellte. Die Kirche, habe er gesagt, so meine Mutter, sei für diejenigen da, die allein den Weg zu Gott nicht fänden. Wer aber den Weg zu Gott allein gehen könne, brauche die Kirche nicht. Für die Kirchenoberen war ein Geistlicher mit dieser Einstellung schwer tragbar. Da er auch seine Ablehnung der Nazis kaum verhehlte, arbeiteten Gestapo und Kirchenleitung zusammen, und er wurde in ein entlegenes Dorf versetzt. Dort, ohne seine Bibliothek, verkümmerte er und starb bald. Weil ich schon früh nichts mehr von dem glaubte, was ein Christ zu glauben hat, bin ich nach dem Krieg, sowie das möglich war, aus der Kirche ausgetreten. Mein Vater blieb in der Kirche, auch als überzeugter Nationalsozialist.
Der war er zumindest in Greifswald, wohin er 1928, nach Bonner Oberarztjahren, einem Ruf als Professor folgte, und sicher auch noch anfangs in Frankfurt, wohin er 1934 berufen wurde. Ich war damals acht und konnte mir nicht vorstellen, dass es jemanden gab, dessen Ruf mein Vater folgen würde. Wenn einer rief, war er’s. Übrigens rief er nie mit erhobener Stimme. Immer war er ernst, ruhig und höflich, und er küsste meiner Mutter die Hand, wenn er abends aus dem Institut kam. Nach dem Novemberpogrom 1938 trug er das Parteiabzeichen nicht mehr am Revers seiner stets dunkelgrauen Anzüge. Aber in den ersten Frankfurter Jahren nahm er noch gelegentlich an SA-Kameradschaftsabenden teil. Bloß, dass er da kein Bier trank wie die anderen Parteigenossen, sondern aus einem Krug mit Deckel Sekt, den ein instruierter Kellner unauffällig nachfüllte. Dazu rauchte er seine Zigaretten mit goldenem Mundstück. Dumpfe Kameraderie, wie er das nannte, war seine Sache nicht. Und holte sich einen arbeitslosen SA-Mann als Institutsdiener. Der wurde dann in kurzer Zeit zum kenntnisreichen Gehilfen im Labor und bei Sektionen, besser als mancher Assistenzarzt.
*
Wir lebten zunächst im Westend, Freiherr-vom-Stein-Straße, gegenüber der kleinen englischen Kirche, in einem Etagenhaus mit großen Wohnungen, unweit der Synagoge. Freitagabends hörte ich, schon im Bett, die Schritte der Juden auf dem Bürgersteig vorm Haus, Trappeln, Scharren, Stimmen. Noch gab es die Mendelssohnstraße. Aber auch schon das Hermann-Göring-Ufer. Und an unserm Vorgartenzaun einen Schaukasten mit dem »Stürmer«. Denn in der Etage über uns wohnte der neue Oberbürgermeister. Und eifrige Parteigenossen dachten wohl, der »Stürmer« gehöre zum Oberbürgermeister. Nur mochte der das antijüdische Hetzblatt nicht, mein Vater noch weniger, der evangelische Propst im Parterre schon gar nicht, und der Gerichtspräsident im dritten Stock war rechtlich schockiert. So einigten sich die Herren schnell, und der Schaukasten wurde abmontiert.
Etwa um diese Zeit bekam mein Vater Besuch von einem Freund. Seinem besten, sagte meine Mutter, vielleicht seinem einzigen. Er war zwar manchen Kollegen lose freundschaftlich verbunden, anderen aber galt er wegen seiner Parteizugehörigkeit als Verräter humanistischer Ideale, besonders in Greifswald. Das gab sich dann in Frankfurt, als mehr und mehr Professoren Parteimitglieder wurden. Doch er muss, wenn auch fachlich hoch geschätzt, im Grunde ziemlich allein gewesen sein. Nun also saß Professor Riesser bei uns im Wohnzimmer, Pharmakologe, von den Nazis aus der Leipziger Universität gejagt, weil Jude. Die Studenten hatten zunächst heftig gegen die Entlassung des beliebten Lehrers protestiert, so war ihm noch ein Semester zugestanden worden. Die Frist war abgelaufen, die Studentenschaft gleichgeschaltet, Riesser brauchte Rat und Hilfe des Freundes. Oft habe ich mich gefragt, wie diese Freundschaft möglich gewesen sein konnte. Eine Antwort habe ich nicht gefunden. Damals war ich kaum neun, und als ich kurz ins Wohnzimmer gerufen wurde, um meinen Diener zu machen, sah ich einen schon älteren Mann im Sessel sitzen, Tee trinkend mit den Eltern, und am Ohr, was mich sehr interessierte, ein Hörgerät. Ich hatte mitgekriegt, dass Riesser Jude war, und irgendwo, in der Schule, auf der Straße, mal aufgeschnappt, dass Juden, wenn sie nicht hören können, eben fühlen müssen. Daher fand ich es klug von Riesser, eine Hörhilfe zu benutzen.
Erst Jahre nach dem Tod meines Vaters war meine Mutter in der Lage, mir zu berichten, was Riesser an diesem Nachmittag von seinem Freund zu hören bekam. In Zeiten wie den unsern, habe mein Vater erklärt, da es um die nationale Erneuerung Deutschlands gehe, dürfe man das große Werk nicht allein den Leuten von der Straße überlassen. Auch und besonders die Intellektuellen seien gefordert, klare Entscheidungen zu treffen. Und sosehr es ihn schmerze, er könne und wolle der notwendigen Entscheidung nicht ausweichen. Fortan sei es ihm unmöglich, einen Juden zum Freund zu haben.
Meine Mutter war entsetzt und widersprach. Aber mein Vater blieb bei seinem Entschluss. Und die gute Ehefrau fügte sich. Riesser gelang es, mit seiner Frau nach Belgien auszureisen. Dort starb er, bevor die Nazis ihn mit ihrer Kriegsmaschine einholen und ermorden konnten. Meiner Mutter blieben Scham- und Schuldgefühle. Nach dem Krieg erfuhr sie, dass und wo die Witwe von Riesser überlebt hatte. Sie schrieb ihr, bat sie um Verzeihung. Sie musste das loswerden. Eine Antwort erwartete sie nicht. Aber es kam eine, kühl und höflich: Was damals geschah, sei ja nun vergangen, dennoch danke für den Brief und alles Gute. Meiner Mutter half es, die Erinnerung an jenen Nachmittag zu ertragen.
Denn Marie-Therese war nie auf der Seite der Nazis gewesen. Schon diese kacke-farbenen Uniformen! (Sie äußerte sich damenhafter.) Das Gebrülle, Fahnengeschwenke! Die stumpfsinnigen Lieder! Das menschenverachtende Arier-Getue! Aber vor allem: dass viele der von ihr geliebten Schriftsteller nicht mehr gelesen werden durften. Sie war gelernte Buchhändlerin, hatte die Ausbildung bei ihrem Vater durchgesetzt, keine Kleinigkeit für ein Mädchen vor dem Ersten Weltkrieg. Aber sie wollte nicht zu Hause sitzen und Staub wischen, bis jemand käme, um sie zu heiraten.
Ich weiß nicht, ob der Kölner Schreinermeister Welter viel von Büchern hielt. Ich vermute, eher nicht. Doch sicher hatte Marie-Therese in ihrer Mutter eine Fürsprecherin. Die war zwar gut katholisch, gebar acht Kinder, ging aber leidenschaftlich gern ins Theater, versäumte keine Premiere. Der Schreinermeister ließ es zu. Vielleicht, weil es seinem neuen gesellschaftlichen Status entsprach. Er hatte sich inzwischen auf Schaufenstereinrichtungen spezialisiert.
Durch die Reparationszahlungen, die nach dem Krieg 1870/71 von den Franzosen an das Deutsche Reich zu richten waren, blühten Handel und Gewerbe, viele Geschäfte wurden eröffnet. Welter kam zu Wohlstand, konnte Marie-Therese nach Grenoble ins Pensionat schicken, wurde vorübergehend sogar Millionär. Bis er, ungeübt im Umgang mit Geld, in der Inflation 1923 fast alles wieder verlor. Da wird es ihm schon recht gewesen sein, dass seine Tochter inzwischen ihr eigenes Geld verdiente. Zuvor musste er jedoch hinnehmen, dass Marie-Therese nicht in Köln bleiben mochte. Sie wurde Angestellte einer Leihbücherei für Arbeiter in Kassel, wunderte sich allerdings, dass die Arbeiter nicht zu bewegen waren, Goethes »Faust« zu lesen. Bei aller Weltzugewandheit: Immer hatte sie etwas leicht Weltfremdes an sich. 1918 arbeitete sie in einer Kieler Bibliothek.
Da bekam sie im November ein Telegramm ihres Vaters: ES IST REVOLUTION KOMM SOFORT NACH HAUSE.
Manchmal denke ich, sie hat erst durch das autoritäre Telegramm erfahren, dass unmittelbar vor ihren Bücherregalen tatsächlich eine Revolution stattfand. Auch dass sie während der vierundzwanzigstündigen, chaotischen Bahnfahrt nach Köln zwischendurch in einem Hamburger Stundenhotel übernachtet hatte, begriff sie zunächst nicht. Sie hielt den ständigen Lärm in den anderen Zimmern, die Stimmen, das Treppengepolter für Begleiterscheinungen der Revolution. Was sie in gewisser Hinsicht ja auch waren.
In Köln arbeitete sie bald wieder in einer Bücherei, wischte zu Hause Staub und ging mit der Mutter ins Theater.
Eines Tages hörte sie von einer älteren Freundin der Mutter, medizinisch-technische Assistentin im nahen Krankenhaus, dass da ein junger Arzt im Sterben liege, weil er sich bei einer Obduktion mit Leichengift infiziert hatte. Ob sie diesem so sympathischen Dr. Rolf Hey, um den sich sonst niemand kümmere, nicht eine Freude mit ihrem Besuch machen wolle.
Marie-Therese war nicht danach, einen ihr unbekannten Sterbenden zu trösten. Aber dann ging sie doch hin. Und sah einen zu ihrer Überraschung durchaus beeindruckenden Mann, der mit zwei Mädchen, die links und rechts neben ihm auf dem Krankenbett saßen, angeregt plauderte und Sekt trank. Offenbar fand auch er sofort Marie-Therese beeindruckend. Die Mädchen verschwanden. Aber mich gab’s erst vier Jahre später.
3.
So wusch ich denn bürgerlich-akademisch auf. Alle Vorfahren meiner Mutter waren Bauern und Handwerker gewesen, auch Schiffer auf dem Rhein und Fischer, sowie durch Suff heruntergekommene, kleine rheinische Landadelige, und im siebzehnten Jahrhundert eine lebenslustige, rothaarige Wirtin, die in Köln als Hexe verbrannt wurde. Vergebens hatte sich der Jesuit Friedrich Spee für sie eingesetzt. Das alles fand mein Vater heraus, weil er gezwungen war, Ahnenforschung zu betreiben. Der Ruf nach Frankfurt war gefährdet. Jemand hatte Marie-Therese als Jüdin denunziert. Sie sah in der Tat nicht eben germanisch aus, sondern mit ihren dunklen Haaren und den großen braunen Augen eher italienisch. Wahrscheinlich hatten vor zweitausend Jahren römische Legionäre in Köln einige Gene hinterlassen. Da er nun mal dabei war, kümmerte sich Rolf auch um die eigenen Vorfahren. Die waren ebenfalls Bauern und Handwerker gewesen, vor allem Schneider und Nagelschmiede. Aber auch ein Rittergutsbesitzer fand sich, der alles, was er besaß, verspielte. Rolfs Vater war der Erste in der Familie mit einem solide gehobenen Beruf: Beamter. Vom Postrat in Berlin-Schöneberg zum Karrieregipfel in Bad Godesberg.
Ich erinnere mich an die Glückwunschkarte zu einem Geburtstag von mir mit der Unterschrift: »Dein Großvater Postdirektor Hey«.
Dieser Mann war ganz und gar preußisch und ganz und gar katholisch zugleich, eine verheerende Mischung. Er muss als Familientyrann selbst für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beispiellos gewesen sein. Warum er seinen Sohn Rudolf Albert Camillus nicht mochte, bleibt ungeklärt. Der galt ihm erst was als Professor. Mit dem schmückte er sich dann. »Mein Sohn, der Herr Professor, hat kürzlich gesagt …« Aber eine ganze Kindheit, eine ganze Jugend hindurch kujonierte er ihn, verbot ihm zum Beispiel die Beschäftigung mit Musik, etwa Querflöte zu lernen, setzte ihn auch ständig herab, vor dem ein Jahr älteren Bruder Richard, dem er, als es ans Studieren ging, Hundertzwanzig Goldmark monatlich gab, während Rolf lediglich achtzig erhielt. Aber die Brüder verstanden sich und teilten, was sie hatten. Selten und nur in Andeutungen äußerte sich Rolf zu alldem. Doch Marie-Therese hatte schon bald den Verdacht, der Postdirektor verarge es Rolf sogar, dass nicht er, Rolf, sondern Richard im Ersten Weltkrieg getötet wurde, abgeschossen als Flieger. Um den Postdirektor milde zu stimmen, bekam dann der erste Enkel, ich, den Namen des abgeschossenen Fliegers. Ich weiß nicht, ob das dem Postdirektor viel gebracht hat.
Vielleicht hatte, mehr noch als Rolf, seine ältere Schwester Maria unter dem Vater zu leiden. Die Mutter, wie in solchen Familien üblich, litt stumm mit, widersprach nie. Und Maria verließ am ersten Tag ihrer Volljährigkeit, damals der einundzwanzigste Geburtstag, für immer das elterliche Haus in Godesberg, ging zurück nach Berlin, lernte Krankenschwester, sehr harte Jahre für ein ganz allein auf sich gestelltes Mädchen in der brutalen Großstadt, sagte sie später, aber nichts im Vergleich zu Godesberg. Irgendwann 1910 oder 1911 schickte sie der Mutter ein Telegramm aus Bremerhaven: Für den Fall, dass die Mutter sie noch einmal sehen wolle, in zwei Tagen fahre ihr Dampfer nach New York. Wie nicht anders zu erwarten, verbot der Vater seiner Frau, die missratene Tochter aufzusuchen. Maria wurde dann amerikanische Staatsbürgerin und Mitbegründerin der Gewerkschaft der Krankenschwestern in den USA. 1933 schrieb sie Rolf, mit den Nazis werde nichts als Unheil kommen, sie rate ihm dringend, in die USA überzusiedeln, als Pathologe könne er hier leicht eine für ihn geeignete Universität finden. Manchmal frage ich mich, was wohl aus uns allen geworden wäre, hätte Rolf nicht den Rat der Schwester in den Wind der nationalen Erneuerung Deutschlands geschlagen.
*
1966, während einer Amerikareise, konnte ich diese außergewöhnliche Frau noch kurz vor ihrem Tod kennenlernen. Sie lebte in Santa Monica, in einem Wohnwagen, der im Garten des Hauses ihrer Tochter abgestellt war. Sie wollte das so, mochte keine vier Wände um sich. Das intensive Blau ihrer Augen erinnerte mich an die Augen meines Vaters. Aber diese Augen durchbohrten mich nicht, sondern umarmten mich gleichsam, voller Wärme die von blauen Augen sonst ja eher selten ausgestrahlt wird.
Wärme! Die hatte es in meiner Kindheit und Jugend nicht gegeben, jedenfalls nicht innerhalb der Familie. Marie-Therese bekam im Lauf der Jahre ihre drei Söhne, die kaum jemand der schmächtigen, meist blassen Frau zugetraut hätte. Was sie gelegentlich ärgerte. Denn die Kinder hatten ja, wie es so schön heißt, ihre Ordnung. Nichts fehlte, für alles wurde gesorgt. Nur erinnert sich keiner von uns, je von der Mutter umarmt worden zu sein. Oder gar geküsst. Sie sei eine Frau mit verschüttetem Temperament, erklärte sie mir Jahrzehnte später. Aber Rolf, der als Verschütter infrage kommt, war ja selbst verschüttet. Und, wer weiß, vielleicht sogar der Postdirektor. Mag sein, auch der Schreinermeister. Zur Etablierung und Festigung der bürgerlichen Kultur gehören offenbar verschüttete Temperamente. Zu ihrer Zerstörung ebenfalls.
Nicht leicht für so bevorzugte Kinder, wie wir es waren, sich da ohne Wärme zurechtzufinden. Wäre nicht Erna Bachl gewesen, unsere letzte Kinderfrau, die mir Wärme gegeben hat, mich empfänglich gemacht hat für weibliche Nähe, mir Mut gemacht hat, Gefühle nicht nur zu haben, sondern auch zu zeigen, die meine Phantasie (Geschichten erfinden, mich verkleiden, imaginäre Landkarten zeichnen) auf heitere Weise ernst nahm, dabei immer ganz konkret, ganz unsentimental blieb, die Dutzende Spiele wusste und schöne Lieder. Ich weiß nicht, unter wie viel Schutt auch mein Temperament begraben läge. Wie war ich verstört, als ich hörte, Erna wird heiraten, einen Sparkassenangestellten, uns also verlassen. Doch blieb sie nach Rolfs Tod meiner Mutter und uns verbunden, sagte, als sie selbst schon Kinder hatte: Aber ihr seid doch meine ersten Kinder gewesen. Als mein Vater einmal zufällig sah, wie sie das jüngste ihrer ersten Kinder umarmte, meinen damals noch sehr kleinen Bruder, verbot er ihr, seine Söhne zu umarmen. Sie tat es trotzdem. Was dieses Mädchen, Tochter eines armen Handschuhmachers, den Professorensöhnen fürs Leben gebracht hat, war, da bin ich sicher, nicht weniger wichtig als die humanistische Bildung, mit der es jetzt losging bei mir und von der sich letzten Endes doch nur Bruchstücke erhalten haben.
RICHARD HEY, SEPTEMBER 1985
4.
Mein neues Leben als Sextaner des Lessing-Gymnasiums begann zunächst mit einer Enttäuschung.