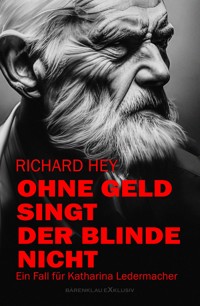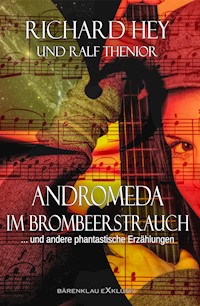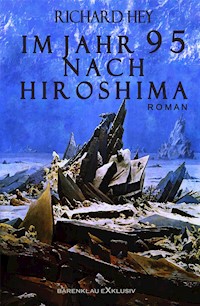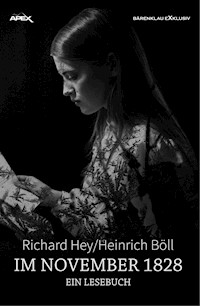
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Richard Hey gehörte zu den bedeutendsten Dreh- und Hörbuchautoren seiner Zeit. Aus seiner Feder stammen unter anderem auch Vorlagen für Tatort-Krimis. Bekannt wurde Hey aber auch durch seine Kriminalromane und -erzählungen sowie zahlreiche Hörspielefassungen nach Romanvorlagen wie ›Der Name der Rose‹. Er erhielt einige Auszeichnungen unter anderem den Kurd-Laßwitz-Preis für seinen Roman IM JAHR 95 NACH HIROSHIMA sowie den Friedrich-Glauser-Preis der Criminale in der Kategorie ›Ehrenpreis‹.
Das hier vorliegende Richard Hey-Lesebuch gibt einen kleinen Einblick in Heys Schaffenswerk und soll dem Leser die Möglichkeit eröffnen, neue und vielleicht unbekannte Seiten Heys kennenzulernen. Es enthält neben den Beiträgen EIN KRIMINELLES VERWIRRSPIEL, MITTEN IM KONZERT, DER FALL MARTINSSON, JONNY HILVERSUMS FRAUEN und der Erzählung GOTT auch sein Debüt-Hörstück 19. NOVEMBER 1828, welches er zusammen mit dem späteren Nobelpreisträger Heinrich Böll für den RIAS Berlin verfasst hat, denn auch bei Böll gilt es immer wieder etwas zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Richard Hey / Heinrich Böll
Im November 1828
Ein Lesebuch
Impressum
Copyright © by Authors/
› 19. November 1828 © Heinrich Böll & Richard Hey (aus: "Heinrich Böll. Werke. Band 7. 1953-1954." Herausgegeben von Heinz Schnell in Zusammenarbeit mit Klaus-Peter Bernhard. © 2006, Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Köln).
Copyright © dieser AusgabeBärenklau Exklusiv, 2022
Cover: © by Christian Dörge nach Motiven , 2021
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichten sind frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Im November 1828 – Ein Lesebuch
Ein kriminelles Verwirrspiel
1.
2.
3.
4.
5.
Mitten im Konzert
19. November 1828
Der Fall Martinsson
1.
2.
3.
4.
5.
Jonny Hilversums Frauen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gott
Über die Autoren
Richard Hey
Der Autor Heinrich Böll
Das Buch
Richard Hey gehörte zu den bedeutendsten Dreh- und Hörbuchautoren seiner Zeit. Aus seiner Feder stammen unter anderem auch Vorlagen für Tatort-Krimis. Bekannt wurde Hey aber auch durch seine Kriminalromane und -erzählungen sowie zahlreiche Hörspielefassungen nach Romanvorlagen wie ›Der Name der Rose‹. Er erhielt einige Auszeichnungen unter anderem den Kurd-Laßwitz-Preis für seinen Roman IM JAHR 95 NACH HIROSHIMA sowie den Friedrich-Glauser-Preis der Criminale in der Kategorie ›Ehrenpreis‹.
Das hier vorliegende Richard Hey-Lesebuch gibt einen kleinen Einblick in Heys Schaffenswerk und soll dem Leser die Möglichkeit eröffnen, neue und vielleicht unbekannte Seiten Heys kennenzulernen. Es enthält neben den Beiträgen EIN KRIMINELLES VERWIRRSPIEL, MITTEN IM KONZERT, DER FALL MARTINSSON, JONNY HILVERSUMS FRAUEN und der Erzählung GOTT auch sein Debüt-Hörstück 19. NOVEMBER 1828, welches er zusammen mit dem späteren Nobelpreisträger Heinrich Böll für den RIAS Berlin verfasst hat, denn auch bei Böll gilt es immer wieder etwas zu entdecken.
In diesem Buch sind folgende Beiträge enthalten:
Ein kriminelles Verwirrspiel - Richard Hey
Mitten im Konzert - Richard Hey
19. November 1828 - Heinrich Böll und Richard Hey
Der Fall Martinsson - Richard Hey
Jonny Hilversums Frauen - Richard Hey
Gott - Richard Hey
***
Im November 1828 – Ein Lesebuch
von Heinrich Böll und Richard Hey
Ein kriminelles Verwirrspiel
Kriminalerzählung von Richard Hey
1.
Alfons Maria Breuer saß am Schreibtisch, im üblichen teuren Flanellanzug mit Weste, Telefonhörer am Ohr, hustete, machte Notizen. Ihm gegenüber saß Renate Reschke in Rock und braver Bluse, hielt ebenfalls einen Telefonhörer ans Ohr, schrieb und kritzelte auf einen Zettel. Es war früher Morgen, Mitte März. An den grauen Fensterscheiben lief Regenwasser hinab.
Fünf Tage Smog waren zu Ende. Aber seit Berlin zur Stadt mit der höchsten Luftverschmutzung in Europa geworden war, erfrischte auch der Regen die Bronchien nur noch mit zusätzlichen Säureanteilen.
Auf Fensterbrett, Schränken und Regalen kämpften Blumentöpfe mit Usambaraveilchen, Azaleen, Pfennigbaum gegen Schadstoffe und Dreck von draußen. Aus den anderen Büros kam durch die angelehnten Türen Schreibmaschinengeklapper. Links nebenan riss jemand Schubladen auf und knallte sie wieder zu. Rechts nebenan zischte eine Kaffeemaschine. Viele Arbeitstage begannen so.
»Mal genauer«, sagte Breuer mit melancholischer Stimme und blickte mit melancholischen dunklen Augen über die Azaleen vor dem Fenster in den Regen. »Wo habt ihr sie gefunden?«
»Was denn«, sagte Renate Reschke, »lebt er oder lebt er nicht?« Sie schüttelte unwillig den Kopf. Aber die spraygefestigten dichten aschblonden Haare bewegten sich kaum.
»Und wieso seid ihr sicher, dass es eine Türkin ist?«, fragte Breuer. »Ach. – Ja, dann könnte es sich …«
»Gut«, sagte Renate Reschke und stopfte sich die Bluse in den Rock. »Welches Krankenhaus? – Und wer hat die Fotos gemacht? – Na, die werden danach sein.«
»Nein«, sagte Breuer, »sie heißt anders. Ja, um die könnte es sich handeln. Renate weiß, wie sie heißt. Sie hat mit der Mutter …«
»Ich will sofort mit dem Jungen reden. Bleibt mit ihm in der Wohnung«, sagte Renate. Und Breuer fast gleichzeitig: »Die Mutter rennt doch seit zwei Monaten von Abschnitt zu Abschnitt und fragt nach der vermissten Tochter, ihr kennt die Frau bestimmt. – Ja, die …«
»Nein«, wiederholte Reschke, »in der Wohnung. Ich will mir die Wohnung anseh’n.«
Breuer drehte den Kopf vom Telefonhörer weg, fragte Renate: »Wie heißt das vermisste türkische Mädchen?«
»Yildiz. – Nein, Breuer hat mich was gefragt.«
Breuer reichte ihr den Telefonhörer. »Bitte buchstabier’ ihm das mal.«
»Gib her. Und hier«, sie gab ihm ihren Telefonhörer. »lass dir inzwischen erklären, wo diese Wohnung – Reschke. Das vermisste Mädchen heißt Yildiz. Ypsilon, i ohne Punkt – die Türken haben nun mal ein i ohne Punkt. Laura, Dora, Isidor, nein, nicht Siegfried. Zacharias. Yildiz.«
»Heidelberger Straße?«, fragt Breuer, »war ich noch nie. Ist die am Heidelberger Platz?«
»Ich hab’ Fotos von der Vermissten«, sagte Renate, »keine sehr guten, aber ihr könnt, wenn ihr vergleicht … Wie? Aber wer die Leiche abtransportiert hat, muss doch Fotos … ach so. Naja. – Moment, Nachnamen hab’ ich auch, warte.« Sie suchte unter den Papieren auf ihrem Schreibtisch. »Verdammt, ich hab’ mein Notizbuch bei PTU liegenlassen. Nein, ich hab’s hier.« Sie blätterte. »Afgan heißt sie. Yildiz Afgan. – Keine Ahnung, warum eine Türkin Afgan heißt. Bei uns gibt’s ja auch Leute, die Franzos oder Däne … eben. Hör mal, ihr bringt sie in die Leichenschau …«
Breuer schrieb wieder mit. »Von der Sonnenallee her, ja. Direkt an der Mauer, ja. Kann’s mir vorstellen.«
»Ich benachrichtige die Mutter«, sagte Renate. »Die Eltern, in Ordnung. Die kommen dahin. Bis gleich.« Sie beugte sich vor und legte den Telefonhörer auf Breuers Apparat, während Breuer erklärte: »Nein, ich hör gerade, sie fährt erst noch in die Invalidenstraße. Sie kommt also später.«
»Das schaff ich nicht. Du musst zu diesem Jungen, wenn ich zu dem toten Mädchen soll.«
»Ich hab’ den Schreibtisch voll, mit Pleesemann. – Nein, ich rede mit Renate.«
»Über Pleesemanns Gift brütest du seit Wochen.«
»Wenn Renate es nicht mehr schafft, komm ich. Ja. Bis später.« Er warf den Hörer auf Renates Apparat. »Wirklich, Pleesemanns Gift …«
»Muss warten«, sagte Renate.
Breuer sah sie an. Von seinen Augen hieß es im Referat, sie könnten Frauen schwach machen. Aber es schien, er nutzte diese Fähigkeit, wenn es eine war, kaum aus. Er war Ende Zwanzig und lebte allein, gesetzt wie ein Fünfzigjähriger, hatte selten eine Freundin: und wenn, zog er sich regelmäßig nach wenigen Wochen zurück. Er verwendete seine Augen allenfalls dienstlich. Aber Renate kannte den Blick schon. Er seufzte. »Reschke. Es gibt Kriminalbeamte, die sind besser im Regen. Zu denen gehörst du. Ich sag das voller Bewunderung. Du stehst im Leben. Du langst zu. Und es gibt Kriminalbeamte, die sind besser am Schreibtisch. Die Popler. Die Kreuzworträtsellöser. Zu denen gehör ich.«
»Du sollst ja dein feines Flanell nicht in den Regen halten«, meinte sie kühl. »Du sollst in die Wohnung eines vierzigjährigen Oboisten, der von einem zwanzigjährigen Kellner niedergestochen wurde. Kein Überfall, kein Raubversuch. Vielleicht Streit.«
»Sind die schwul?«
»Könnte sein.«
»Auch das noch.«
Sie stand auf, schob ihm ihren Notizzettel hin. »Der Junge heißt Otmar Renz, hat sich vor fünfundzwanzig Minuten bei der Inspektion Sonnenallee gemeldet und erklärt, er hätte einen Mann in dessen Wohnung totgestochen. Die sind sofort los und haben den Oboisten auf dem Sofa gefunden, vier Messerstiche, lebt aber noch.«
Sie holte ihren Regenmantel aus dem Schrank. Er überflog den Zettel. »Krankenhaus hast du nicht aufgeschrieben.«
Sie zog den Mantel über. »Urban. Was ist mit dem türkischen Mädchen?« Er hielt ihr einen Zettel hin. »Sag’s mir lieber. Ich komm mit deiner Kreuzworträtsellöserschrift nicht klar.«
»So geht’s vielen«, sagte Breuer. »Zwischen der S-Bahn Unterführung Großgörschenstraße und dem Friedhofseingang hat ein Steinmetz seine Werkstatt. Da lag sie im Vorgarten, zwischen zwei Mustergrabsteinen. Kein Anzeichen für einen gewaltsamen Tod. Entweder ist sie über den Zaun geklettert und anschließend gestorben, oder man hat die Leiche über den Zaun gekippt.«
»Wenn sie Fotos gemacht hätten, wüssten sie’s.«
»Der Arzt dachte, sie lebt noch. Man hat sie sofort ins Klinikum gefahren. Keine Papiere, aber typisch türkisch gekleidet. Kopftuch und so weiter. Auch der Schnitt des Gesichts und die dunklen Haare sollen typisch türkisch sein.«
»Was ist typisch türkisch?«
Breuer schob die Pleesemann-Akten beiseite. »Frag den Kollegen.«
»Ich brauch einen Dolmetscher«, murmelte Renate, schon in der Tür zum Nebenzimmer.
Er hörte noch, wie sie nebenan Anweisung gab, einen Streifenwagen zu Frau Afgan zu schicken. Er seufzte und rief PTU-Chemie an, redete zehn Minuten über die Notwendigkeit, den Schwimmer aus dem Wasserkasten der Toilette in der Wohnung Pleesemann auf Ablagerungen zu untersuchen, innen, denn der Hohlkörper, aus dem der Schwimmer bestand, musste seiner Meinung nach, darauf war er letzte Nacht gekommen, angebohrt worden sein. Er hörte sich ungeduldig einen Witz des Chemikers an, in dem es um den Zusammenhang von Schwimmer, Brustschwimmerin, und angebohrt ging – »Hab’ ich schon gekannt, bevor ich durchs Abitur gefallen bin«, bemerkte er liebenswürdig und zerrte schließlich, in unergiebiges Nachdenken über das Sexualleben der Chemiker der Polizeitechnischen Untersuchungsstelle versunken, Hut und Mantel aus seinem Schrank, um nach Neukölln zu fahren.
Der Regen ließ nach. Als Breuer den Neuköllner Kanal überquert hatte, sah er links und rechts schöne, seit Jahren herunterspekulierte verwahrloste Bürgerhäuser, sehr alte Bäume, die im August ihre jetzt als Knospen noch kaum erkennbaren Blätter schon wieder verlieren würden, weil der Regen ihnen gerade das Streusalz zwischen die Wurzeln spülte, und ihm fiel die Stille auf. Ein paar Kinder stapften durch Pfützen, Frauen mit Einkaufstaschen huschten um die Ecke, gelegentlich kam ihm ein verbeultes Auto entgegen. Er näherte sich einer kranken Idylle.
Die mit Zeichnungen und Inschriften vollgesprühte Mauer verlief genau in der Mitte der Straße. Gegenüber waren die Häuser unbewohnt, die Fenster zugemauert. Der Oboist wohnte Parterre, in einem lieblosen Neubau, umgeben von Sträuchern und dürren Bäumchen, wenige Meter von der Mauer entfernt. Im langen Flur mit den vielen Türen warteten zwei neugierige Frauen. Ein Streifenbeamter lehnte neben der Tür vor dem Bronzeschild, mit dem Namen: Walter Andreas Lombard und stieß die Tür für ihn auf.
Drinnen war es heiß. Der Fotograf kroch auf dem fadenscheinigen Läufer vor der Couch herum, der Kollege von der Spurensicherung war über die Couch gebeugt und hantierte mit Pulver, Pinsel und Klarsichtfolien. Ein schwitzender Streifenbeamter, dem der Uniformrock sichtlich zu eng wurde, begrüßte ihn, die beiden anderen begnügten sich mit einem Nicken.
»Kombiniertes Wohn-Schlafzimmer, Küche, Bad, mehr ist nicht, Herr Kommissar«, erklärte der Beamte. »Außer dem Blick auf den Friedenswall.«
Breuer sah sich um. Die Einrichtung war karg. Schrank, Schreibtisch, Regal, Couch, Sessel, niedriger Beistelltisch, Fernseher – alles gebrauchter Plunder. Ein paar hübsche Federzeichnungen über der Couch. Griechische Jünglinge, die sich in verschiedenen Positionen umschlangen.
»Geübt hat er im Keller«, fuhr der Beamte fort. »Bei diesen Neubauten geht Oboe noch schärfer durch die Wände als Geige.«
»Sie kennen sich aus«, sagte Breuer und hob den Brief hoch, der auseinandergefaltet auf dem Fernsehapparat lag.
»Ich war fünf Jahre lang im Polizeiorchester, Herr Kommissar, bis zu meinem Motorradunfall. Seitdem habe ich keine Luft mehr für das Horn. Oboe braucht ja noch mehr. Die Luft muss doch durch das enge Mundstück gepresst werden. Wenn Sie einem Oboisten zusehen, denken Sie, der platzt gleich, ist doch so. Deshalb haben sie ja auch alle eine Meise. Diesen Druck im Kopf, wie kann man den zig Jahre aushalten, ohne dass im Gehirn was kaputtgeht, sag ich immer. Seh’n Sie bloß die Bilder.«
»Naja«, sagte Breuer.
»Kerle mit Kerlen. So was hängt sich doch kein normaler Mensch hin.«
»Normale Menschen hängen sich noch ganz andere Sachen hin.«
»So?«
»Röhrende Hirsche im Herbstnebel, Blumen, die im Frühling ihre Knospen öffnen. Nichts als Pornographie.«
Der Beamte sah ihn verständnislos an. »Wie?«
»Ist er vernehmungsfähig?«, fragte Breuer.
»Renz?«
»Der Oboist.«
»Lombard war noch bei Bewusstsein, als wir mit Renz vor der Couch standen.«
»Das hab’ ich mir gedacht.«
»Das hab’ ich mir gedacht?«
»Ja.«
»Wo ist er?«
»Lombard? Im Urban.«
»Renz.«
Der Beamte zeigte auf eine Tür. »In der Küche«, sagte er und versuchte, sich das schwitzende Gesicht mit dem Ärmel abzuwischen. In der Hand hielt er zwei Kassetten.
»Allein?«, fragte Breuer.
»An die Heizung geschlossen.«
»Und die Kassetten?«
»Hatte er in der Hosentasche. Aber da ist nur Musik drauf. Oboe mit Klavier. Habe ich gleich gecheckt«, setzte er hinzu.
Breuer öffnete die Küchentür.
Auf dem Fensterbrett, vor der grauen Spanngardine, saß ein Junge in Jeans und Pullover. Er trug ausgelatschte Tennisschuhe an den ziemlich großen Füßen. Dichte blonde Locken umgaben das blasse, verschlossene Gesicht. Mit einer Handschelle war seine rechte Hand an das Heizungsrohr geschlossen.
»Nehmen Sie ihm das ab!«, sagte Breuer.
»Wenn Sie meinen.« Der Beamte war gekränkt. Aber beflissen schloss er die Handschelle auf.
In der Küchentür zeigten sich der kamerabehängte Fotograf und der Kollege von der Spurensicherung mit seinem Koffer.
»Wir wären so weit.«
Breuer nickte. »Wann haben wir die Abzüge?«
»Wie üblich, Herr Kommissar. Vorgestern.«
Breuer nickte wieder. Die beiden entfernten sich polternd und türenschlagend. Breuer betrachtete den Jungen.
»Sie sind Otmar Renz?«
Der Junge zuckte die Schulter.
»Sie haben zu Protokoll gegeben …«
»Ich hab’ ihn getötet«, sagte der Junge. Er sprach hochdeutsch. Aber jeder Vokal und jeder Konsonant waren berlinisch.
»Herr Lombard lebt noch.«
»Ich wollte ihn töten.«
»Warum?«
Der Junge schwieg. Er blickte Breuer aus großen braunen Augen an, verstört, voller Ablehnung. Breuer hatte noch nie so lange, dichte Wimpern gesehen.
»Ich muss Sie bitten, mitzukommen«, sagte er.
»Ja, sicher«, murmelte der Junge. »Ja.« Er schien erleichtert.
2.
Der Bahnhof lag verlassen. Die S-Bahn fuhr diese Strecke nicht mehr. Als Renate Reschke die Fußgängerunterführung durchquerte, entlang an schmutzigen Backsteinen und zerrissenen Werbeplakaten mit glücklichen, violetten Kühen, wurde sie von einem alten Herrn überholt, der auf einem Fahrrad saß, ganz in Schwarz, mit schwarzer Baskenmütze über den weißen Haaren. Langsam und würdevoll bewegte er das Pedal. Auf dem Gepäckträger war ein Kranz befestigt. »Meiner lieben Frau«, stand auf der Schleife, und: »Zehnter Todestag«.
Rechts von der Unterführung hatte der Steinmetz seine Werkstatt. Geradeaus war der Friedhofseingang.
Sie hörte das helle Hämmern auf Stein aus der Werkstatt, während sie dem alten Herrn zusah. Der stieg vor dem Friedhofsportal vom Rad, schob das Rad ins Eisengitter eines Mietshauses neben dem Eingang, schloss es an, nahm vom Gepäckträger den Kranz und aus einer Aktentasche, die unter dem Kranz gelegen hatte, einen Chapeau Claque.
Mit geübter, ruckartiger Handbewegung klappte er ihn auf. Er verstaute die Baskenmütze in der Aktentasche und stülpte sich den Zylinder über. Dann fielen ihm die Fahrradspangen an den Hosen ein. Er bückte sich nicht ohne Mühe und löste sie und stopfte sie in die Manteltasche. Dann ging er, in einer Hand die Aktentasche, mit der andern den Kranz in halber Höhe vor der Brust haltend, gemessenen Schrittes durchs Friedhofsportal.
Renate näherte sich der offenen Werkstatt. Der hagere, bärtige Mann, der Buchstaben in einen weißgrauen Stein schlug, bemerkte sie, ließ sich aber nicht stören. »Renate Reschke«, sagte sie und hielt ihm ihren Ausweis entgegen. »Kriminalpolizei. Ich hätte ein paar Fragen.« Er hämmerte weiter. Die scharfen Falten in seinem Gesicht schienen sich zu vertiefen. Feiner Steinstaub bedeckte Mütze und Bart, Holztisch, Werkzeuge und Fußboden.
»Wenn’s schnell geht«, sagte er heiser. »Der Stein muss um zwölf klar sein.«
»Also Sie haben das Mädchen hier im Vorgarten gefunden.«
»Ja.«
»Wann?«
»Heute Morgen.«
»Genau?«
»Um fünf. War noch dunkel. Und ekelhaft kalt.«
»Fangen Sie immer so früh an?«
»Wenn der Chef in Termindruck ist. Zwei, dreimal im Jahr. Die Anwohner hier würden mir was husten, kam das öfter vor.«
»Sie sind Angestellter?«
Der Mann legte Hammer und Meißel auf den Tisch, prüfte mit der Hand den Stein.
»Seh’ ich aus wie ’n Chef? Die Steinmetzmafia, die lässt nirgendwo einen von außen groß werden. Da kannst du ein Genie sein. Heirate die Tochter von deinem Innungshäuptling, dann geht’s. Aber wenn du nicht auf die stehst.«
»Sie sagen, es war dunkel. Wie haben Sie gemerkt, dass da jemand zwischen den Grabsteinen lag?«
»Von der Straßenlampe drüben kommt Licht. Da hab’ ich einen Schatten geseh’n. Ich dachte, wieder ein Penner. Das haben wir öfter, dass die bei uns übernachten. Aber für Penner war’s eigentlich zu kalt. Ich bin hin und seh’ die Türkin und ruf die Polizei an. So war’s.«
»Wieso Türkin?«
»Pluderhosen, Kopftuch. Als wäre sie eben aus Istanbul gekommen.«
»Wie lag sie da?«
»Wie soll die dagelegen haben?«
»Ausgestreckt, gekrümmt, auf der Seite, auf dem Rücken?«, schlug Renate geduldig vor.
»Drapiert.«
»Drapiert?«
Der Mann fing wieder an zu hämmern. »Auf dem Rücken und Blumen in den Händen. Wie man Leute im Sarg zurechtlegt.«
»Blumen in den Händen?«, fragt Renate.
»Weiße Rosen.«
»Eine Türkin!«
»Warum nicht?«
»Wieso waren Sie sicher, dass die Frau nicht mehr lebte?«
»Ich hab’ immer eine Taschenlampe bei mir. Pupillenreflexe null, Puls null. Ich war mal Krankenpfleger.«
Er hieb schneller und heftiger auf den Stein. Renate sah ihm zu. Dann sagte sie: »Der Arzt hielt es für möglich, dass sie noch gelebt hat, als die Polizei kam.«
»Ärzte sind immer klüger. Aber dann hat er sie sterben lassen, oder?«
»Ach was.«
»Früher, da galt der deutsche Arzt was in der Welt«, knurrte der Mann und redete weiter aufgebracht in den Stein hinein, während sie schon wegging.
Das Fahrrad des alten Herrn lehnte noch angeschlossen am Gitter.
*
Der bis zur Decke gekachelte niedrige Raum der Leichenschauhalle erinnerte sie jedes Mal an den Kühlraum der Hähnchenfabrik, in der sie vor Jahren drei Monate gearbeitet hatte, um unter hundertzwanzig Hähnchenschlachtern, aus sieben Nationen, einen Mörder zu finden. Die Schreie der Tiere, bevor sie, mit dem Kopf nach unten an eine Art Fließband gehängt, mechanisch getötet wurden, den Geruch von Blut und Eingeweiden konnte sie nicht mehr vergessen. Ihr schmeckte keine Hühnersuppe mehr.
Zu ihrer Erleichterung sah sie Nadja. Die blonde zierliche Frau, Tochter eines Russen und einer Türkin, arbeitete bei Siemens und half manchmal, vor oder nach der Schicht, als Dolmetscherin aus. Renate mochte sie. Schon lange hatte sie Nadja zu sich nach Hause zum Essen einladen wollen. Es war aus irgendwelchen Gründen nie dazu gekommen.
In einer Ecke standen nebeneinander, ohne sich zu berühren, eine leise schluchzende Frau mit Kopftuch und ein großer, dunkler, leicht gebeugter, fast kahlköpfiger Mann mit breitem schwarzem Schnurrbart. Der Mann flüsterte auf die Frau ein. Renate kannte die Frau. Es war die Türkin, die monatelang bei allen Polizeidienststellen nach ihrer Tochter gefragt hatte. »Was sagt er?«, fragte Renate.
»Es ist Allahs Wille«, sagte Nadja. »Man muss es hinnehmen.«
Durch die Schwingtür wurde ein fahrbares Gestell mit der zugedeckten Leiche geschoben. Der kleine Beamte im weißen Kittel, der es schob, bremste es mit leichtem Quietschen und einem vertraulichen Lächeln vor Renate, schlug das Tuch, mit dem der Kopf der Leiche bedeckt war, zurück. Sie sah ein ovales empfindliches Gesicht, das noch jetzt von Schmerz oder Anspannung gezeichnet schien, lange dunkle Haare unter dem Kopftuch.
Der Mann und die Frau waren näher herangetreten. Die Frau blickte kaum hin, weinte auf. »Ist das Ihre Tochter Yildiz?«, fragte Renate.
Nadja wiederholte die Frage auf Türkisch. Die Frau schluchzte.
»Frau Afgan«, sagte Renate. »Bitte sagen Sie uns, ob Sie Ihre Tochter wiedererkennen.«
Sie hörte Nadjas Übersetzung zu.