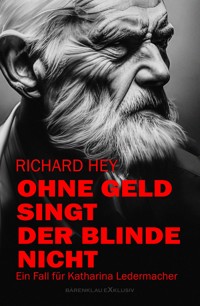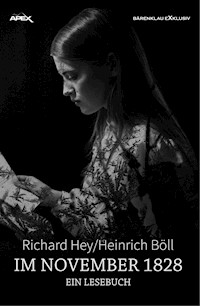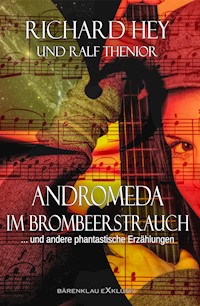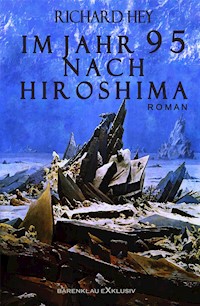3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich entspricht er dem weiblichen Wunschbild vom »neuen Mann«: Er ist sensibel, einfühlend und phantasievoll, er begehrt und liebt die Frauen, ist nicht besitzergreifend, nicht eifersüchtig. Dennoch kann er die, die er liebt, nicht halten, und er ahnt, dass Frauen bei aller Lust an der Freiheit Entschiedenheit bei ihm vermissen: Hannah, die extravagante Jüdin mit traumatischen Kindheitserinnerungen, seine Lebensgefährtin aus »Humboldts Höhle« in Frankfurt, die es immer wieder zu Ahmed nach Marokko zieht, Saskia, die junge schwäbische Schlagzeugerin mit den exotischen Ahnen, und Meta, Mezzosopran im Opernchor.
Karl Werres, genannt Charlie, ist Musiker, er spielt Cello, Jazz, Rock und Klassik, manchmal auch im Frankfurter Jazzkeller. An seinem 50. Geburtstag beginnt er zu erzählen – von seiner Kindheit, von der ererbten »krummen Million«, von seinen Gefühlen, Einsichten, Bedürfnissen, von der Suche nach seinem Doppelgänger, der ihm Ärger mit der Polizei beschert, und immer wieder von seinen Frauen …
Der Krimiautor Richard Hey hat sein bisher persönlichstes Buch geschrieben, einen erotischen Roman im Sinne einer Utopie, weil er vielfältige Versuche beschreibt, ohne Eifersucht, ohne Besitzanspruch und ohne Gewalttätigkeit miteinander zu leben. Ein Liebesroman mit grellen und leisen Tönen, an dessen Ende der Held feststellt, dass nur eine Frau den bedrohten Planeten retten könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Richard Hey
Ein unvollkommener
Liebhaber
Roman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer, 2022
Korrektorat: Antje Ippensen
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Erster Teil: HUMBOLDTS HÖHLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zweiter Teil GUDIMA, UNGEHEILT
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Der Autor Richard Hey
Von Richard Hey sind folgende Romane und Kurzgeschichten ebenfalls erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Eigentlich entspricht er dem weiblichen Wunschbild vom »neuen Mann«: Er ist sensibel, einfühlend und phantasievoll, er begehrt und liebt die Frauen, ist nicht besitzergreifend, nicht eifersüchtig. Dennoch kann er die, die er liebt, nicht halten, und er ahnt, dass Frauen bei aller Lust an der Freiheit Entschiedenheit bei ihm vermissen: Hannah, die extravagante Jüdin mit traumatischen Kindheitserinnerungen, seine Lebensgefährtin aus »Humboldts Höhle« in Frankfurt, die es immer wieder zu Ahmed nach Marokko zieht, Saskia, die junge schwäbische Schlagzeugerin mit den exotischen Ahnen, und Meta, Mezzosopran im Opernchor.
Karl Werres, genannt Charlie, ist Musiker, er spielt Cello, Jazz, Rock und Klassik, manchmal auch im Frankfurter Jazzkeller.
An seinem 50. Geburtstag beginnt er zu erzählen – von seiner Kindheit, von der ererbten »krummen Million«, von seinen Gefühlen, Einsichten, Bedürfnissen, von der Suche nach seinem Doppelgänger, der ihm Ärger mit der Polizei beschert, und immer wieder von seinen Frauen …
Der Krimiautor Richard Hey hat sein bisher persönlichstes Buch geschrieben, einen erotischen Roman im Sinne einer Utopie, weil er vielfältige Versuche beschreibt, ohne Eifersucht, ohne Besitzanspruch und ohne Gewalttätigkeit miteinander zu leben. Ein Liebesroman mit grellen und leisen Tönen, an dessen Ende der Held feststellt, dass nur eine Frau den bedrohten Planeten retten könnte.
***
Erster Teil: HUMBOLDTS HÖHLE
1.
Mal sehn, wie’s weitergeht, dachte ich am Morgen nach meinem fünfzigsten Geburtstag. Das weiß ich noch. Und keine Bilanz. Bilanz, dachte ich, kann machen, wer untergegangen ist. Oder berühmt geworden. Oder unheilbar krank – sagen wir: gelähmt. (Wenn ich meine Hände nicht mehr bewegen könnte!) Nichts davon traf auf mich zu oder hatte ich zu erwarten.
Ich bin nie aufgefallen.
Als Kind war ich ungewöhnlich schüchtern und zugleich ungewöhnlich neugierig, ja gierig. Beide Eigenschaften bekämpften sich rücksichtslos in mir. Dies ständige herrschsüchtige Wüten, dessen Zeuge und Opfer ich war, machte mich wortkarg und großäugig, verlangsamte meine Bewegungen. Infolgedessen galt ich früh als ausgeglichen, friedlich, über meine Jahre hinaus gereift.
Ich erinnere mich; einmal zersprang ich vor Begierde, die Brüste einer Tante zu berühren, die zu Besuch gekommen war. Gleichzeitig hatte ich unüberwindliche Hemmungen, ihr die Hand zu geben. Zitternd (aber ich unterdrückte das Zittern sofort) schob ich mich rückwärts durch die nächste halboffene Tür und stand in der Küche neben dem Sonntagspudding.
Auf der Stelle wollte ich ihn verschlingen, voller Verzweiflung, ganz und gar. Natürlich blieb er unberührt wie die Brust der Tante. Mit einem Glas Milch als Willkommenstrunk für den Besuch kehrte ich zurück, die Hand wurde brav gegeben. »Was für ein lieber, höflicher Junge«, sagte die Tante und lachte.
Sorgfältig verbarg ich meine Phantasien, in denen ich kühner Revolutionär, gerechter Diktator und feuriges samenschleuderndes Genie war, das zu Füßen schöner Frauen Trompete blies.
Mein Vater, der nichts von mir begriff, sah seinen Sohn mit Wohlgefallen. »Den Jungen können wir guten Gewissens erben lassen, was ich so hart erarbeiten musste«, soll er, sagt meine Mutter, ihr öfters versichert haben. »Er wirft das Geld nicht zum Fenster raus.«
Wenn er geahnt hätte, wie sehr ich später dazu bereit war. Bloß unfähig, dafür auch nur das kleinste Fenster zu öffnen. Obwohl ich bald wusste, er hatte sein Geld nicht hart erarbeitet, sondern biedermännisch ergaunert, im November 38, dreieinhalb Jahre nach meiner Geburt, von seinem jüdischen Teilhaber, der ihm für drei Fahrkarten Frankfurt–Paris seine Anteile der Firma Speyer & Werres, Verpackungsmaterial, überließ und ihn damit in die Lage versetzte, Zulieferer der Wehrmacht zu werden sowie nach Krieg und Überwindung einiger magerer Jahre, einiger Unbill und vorübergehender Beschlagnahmungen, auch wieder Zulieferer der Bundeswehr, da bestens eingeführt als zuverlässig, solide, verschwiegen.
Manchmal denke ich, es ist unmöglich, dass meine Mutter über ihren Mann nicht genau Bescheid gewusst hat. Oder über mich. Auch wenn er sich ebenso wenig über seine Geschäfte äußerte wie ich mich über meine Phantasien. Aber sie widersprach weder ihm noch mir. Sie widersprach nie, aus Prinzip. Um unabhängig zu bleiben, wie sie mir eines Nachts, im Luftschutzkeller, wenige Minuten vor ihrem Tod, erklärte.
Ich war gerade neun, die Stadt brannte, mein Vater bewachte inzwischen eine Eisenbahnbrücke im Westerwald, wobei ihn zweifellos der Gedanke an die jüdische Million vaterländisch beflügelte, und das Haus stürzte über uns zusammen. Entsetzt, fasziniert, unversehrt hockte ich ein paar Stunden in Finsternis und Mörtelstaub neben dem Steinhaufen, der meine unabhängige Mutter begraben hatte. Und Papa, kurz von der Brücke beurlaubt, übergab mich einer Tante, deren Brüste mir nichts sagten.
Ihre wachsamen Augen zwangen mich, meine Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, sorgfältiger zu kaschieren, als ich es unter den liebevoll abwesenden Blicken meiner Mutter hatte tun müssen. Immerhin, so was übt. Und als Kind hat man’s ja zunächst auch noch leicht. Man tut, was einem gesagt wird.
Im Laufe der Jahre lernte ich dann, meine Unentschlossenheit mit Witz zu verbergen, mit ihr zu leben, als heiterer folgsamer Junge, als gelassener junger Mann. Oft wusste ich genauer als andere, was in einer bestimmten Situation zu tun oder zu vermeiden gewesen wäre. Entweder tat oder vermied ich’s nicht, weil das, was dagegen sprach, für mich genauso viel Gewicht hatte wie das, was dafür sprach. Oder ich missachtete alle Gegenargumente, weil ich einleuchtend fand, wofür ich mich zu entscheiden hatte.
Dann rechnete ich mit üblen bis verheerenden Folgen meiner richtigen Entscheidung. Die auch meistens eintrafen. Also tat oder unterließ ich gelegentlich was Beliebiges, um mich nicht entscheiden zu müssen, achtete nur darauf, dass es nach Entscheidung aussah. Das wurde allmählich anstrengend. Immer deutlicher empfand ich, so nicht mehr leben zu sollen. Andererseits, wollte ich wirklich was ändern?
Auch das nichts Besonderes. Ähnliche Probleme hat jeder, der in seine mittleren Jahre kommt. Aber bei mir lösten sie irgendwann das Bedürfnis aus, mich dauernd zu bewegen. Wo ich nun hinkam, rannte ich umher.
Meine Freunde gewöhnten sich daran. Ich blieb ja liebenswürdig und redete, meistens, gescheit. Auch die Frauen waren großzügig, hierin. Wie oft bin ich in den angenehmsten Momenten, aus den zärtlichsten Armen, vom Bett gesprungen! Bloß um mal eben durch Küche und Flur zu laufen.
Man kann auch das halbwegs kaschieren. »Möchtest du jetzt nicht was trinken, mein Herz?« In dieser Art. Seit ich Papas krumme Million tatsächlich geerbt habe, die ich niemals akzeptieren wollte, deren Zinsen ich aber dringend brauchte, weil ich unfähig bin, genug zu verdienen, und seit ich professionell Musik mache, gelingt es mir immerhin, mich gelegentlich ganz und gar für die Neugier zu entscheiden. Zum Ausgleich muss ich dann hinnehmen, dass sich die Unentschlossenheit wochenlang wie nasser Flanell über meine Gier legt.
Ich fühlte den Flanell an diesem Morgen. Ich hatte ihn schon gestern gefühlt. Das war alles. Keine Bilanz, wie gesagt. Die üblichen offenen Posten einer üblichen Rechnung, nicht mal addiert. Was hätte eine Addition auch ergeben. (Zu wenig gelebt, zu viel getrunken, zu abhängig von Frauen, zu viel verrückte Musik.)
Auf dem flachen Dach der Tiefgarage unter meinem Balkon lagen neue Trümmer, und über dem Lietzensee stach die Märzsonne durch gehetzte Wolken. Die Dreckbrühe glitzerte fern zwischen immer noch kahlen Ästen, die sich pathetisch bewegten. So begann ich mein neues Lebensjahr.
Nachts zuvor, etwa um die Stunde meiner Geburt (falls Mama, die sich so oft geirrt hatte, auch in der Wahl ihres Mannes, ausgerechnet diesen Zeitpunkt richtig behalten haben sollte), war ein Wirbelsturm durch Berlin gefegt. Der fünfte oder sechste seit vorigem Herbst, seit ich angefangen hatte, mich in dem zerfallenden Kasten zwischen Komfort und Slum einzurichten, nicht im zehnten oder wenigstens siebten Stock, wie sich’s für ein Hochhaus gehört, sondern bloß im ersten. Dafür Nachbar von Halima, Warschauer Ex-Covergirl.
Jeden Monat siedelte sie zweimal endgültig zu ihrem Freund nach Düsseldorf über, von Frau Lehnert, deren Schwiegertochter sie samt verstimmtem Klavier, heiserem Setter und vielen Perserteppichen hier abgestellt hatte, und der sanften Jacqueline, die sich tagsüber jenseits des Aufzugs ohne Hast und Aids-Angst ihren Kunden widmete.
Ich hatte mir die Bettcouch schon fürs Schlafen zurechtgemacht. Sie beansprucht zwischen zerkratzter Balkontür und dem fleckigen, beschädigten Sperrholz des eingebauten Wandschranks die Hälfte des schmuddelig hell gestrichenen Ein-Zimmer-Appartements. In der anderen ist kaum noch Platz für Stuhl, Tisch, Cello und Regal. Ich lag da, nackt, allein, und las Zeitung, trank Cognac mit Selters und sah gelegentlich aus fünfzigjährigen Augen auf meinen fünfzigjährigen faltigen Bauch (No Sports!) und den fünfzigjährigen Schwanz, der auf der Innenseite des immer noch ansehnlichen fünfzigjährigen rechten Oberschenkels ruhte und so tat, als sei er kein halbes Jahrhundert alt, sondern höchstens zwanzig.
Der Tag war wie andere gewesen, mit normalen Beschäftigungen: im Keller üben, dem Flanell entkommen, hinter meinem Doppelgänger erst ergebnislos her telefonieren, dann ergebnislos herfahren, einem verlegenen Mann, der sich in der Tür geirrt hatte (diesmal war’s einer in dunklem Zweireiher, etwa so alt wie ich, mit schwarzem Aktenköfferchen), den Weg zu Jacquelines Appartement gegenüber zeigen, Frau Lehnert, die manchmal nicht wusste, wo sie wohnte, aus dem Treppenhaus helfen, in dem sie verwirrt, mit ratlosem Hund, zwischen erstem und zweitem Stock auf und ab stieg.
Post war keine gekommen.
Da meine Geburtstage mir nichts bedeuten, bedeuten sie auch anderen nichts, ausgenommen Hannah. Aber die fuhr gerade in klapprigen Linien-Bussen durchs Atlasgebirge, sehr beschäftigt mit Ahmed Ben Mansour. Obendrein noch damit, den König, der Ahmed jahrelang eingesperrt hatte, sowie den Polizeichef, der ihn persönlich gefoltert hatte, zu einem Interview zu bewegen.
Ich hätte beunruhigt sein müssen. Aber was sie antrieb, diese klarsichtige Besessenheit oder soll ich sagen: eine Art irrational erleuchteter Vernunft – es hatte sie, bisher wenigstens, auch immer auf geheimnisvolle Weise beschützt, sie sicher durch haarsträubende Bedrohungen geleitet. Besonders durch solche, die sie selber verursachte.
Bevor sie abflog, hatten wir uns noch in Humboldts Höhle getroffen, und Hannah hatte gesagt: »Lach nicht. Aber was man in der Geburtstagsnacht tut oder träumt, hat Bedeutung.« Und hatte mich umarmt und gestreichelt. Die polnisch blauen Augen, orientalisch mandelförmig geschnitten, waren unter den tief in die Stirn hängenden schwarzen Haaren (silberne Strähnen dazwischen) voller alttestamentarischer Trauer: »Ich muss zu diesem Marokkaner. Weiß auch nicht, warum. Betrüg uns inzwischen nicht. Es langt, wenn ich das tu. Falls jemand von der Botschaft anruft, sag, ich bin schon unterwegs. Aber es wird keiner anrufen.«
Ich wollte gerade das Licht ausmachen, da hörte ich, der Wind nahm zu. Plötzlich heulte er laut durch alle Ritzen und Schächte des Hochhauses. Ich ging in die Küche. Die ist so geräumig wie die Kombüse eines alten Fischkutters. Mehr als eine dünne Person hat nicht Platz. Wenn man das doppelt isolierte Milchglasfenster öffnen will, muss man den Wasserkessel vom Herd nehmen.
Dann sieht man auf die Kolonnen von vorbeirasenden, bremsenden, anfahrenden Autos, gegen die Ohren kracht der Verkehrslärm. Jetzt zischten Regenbögen über die dunkle leere Straße, prasselten im schwachen Ampel- und Straßenlampenlicht auf parkendes Blech. Keine Eva, keine Marie gegen einen Panda oder Kadett gelehnt, mit grellen Mini-Minis und Hotpants, auch sonst kein Mensch weit und nah, nur eine über die Kreuzung rollende Bierdose, die in Filmen auf Einsamkeit hinweist. Ich stand so da, lange, fast ohne Gedanken. Bis der Sturm mir eine Augenbrauengranne ins Auge zerrte und die Küchenlampe zu klirren anfing.
Ich schloss das Fenster, mit Mühe, ging zurück ins Zimmer und blickte durchs Balkonfenster in Richtung Lietzensee. Nichts war zu erkennen, nur finsterste Finsternis und irgendwo, weit entfernt, ein beharrliches, kleines Licht. Außer den Windgeräuschen hörte ich jetzt auch wohlbekanntes Knirschen, Gepolter, Gekrache. Der Sturm riss, wie schon oft, Stücke der morschen Außenverkleidung aus dem zwölften und dreizehnten Stock. Einige, bevor sie unten dumpf zerplatzten, verbeulten noch mit Kling-dsching-rums, unreines Ges, Es, D, mein eisernes Balkongitter.
Ich zog den Vorhang vor und legte mich wieder hin, jäh flanellbedeckt. Drei Minuten später fiel der Strom aus. Ich blickte durch den Vorhangspalt. Auch das beharrliche Licht war weg. Ich zündete die Kerze an, die seit dem ersten Stromausfall auf dem Hocker neben der Couch liegt. Dabei kam mir eine flanellvertreibende Idee:
Könnte nicht berechenbar sein, wie viele Stürme nötig sind, um in wie langer Zeit das regengeschwächte Hochhaus abzutragen? Mit Taschenrechner, Cognac, Selters, Bleistift und Papier machte ich mich im Kerzenlicht an die Arbeit.
Zu berücksichtigen war nicht nur die durchschnittliche jährliche Anzahl von Wolkenbrüchen und Stürmen über Berlin. Der Letzte hatte mit Teilen der Außenverkleidung auch schon ganze Betonbrocken von der Hochhaussubstanz abgerissen, aus der ständig feuchten Terrassenbrüstung nämlich, wo der Hochhauseigner früher seine Penthouse-Wohnung hatte, samt Rasen, Sauna und Hollywood-Schaukel.
Da war auch der jährlich runterfallende Betonschutt kubikmetermäßig hochzurechnen, der möglichst genau gemutmaßte Inhalt aller oberen Stockwerke ebenso zu berücksichtigen wie die Zermürbungszeit von Eisenbeton (siebzig Jahre, hatte ich gelesen), und mit all diesen Daten, Fakten, Hypothesen, beschleunigten und verlangsamten Abläufen war exakt zu jonglieren und zu extrapolieren.
Bei heruntergebrannter Kerze und zwischen leeren Flaschen hatte ich dann das Ergebnis: Mit sechs Stürmen jährlich und annähernd konstanter Menge von saurem Regen könnte ich es nach einundvierzig Komma drei Jahren geschafft haben. Ich wäre oben und oben hieße: Oberhalb vom ersten Stock würde es kein Stockwerk mehr geben – vorausgesetzt, der Schutt wird wie bisher abgeräumt oder bricht durchs Flachdach in die Tiefgarage. Mit einundneunzig Jahren und vier Monaten endlich oben! Vorübergehend natürlich. Bevor das ganze Hochhaus in der Tiefgarage verschwände, müsste ich ausziehen. Aber einmal hätte ich, unterstützt von Naturgewalten, Luftverpestern und Betonpfuschern, auf der obersten Plattform eines Hochhauses gelebt.
Auf einmal lag Saskia neben mir.
»Was willst du«, murmelte ich und küsste zitternd (aber ich unterdrückte das Zittern sofort) ihre wie immer zu grün getönten Augenlider, die nach Pistazien dufteten (bildete ich mir ein), und ihre kastanienroten Haare. »Du hast mich doch verlassen.«
»Aber geh«, sagte sie.
Sie stand zwischen den Gemüsebeeten von Kloster Eberbach und hielt meine Hand. Es war ein kühler Sommerabend mit ziehenden Wolken vor der untergehenden Sonne. Ich wusste, gleich würden wir uns im klammen Klosterbett umarmen, stundenlang atemloses Gefummel, Gewiege, Gestammel voller Hingabe und Süße, ohne Aufspringen und Hin- und Herrennen zwischendurch. Und am frühen Morgen würde Saskia anfangen zu schnarchen, ich würde es mit aller Anstrengung nicht für Hindemiths Engelskonzert halten, trotz vergleichbarer Lautstärke, ich würde erschöpft an ihrem offenen Mund liegen, eine Hand auf der Wölbung ihres Beckens, wo sie die zarteste Haut hat, und ich würde schlaflos bleiben, mich nicht mehr bewegen, um sie nicht aufzuwecken, würde schlaflos leiden und schlaflos glücklich sein.
»Verlassen!«, schrie ich. »Du siehst doch, was aus mir geworden ist! Ich bin krank an dir! Impotent, ja! Alles in Unordnung! Mein ganzes Leben! Verstehst du?«
Sie saß auf dem Platz vor dem Dom von Mantua, mittags, unter milder Herbstsonne, die Schatten der Tauben glitten träge über die alten Steine, und sie trank Campari.
»Ei was nicht gar«, sagte sie, lachend.
»Ich hab mich doch entschieden!«, schrie ich. »Für dich!«
»Ah ja?«, flüsterte sie, Tränen in den Augen.
»Schneller konnte kein Mann«, schrie ich.
Sie lächelte.
Ich schrie und schrie.
Sie lächelte und lächelte.
Ich wachte auf, in gleißendes Licht getaucht.
Die Lampe neben der Couch hatte wieder Strom. Der Flanell hielt sich, die Neugier darunter auch. Ich war heiser, aber im gewohnten trügerischen Gleichgewicht.
Wenige Stunden später lag ich zusammengeschlagen in einem Charlottenburger Hinterhof, zwischen Müllcontainern, auf den Resten eines verrosteten Kinderfahrrads, weil ein robustes junges Ehepaar mich für meinen Doppelgänger gehalten hatte.
Und wenige Wochen später wurde ich, zu meiner Überraschung und gegen alle Bedenken, aber auch ohne Begierde, eher aus Fürsorge oder Zerstreutheit, der Liebhaber meiner Tochter. Nein, eigentlich wurde ich’s nicht. Ich weiß nicht, was ich da wurde.
2.
Humboldts Höhle nannte Hannah unsere Wohnung in Frankfurt. Wir hatten sie seit elf Jahren, im Parterre eines kleinen zweistöckigen Hauses, das um 1910 ein halsstarriger Architekt zwischen die bürgerlichen Mietshäuser der eng bebauten Humboldtstraße gezwängt hatte.
Kriege, Inflationen und Bauspekulanten waren nicht imstande gewesen, es zu vernichten. Unauffällig, mit bröckelndem Putz, hielt es sich, halb verborgen von wuchernden Vorgartensträuchern, und ließ den großen Garten hinter dem Haus nicht ahnen. Der war schon verwildert, als wir ihn an einem Spätsommernachmittag zum ersten Mal durch die schmutzigen Scheiben der Wintergartenfenster sahen.
Hannah stemmte die kreischende Wintergartentür auf, stieg über verrostete Eisenstufen hinunter und stapfte durch dichtes Gras, Haufen von welken Blättern, Gebüsche und Efeuranken, die von einer haushohen Platane herabhingen, zu einem moosüberwucherten, steinernen Brunnen.
»Alles verkommen«, rief sie mir zu. »Was da investiert werden muss!«
Der hagere alte Herr in Hut und geschlossenem Lodenmantel neben mir hüstelte. »Ich hätt genug Interessenten für die Wohnung, das werden Sie mir glauben. Aber ich würd sie Ihnen lassen. Ich hab Ihren Vater gekannt. Ein aufrechter Mann.«
Er sah der zurückkehrenden Hannah entgegen, die Laub und Zweige aus ihren langen schwarzen Locken schüttelte.
»Die Dame macht Rundfunksendungen?«
»Ja«, sagte ich.
»Gespräche mit Leuten, die was zu erzählen haben, nicht wahr? Interviews, kulturelle und soziale Themen, ja?«
Ich nickte.
»Politik? Biographisches?«
»Auch. Kommt drauf an.«
»Worauf?«
»Ob sie’s durchkriegt.«
»Sie ist nicht mit Ihnen verheiratet?«
»Nein.«
»Nun, dann können Sie sich’s ja noch überlegen.«
Ich betrachtete das strenge knochige Altmännergesicht, dachte mit Unbehagen: Hat er, aufrecht wie Papa, ebenfalls eine krumme Million zu vererben?Verhandeln wir hier von krummer Million zu krummer Million?
»Vielleicht«, sagte der alte Herr, »hätt ich der Dame ja was zu bieten. Was sie durchkriegt. Ich hab genug erlebt, sag ich Ihnen, mehr als genug.«
Und zu Hannah, während er ihren Pullover anstarrte: »Die Frau Doktor, die hier gewohnt hat, war die letzten Jahre schon sehr hinfällig.« Er sah auf. »Da drüben stand der Sessel, in dem sie ihre Nächte verbrachte.«
»Kommen Sie«, sagte Hannah und nahm seinen Arm, »ich zeig Ihnen die feuchte Küchenwand. Da holt man sich glatt den Tod.«
Als er abwechselnd im Keller und beim Mieter im ersten Stock unter Regale und Spülbecken kroch, auf der Suche nach Hauptwasserhahn und defekten Abflüssen, tanzte sie mit mir durch die drei Zimmer, über krachende Bohlen, vorbei an rissigen Tapeten mit scheußlichen Mustern.
»Wir kriegen die Wohnung, wir kriegen den Garten«, sang sie mir ins Ohr. Die Haare flogen ihr um die Anna-Magnani-Nase, die kalmückischen Jochbeine glänzten, und ihre Augen funkelten.
»Magst du den Garten denn?«
»Dummkopf«, sagte sie zärtlich und drehte sich langsam mit mir in den Wintergarten. »Nach einem halben Jahr solltest du mich kennen. Eine alte Jiddsche macht runter, was sie unbedingt haben will. Das ist der schönste Garten, den ich je gesehen habe. Der muss noch viel wilder werden.
Und in der Küche, ach, ist mir doch egal, ob’s da mal durchgeregnet hat oder was. Weißt du, was ich dem Alten gesagt hab?« Sie senkte die Stimme und hauchte dunkel, mit betörendem Vibrato: »Ich bring dir auch jeden Ersten persönlich die Miete, du kleines geiles vertrocknetes Naziarschloch.«
»Das hast du ihm gesagt?«
»Auf Polnisch natürlich.«
Nach einer Woche bekamen wir den Vertrag geschickt, per Adresse Hannahs Zweizimmer-Provisorium im spekulationsgepeinigten Westend. Ich lebte da mit ihr, seitdem feststand, dass ich nicht mehr zu Margaret und Muriel nach Hamburg zurückkehren würde und Hannah nicht mehr nach Wuppertal zu ihrem Friedensforscher, der sie bewusstlos geschlagen hatte, weil sie beim Frühstück zwischen zwei Toasts gesagt hatte, sie hätten wohl besser nicht geheiratet.
Das Haus sollte abgerissen werden, die Treppe war schon ohne Geländer, der Hof lag voller Schutt. Jugoslawische Demontagetrupps zertrümmerten im Auftrag des neuen Hausbesitzers Haustür und Kellerfenster, unmissverständliche Mahnung an uns, die letzten Mieter, endlich abzuhauen.
Der fünfundzwanziggeschossige Hochhausbau mit Wolkenspiegeln der himmelimitierenden Glasfassade, der heute unverkäuflich rumsteht, wurde damals mit Energie geplant. Wir zahlten keine Miete, warteten auf Hausbesetzer, die nicht kamen, und schickten Zahlungsaufforderungen des Hausbesitzers zurück.
Trotzdem zögerte ich, den Mietvertrag für Lodenmantels Wohnung zu unterschreiben.
Ich saß um diese Zeit jeden Tag in einer verwüsteten, leeren Mansardenwohnung auf einem vergessenen Stuhl und schlug mich mit Bach und Brahms herum, probierte Tontricks für meine Sorte Jazz-Rock, ohne Verstärker, Moog & Modul (alles noch in Hamburg beim Spediteur auf Lager), während Hannah zwei verlassene Stockwerke tiefer einen Reisebericht für irgendein liberalprotestantisches Blatt in ihre alte Olivetti hackte.
Ich weiß noch, wir hatten ziemlich warme schwüle Tage, mit dünnem, hellgrauem Himmel über der Stadt, was bedeutete, dass es unter dem Dach unerträglich heiß und stickig wurde. Also spielte ich nackt, lief schon nackt, nur in Sandalen, an der halbnackt schwitzenden Hannah vorbei über die scherbenbedeckten Stufen nach oben, mit meinen drei Instrumenten: Cello, Cognac, Selters, und Pause machte ich nur alle anderthalb Stunden, um die warmgewordene Seltersflasche durch eine aus dem Kühlschrank zu ersetzen.
Einmal schiffte ich in die Regenrinne, das Klo hatten sie längst rausgerissen. Aber Hannah schrie von unten, ob ich verrückt bin, die Seeche pladderte ihr aus der rostzerfressenen Rinne auf den brüchigen Balkon neben die Olivetti. Und sie sei weder fortschrittlich noch verklemmt genug, auch meinen Urin zu lieben.
Könnte an diesem Tag gewesen sein, dass wir anschließend zum Rundfunk gingen, ich erinnere mich, sie riss ein Blatt aus der Maschine und wischte wütend darauf rum. Denn ihr Reisebericht sollte eventuell auch gesendet werden. Deshalb schleppte sie einen Haufen Kassetten mit Original-Ton-Aufnahmen mit.
Und ich wollte mich inzwischen erkundigen, ob jemand schon mal das letzte Gedicht von Hölderlin vertont hätte. Bei der E-Musik wussten sie’s nicht, und bei der U-Musik grinsten sie: na er selbst doch, und fanden sich witzig. Ich sagte, dass ich nicht den U-Sänger meinte, sondern den E-Dichter, und die sagten, E-Dichter kämen als Textlieferanten für Rockmusiker wohl weniger in Frage, und ich sagte, da seien sie ja wohl ganz schön hinterm U-Mond, und schmiss eine Tür, ich, der Höfliche.
Und Hannah, die Unangepasste, Widersetzliche, hatte inzwischen mit damenhaftem Lächeln und liebenswürdiger Konversation den Feature-Auftrag an Land gezogen.
Als wir zurückkamen (ich glaube, wir redeten über das große Fressen, dass wir uns am Abend auswärts leisten wollten), da lagen im Hof noch mehr Trümmer als zuvor, und das Haus schien in einen zarten rosa Schleier gehüllt.
Kein Strom.
Aber Wasser lief noch.
Hannah machte sich sofort auf die Suche nach dem verschwundenen Licht. Es gibt nichts, was sie nicht (wieder) elektrifizieren kann, keinen verborgenen Schalter, den sie nicht entdeckt, keine Leitung, die sie nicht flickt oder anzapft. Ich kam dafür nicht in Frage, meine elektrischen Grenzen sind bekannt, schon zweimal hatte ich durch Kurzschlüsse (wahrscheinlich mit Hilfe von Selters und Cognac) die Verstärkeranlagen in Brand gesetzt.
Ich wollte wieder an meine Musikprobleme, und während Hannah im Fäulnisgestank des Kellers schon Kabel sortierte, warf ich, was ich anhatte, aufs rosagetupfte Bett und rannte nackt hinauf. Da sah ich dann, was wir schon von der Straße hätten sehen können, wenn uns eingefallen wäre, auch nach oben zu blicken und nicht nur in den Hof: das Dach war weg. Die Jugos hatten alle Dachziegel und Dachluken zerschlagen, gründliche Arbeit, in großer Geschwindigkeit ausgeführt.
Notenpult, Bach, Brahms und Stuhl lagen unter Massen zerbrochener Ziegel- und Glasscherben im rötlichen Staub begraben. Ich blickte durchs Holzgerippe des Dachs in die Nachmittagssonne am jetzt klaren Himmel. Dabei entdeckte ich oben auf dem Gerippe, vor dem Schornstein, die kleine hölzerne Plattform für den Kaminkehrer. Und merkte zugleich, ich bekam eine Erektion.
Ratlos, in beiden Händen meine Instrumente, betrachtete ich, was sich unpassend spannte und hob. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es zu mir gehörte. Ohne mein Wissen stimuliert (mechanisch, wie im traumlosen Schlaf), stand ich auf Schutt, Nase und Mund voller Staub, und fragte mich, welche sexuellen Reize denn hier verdammt im Trüben fischten und mir an meinem Bewusstsein vorbei in die Spermien fuhren, dass die Brüder sich zum Absprung fertig machten. Die absolut falsche Reaktion auf was immer es sein mochte.
Dann kam ich drauf. Der Staub! Oh Gott, der Staub. Den kaute auch der Neunjährige, der verklebte ihm in jener Nacht der Finsternis die Atemwege, mit Todesangst neben der erschlagenen Mutter. Irgendwo in einem abgelegenen Winkel meines Gehirns war wohl diese Erinnerung gespeichert, mit dem Zusatz: Nichts ist bedrohlicher.
Offenbar genügte weder die Information der Augen, dass von Finsternis keine Rede sein konnte, noch die Information der Haut, die sich, im leichten Wind, der durch den Dachstuhl ging, durchaus nicht lebendig begraben fühlte.
Staub gleich Tod war stärker.
Und gegen den Tod wurde noch einmal, zum letzten Mal und unnachsichtig, Leben beschworen. So musste es sein. Wie beim Gehenkten, dem Leben und Samen zugleich davongehen (sagt man).
Wahrscheinlich sollte ich, in meiner Finsternis, in meinem Mörtelgrab, sofort über ein Weib herfallen und kurz vorm Verrecken neues Leben zeugen. Aber Hannah hatte Wichtigeres zu tun, und ich wollte auf die Plattform.
Den verbogenen Dachlukenrahmen, der voller Splitter steckte, konnte ich nicht umklappen. So schleppte ich mühsam, anfangs noch ständerbehindert, alle meine Instrumente zwischen den scharfen Glasresten hindurch über die Leiter nach oben vor den Schornstein, setzte mich, Füße und Cello auf einen Querbalken unterhalb der Plattform gestützt, stimmte und begann mit den Übungen, vorsichtig zunächst, damit zu heftige Bogenführung das Cello nicht rutschen und im Schutt unter mir verschwinden ließe.
Als ich mich sicher fühlte und auch die beiden anderen Instrumente nicht verlor, langte ich kräftiger zu. Bis ich jäh begriff: Tod, Sex und Musik, beliebtes Muster feinster Sublimierung. Sex für Tod und Musik für Sex, oh ja, symbolisch, symbolisch. Und das mir! Mit Mama als Sponsorin der Gene. Wenn das nicht aus dem Bilderbuch war.
Vor Unbehagen ließ ich den Bogen aus der Hand rutschen. Er segelte auf den Schutt. Da griff ich mit beiden Händen in die Saiten, sang dazu, so laut ich konnte, rau und langsam über die noch heilen Dächer Frankfurts hin, gegen den Lärm der Straße, was mir jetzt angemessen vorkam, die letzten Verse des E-Dichters, als er schon Jahrzehnte in U-Haft im Turm gesessen hatte: »Das Angenehme dieser Welt hab ich genossen …«
»Was ist?«, rief Hannah aus dem Keller.
»Der Jugend Jahre sind wie lang, wie lang verflossen …«
»Warum brüllst du so?«
»April und Mai und Junius sind ferne, ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne.«
»Komm runter, die Kühlkiste läuft wieder«, sagte Hannah. Sie stand schräg unterhalb von mir im Schutt, außer Atem und lachte.
In den Nachbarhäusern erschienen ein paar Figuren auf Balkons, an Dachfenstern und starrten zu mir rüber. Ich kümmerte mich nicht um sie, blieb noch eine Weile hocken, gegen den Schornstein gelehnt, machte keine Musik mehr, trank nicht, rührte mich nicht, blickte an neuen, alten, halbfertigen Hochhäusern mit riesigen Montagekränen vorbei in Richtung Turm der Katharinenkirche und weiter über die Stadt in den Dunst am Horizont.
Wer weit genug ins Universum blickt, sagen die Physiker, sieht schließlich sich selbst, wenn auch nur von hinten. Was doch wohl heißt: Wer von sich weg will, hat seinen Rücken vor sich.
Ich fragte mich, warum ich nicht endlich den Mietvertrag für die neue Wohnung unterschrieb. Ob das mit Papas krummer Million zu tun haben konnte. Nie hatte ich versucht, den Teilhaber wiederzufinden. Oder seine Erben. Und war doch überzeugt, das Geld unrechtmäßig zu besitzen. Vermutlich ging ich deshalb nicht ans Kapital.
Aber ich hatte auch immer diese vage Idee, irgendwann würde ich das Eigentliche, das Wesentliche meines Lebens erfahren. Ich würde was tun oder hinkriegen, das alles rechtfertigt.
Heute glaube ich, das war nicht mal Selbstbetrug. Es war sentimental und deshalb echt. Nichts als Widersprüche, wahrhaftig. Das Grauen vor aufrechten Männern – und sie gleichzeitig beerben.
Wäre jemand gekommen und hätte erklärt, das Geld gehört ihm, ich hätte es ihm sofort gegeben. Dass niemand kam, war mir auch recht. Mein Preis, inzwischen: schlechtes Gewissen (aber nicht zu sehr), Zahlungen (nicht zu hohe) an Organisationen, die Verfolgten halfen. Gelegentlich beunruhigte mich, dass ich so leben mochte. Aber ich mochte ja so leben. Sollte ich plötzlich, unbehaglicher Gedanke, zu empfindlich geworden sein, um mit Lodenmantel einen Vertrag zu schließen, krumme Million mit krummer Million?
In einer der folgenden Nächte, bei Gewitter, Wolkenbruch und einströmenden arktischen Luftmassen, in Hannahs Armen unter feuchten Bettdecken, auf die es rosa tropfte, erfuhr ich, sie hatte meine Unterschrift längst gefälscht. Ich war erleichtert. Zugleich fühlte ich mich bevormundet. Einerseits reingewaschen von Schuld. Weil Hannah über meine Skrupel lachte. Aber auch tiefer drin in der Schuld, deshalb.
Am nächsten Abend feierten wir den Vertrag in Humboldts Höhle (die es noch nicht war, die es erst werden würde), im Licht einiger Kerzenstummel auf dem vergammelten Parkett, mit Sekt aus Plastikbechern, und die Spur unserer zwischen den Flaschen verstreuten Schuhe, Hosen, Strümpfe, Slips führte vom vorderen Zimmer zum Wintergarten, wo Hannah, nur noch im Pullover, gebückt vor der großen Scheibe stehenblieb, aufs Fensterbrett gestützt, mit im Halbdunkel schimmerndem orientalischen Hintern. Während ich sie umarmte, starrte sie durch ihr gespiegeltes Gesicht in den dämmrigen Garten. Unsere Bewegungen, unser Atemholen ließen das Kerzenlicht und das Gesicht zittern.
»Wird so nicht bleiben«, flüsterte Hannah, »soll aber, soll aber!« Plötzlich stieß sie ihre tief röchelnden Schreie aus, die Wasserstelle-in-der-Wüste-gefunden-Schreie, richtete sich auf, hob die Arme und griff hinter sich, fasste meinen Kopf mit beiden Händen. Ich erinnere mich an die warme bebende Haut unter ihrem Pullover. Nur in unseren ersten Jahren hatte sie diese Haut.
Allmählich ließ das Beben nach. Wir blieben noch lange so steh’n, regungslos aneinandergeklammert, gegen den Fensterrahmen gelehnt, Halbentblößte im Kerzenschein. Bis ich den kühlen Luftzug in den Kniekehlen spürte. Die Tür vom Wintergarten stand offen, wir hatten es nicht gemerkt. Hannah löste sich von mir, führte mich an die rostigen Eisenstufen. Der Garten lag dunkel vor uns, mit schwachen Lichtern von den Nachbarhäusern fern zwischen den Ästen der Platane.
»Der Garten braucht auch was«, sagte Hannah.
Ich dachte an das samenschleudernde Genie meiner Jugendträume. Aber mit Schleudern war nichts mehr. Hannahs hilfreiche Hände bewirkten nur eine kärgliche Benetzung der mittleren Stufe. Da fuhr sie mit der linken Faust durchs kleine Fenster neben der Tür. Das Glas zerplatzte, ich hör noch das hässliche Geräusch, die Splitter klirrten in den Garten.
»Bist du verrückt?«, schrie ich.
»Blut gehört dazu«, erklärte sie und ließ es auf die Stufe tropfen. Ihr Gesicht im Licht der flackernden Kerze hinter uns war schattig und schien mir verzerrt. Wahrscheinlich lächelte sie ihr unergründlichstes slawisches Lächeln.
»Blöde magische Kuh«, murmelte ich und rannte frierend zurück ins vordere Zimmer zu meiner Hose, um nach Papiertaschentüchern für die Hand zu wühlen. Dabei trat ich auf ihre Sonnenbrille.
Anschließend hockten wir im Badezimmer auf dem Wannenrand im trüben Licht einer von Fliegen verdreckten Wandlampe, die uns die Frau Doktor hinterlassen hatte, und zogen uns gegenseitig aus Handrücken und Fußballen die Splitter.
So fingen wir in Humboldts Höhle an. Ich neununddreißig, Hannah einundvierzig, wissend wie Neunzigjährige, arglos wie glückliche Kinder (die wir beide nie gewesen sind) und törichter als alle Kinder und Greise zusammen, die wir je waren oder sein würden.
Schon wenige Tage später hatten wir Fieber. Wir dachten, das kommt von der Aufregung, neue Wohnung, neues Leben, die Liebe ist es, die uns glühen macht. Es war aber nicht die Liebe, es war die beginnende Sepsis. Auf dem Rücken des verletzten Fußes, am Zehenansatz, gegenüber oder besser: Genau oberhalb der zwei, drei kleinen Schnitte am Ballen, die ich mit Pflaster zugeklebt hatte, bekam ich eine Beule. Sie wuchs schnell, war schließlich möweneigroß, aber die normale Hautfarbe veränderte sich nicht. Sie sah aus wie der Grützbeutel an der Stirn des Kinderarztes, den Mama holte, wenn ich Husten oder Windpocken hatte.
Einmal durfte ich den Grützbeutel des Doktors anfassen. Vorsichtig, aber auch neugierig und mit ein bisschen Schaudern befühlte ich das wabbelige Ding, und der Doktor lachte, es schien ihm nicht wehzutun.
Mein Fußgrützbeutel tat weh, ich begriff ihn nicht, konnte in keinen Schuh mehr rein und humpelte in Wollsocken durch die mit Farbeimern vollgestellte Wohnung. Eines Morgens kam ein Freund, ein dicker Kerl mit fettem, blassem Gesicht und kleiner Nickelbrille. Vorher hatten wir ihn zwei- oder dreimal in einer Kneipe getroffen, danach nie mehr.
Es scheint, seine Funktion in unserm Leben war nur, es zu retten, denn kaum sieht er das Möwenei samt rotem Strich vom Fuß bis zum Knie, den ich noch gar nicht bemerkt hatte, sowie den roten Strich von Hannahs Handrücken zum Ellbogen, den sie ebenfalls noch nicht bemerkt hatte, da wird sein Gesicht noch blasser und plötzlich ganz dünn, die Nickelbrille riesengroß.
Er schmeißt den gebrauchten Staubsauger, den er uns zum Einzug schenken wollte, in eine Ecke (nie hat das Ding funktioniert), packt uns, wir lassen es uns, ängstlich geworden, gefallen, und stopft uns in seine alte Karre, schaukelt uns mit Geschepper zu einem Orthopäden.
Auch der wird blass, kümmert sich nicht mehr um die anderen Patienten, pumpt uns mit Antibiotika voll, legt Arm und Bein in Gips, und nach zwei Wochen Injektionen und Gips runter, Gips rauf, erklärt er sachlich, wir seien um Adernbreite am Tod vorbeigekommen, wahlweise an Amputation von Fuß und Hand.
Zu Hause, endlich wieder gipslos, sangen wir zweistimmig, wenn auch etwas belegt, den Choral: »Ich kam abhanden mit der Hand und kam abfußen mit dem Fuß«, Arpwerkeverzeichnis Nummer wasweißich, aber dann kamen uns die Kalauer abhanden, und wir hockten den Rest des Tages still in der Wohnung, vor den in unserer Gipszeit von anderen Freunden weißgestrichenen Wänden, mit Bücher- und Plattensortieren beschäftigt oder mit dem Bohren von Schraubenlöchern in Holzleisten. Was Pascal gefreut hätte, dem schon vor einigen Jahrhunderten aufgegangen war, woher das Unheil in der Welt kommt: Weil die Menschen nicht ruhig in ihren Zimmern sitzen wollen.
Falls auch an diesem Nachmittag und Abend in der Welt gehungert, gefoltert, gemordet, geprügelt, ausgebeutet, vergewaltigt, geraubt, betrogen wurde, an uns kann’s nicht gelegen haben. Wir waren ausschließlich damit beschäftigt zu verstehen, dass wir beinahe gestorben wären – an ein paar blöden Kratzern, die mit unserer verrückten Liebe zu tun hatten. Und wir wollten doch nicht gestorben sein, oh nein, noch nicht, noch nicht, weder an verrückter Liebe noch an was anderem, Nichtverrückten, denn das Angenehme dieser Welt hatten wir ja eben noch nicht genossen, nicht genug jedenfalls, fanden wir. Das sollte jetzt erst kommen, endlich.
Und wir machten kein Licht, als es Nacht wurde, sondern kauerten im Dunkel aneinandergedrängt auf dem Boden, zwischen Regalen, Büchern, Platten, Schrauben, Kassetten, Kissen, Pappkartons, und erzählten uns Geschichten von früher, als wir Kinder waren, und Hannah hielt meinen nicht amputierten Fuß, und ich hielt ihre nicht amputierte Hand.
3.
Die ersten Jahre mit Hannah: Chaos, Verzückung, Schrecknisse, und meistens alles zugleich, ein dreifach geflochtener dunkler Zopf (wie sie ihn damals manchmal asymmetrisch links über Schulter und Brust trug), Ursache und Wirkung unentwirrbar verschlungen, umkehrbar, unwichtig. Dennoch, die Schrecknisse kamen fast immer aus Hannahs Erinnerungen. Und um gegen diese Erinnerungen geschützt zu sein, um gewärmt, behütet, aufgehoben zu sein, machte sie sich (und mir) die Höhle. Zur Beschwörung ihrer Erinnerungen, zu einer erinnerungsverändernden, erinnerungsbeschwichtigenden Beschwörung.
Schon nach wenigen Wochen gab es in der Küche, in Hannahs Zimmer, in Wohnzimmer, Flur und Wintergarten oberhalb von Sesseln, Sofa, Regalen, Kommode und Couch, neben Schränken, Fenstern, Türen kaum noch ein Stück freie Wand, alles war zugehängt, zugepinnt, zugeklebt, mit Fotos, Zeichnungen, Plakaten, Drucken, Holz- und Linolschnitten, kleinen naiven Ölgemälden, Gouachen.
Jedes Bild in einem sorgfältig ausgesuchten schmalen oder breiten, gelegentlich sogar auch kostbaren Rahmen. Und all das, Portraitfotos alter Männer und Frauen aus den letzten achtzig Jahren, Gruppenfotos von Familien, Landarbeitern, Liedertafeln, Scherenschnitte mit Rehen, Jägern, Tannen, Landschaftsidyllen, Plakate mit italienischen Villen und Gärten, alte Veduten (echte), technische Darstellungen, Früchte aus dem Mittelalter, Surreales, Jugendstil, Fin de siècle, Modernes, elegante Damen und Herren, die sich müde umarmten, verblichene deftige Paare beim Ficken in verschiedenen Stellungen, irgendwo auch der sechzehnjährige Arthur Rimbaud mit seinem Satz: »ICH ist ein ANDERER«. – All das hing beieinander, übereinander, zwischen Vasen und Büchern, in einer Ordnung, deren Geheimnis nur Hannah kannte.
Aber auf jeden Betrachter wirkte sie überzeugend, auch wenn er die Zusammenhänge nicht begriff. Viele Bestandteile ihrer Sammlung hatten, für sich genommen und nach üblichem Verständnis, kaum Wert, andere, hinter denen sie lange her war (aber nie viel bezahlt hatte), möglicherweise einen relativ hohen.
Im Grund interessierte sie nur, was sich in ihr großes Gesamtbild fügte, unabhängig vom Marktwert, und dem Betrachter kamen denn auch bald die überkommenen Kunstbegriffe abhanden.
Die wenigsten Bilder packte sie aus Wuppertaler Kisten aus; die tapezierten Wände, die sie mit dem Friedensforscher geteilt hatte, waren ihr gleichgültig gewesen. Aber Humboldts nackte Wände provozierten sie. Knallweiß gestrichen reflektierten sie dennoch, auch tagsüber, nie was anderes als milde Dämmerung – im Sommer zartgrün wegen der Vorgartensträucher und der Platane hinterm Wintergarten, im Winter eher grau wegen Parterre.
Wenn ich an unsere Stromrechnungen denke! Diese Dämmerung war’s, die Hannah brauchte. Weiße Wände, dunkle Rahmen darauf, Dämmerung. Und der Rauch der Pfeife, die sie sich während der Schreibmaschinenhackerei gelegentlich stopfte. Oder, wenn sie kochte (nie anders als bei weit geöffneter Küchentür), die Schwaden von Knoblauch- und Zwiebeldunst zwischen Büchern und Bildern, der Safran-Majoran-Rosmarinduft …
Tagelang ging sie auf Jagd, bei jedem Wetter, kehrte aus Antiquariaten, Auktionen, aus Bruchläden mit Nachlassauflösungen in Bornheim und Sachsenhausen, von fliegenden Händlern am Mainufer, am Eisernen Steg, regendurchnässt, staubbedeckt, schwitzend, aber selten ohne Beute zurück. Ein Wunder, was sie in relativ kurzer Zeit alles ausgrub und zusammenraffte.
Mit Bahn und Omnibussen (Führerschein hatte sie nicht, nie gewollt) fuhr sie in Vororte, feilschte mit Italienern, Griechen, Türken in Fechenheim, Hanau, Vilbel, brauchte oft nicht zu feilschen, bekam mehr als sie wollte geschenkt, sammelte Tipps, Adressen, fuhr weiter ins Hessische, nach Lich bei Gießen, nach Hüttengesäß, Altwiedermus, Sterbfritz und Lieblos (seit meiner Kindheit kannte ich die Namen, war aber nie da), und kam wieder mit Bauernkrimskrams aus dem vorigen Jahrhundert, mit einer kleinen dreieckigen Kommode, mit Bronzeleuchtern, Familienbildern, Stickereien, Melkschemeln, uralten Ansichtskarten, Schnitzarbeiten.
Oft wurden beim Einordnen neuer Einzelteile andere umgehängt. Die Fotos einer alten Frau (etwa 1930) und einer jungen (etwa 1900), beide in zierlichen goldbronzierten Rahmen, mit roten Samtschleifen drapiert, sowie ein kleines Poster mit Rosa Luxemburg wanderten über viele Wände, bis sie, als der Friedensforscher endlich auf Hannahs riesiges Eisenbett mit den vier leuchtenden Messingknöpfen verzichtet hatte, über dem Kopfende des Bettes zur Ruhe kamen, direkt neben einem verblichenen Geburtstagsfoto von mir als Neunjährigem, das unversehrt in der Handtasche meiner Mutter gefunden worden war.
Sträuße getrockneter Blumen in dunklen Farben (Violett, Orange, Rot, Braungelb) standen oder hingen zwischen den Fotos und Bildern, und wenn Hannah einmal ihre goldenen oder silbernen Ketten mit Klunkern, Anhängern, Davidsstern und Fatimahs Händchen nicht trug, baumelten sie in den Blumen.
Überall saßen große und kleine Puppen in Kleidern von 1910 auf Puppen- oder Kinderstühlen oder auf altem Blechspielzeug (Autos, Eisenbahnwaggons) in den Regalen und auf Fensterbänken zwischen wuchernden Grünpflanzen. Sie brachte es sogar fertig, einen starken Zweig der Platane so zu biegen, dass er sich durch das kleine von ihrer Faust zersplitterte Fenster ziehen ließ, und auf diesem Zweig saß dann eine winzige Puppe, die als Stirnreif Hannahs goldenen Lieblingsring mit Rubinsplittern trug.
»Was ist das denn?«
Ich hör noch die norddeutsche Stimme. Ein junger Mann, bärtig, im dreckigen, zerrissenen Parka, zerschrammt, mit einem blutunterlaufenen zugeschwollenen Auge, war plötzlich vom Garten in den Wintergarten gestolpert. Ich lag schief in einem dreibeinigen morschen Korbsessel unter dem Zweig mit der Puppe und las Zeitung, und Hannah malte sich die Zehennägel lila.
»Hallo«, sagte Hannah freundlich.
Wir kannten den Jungen. Er war Soziologiestudent und versuchte seit längerem, ebenso beharrlich wie undialektisch, bei Hannah zu landen.
Damals gefährdete ein progressiver Linker sein Ansehen erheblich, wenn er sich anhaltend um eine fünfzehn Jahre ältere Frau bemühte. Noch dazu um eine, die zwar gelegentlich bei Demonstrationen mitmachte, aber nicht im Parka, sondern in teuren Mänteln und schmuckklirrend. (»Ich verkleide mich doch nicht, wenn ich demonstrieren geh.«)
Mir gefiel, dass Reinhold sein Ansehen gefährdete. Nein, er hieß Ronald. Offensichtlich kam er von einer Demonstration – einer überflüssigen, wie Hannah später erklärte (»Ist doch alles schon gelaufen«).
»Ich dachte, du könntest mir solidarisch das Auge kühlen, Hannah«, sagte Ronald, »aber …« Und er sah angewidert mit dem Restauge auf die Puppe im Zweig. Die war neu für ihn.
Hannah ging hinaus, um ein Tuch und Wasser zu holen, auch Salben und Heilerde, und ich stand auf, um ihm meinen Sessel anzubieten. Er hätte auch noch in zwei anderen morschen Korbsesseln sitzen können. Aber ich war zu beflissen gewesen. Er setzte sich in meinen. Und starrte gleich nach oben, wieder auf die Puppe im Zweig, wiederholte auch nach einer Weile, als Hannah zurückkam, die alberne Frage, streng, ungläubig, wie ein Lehrer, der seine Lieblingsschülerin beim Betrachten von Pornofotos überrascht hat:
»Was ist das?«
»Kitsch«, sagte Hannah.
»Dafür …«, er stöhnte, mehr aus Wut, schien mir, als aus Schmerz, »dafür hab ich mich von den Bullen nicht zusammenschlagen lassen, Bürgerin.«
»Doch«, sagte Hannah und kühlte das Auge.
Er unterließ eine Entgegnung, um den Kühlungs-Prozess nicht zu gefährden, wendete stattdessen mir sein feindselig blickendes, ungekühltes Auge zu: »Wieso sieht man dich nie auf Demos?«
Die Frage kannte ich. Schon in Hamburg, Ende der sechziger Jahre, hatte ich sie gehört. Und nicht beantwortet, was hätte ich auch sagen sollen. Da saßen sie bei uns in Margarets Haus, Brandts Treppe, Blankenese, auf halber Höhe über der Elbe, tranken Tee, rauchten Haschisch (zum Missvergnügen von Margaret, aber sie ließ sie anfangs gewähren), verjagte Bürgerkinder, die Revolution machen wollten.
Was nach dem Sieg der Revolution sein sollte, konnten sie nicht sagen. »Sozialismus natürlich.«
»Aber welcher?«
»Der wahre natürlich.«
»Und wie geht der?«
»Das werden wir schon sehen. Du machst Jura und Musik, das gefällt den Bürgern, du wirst Kulturminister«, sagten sie, »für die Zeit des Übergangs, für die ersten Jahre, bis wir ein neues Recht und eine neue Kunst haben.«
Und dann, sagte ich: »Dann erschießt ihr mich, was.«
»Ja«, sagten sie ernst, »dann erschießen wir dich natürlich.«
»Und die Hafenarbeiter, die heute über euch lachen, wenn die nach dem Sieg der Revolution immer noch über euch lachen, erschießt ihr die dann auch?« Darauf wussten sie keine Antwort. Aber ich will mich, nach fast zwanzig Jahren, nicht über sie lustig machen. Das wäre leicht. Heute weiß jeder über damals Bescheid. Ich fand ja, sie hatten recht, zu stören, zu schreien, sich zu wehren.
Die Politiker, die den Höllensturz des Planeten ins atomare Feuer vorbereiteten; die Generäle, die im Namen der Demokratie Hanoi in die Steinzeit zurückbombten und im Namen des Sozialismus Prag besetzten; die Nazirichter, die im Namen Hitlers Todesurteile gesprochen hatten und ungerührt weiter richteten; die Naziärzte, die mit Spritzen, mit Gas, mit Menschenversuchen gemordet und gefoltert hatten und weiterhin (oder wieder) hochangesehen auf ihren Lehrstühlen saßen; die Professoren, die in versteinerten Universitäten Fossile hüteten – Warum sollten sie alle ungehindert die Welt weiter beschädigen dürfen.
Das war es, was die Jungen bewegte: Sie wollten die verkommene Welt der aufrechten Männer nicht mehr. Der um Vaterland, Parteien und Kultur verdienten erfolgreichen Brüder und Vettern meines unbedeutenden Vaters. (»Aber sie waren ja selber auch bloß Männer, deshalb konnte ihnen nichts gelingen, deshalb sind sie heute geworden, was sie damals bekämpften, und die Welt ist viel verkommener«, sagte Muriel später, die damals noch Hoppe-Reiter auf meinen Knien machte.)
Ich erwähne das alles nur, um zu erklären, weshalb ich nie demonstrieren ging. Ich bezog eine Rente von einem der aufrechten Männer, wie konnte ich die anderen da zum Teufel wünschen. Ich wünschte sie zum Teufel, aber das Geld wollte ich (noch) behalten. Der alte Widerspruch.
Und wenn ich jetzt darüber rede, denke ich, es fällt mir immer noch schwer, verständlich zu machen, warum mein Vater für mich mit diesen anderen aufrechten Männern verbunden war. Es handelte sich ja keineswegs bei allen um Nazis. Aber sie müssen etwas verheerend Gemeinsames gehabt haben. Jedenfalls empfand ich es so. Und das lähmte mich.
Wie beneidete ich die Jungen, die nicht so empfanden und sich befreien konnten. Für mich (glaubte ich) würde es die Befreiung nicht geben. Vielleicht habe ich deshalb immer mehr Musik gemacht. Sublimiert eben. (Mit meiner Abneigung gegen alles, was Sublimieren ist!)
»Er muss zu Gottlieb«, sagte Hannah.
Der Orthopäde war unser Freund geworden. Für Hannah bedeutete das viel. Wer einen weißen Kittel trägt, wird von ihr mit Misstrauen betrachtet. Aber Gottlieb durfte sich jetzt um ihre unregelmäßigen Perioden kümmern. Gleichzeitig versuchte er, ohne die arbeitsnotwendigen Instrumente um die Cognac-Flasche verringern zu wollen, meiner immer wieder drohenden Gastritis beizukommen. Also war ihm auch ein verletztes Auge anzuvertrauen.
Ich fuhr den Jungen hin. Während der Fahrt hielt er das Auge mit einem feuchten Tuch bedeckt und schwieg. Ich hatte seine Frage nicht beantwortet. Das ließ er mich fühlen. Abgesehen davon missfiel ihm, dass ich nach wie vor in den drei mal drei Metern von Hannahs Eisenbett liegen durfte und er nicht. Und schließlich, auch ein Einäugiger konnte sehen, dass mein weißgrüner VW-Bus früher ein Polizeifahrzeug gewesen war. Vielleicht mochte er in diesem Moment nicht daran erinnert werden.
Nach Wochen erfuhr ich (über Hannah), er ist während der Demonstration gegen Bauspekulation und Vernichtung von Wohnraum vor der Alten Oper von einem Wasserwerferstrahl in den Bauschutt geschleudert worden, aus dem der Opernplatz damals bestand. Anschließend (so Hannah) prügelte ein Polizist auf ihn ein, obwohl er halb bewusstlos war. Dann ist er aber doch noch hochgekommen, konnte dem Schläger den Knüppel entreißen und ihm damit einen Rückschlag über die Stirn verpassen. Der Beamte ist in die Knie gegangen, und Ronald gelang es, im Schutz des schreienden, tobenden, steineschmeißenden Gewühls der anderen Demonstranten, durch den Ring der Polizisten hindurch zu kommen, wobei ihm ein Kriminalist aber fast noch die rechte Niere abgedroschen hat.
Als ich Hannah so reden hörte, wurde mir klar, warum Ronald sich nicht ins besetzte Haus in den Kettenhofweg geschleppt hatte, wo er zu Hause war, sondern zu uns. Er wusste, er wurde jetzt gesucht, und er dachte sich, mit Recht, bei uns wär er sicherer als im Kettenhofweg, so nah am Opernplatz. Und wenn er schon hochgenommen würde, dann wollte er lieber uns gefährden.
Heute frage ich mich, wieso er mich dann Richtung Opernplatz fahren ließ. Vielleicht hatte Ronald große Schmerzen und nahm zunächst kaum wahr, wo wir lang fuhren.
Ich sah ein umgestürztes Polizeifahrzeug, zerbeult, mit qualmenden Reifen, schuttbedeckt, Feuerwehrwagen und in den Anlagen Polizisten, neugierige Passanten. Ein Verkehrspolizist winkte uns vom Opernplatz in den Reuterweg weg, ohne weiter auf uns zu achten. Ich war erleichtert.
»Halt mal an«, sagte Ronald.
Als ich hielt, stieg er aus, bevor ich ihn daran hindern konnte, und war sofort aus meinem Leben verschwunden, für viele Jahre.
Hannah hatte inzwischen wieder ein paar Bilder umgehängt. Sie blieb dabei, die ganze nächste Zeit: Ständig veränderten sich die Wände. Bücher, Bilder, Trockenblumen, Puppen wanderten. Die Wände schienen sich zu bewegen, zu atmen, wechselten Farben und Strukturen. Später verlangsamte sich der Rhythmus, die Veränderungen kamen seltener, waren weniger auffällig, hörten schließlich ganz auf.
Hannah verschenkte Bilder und Blumen, sogar Ringe und Ketten, stückweise wurde wieder Wand sichtbar, nicht mehr weiß, eher vergilbt, verwohnt, mit den deutlich erkennbaren Umrissen der nicht mehr vorhandenen Bilder.
Am Anfang, als sie noch expandierte, musste ich monatelang die weißen Wände meines Zimmers verteidigen. Hannah hätte auch sie gern mit Ikonen bedeckt. Mit Ikonen nach meinem Wunsch, gewiss. Aber ich wünschte keine Ikonen. Ich musste mir nicht, wie Hannah, gegen Erinnerungen voller Gewalt, Blut, Folter eine Familie, eine Heimat mit fremden Bildern neu erfinden.
Und es hatte schon bei Margaret eine Menge Bilder an den Wänden gegeben, alte und neue Grafik, schöne bürgerliche Schmucke aus vorzeigbarer Kunst. Die Atmosphäre in ihrer Wohnung war dicht wie der Nebel gewesen, der im Herbst vom Fluss aufstieg, dicht und gemütlich, mit Heidschnuckenfellen, Berberteppichen, echtem englischen Chippendale, echtem chinesischen Holzkohleofen aus Messing, knackendem Kandis im Tee, Kaminfeuer. Jetzt wollte ich’s kahl haben.
Trotzdem (oder gerade deswegen) saß oder lag ich oft mit Hannah unter ihren Ikonen und hörte den Geschichten zu, die ich schon kannte. Sie erzählte sie mir immer wieder.
Ich war der Erste, dem sie ausführlich von sich berichtete. Die anderen Männer hatten nur karge Hinweise zu hören bekommen, Andeutungen, nichts Genaues. So erfuhr ich mehr und mehr über Kasimir, den warmherzigen, phantasievollen, schwachen, schürzenjägerischen, gerissenen, schamlos opportunistischen, quartalsweise in Alkohol versinkenden Vater; über Lena, die rothaarige sittenstrenge Kunstreiterin aus dem Zirkus, die von Kasimir in Uniform, er war damals Leutnant der polnischen Armee, und mit vorgehaltenem Revolver gezwungen wurde, ihn auf der Stelle zu heiraten (wie Lena Jahr um Jahr den staunenden Töchtern aufs Neue versicherte). Worauf er sie mit hundert Frauen betrog und ihr ein Kind nach dem andern machte, damit sie ihn nicht verlassen konnte, Lena, die nie wieder ein Zirkuspferd sah, ständig mit dem Gebären, Aufziehen und Zugrabetragen der Kinder beschäftigt – von neun starben vier.
Lena, die pflichtbewusste sorgsame Mutter, die ihre Kinder wegen jeder Kleinigkeit erbarmungslos und lange mit dem angefeuchteten Einkaufsnetz schlug und stumm und aufgebracht in der Ecke saß, wenn der Vater vom Dienst oder von den Weibern heimkehrte und die weinenden Kinder tröstete.
Kasimir, der Sonntagfrüh, wenn die Kinder zu ihm ins Bett durften, Märchen und Abenteuergeschichten erzählte, während die kleine Hannah ein Ohr auf seine haarige Brust gepresst hielt, in der es dröhnte und rauschte, tief drinnen, geheimnisvoll. Solange der Vater redete, Lena, der ein zahmes Huhn folgte, wohin sie auch ging, das Eier in einen alten Pantoffel unter dem Küchenherd legte und im Wohnzimmer auf dem Kachelofen schlief, das nie ins Haus schiss, nur in den Garten, und mit Lena, friedlich glucksend, vor dem Radio saß, wenn sie strickte und Hitlerreden hörte.
Kasimir, der sich, nackt und betrunken, von Rekruten in einem offenen Sarg durch die Stadt tragen ließ, wozu er laut mit Kontratenor-Stimme sang: »Matka, Matka, was ist das, meine Muschi ist so nass« und andere ehrwürdige Volkslieder dieser Art.
Wenige Monate vor Kriegsausbruch, was sein Glück war, denn die polnische Armee warf ihn unverzüglich raus, noch aus dem Sarg gewissermaßen, so wurde er beim Versuch der polnischen Kavallerie, Hitlers Panzer mit Lanzen und Säbeln nach Berlin zurückzutreiben, weder maschinengewehrdurchsiebt in blutige Erde gewalzt, noch wurde er später von Stalin in Katyn ermordet; Kasimir, dessen Mutter, Witwe eines kurzlebigen Rechtsanwalts in Poznan, Konzertpianistin gewesen war, »Chopinistin«, die er als Fünfzehnjähriger auf Konzertreisen durch Europa und Südamerika begleitet hatte, einziger Sohn, dem sie nie die Mesalliance mit der Zirkusreiterin verzieh; Lena, deren Mutter nur die Frau eines unruhig von Dorf zu Dorf ziehenden Schreiners gewesen war –Kasimir und Lena, die sich beim Frühstück gegenseitig mit »Saujud!« anschrien, weil beide Mütter Jüdinnen gewesen waren.
»Slawische Familie!«, sagte Hannah. »Ach ja. Hält durch dick und dünn zusammen. Von wegen. Ich will keinen von denen mehr sehn. Nie mehr! Und wenn Papa nicht schon tot wär, ich würd auch ihn nicht mehr sehen wollen, nicht mal ihn.«
Im milden Licht der von Hannah elektrifizierten Petroleumlampe über den Messingknöpfen hielt ich ein Ohr zwischen die Brüste von Hannah, um zu hören, wie es tief drinnen rauscht und dröhnt, wenn sie erzählt, aber ich hörte nur Rasseln und Pfeifen, und im Getöse ihrer chronisch gereizten Bronchien versuchte ich, Weichsel und Brahe zu erkennen, Bydgoszcz – »Die Deutschen sagen Bromberg« –, die endlosen Wälder, die Tucheler Heide.
Ich sah das kleine Mädchen, das Pilze sammeln ging und seine Sandalen ordentlich an einen dicken Baumstamm lehnte, weil es mit nackten Füßen Moos und Laub fühlen wollte. Dann suchte es stundenlang nach den Sandalen, fand sie nicht wieder, verlor auch die gesammelten Pilze, kehrte in der Abenddämmerung barfuß und voller Furcht nach Hause zurück, von der Mutter, die schon besorgt gewartet hatte, umarmt und geküsst und anschließend, wegen der verlorenen Sandalen, so geschlagen, dass es am nächsten Morgen nicht in die Schule gehen konnte, weil die Blutergüsse und blutigen Striemen nicht zu verbergen gewesen wären.
Die Schule: eine deutsche Schule. Denn kaum waren die Deutschen einmarschiert, da hatte Kasimir es schon fertiggebracht, Dokumente zu finden, die bewiesen, dass der frühverstorbene Rechtsanwalt und der unruhige Schreiner deutscher Abstammung gewesen sein mussten. Und bevor in irgendeiner deutschen Schreibstube der Verdacht aufkommen konnte, bei Kasimir und Lena handele es sich um Halbjuden, hatte Kasimir schon für die deutsche Staatsangehörigkeit optiert, aus einer offiziellen Liste einen deutschen Namen ausgesucht: Karstensen (Kurt-Erich und Helene) und erklärt, er sei wegen seiner deutschen Gesinnung aus der polnischen Armee ausgestoßen worden.
Der Familie erlaubte er ab sofort kein polnisches oder jiddisches Wort mehr. Die Kinder waren ohnehin zweisprachig, nichts Besonderes im ehemaligen Westpreußen, jetzigem Warthegau, und Helene Karstensen verstand wenigstens Deutsch, auch wenn sie’s kaum sprach oder nur mit »grauenhaftem Polacken-Akzent« – wie Kurt-Erich Karstensen ihr täglich voller Ekel vorhielt.
Statt der bisher in der Familie ausschließlich gefeierten jüdischen Feste gab’s jetzt ausschließlich die katholischen, in denen sich Helene natürlich ebenso auskannte, für die Kinder als wichtigstes Weihnachten mit der Aussicht, endlich wie andere Kinder Geschenke zu ernten.
Aber da war nichts zu ernten. Der Vater hatte kaum Geld für Magermilch und Brot. Nur das Huhn hatte ausreichend zu essen, auch unter Schnee und Frost war der Garten noch voller Würmer, Käfer, Samenkörner. Es legte keine Eier mehr. Aber niemand kam auf die Idee, es zu schlachten. Es gehörte zur Familie wie ein Kind. Wie ein bevorzugtes Kind sogar: Es wurde nie geschlagen.
Erst im neuen Jahr schaffte es Kurt-Erich Karstensen, Dolmetscher beim Stadtkommandanten zu werden. Deutsch konnte er perfekt, weil die Chopinistin eine überwiegend deutsche Jüdin gewesen war, außerdem sprach er Russisch und Ukrainisch, weil er vor der Revolution in Kiew im Internat gewesen war (im besten und teuersten, versteht sich), sowie Französisch und ein sonderbares Englisch, in dem Vater und Mutter föddser ent möddser hießen und Butter böddser – feinstes Öxford-Ingliesch nach des vormaligen Kasimir und jetzigen Kurt-Erichs Überzeugung.
Zu seinem Glück war Öxford-Ingliesch auf der Kommandantur nicht gefragt.
»Siehst du«, sagte Hannah und stopfte sich eine Pfeife, »er muss verheerende Sachen gemacht haben, um lieb Kind bei den Deutschen zu sein. Sonst wär’s ihm nicht gelungen, seine Familie zu retten. Wir wären ohne ihn Seife geworden. Die Juden kamen sofort dran, die Halbjuden später. Wir nicht. Wir waren weder Pollacken noch Juden, sondern Arier, dank Papa.
Aus Vorsicht oder Schlamperei sind ja weder er noch meine Brüder beschnitten gewesen. Religion war ihm völlig gleichgültig. Als Mama ihm das mal vorwarf, schrie er: ›Das ist mein Gott!‹ Und schlug sich auf den Arsch.«
Sie zündete die Pfeife an. Ich mochte den Geruch ihres Tabaks nicht, noch weniger die Qualmwolken, mit denen sie uns umgab. Aber ich wusste, sie brauchte den Qualm, um klar zu sehn. Nur wenn sie trank, wollte sie nichts sehn.
»Für unsere Rettung müssen andere bezahlt haben. Papa hat Freunde verraten und Fremde zugrunde gerichtet, da bin ich sicher. Anders wär’s nicht gegangen.
Zum Beispiel: Was hat er getan, dass Pan Szkrenetzky dichthielt? Der war Nachkomme eines berühmten Generals, wohnte über uns und konnte zusehen, wenn wir das Laubhüttenfest feierten. Zwar hasste er die Deutschen, bei aller Bewunderung für Ludendorff, der kam gleich nach Marschall Pilsudski, aber die Juden hasste er noch mehr.