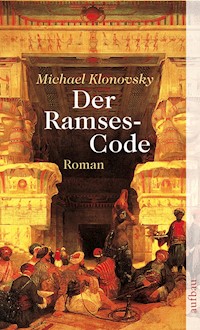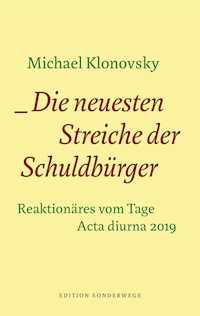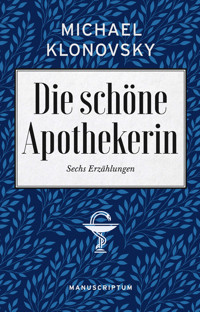
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Manuscriptum
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sechs Erzählungen, die vor allem um das Thema Nummer eins kreisen: Frauen locken Männer an, Männer stellen Frauen nach, Frauen legen Männer herein. Ein junger Bankangestellter verliert sich in der obsessiven Beobachtung einer lokalen Schönheit. Eine Abendgesellschaft unterhält sich über die rechte Art zu sterben. Ein alter Mann erzählt zwei theoretisierenden Feministinnen das Realdrama seiner Familie. Ein Milliardär kauft Frauen, bis sich Gott und Satan mit einer Wette einmischen. Jemand will sich auf seinen letzten Weg begeben, aber … Mit Fabulierlust und der ihm eigenen Sprachkunst erzählt Michael Klonovsky von Liebe, Begehren und dem Tod. Seine sechs Erzählungen sind in den späten sogenannten Nullerjahren entstanden, seitdem bereits historisch geworden und hätten im Untertitel auch "Geschichten aus der alten Bundesrepublik" heißen können: ein Rückblick ins zweite Biedermeier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE SCHÖNE APOTHEKERIN
MICHAEL KLONOVSKY
DIE SCHÖNE APOTHEKERIN
Sechs Erzählungen
MANUSCRIPTUM
Für Lena
INHALT
Vorbemerkung
Die schöne Apothekerin
Wie sterben?
Faustina
Unordnung und zu frühe Freud
Eine Unterhaltung im Zug
Um derentwillen die Sonne scheint
Vorbemerkung
Es ist unüblich, dass ein Autor einem belletristischen Werk ein Vorwort voranstellt. Allerdings ist es auch nicht besonders üblich, dass ein Autor eine Sammlung von Erzählungen mehr als ein Jahrzehnt nach der Niederschrift veröffentlicht, weil er deren Existenz zwischenzeitlich buchstäblich vergessen hatte. In solchen Zwischenzeiten pflegt sich – das ist wiederum üblich – die Welt zu verändern.
Die vorliegenden Geschichten entstanden Ende der sogenannten Nullerjahre, ich würde sagen, um das Jahr 2009, genau weiß ich es nicht mehr. Ich entdeckte sie auf der Festplatte meines alten PCs wieder, bevor ich ihn, nachdem er mir viele Jahre treue Dienste leistete, in den Computerhimmel entließ. Diesen etwas skurrilen Umständen ist nun eine verblüffende Erkenntnis zu verdanken, die sich bei der Wiederlektüre einstellte und deretwegen ich mich genötigt sehe, den Texten ein Vorwort voranzustellen. Sie sind nämlich während der verstrichenen ca. zwölf Jahre historisch geworden. Ich hätte die Unterzeile »Geschichten aus der alten Bundesrepublik« in den Titel einfügen können. Zugleich mögen diese Texte einen Eindruck davon vermitteln, wie sehr sich Deutschland binnen kurzer Zeit verändert hat.
Das sind natürlich keine literarischen Kriterien. Der Erzähler ist ja fast immer der Beschwörer des Imperfekts, er kann seine Handlung spielen lassen, wo und wann er will, und ob er den politischen Straßenlärm oder überhaupt die Gegenwart in seine Prosa dringen lässt, ist seine Sache. Ich möchte nur für den Fall, dass der eine Leser oder die andere Leserin sich fragt: Warum schreibt der das gerade jetzt?, deutlich machen: Es war gar nicht jetzt.
München, im Oktober 2022
Michael Klonovsky
DIE SCHÖNE APOTHEKERIN
Es war an einem Mittag im Mai, als ich sie zum ersten Mal sah. Ich saß mit einem Kollegen, Daniel ist sein Name, in einem Bistro, das keine hundert Meter neben unserer Firma seine Fensterfront zum Meistersingerplatz hin öffnet. Vor dem Bistro stand eine Reihe runder Tische, an einem davon tranken wir Espresso. Wir waren beide neu an diesem Ort, man hatte uns von einer Außenstelle der Firma hierher in die Zentrale versetzt, und wir sprachen gerade über ein anstehendes Projekt, als Daniel den Blick wie gezogen an mir vorbei richtete und raunte: »Mein Gott, was ist denn das?«
Ich drehte mich um und sah eine Frau auf uns zukommen. Ihr Anblick versetzte mir einen Stich. Jeder Mann kennt diesen Stich. Manche Frauen sind so schön, dass ihr Anblick schmerzt. Ich muss vorausschicken, dass ich solche Empfindungen keineswegs öfter habe, ich neige, was Frauen angeht, eigentlich wenig zur Schwärmerei. Obwohl ich Anfang dreißig bin, lebe ich solo; ich fand die Unterschiede zwischen allen meinen Freundinnen und Kurzbekanntschaften nicht so gewaltig, als dass ich mich für eine hätte entscheiden wollen. Freilich sah keine von ihnen so sensationell aus wie diese Frau, die sich dort gemächlich auf uns zubewegte und gewissermaßen Stiche nach allen Seiten austeilte.
Sie hatte langes, schwarzes Haar, das auf tiefbraune und wie gemeißelt proportionierte Schultern fiel. In ihrem Gang mischten sich Stolz und Lässigkeit auf eine Weise, wie ich es noch nie gesehen hatte. Ihre Haut und ihre Züge verrieten eine südländische Herkunft. Vielleicht eine Türkin, dachte ich, mindestens eine Griechin. Sie war aus einer Seitengasse gekommen, überquerte den Meistersingerplatz und ging in die Apotheke, die sich genau dem Bistro gegenüber befand. Für das Studium ihres Gesichts hatte ich kaum zwanzig Sekunden Zeit, für die Rückansicht blieb mir etwas mehr. Ihre großen, besonders mandelförmigen und wahrscheinlich braunen Augen strahlten aus dem bronzenen Teint wie zwei aufgeblendete Scheinwerfer. Ihr voller, augenscheinlich ungeschminkter Mund war von einem verblüffenden Hellrot. Ich schätzte sie auf Ende zwanzig.
Sie trug Jeans, dazu kurze Stiefel aus einem offenbar sehr weichen Leder, in denen sie ihren halb federnden, halb schläfrigen Gang zelebrierte, darüber ein etwas folkloristisch wirkendes mattgrünes Etwas, halb Poncho, halb Hemdbluse. Da das Teil am Hals ziemlich weit ausgeschnitten war, lagen die Schultern nahezu frei, sodass man die filigranen Träger ihres BHs sah.
Als die Schöne uns ihren Rücken präsentierte, führte Daniel die Fingerspitzen seiner Rechten zu den Lippen, warf ihr eine Kusshand nach und seufzte: »Nun sieh dir diesen Hintern an, das ist doch ein Gottesbeweis!«
»Nein«, widersprach ich ihm, »das ist ein Folterwerkzeug.«
Was mich noch stärker mitriss, war die animalische Sicherheit, mit welcher dessen Besitzerin sich bewegte. Sie ging so selbstverständlich, wie ein Tier läuft, weil das eben seine Natur ist, sie lief, als ob sie ganz allein auf diesem Platz gewesen wäre, als hätte sie nicht gewusst, dass in diesem Moment Dutzende faszinierte Männeraugen (und bestimmt ebenso viele missgünstige Frauenblicke) auf ihr ruhten. Der Mensch hat doch normalerweise Schwierigkeiten, einen belebten öffentlichen Platz ungezwungen zu überqueren, man fühlt sich einfach unbehaglich unter den Blicken vieler anderer, und manche meiden solche Orte deshalb sogar. Man spricht in diesem Fall von Agoraphobie. Und das genaue Gegenteil von Agoraphobie schien mir diese Frau zu verkörpern.
Schließlich verschwand sie in besagter Apotheke, und wir warteten in schweigender Ergriffenheit darauf, dass sie wieder herauskam. Aber sie kam nicht heraus, nicht nach zehn, nicht nach fünfzehn Minuten.
»Haben wir sie übersehen, oder hat der Laden einen Hinterausgang?«, fragte ich.
»Übersehen?« Daniel blies Luft durch die Nase. »Die?«
Wir konnten unsere Lauer nicht länger ausdehnen, weil man uns im Büro erwartete. Ich war den gesamten Nachmittag zerstreut, und noch am Abend, als ich heimkam, spürte ich den Stich. In Worte übersetzt bedeutete er: Du wirst nicht wieder glücklich, solange du weißt, dass eine solche Frau in deiner Nähe existiert, und du sie nicht besitzt, und du weißt ziemlich genau, dass du sie nicht bekommen wirst, weil sie anderthalb Nummern zu groß für dich ist.
Mein Wechsel in die Firmenzentrale am Meistersingerplatz verdankte sich einer überraschenden Beförderung. Ich besaß von meinem neuen Büro im vierten Stock aus einen guten Blick über das gesamte, ausschließlich Fußgängern vorbehaltene Areal. Zunächst einmal war an diesem Platz nichts Besonderes: ein italienisches Restaurant, das erwähnte Bistro, ein San Francisco Coffee Shop, ein paar Geschäfte, eine Bibliothek, die Apotheke, einige verstreute Bänke aus Metall, ein kleiner Springbrunnen, dessen Fontäne einer Blüte aus gestanztem Blech entsprang, ein paar Bäumchen und Hecken, mehr nicht. Einmal in der Woche fand hier ein Markt statt.
Als ich tags darauf an der Apotheke vorbeilief, erhielt ich die Erklärung dafür, warum die schöne Unbekannte das Geschäft nicht wieder verlassen hatte. Sie stand nämlich in einem weißen Kittel hinter dem Verkaufstresen und übergab gerade einer alten Dame eine stattliche Kollektion von Arzneimitteln. Dieses erlesene Geschöpf war also weder ein türkisches Supermodel noch die müßiggängerische Gattin eines Millionärs aus dem angrenzenden Villenviertel, sondern übte den stinknormalen Beruf einer Apothekerin aus. Redete mit Kunden über Kopfweh, Halskratzen, krankhaften Harndrang und Gallensteine. Als wir sie gestern gesehen hatten, war sie auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Aber wer kam denn auf die Idee, dass eine Frau, die so aussieht, arbeitet?
Da ich nicht einfach vor der Apotheke stehen bleiben und hineinstarren konnte, ging ich weiter ins Büro. Dort ließ ich eine halbe Stunde verstreichen, dann marschierte ich wieder zurück, um mir die Schöne unter dem Vorwand, irgendein Medikament zu benötigen, einmal richtig anzusehen. Vielleicht hatte sie aus der Nähe ja irgendeinen Makel, der mir bislang entgangen war und der dem Stich sozusagen den Stachel nehmen würde. Als ich das Geschäft betrat, befanden sich dort zwei Verkäuferinnen, aber die Türkin – ich hatte diese Herkunfts- und Gattungsbezeichnung inzwischen innerlich für sie festgelegt – war nicht darunter. Also vertiefte ich mich in das Angebot der Regale diesseits des Verkaufstresens. Darin standen die üblichen Sachen: Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate, Cremes. Der Laden war kühl und nüchtern eingerichtet, Regale und Tresen bestanden aus schmucklosem hellen Holz, es handelte sich um keine jener Apotheken, die mit ihrem Interieur noch eine Brücke in vergangene Jahrhunderte zu schlagen versuchen. Da ich nicht der einzige Kunde war, blieb mir etwas Wartezeit, vielleicht war sie ja bloß mal in den Nebenraum gegangen, um eine Tinktur anzurühren. Aber sie tauchte auch in der Folgezeit nicht auf, sodass ich unverrichteter Blicke wieder an meine Planstelle zurückkehren musste, wo ich zerstreut meinen Dienst schob.
Wie ich im Laufe der nächsten Tage feststellen konnte, war die schöne Südländerin der allgemein akzeptierte optische Mittelpunkt des gesamten Meistersingerplatzes. Nahezu jeder Mann, an dem sie vorbeilief, egal welchen Alters, drehte den Kopf nach ihr oder folgte ihr wenigstens aus den Augenwinkeln. Gebieterisch zog sie die Blicke auf sich, ohne je einen davon zu erwidern. Es war gleichermaßen unmöglich, nicht auf sie zu sehen und allzu offenkundig hinzuschauen. Dass diese Frau gewissermaßen eine Institution an diesem Ort war, wurde mir spätestens klar, als ich in der Kantine inmitten einer Runde männlicher Kollegen einmal die Apothekerin erwähnte, ohne ein Wort näherer Beschreibung, und sofort einer sagte: »Ja, eine Schönheit, unglaublich!«, worauf beifälliges Gemurmel einsetzte. Alle wussten, wer gemeint war. Alle bewunderten sie. Aber keiner hatte je ein privates Wort mit ihr gewechselt.
Als ich die Apothekerin das nächste Mal sah, saß sie mittags beim Italiener am Nachbartisch, und zwar mit einer anderen Frau, die offenbar nicht zu ihrem Geschäft gehörte. Sie trug an diesem Tag wieder eine Hose, dazu ein enges schwarzes Shirt mit ebenfalls engen, ellenbogenlangen Ärmeln, und der Anblick ihres Körpers versüßte und verdarb mir den Tag.
Ich war mit meinem neuen Abteilungsleiter essen gegangen, das erste Mal nach meiner Versetzung beziehungsweise Beförderung, das heißt, er hatte mich eingeladen, zum besseren Kennenlernen, wie er sagte, aber weil ich die gesamte Mahlzeit hindurch vor allem bestrebt war, irgendein Wort von ihr zu erhaschen und wenigstens gelegentlich einen wie zufälligen Blick auf sie zu werfen, hörte ich ihm nur sehr zerstreut zu und gab entsprechend nichtssagende Antworten. Andererseits sprach mein neuer Chef sehr laut, begleitete seine Worte mit bedeutungsschweren Gesten – ich könnte auch sagen, er plusterte sich auf –, und selbst ein Trottel hätte kapiert, dass er dies alles keineswegs nur meinetwegen tat, zumal sein unsteter Blick regelmäßig an mir vorbei in ihre Richtung flackerte. Dass sein Gedröhne kaum mir galt, war mir egal, aber dass ich deshalb vom Gespräch am Nachbartisch nicht ein Wort mitbekam, fand ich doch recht ärgerlich. Allerdings sprach speziell sie dermaßen gedämpft, dass ich vermutlich auch dann nichts gehört haben würde, wenn mich mein Vorgesetzter nicht zugetextet hätte. Wie mir später auch in der Apotheke auffallen sollte, konnte sie die Lautstärke ihrer Rede außergewöhnlich genau dosieren, die Worte erreichten exakt ihren Adressaten und fielen dann gewissermaßen zu Boden; jedenfalls waren sie einen Meter weiter schon nicht mehr zu verstehen. Wo lernte man so etwas?
Aus der Distanz betrachtet war dieses gemeinsame Mittagessen, das später in einem Büro als Dienstgespräch zur Vorbereitung irgendeines Projektes mit Kostenrückerstattung verbucht wurde, ein recht kurioser Vorgang: Zwei Kerle führen angeblich eine berufliche Unterhaltung, doch bekommen sie von ihr kaum etwas mit, weil sie sich ausschließlich für die Frau am Nachbartisch interessieren, die sie allerdings nicht eine Sekunde in Ruhe anschauen können, da sie so tun müssen, als würden sie sich zum Nutzen des Unternehmens gerade näher kennenlernen, und der sie dermaßen egal sind, dass sie nicht ein Mal zu ihnen herüberschaut. Einzig den überraschend sanften Klang ihrer Stimme trug ich als Beute dieses Mittags mit mir fort.
Tags darauf hörte ich ihn wieder, und diesmal sprach die Stimme zu mir. Ich hatte dem Drang nicht widerstehen können, die Apotheke zu besuchen, und diesmal hatte ich mehr Glück: Sie stand hinter dem Verkaufstresen und bediente gemeinsam mit zwei Kolleginnen. Da es zwei Kassen, aber nur eine Schlange gab und die Kunden verschieden viel Zeit in Anspruch nahmen, war es kaum möglich einzuschätzen, bei welcher Verkäuferin ich landen würde. Als nur noch zwei Leute vor mir standen, fiel mir ein, dass ich mir noch gar nicht überlegt hatte, was ich kaufen wollte. Ich scherte aus der Reihe und stellte mich vor eines der Regale mit Nahrungsergänzungsmitteln, starrte die bunten Reihen von Vitamin- und Mineralpräparaten an und überlegte, was ich hier eigentlich zu suchen hatte, als es in meinem Rücken fragte: »Kann ich Ihnen helfen?«
Ich fuhr herum wie ein Ladendieb unmittelbar vor der Ausübung der geplanten Tat. Einen Schritt von mir entfernt stand – sie.
»Ist alles in Ordnung bei Ihnen?«, fragte sie.
Ich kam mir einen Augenblick vor, als wäre ich ein Wurm oder etwas Derartiges und würde von einem höherentwickelten Wirbeltier angesprochen, weshalb es zwei oder drei quälende Sekunden dauerte, bis ich antwortete: »Aber ja, alles bestens!«
Ich stand da und starrte sie an – nein, in diesem Antlitz befand sich nicht die Spur eines Makels –, während sie ihre Frage modifiziert wiederholte: »Suchen Sie etwas Bestimmtes?«
Klar suchte ich etwas Bestimmtes. Ich hatte nur vergessen, mir zu überlegen, was ich zu suchen vorgeben würde, wenn ich es gefunden hätte.
»Ich – ich brauche Vaseline!«
»Wie viel denn? Es gibt verschiedene Packungsgrößen.«
»Die größte«, hörte ich mich sagen.
Nun runzelte sie sacht die Stirn. »Das wären tausend Gramm! Brauchen Sie wirklich so viel?«
»Ja«, erwiderte ich, und es war wohl dem Stress ihrer Gegenwart zuzuschreiben, dass ich folgsam wie ein Erstklässler und absolut wahrheitsgemäß hinzufügte: »Für den Hintern.«
Eine flüchtige Röte überzog ihr Gesicht, und zugleich fror ihre Miene ein. Der Anblick war so zauberhaft, dass ich eine Sekunde lang vergaß, wie obszön meine Auskunft eigentlich gewesen war. Ich hatte sie in Verlegenheit gebracht!
»Um Himmelswillen!«, rief ich und hob beschwichtigend die Hände. »Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin Fahrradfahrer, ich meine, sportlicher Fahrradfahrer, man sitzt dabei so lange auf diesem kleinen Sattel – diese Sättel sind Marterinstrumente, müssen Sie wissen –, und da hilft Vaseline etwas …«
Diese Erklärung schien sie zufriedenzustellen, wenngleich noch in meinem Dementi die Frivolität dessen mitschwang, woran ich sie zu denken gezwungen hatte. Jedenfalls klarten sich ihre Züge wieder auf, sie lächelte fast ein bisschen schuldbewusst und hauchte: »Ach so! Vaseline muss ich Ihnen aus dem Lager holen. Warten Sie bitte.«
Was für ein Auftritt, dachte ich, als ich wenig später mit meiner Kilopackung über den Platz ging, jetzt hält sie dich zwar für einen Volldeppen, aber sie wird dich so schnell nicht vergessen. Dieser Einkauf war natürlich vollkommener Unsinn, ein Kilogramm würde für eine ganze Mannschaft reichen. Doch wenn ich daran dachte, wie reizend es ausgesehen hatte, als diese sanfte Röte über ihr Gesicht flog, als aus dieser Diva plötzlich wieder ein Mädchen geworden war, fand ich meine Auskunft beinahe genial. Ich sah dieses Bild, als ich abends einschlief, und als ich morgens aufwachte, war es wieder da.
Schon am übernächsten Vormittag bot sich mir die Gelegenheit, unsere Bekanntschaft zu bekräftigen. Sie kam mir auf dem Platz entgegen, gemächlich wie immer und stolz erhobenen Hauptes. Ich erkannte sie natürlich schon von Weitem, und ich spürte, wie mein Gang unsicher wurde und meine Hände nicht wussten, wohin mit sich. Nachdem ich ein paar Schritte lang so getan hatte, als fessele irgendetwas hinter einem Fenster zur Rechten meine Aufmerksamkeit, und ihr nahe genug gekommen war, wendete ich mich ihr zu, um sie zu grüßen. Aber ich suchte ihren Blick vergeblich, obwohl sie den ihren keineswegs gesenkt hielt, als sie an mir vorüberging. Sie schien mich nicht wahrzunehmen. Haarscharf sah sie an mir vorbei.
Hatte sie mich nicht erkannt? Nein, das war nicht möglich. Ich fühlte mich vorsätzlich ignoriert. Weshalb grüßte sie mich nicht? Wieso sah sie mich nicht einmal an? Hatte sie mich wirklich nur nicht erkannt?
Als ich ihr das nächste Mal begegnete, befand sie sich in Begleitung eines hochgewachsenen, schlanken, hellhäutigen Mannes von ungefähr Ende vierzig, dessen Haar entweder sehr weißblond oder aber bereits ergraut war – oder beides – und der ansonsten ziemlich distinguiert aussah, obwohl er keineswegs besonders teuer gekleidet war. Man sah ihm an, dass er kein Angestellter war, sondern eher Anweisungen erteilte. Die beiden saßen vor dem Coffee Shop, in sehr vertraut wirkender Konstellation, das heißt, er saß, während sie eher lümmelte; sie lag, wie man sagt, dahingegossen auf dem Korbstuhl, in ihrer naturhaften Lässigkeit, und man hätte vermuten können, dass sie ein Paar waren. Zog sie sich etwa allabendlich für diesen Kerl aus? Während der Stich in meiner Brust verharrte, schlich ich an den beiden vorbei. Selbstverständlich beachtete sie mich nicht.
Später stellte ich fest, dass der graublonde Mann ebenfalls zur Apotheke gehörte, wobei ich genau genommen den Eindruck gewann, dass die Apotheke ihm gehörte. Augenscheinlich war er der Chef des gesamten Ladens, daran ließ die Art, wie er darin umherging und mit den Mitarbeiterinnen sprach, keinen Zweifel. Hin und wieder bediente er auch oder half den Verkäuferinnen bei anscheinend besonders kniffligen Rezepturen. Im Gegensatz zu ihnen trug er meistens keinen Kittel. Chef oder Besitzer, sagte ich mir, etwas anderes kam nicht infrage. Zwei der Verkäuferinnen waren übrigens recht hübsch, eine lockenköpfige Rotbraunhaarige, die immer knapp sitzende T-Shirts unter ihrem offenen Kittel trug, sowie eine große, drahtige Blondine mit Sommersprossen und einem enormen Mund. Diese beiden wären einem Mann normalerweise aufgefallen, doch unter den gegebenen Umständen hatten sie kaum Chancen dafür. Bemerkenswerterweise schauten sie nie scheel oder neidisch auf das Mirakel an ihrer Seite – jedenfalls soweit ich imstande war, das zu beurteilen. Es war, als nähmen sie den Abstand zwischen sich und ihr überhaupt nicht zur Kenntnis. Vielleicht weil er zu enorm war?
Ich beobachtete die Apothekerin inzwischen regelmäßig vom Fenster meines Büros aus, wo ich allerdings nur den Eingang des Geschäftes sehen konnte, das heißt, ich musste warten, bis sie den Laden verließ, was sie mittags stets zur gleichen Zeit tat. Kurz davor schloss ich die Tür meines Arbeitszimmers von innen ab und bezog mit einem Fernglas, das ich mir eigens für diesen Zweck gekauft hatte, Position, wobei ich die Lamellen des vor dem Fenster heruntergelassenen Metallrollos so einstellte, dass sie leicht nach außen geneigt waren. Wie ich mich zuvor überzeugt hatte, konnte man von unten einen Menschen hinter diesen Lamellen nicht sehen. Auch von gegenüber sah man mich nicht, denn die Entfernung zwischen unserem Bürohaus und den Wohnungen auf der anderen Seite des Platzes war dafür zu groß – dort hätte jemand ebenfalls ein Fernglas benutzen müssen, um mich zu ertappen.
Wenn die Schöne aus der Apotheke kam, konnte ich nun meinen Blick so auf sie heften, als ob ich direkt vor oder neben ihr stand. Manchmal setzte sie sich auf eine der Bänke und ließ sich von der Sonne bescheinen, und ich studierte jedes Detail ihres Gesichts, ihres Körpers und ihrer Garderobe. Ich sah, dass sie am Fußknöchel ein Tattoo trug und dass auf der rechten Seite ihrer Oberlippe ein kleiner Leberfleck war. Minutenlang vertiefte ich mich in den Anblick ihres Haars, in dem sich das Licht verfing, oder der Beuge ihres Halses oberhalb des Schlüsselbeins, in die ich in Gedanken meine Nase vergrub, um den Zedernduft ihrer Haut zu riechen. Ich sah zu, wie sich ihr Bauch unter dem Stoff des Kleides bewegte, und malte mir aus, wie er sich anfühlte. Ihren gesamten Leib erforschte ich aus der fernen Nähe, ich liebkoste ihn mit Blicken, und ich hätte zu gern einmal ihr Höschen gesehen, doch meistens trug sie Jeans, und wenn sie ein Kleid anhatte, reichte es stets bis über die Knie, sodass ich mit dem Anblick ihrer braunen, glatt rasierten Waden und der filigranen Fesseln vorliebnehmen musste.
Bald hatte ich mehrere Anläufe unternommen, die Apothekerin zu grüßen, aber jedes Mal vor ihrer majestätischen Ignoranz kapitulieren müssen. Dass sie eine Türkin war, wusste ich inzwischen durch einen Verkaufsbon. »Es bediente Sie Ceylan Demiröz«, stand darauf zu lesen. Aus dem Nachnamen folgerte ich, dass sie mit dem graublonden Chef jedenfalls nicht verheiratet sein konnte, denn der war alles, nur kein Türke. Ich gab ihren Namen bei der Google-Bildersuche ein, doch ich fand ihr Konterfei dort ebenso wenig wie ihren Namen unter den Online-Einträgen ihrer Apotheke. Ceylan Demiröz existierte im Internet nicht.
Dafür existierte sie in der Wirklichkeit, und das auch noch sozusagen doppelt beziehungsweise in zwei verschiedenen Wesensarten. Begegnete ich der einen auf dem Platz, sah sie dermaßen exakt an mir vorbei, dass von Zufall oder Zerstreutheit keine Rede sein konnte. Sie wollte mich nicht sehen. Traf ich dagegen die andere in der Apotheke, grüßte sie mich freundlich, zwar nicht gerade wie einen Bekannten, aber doch wie einen Menschen, den man eben kennt. Und trotzdem konnte es geschehen, dass ich ihr am selben Tag später draußen über den Weg lief und sie mich ebenso bewusst ignorierte wie bei allen anderen Zusammentreffen dieser Art zuvor.
Was für ein hochmütiges Stück!, dachte ich. Ich fühlte mich schließlich dermaßen gekränkt, dass ich nicht anders konnte, als Daniel davon zu berichten, selbstredend in einem völlig leidenschaftslosen Tonfall, so als ob ich über eine Uraltbekannte sprach, die ich gestern getroffen und die mich kurioserweise nicht gegrüßt hatte. Ich war geradezu erleichtert, als er mir seinerseits exakt denselben Eindruck beschrieb. »Sie grüßt einen nie!«, sagte er, und es klang beinahe bewundernd.
Sobald ich begriffen hatte, dass dieses Übersehenwerden nicht mich persönlich betraf, verstand ich die Frau auf einmal. Wenn man jeden Tag fünfzig Männern begegnet, die einen anstarren und um einen Gruß flehen, muss man entweder ein Philanthrop sein und tatsächlieh alle grüßen – oder sich einen Panzer zulegen. Sie behandelte niemanden persönlich schlecht, sondern bloß alle gleich. In diese Überlegungen hinein erzählte mir Daniel, dass man vom Lesesofa der öffentlichen Bibliothek aus die ideale Sicht in das Pharmaziegeschäft besaß, sofern dessen Tür offenstand, was in der warmen Jahreszeit immer der Fall war. Auch er erwähnte diesen Umstand beiläufig, versteckt hinter einem »Ach übrigens, weißt du, was mir aufgefallen ist?«, und mir dämmerte, dass die Beobachtung dieser Frau keineswegs nur mir zur Obsession geworden war – und dass zumindest Daniel es von mir zu wissen schien. Warum sollte er mir sonst so etwas mitteilen?
Später im Büro fragte ich mich, ob ich unzurechnungsfähig geworden war; dann ging ich in die Bibliothek und erwarb einen Mitgliedsausweis. Ich griff mir den erstbesten Bildband (es war ein Buch über die Pyramiden der Maya), warf einen prüfenden Blick auf die Fensterfront und setzte mich auf ein zerschlissenes Sofa in der Ecke, das mir der beste Platz für meinen Zweck zu sein schien. Hier lauerte ich wie ein Jäger auf dem Hochsitz auf mein scheues Reh. Die Stelle war in der Tat ideal, der Meistersingerplatz machte hier einen Knick, sodass sich Apotheke und Bibliothek näher kamen als alle anderen Geschäfte am Ort, und ich besaß direkte Sicht auf den gesamten Verkaufstresen. Sie trug heute rotbraune Schaftstiefel und ein schwarzes Kleid mit offengelassenem Kittel darüber und händigte gerade einem Mann in einem blauen Anzug eine Packung Tabletten aus. Als der Kunde sich zur Tür wandte, erkannte ich meinem Abteilungsleiter. Ob der die Medizin wohl wirklich brauchte, oder gehörte auch er zum Fanclub?
Ich kam erst darauf, wie lange ich ihr zugeschaut und meinen Gedanken nachgehangen hatte, als mich im Büro mein Chef fragte, wo ich denn die ganze Zeit gewesen war. Ich hatte die Mittagspause um fast eine Stunde überzogen. Während ich Kopfschmerzen fingierte, beschloss ich, es einstweilen gut sein zu lassen mit diesem Voyeurismus. Zumindest ließ ich das Fernglas daheim, und ich versuchte mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Aber ich musste mich am Mittag zur fraglichen Zeit erheblich zwingen, nicht ans Fenster zu gehen – und schaffte es meistens doch nicht.
* * *
Hier wäre meine Geschichte eigentlich an einem traurigen und etwas langweiligen Ende angekommen, wenn ihr nicht ein Zufall auf die Sprünge geholfen hätte. Inzwischen war es August geworden, und an einem sonnigen Morgen fuhr ich mit dem Fahrrad ins Büro. Ich radelte langsam, denn ich hatte einen neuen Anzug an, und ich dachte an eine Frau, die ich am Vorabend auf einem Empfang kennengelernt und die mir ihre Telefonnummer gegeben hatte. Ich fuhr an einer Reihe mit der Vorderseite zum Bürgersteig parkender Autos vorbei, aus der plötzlich ein BMW-Jeep rückwärts herausschoss, als ich genau auf dessen Höhe war. Er warf mich um, ehe ich an ein Ausweichen auch nur denken konnte. Ich war, wie gesagt, sehr langsam unterwegs, aber es reichte, dass ich mindestens zwei Meter über den Asphalt schlitterte. Wütend schob ich das Fahrrad von mir, um mich aufzurappeln und den Scheißkerl zur Rede zu stellen, der hier ohne zu schauen ausparkte, doch meine Wut verwandelte sich jäh in das reinste Entzücken, als ich sah, wer da aus dem Wagen sprang, erschrocken die Hand auf den Mund legte und zu mir geeilt kam, um mir zu helfen.
»Oh mein Gott! Ist Ihnen etwas passiert?«, hörte ich sie rufen, und diesmal klang ihre Stimme nicht förmlich wie in der Apotheke, sondern warm und teilnahmsvoll.