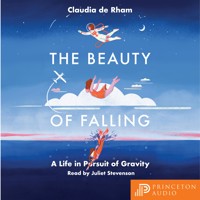18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
»Sie denkt weiter als Einstein.« DIE ZEIT.
2009 hat es Claudia de Rham in die Endauswahl der ESA geschafft. Sie ist kurz davor, dem Geheimnis der Gravitation als Astronautin auf die Spur zu kommen. Dann wird sie positiv auf latente Tuberkulose getestet. Ihr Traum platzt. Seitdem hat sich de Rham in der Astrophysik einen Namen gemacht, ist sie zu einer der renommiertesten Kosmolog:innen aufgestiegen. Ihre Arbeit fordert die Allgemeine Relativitätstheorie heraus.
In „Die Schönheit des Fallens“ begibt sie sich auf eine persönliche Suche nach Antworten auf die ganz großen Fragen: Woraus besteht das Universum? Was sind dunkle Materie und Energie? Und wie hält die Gravitation den gesamten Kosmos zusammen? Nach der Lektüre sehen wir die Welt mit anderen Augen
»Was für eine wunderbare Lektüre! Faszinierend und hochaktuell!« Pedro G. Ferreira, Autor von „Die perfekte Theorie“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Claudia de Rham hat ihr Leben der Gravitation gewidmet. Als Taucherin spielte sie im Indischen Ozean mit dem Auftrieb ihres Körpers. Als Pilotin schwebte sie an dunklen Morgen über kanadischen Wasserfällen, bevor sie ihre wissenschaftlichen Forschungen begann. Als Astronautenanwärterin träumte sie von der Erfahrung, frei von der Erdanziehung zu fliegen. Und als Physikerin entdeckte sie neue Seiten der Schwerkraft, indem sie die Grenzen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie auslotete.
Was genau ist Schwerkraft? Claudia de Rham zeigt, dass diese einfache Frage von großen Denkern wie Newton, Einstein oder Stephen Hawking nur zum Teil beantwortet werden konnte. Und sie entwickelt eine heiß diskutierte eigene Theorie eines von der Schwerkraft gesteuerten Universums.
»Claudia de Rham erweckt die Geschichte der Schwerkraft zum Leben. Auf elegante Weise verbindet sie faszinierende Wissenschaft mit ihrer eigenen Lebensgeschichte.« Jo Dunkley
Über Claudia de Rham
Claudia de Rham, 1978 in Lausanne geboren, ist Professorin für theoretische Physik am Imperial College London und Mitglied der American Academy of Arts and Sciences. Sie wurde mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen geehrt und zählt zu den bedeutendsten Forscher:innen auf dem Gebiet der Grundlagenphysik des letzten Jahrzehnts.
Hainer Kober, geboren 1942, studierte Germanistik und Romanistik. Seit 1972 übersetzt er Werke aus dem Englischen und Französischen, unter anderem von Stephen Hawking, Brian Greene, Antonio Damasio und Oliver Sacks. 2015 wurde Kober mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis für deutschsprachige Übersetzer ausgezeichnet. Hainer Kober lebt in Soltau.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Claudia de Rham
Die Schönheit des Fallens
Auf der Suche nach dem Geheimnis der Gravitation
Aus dem Englischen von Hainer Kober
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Einleitung: Eine Reise durch die Gravitation
Kapitel 1: Eine Universalsprache
Die Universalität der Lichtgeschwindigkeit
Ein gescheitertes Experiment
Rotationen in Raum und Zeit
Die Universalität der Gravitation
Kapitel 2: Die Gravität unserer gekrümmten Realität
Der Faden im Gewebe der Raumzeit
Raumzeit-Geometrie
Eine gerade Linie in einer gekrümmten Raumzeit
Kapitel 3: Gravitation und die ihr innewohnende Kraft
Gravitation spüren
Gezeitenkräfte
Ein Bote der Gravitation
Eine kurze Sicht auf Glicht
Einstein hatte recht! Oder doch nicht?
Kapitel 4: Unser eigenes Scheitern vorhersagen
Gravitation im Grenzbereich
Singularitäten
Die Bedeutung der Planck-Skala
Reise ins Innere eines Schwarzen Lochs
Reise zum Anfang der Zeit
Kapitel 5: Expansion ins Nichts
Ein rätselhaftes Universum im Zustand unaufhörlicher Expansion
Beschleunigte Expansion
Dunkle Energie
Einsteins kosmologische Konstante
In das Vakuum eintauchen
Die größte Diskrepanz der Wissenschaftsgeschichte
Kapitel 6: Das Graviton: Was für ein Teilchen!?
So weit, so gut
Gravitation mit Sinn für Humor?
Der Geist der massiven Gravitation
Von Extradimensionen zu massiven Gravitonen
Einen Elefanten kitzeln
Graffiti im Himmel
Kapitel 7: Unser Leben auf der Suche nach der Gravitation
Die Leichtigkeit der Gravitation
Die (Raum)Zeit wird es zeigen
Pi in the Sky
Die unabänderliche Quantennatur der Gravitation
Von Wellen zu Teilchen
Die letzte Reise
Schluss: Geschöpfe der Gravitation
Bibliografie
Register
Erläuterungen
Impressum
Einleitung
Eine Reise durch die Gravitation
Gravitation. Ein vertrautes Konzept, das zwar in fast jeder Sprache und Kultur vertreten ist, um dessen Verständnis Wissenschaftler aber seit Jahrtausenden ringen. Sie ist das allumfassende Wunder, das alles im Universum überall und für immer miteinander verbindet. Universell in jeglicher Hinsicht. Wir Menschen stellen sie uns als die verborgene Kraft vor, die uns auf der Erde festhält, als die Ursache, die bewirkt, dass die Erde die Sonne umkreist, oder die Wechselwirkung, dank der die Milchstraße und ihre etlichen Hundert Milliarden Sterne überhaupt erst entstanden sind. Doch das ist nur ein schwacher Abglanz ihrer wahren Bedeutung. Gravitation ist der Grund, warum das Universum überhaupt existieren und sich entwickeln kann. Sie sorgt dafür, dass Raum und Zeit nicht bloße Kulisse, sondern Hautpdarsteller in der dramatischen Entwicklung der Realität sind.
Ich persönlich habe der Gravitation mein ganzes Leben gewidmet. Dabei nahm meine Suche nach dem Geheimnis der Gravitation in ganz alltäglichen Situationen ihren Anfang.
•
Stellen Sie sich etwa vor, Sie säßen allein im Cockpit eines kleinen einmotorigen Flugzeugs auf der Startbahn und warteten geduldig auf das Zeichen der Flugleitung (eine mir äußerst vertraute Situation). Vier einfache Wörter – clear to take off – wirken wie ein Zauberspruch: Sie lösen eine exakte Ereignisfolge aus, die vor 120 Jahren noch unmöglich gewesen wäre: Ein Objekt von einer Tonne Gewicht wird hoch in die Luft gehoben und dort zum Schweben gebracht. Während die Maschine die Stadtbahn entlangrast, werden Sie mit dem Rücken in den Schaumstoff ihrer Sitze gepresst, weil Sie horizontal auf eine Geschwindigkeit von 100 bis 200 km/h beschleunigt werden. Paradoxerweise ermöglicht diese waagerechte Geschwindigkeit dem Schub unter den Flügeln, die senkrecht wirkende Gravitation zu überwinden und Sie himmelwärts zu heben. Während Sie auf Reisehöhe steigen, wird die kleine Maschine bereits von der geringsten Turbulenz durchgeschüttelt. Einen Augenblick fühlt es sich an wie in einer Schneekugel gefangen und der Willkür irgendeines riesigen, boshaften Schüttlers ausgeliefert zu sein – bis Sie sich daran erinnern, dass eine kleine Justierung des Seitenruders, eine leichte Korrektur des Höhenruders und eine sanfte Drehung des Querruders genügen, um elegant auf dem Luftstrom zu surfen – zugleich vom Druck nach oben geschoben und von der Gravitation nach unten gezogen.
Neben der grenzenlosen Freiheit über den Wolken, die ja nicht jedermanns Sache ist, bin ich in meinem Leben früh in die blaue Tiefe des Ozeans hinabgetaucht und habe mich einige Dutzend Meter unter der Wasseroberfläche zu den Tausenden von Korallenfischen gesellt. Während Sie dort unten die heitere Gelassenheit der Unterwasserwelt betrachten, umfängt Sie eine Stille, die nur von wenigen Geräuschen unterbrochen wird – dem Knistern des vibrierenden Korallenriffs und Ihrem Atem, wenn Sie langsam die Luft aus ihrer Flasche ein- und dann in kleinen, an die Oberfläche schießenden Blasen ausatmen. Mit jedem Atenmzug dümpelt Ihr Körper ein paar Zentimeter auf und ab, während sich der Luftdruck in Ihren Lungen gegen die Gravitationskraft und gegen die auf jeder Zelle Ihres Körpers lastende Masse der Wassersäule stemmt.
Doch um das wahre Gefühl der Schwerelosigkeit zu erleben, muss man im All schweben, dem Zugriff der Gravitation scheinbar vollkommen entzogen. Dort ist das Gefühl der Freiheit keine Illusion mehr – es gibt keine Stricke, an denen zu ziehen, und keinen Druck, dem entgegenzuwirken wäre. Betrachtet man die Erde aus dem Orbit, erlebt man die absolute Freiheit des »freien Falls« – ein Begriff, der tief in unserer Vorstellung von der Gravitation verankert ist, obwohl er ein Luxus ist, in dessen Genuss bisher nur wenige kamen.
In meinem eigenen Leben habe ich also die Freuden des Fliegens und Tauchens erfahren. Die Gelegenheit, ins All zu gelangen, habe ich nur sehr knapp verpasst. Aber wir brauchen keine technischen Wunderwerke wie Flugzeuge, Taucherausrüstungen oder Space Shuttles, um mit der Gravitation zu experimentieren. Schon wenn wir ganz einfache Dinge tun – einen Ball werfen, in einer Hängematte schwingen oder einen Stein auf dem Wasser hüpfen lassen –, sind wir Wissenschaftler, die ihre persönlichen Experimente durchführen und ihre eigenen Schlüsse über dieses so universelle wie geheimnisvolle Phänomen ziehen.
Doch was geht in diesen Augenblicken tatsächlich vor? Was ist Gravitation? Die Frage wirkt naiv, und trotzdem scheint sich die Antwort hinter schwer verständlichen physikalischen Gesetzen zu verbergen. Physikalische Phänomene werden oft als eine Reihe schwieriger Grundregeln dargestellt – Archimedisches Prinzip, Newtons Gravitationsgesetz, Bernoulli-Prinzip und so fort –, denen die Natur bedingungslos zu gehorchen hat. Natürlich sind diese Gesetze entscheidend für unser Verständnis der Welt und der Struktur der Realität. Sie haben gezeigt, dass der Auftrieb Schiffen das Schwimmen ermöglicht und dass der Druckunterschied, der durch die Luftbewegung unter den Flügeln hervorgerufen wird, Vögel und Flugzeuge befähigt, den Himmel zu durchkreuzen. Sie haben uns instand gesetzt, einen Mann – und hoffentlich bald auch eine Frau – auf den Mond zu schicken. Doch wer behauptet, diese Gesetze seien in Stein gemeißelt, verleugnet unsere Wissenschaftsgeschichte. Weit davon entfernt, sich unverrückbar und unverändert zu zeigen, entwickeln sich das Verständnis und die Bewertung dieser Gesetze unablässig fort.
Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Roger Penrose, Andrea Ghez und zahllose andere brillante Forscher haben unser Verständnis der Gravitation jeweils durch neue Perspektiven ergänzt, aber unsere Reise ist noch längst nicht zu Ende. Verstehen Sie dieses Buch als eine Einladung, mich auf der Suche nach der Bedeutung der Gravitation für die Struktur unserer Realität zu begleiten. Glücklicherweise werden wir den größten Teil dieses Abenteuers nicht allein bestreiten müssen, sondern können uns der Führung einiger der bedeutendsten Denker der letzten Jahrhunderte anvertrauen – zumindest so lange, bis wir den Rand der Karte des etablierten Wissens erreichen. Von dort aus werden wir einige tastende Schritte ins Unbekannte wagen. Doch beginnen wird unsere Reise in gut vermessenen Gebieten und in Begleitung verlässlicher Gefährten.
•
Mit der Erkenntnis, dass Gravitation eine universelle Kraft sein muss, die auf alles einwirkt und alle Körper ungeachtet ihrer Masse in derselben Weise beschleunigt, lieferten Galilei, Kepler und Newton das erste entscheidende Teil des Puzzles. Diese Entdeckung überwand das jahrhundertealte aristotelische Dogma und verlieh dem Begriff der Trägheit eine vollkommen neue Bedeutung.
Allgemein bekannt wurde diese Sichtweise, als der italienische Astronom und Physiker 1632 seine Schrift »Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme« (»Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo«) veröffentlichte. Dort verkündete Galilei eine neue kopernikanische Revolution, die nicht nur darin bestand, der Erde ihre Sonderstellung im Sonnensystem abzusprechen – sondern auch, die Idee zu verwerfen, dass irgendein Mensch oder Objekt jemals in Hinblick auf die Naturgesetze eine Sonderstellung beanspruchen könne.
Zur Erklärung dieser Behauptung betrachtete Galilei die Welt mit den Augen eines Seemanns, der in eine große Kabine unter Deck eines fahrenden Schiffes eingeschlossen ist. Unfähig, die Welt draußen zu sehen, vertreibt er sich die Zeit damit, »Mücken, Schmetterlinge und anderes Getier« zu beobachten, die ebenfalls in der Kabine gefangen sind. Galileo erkannte, dass der Seemann nicht angeben kann, ob das Schiff in Ruhe ist oder sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt – zumindest nicht durch Beobachtung der geflügelten Tierchen. Warum? Ganz einfach: Wenn das Schiff sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, so gilt das auch für alles andere an Bord einschließlich der Luft, in der die Mücken und Schmetterlinge umherflattern. Der unter Deck eingeschlossene Seemann kann die Bewegung der Insekten nur relativ zum Inneren der Kabine beobachten. Mit Hilfe dieses Gedankenexperiments, das die Bedeutung der relativen Bewegung verdeutlicht, erklärt Galilei, wie die Erde rotieren kann, ohne dass wir dies direkt bemerken. Mehr noch, sobald wir uns klargemacht haben, dass wir nicht in der Lage sind, zwischen einem Schiff in Ruhe und einem Schiff in gleichförmiger Bewegung zu unterscheiden, können wir allgemeiner schließen, dass die Gesetze der Physik für jeden Beobachter mit gleichförmiger Geschwindigkeit dieselben sein müssen, egal, wie schnell er unterwegs ist.
Dieses »galileische Relativitätsprinzip« – die Erkenntnis, dass die Naturgesetze gleich sind, egal, wer sie beschreibt – ist Teil von Newtons erstem Axiom der Mechanik, nach dem jeder Körper in Ruhe oder in gleichförmiger, geradliniger Bewegung bleibt, solange er nicht durch Einwirkung einer äußeren Kraft gezwungen wird, seinen Zustand zu verändern.[1] Newton erkannte, dass frei zu sein das Privileg ist, eine Bewegung ungestört und mit gleichbleibender Geschwindigkeit fortzusetzen. Ausgehend von Kepler, der die Gesetze der Planetenbewegung entwickelte, führte diese Erkenntnis 1687 zu Newtons Gravitationsgesetz. Danach ist die Kraft, die zwischen zwei Teilchen mit Masse (im Sprachgebrauch der Physik: massiven Teilchen) herrscht, eine universelle und instantan (augenblicklich) wirkende Kraft, deren Intensität mit dem Quadrat des Abstands zwischen den beiden Teilchen abnimmt.
Newtons Gesetz, das viele von uns in der Schule gelernt haben, beschreibt, wie ein Objekt, das man fallen lässt, unerbittlich von der Masse der Erde angezogen wird. Doch die universelle Natur der Gravitation greift weit über dieses einfache Phänomen hinaus. Sie manifestiert sich in allem und jedem, gleich, wie Objekt und Abstand beschaffen sind. 1798 gehörte Henry Cavendish zu den ersten Naturforschern, die die Theorie exakt in einem Labor überprüften. Mehr als drei Jahrhunderte nach seiner Entdeckung hat sich Newtons Gravitationsgesetz eindrucksvoll bewährt – bei Abständen von einem Zehntel der Dicke eines menschlichen Haars bis zu Entfernungen, die sich über Milliarden Kilometer erstreckten. Tatsächlich ist Newtons (universelles) Gravitationsgesetz so grundlegend, dass sich mit ihm auch heute noch die Entwicklung unseres Universums weitgehend vorhersagen lässt, vom Gravitationskollaps dunkler Materie bis zur Bildung von Galaxienhaufen und der Entstehung des Sonnensystems.
Jahrhunderte vergingen, bevor einige Beobachtungsdaten erste leise Zweifel an der Allgemeingültigkeit von Newtons Gravitationsgesetz weckten. Aus heutiger Sicht hätte allerdings bereits die Idee, die Gravitationsanziehung könne zwischen zwei beliebigen Körpern augenblicklich wirken, ein Warnzeichen sein müssen. Nach Newtons einfachem Gesetz müssten sich zwei Körper bei ihrer Entstehung ja ohne die geringste Verzögerung anziehen.
Ganz gleich, was wir unter Anziehung verstehen, dürfte klar sein, dass sie nicht instantan wirken kann. Selbst wenn es sich um Liebe auf den ersten Blick handelt, muss man zunächst einmal die andere Person sehen (das heißt, mit ihr »kommunizieren«, wenn auch nicht unbedingt sprachlich), damit die Anziehung stattfinden kann. In einem Brief an Richard Bentley brachte Newton selbst sein Unbehagen an dem Begriff eines instantanen Gesetzes zum Ausdruck[2] [1]. Auf die Implikationen dieses Problems werde ich später genauer eingehen.
•
Zwei Jahrhunderte später veröffentlichten die amerikanischen Forscher Albert Michelson und Edward Morley die Ergebnisse ihres berühmten »gescheiterten Experiments«, womit sie eine neue wissenschaftliche Revolution auslösten. Kurz darauf erweiterte Einstein unseren Relativitätsbegriff, indem er zunächst Galileis Bewegungslehre durch die spezielle Relativitätstheorie ersetzte und dann mit der allgemeinen Relativitätstheorie unser heutiges Verständnis der Gravitation schuf.
Gestützt auf diese Theorien, ist ein neues Bild vom Universum entstanden, in dem Gravitation auf tiefster Ebene mit dem Gefüge von Raum und Zeit verknüpft und vereinigt ist.
Heute ist mehr als ein Jahrhundert seit Einsteins bahnbrechenden Entdeckungen vergangen, und die allgemeine Relativitätstheorie steht auf stabilerer Grundlage als je zuvor. Die Gravitationstheorie ist sehr gründlich überprüft worden, und die Ergebnisse deckten sich auch unter extremsten Bedingungen mit Einsteins Vorhersagen. Wir haben dank der Gravitationswellen die Kraft entdeckt, die der Gravitation selbst innewohnt. Zugleich haben wir durch die Atom-, Kern- und Teilchenphysik sowie die zahlreichen technologischen Fortschritte des Elektronik- und Computerzeitalters sehr viel genauere Kenntnisse über die Quantennatur unserer Welt erworben.
Parallel zu diesen Fortschritten bringen wir in dem Bestreben, unsere Welt besser zu verstehen, ständig neue Ideen und Theorien hervor. Doch bislang ist noch keine davon über Einsteins allgemeine Relativitätstheorie hinausgelangt, obwohl wir zweifellos eine neue Theorie brauchen. Denn eines machte die allgemeine Relativitätstheorie von Anfang an sehr deutlich: Ab einem bestimmten Punkt muss sie versagen. Dort beginnt ein völlig neuer Bereich der Physik, der noch auf eine Erklärung wartet. Aus diesem Scheitern ergibt sich die Gelegenheit, die Natur auf einer noch tieferen Ebene zu erkunden und zu verstehen.
Im Fortgang unserer Reise werden wir sehen, dass sich die Gravitation unter einem modernen Blickwinkel auch als Manifestation eines Elementarteilchens, des Gravitons, beschreiben lässt – so wie der Elektromagnetismus die Manifestation des Photons, des Elementarteilchens des Lichts, ist.
Genauso wie wir Licht »sehen« können, das sich in Gestalt elektromagnetischer Wellen in Raum und Zeit ausbreitet, können wir heute die Gravitationswellen (ich nenne sie Glicht [glight]) hören, während sie direkt in der Raumzeit Störungen hervorrufen. Da wir mittlerweile den siebten Jahrestag der ersten Entdeckung von Gravitationswellen begehen, ist die Existenz von Glicht über jeden Zweifel erhaben. Seine Entdeckung eröffnete nie da gewesene Möglichkeiten, den vielen Geheimnissen auf die Spur zu kommen, die unser Universum bisher nicht preisgegeben hat.
Welchen Ursprung hat das Universum? Was hat es mit den dunklen Bestandteilen des Universums auf sich, die seine Struktur und Entwicklung bestimmen, aber von unseren Instrumenten nicht direkt erfasst werden? Welches Schicksal erwartet uns? Diese grundlegenden Fragen verlangen nach einer Antwort. Und wer würde sich nicht gern auf die Suche nach ihr begeben?
Unsere Reise wird uns also bis an den Rand des kartierten Gebiets führen. Während Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie natürliche und elegante Antworten auf einige der verwirrendsten Fragen zum Wesen der Gravitation geliefert hat, wirft er auch etliche Fragen auf, mit denen wir immer noch ringen. Wie kommt es beispielsweise, dass die Beiträge bekannter Teilchen, die wir in unseren unterirdischen Teilchenbeschleunigern so gut verstehen, auf das Universum in einer Art einwirken, die wir noch nicht einmal ansatzweise begreifen?
Bei dem Versuch, die Entwicklung unseres Universums mit der fundamentalen Quantennatur der Welt in Einklang zu bringen, werden wir gezwungen sein, uns um ein neues Verständnis der Gravitation zu bemühen. Was wäre, wenn sie sich in großen kosmologischen Maßstäben anders verhielte, als die allgemeine Relativitätstheorie vorhersagt? Was wäre, wenn die lange Zeit für masselos gehaltene Gravitation doch Masse besäße? Diese Idee ist fast so alt wie die allgemeine Relativitätstheorie selbst und wurde von einigen der bedeutendsten Wissenschaftlern des letzten Jahrhundert erforscht. Bis vor Kurzem sind alle Versuche, die Idee vernünftig auszuformulieren, hoffnungslos gescheitert. Doch das ist nicht etwa das Ende unserer Reise, sondern der Beginn ihrer aufregendsten Etappe. Denn von dort aus werde ich Sie auf die neuen Wege führen, die meine Kollegen und ich in unserem Bemühen um ein tieferes Verständnis der Gravitation entdeckt haben.
Diese Wege könnten uns einen völlig neuen Ansatz zum Verständnis der Gravitation ermöglichen. Zwar werden sie uns keine endgültigen Antworten auf all unsere Fragen liefern, aber wenn wir erkunden, wie die Gravitation sein könnte, werden wir möglicherweise ein klareres Bild von der Natur und ihrer ganzen Vielfalt erhalten.
•
Gravitation ist eines der ersten physikalischen Phänomene, die uns bewusst werden, und der Wunsch, ihre Grenzen zu testen, ist fast universell. Als Babys schubsen wir unsere Spielsachen immer wieder vom Tisch und beobachten, wie sie zu Boden fallen (und wie unsere Eltern sie uns wieder zurückbringen). Als Kinder hüpfen wir endlos auf dem Trampolin und schauen, wie hoch wir kommen, bevor wir wieder in Richtung Erde zurückgezogen werden. Wir lassen am Meer Steine über das Wasser hüpfen und bestaunen die Schönheit der Wellenkaskaden. In allen Fällen spielen wir mit diesem hartnäckigen Phänomen und versuchen, ihm entgegenzuwirken. Sein ständiger Widerstand bringt Beschwernis in unser Leben, doch statt ihm auszuweichen, lassen wir uns mit Freuden darauf ein.
Während wir so frei durch die Krümmung der Raumzeit fallen wie durch unser Leben, bemerken wir, dass unsere Reise durch Zeit und Raum – mag sie auch ungebunden und direkt erscheinen – alles andere als geradlinig verläuft. Sicherlich wäre sie nicht vollständig ohne ihren Teil an Hindernissen und Fehlschlägen. Diese zu akzeptieren und die Schönheit des Fallens zu würdigen ist unabdingbar, wenn wir bei unserer nie endenden Suche Fortschritte erzielen wollen. Alle bislang entwickelten Gravitationstheorien bewiesen den Mut zum Scheitern. Das Scheitern in Kauf zu nehmen, heißt, es nicht als beschämenden Schlussstrich anzusehen, sondern als eine Gelegenheit zu einem tieferen Verständnis der Natur.
Meine Suche nach dem Geheimnis der Gravitation gehört nicht nur mir, nicht nur meinen Kollegen, nicht nur Einstein oder Newton mit ihren Entdeckungen; sie ist unser gemeinsames Abenteuer, Ihres nicht weniger als das der großen Forscher, die den Weg gebahnt haben. Die Reise begann vor Jahrtausenden und wird vielleicht niemals enden. Unterwegs können wir hoffen, Erkenntnisse zu gewinnen, die das Leben künftiger Generationen bereichern.
Kapitel 1
Eine Universalsprache
Obwohl meine Muttersprache Französisch ist, lernte ich sie von einer schwedischen Mutter, während wir in verschiedenen Ketschua-Provinzen Perus lebten. Rückblickend ist es vielleicht keine große Überraschung, dass ich in allen Sprachen, in denen ich mich versuchte, ein oder zwei Schwächen und einen unidentifizierbaren Akzent entwickelte. Als ich Anfang zwanzig an der École Polytechnique in Paris studierte, lobte man mich häufig, dass ich so rasch Französisch gelernt hätte. Eine niederschmetternde Feststellung, hatte ich mich dieser Sprache doch seit zwanzig Jahren bedient. Einige Jahre später zog ich nach Kanada. Dort wechselten die Quebecer, wenn sie sich mit mir unterhielten, höflich ins Englische, weil sie (völlig zu Recht) annahmen, ich fühlte mich in ihrer Sprache nicht ganz zu Hause. Ironischerweise verfuhren die englischsprachigen Kanadier genau umgekehrt. Und als ich am Steuerknüppel der winzigen Diamond DA20 Katana saß, in der ich Fliegen lernte, trauten die Fluglotsen ihren Ohren nicht, als ich um Landeerlaubnis auf dem highway bat – der Schnellstraße – statt auf dem runway – der Landebahn.
Tatsächlich hatte ich immer schon Mühe, die richtigen Wörter zu finden. Als ich zwei Jahre alt war, zogen wir nach Ayacucho, einer schönen Region der peruanischen Anden. Das war ein magischer Ort für ein Kind; unvergesslich die leuchtenden Farben des Marktes und die Musik, von der man ständig umgeben war. Doch Ayacucho war auch der Stützpunkt des Sendero Luminoso, des Leuchtenden Pfads, einer linksterroristischen Organisation. Während wir eines Nachmittags bei einem Freund Geburtstag feierten, wurde das Fest jäh durch Schüsse in den umgebenden Hügeln unterbrochen. Meine Eltern packten mich sofort ins Auto. Einige Zeit nach dem überstürzten Aufbruch hielt man uns an einem Checkpoint an, wo einer der Soldaten den Lauf seiner Waffe auf das Ohr meines Vaters richtete. Von Panik ergriffen, rief ich mehrmals hintereinander »Dis Pare!« (französisch für »Sag ihm!«, spanisch für »Stop!«). Zum Entsetzen meiner Familie hatte ich vergessen, dass »Dispare!« auf Spanisch »Schießt!« heißt. Glücklicherweise achteten die Soldaten nicht auf mein Gestammel.
Obwohl sich meine Übersetzungsfehler als relativ harmlos – wenn nicht gar komisch – erwiesen, war ich immer bestrebt, Zugang zu einer verlässlicheren, universelleren Sprache zu finden, in der sich die Welt jenseits aller Worte und Missverständnisse erklären ließ. Als Kind fand ich Trost in einfachen Regeln, die mir immer sehr viel klarer erschienen als die Wörter, um die ich mich bemühte. Alles, was ich sah, schien einfachen Regeln zu folgen, sogar die nicht zu rechtfertigenden Taten des Leuchtenden Pfads.
Dessen Taktik blieb sich immer gleich, egal, ob seine Mitglieder in das örtliche Gefängnis eindrangen, um wichtige Gefangene zu befreien, Regierungsgebäude angriffen oder Zivilisten kidnappten. Unmittelbar bevor sie aus ideologischen Gründen irgendjemanden oder etwas angriffen, jagten sie nach Sonnenuntergang eine Hochspannungsleitung in die Luft, woraufhin die ganze Stadt im Dunkel lag. Bald war mir die Regel klar: Ich zählte bis zehn, und dann brach der Hexenkessel los. Ich hörte Geschrei, sah Schüsse und erblickte überall Angst und Leid. Am lebhaftesten erinnere ich mich aber an den Zehn-Sekunden-Countdown bis zu den Überfällen: Während dieses Zeitraums verspürte ich keine Panik, weil mir die 10‑Sekunden-Regel, die niemals versagte, Halt gab.
Ganz gleich, unter welchen Umständen wir leben, alle haben wir das instinktive Bestreben, die Welt, die uns umgibt, zu verstehen, aus ihr Gesetze abzuleiten, die unsere Beobachtungen erklären und uns zu Vorhersagen befähigen. Das ermöglicht uns, das zuvor Unverständliche zu verstehen, woraus sich – zum Teil – der Erfolg unserer Spezies erklärt. In meinem Fall vollzog sich die Einsicht in diese Muster und Strukturen unserer Welt allmählich – zunächst entwickelte ich Modelle für die Dinge, die mir als Kind unerklärlich waren, dann ergriff mich Ehrfurcht vor dem Unbekannten, ich lernte die Freuden des Entdeckens kennen und verspürte schließlich den Wunsch, einige der Rätsel des Universums zu lösen.
Ich weiß noch genau, dass ich als Fünfjährige in einer Hängematte schaukelte – es war in einem Vorort der Stadt Iqitosa, die an der Grenze zum peruanischen Amazonasgebiet liegt – und ein Gefühl grenzenloser Schwerelosigkeit empfand. Als ich dabei die Sterne erblickte, die durch das Geäst der tausendjährigen Bäume funkelten, konnte ich mir fast vorstellen, im Weltraum zu schweben und die Schwerkraft zu bezwingen. Seither übt dieses Phänomen eine unwiderstehliche Faszination auf mich aus. Sie treibt mich heute, als Wissenschaftlerin, die sich um ein tieferes und allgemeineres Verständnis der Natur bemüht, noch immer an. Zwar scheinen wissenschaftliche Untersuchungen nur noch von mathematischen Lehrsätzen und physikalischen Gesetzen geleitet zu sein, die tiefsten Entdeckungen jedoch verdanken wir in erster Linie: Leidenschaft und Neugier.
Wir sind alle mit ganzer Seele Wissenschaftler, erkennen Muster, erschließen ihre Bedeutungen und sagen Ergebnisse in einer Sprache voraus, die sich von allen anderen Kommunikationsweisen unterscheidet. Sie hilft uns bei dem Versuch, die Muster der Natur zu verstehen und Einblicke in das Wesen der Realität zu gewinnen – wie etwa in die elegante Universalität der Gravitation.
Die Universalität der Lichtgeschwindigkeit
Von der vor mehr als dreitausend Jahren entstandenen chinesischen Astronomie bis zu den jüngsten Entdeckungen des James-Webb-Weltraumteleskops verdankten wir letzten Endes dem Licht jede Beobachtung, die uns gelang, jeden Hinweis, den wir erhaschten. Das Licht hat uns als wertvoller, absolut zuverlässiger Bote gedient, entweder mittels unserer Augen oder durch Teleskope, Beobachtungen und andere Experimente. Doch erst in den letzten Jahrhunderten begriffen wir allmählich, was das Licht wirklich ist.
Nach einer Reihe von Entdeckungen fasste der schottische Physiker und Mathematiker James Clerk Maxwell 1861 die Erkenntnisse von Jahrtausenden in einigen bemerkenswert einfachen Gleichungen zusammen. Die »Maxwell-Gleichungen«, wie sie heute heißen, beschrieben alles, was man damals über die elektrischen und magnetischen Kräfte wusste, und vereinigten sie zu einem »elektromagnetischen Feld«. Vier Jahre später leitete Maxwell aus diesen Gleichungen ab, dass sich Störungen im elektrischen Feld wie Wellen verhalten und ausbreiten. Ihre errechnete Geschwindigkeit lag »so nahe an der des Lichts«, dass sich Maxwell die Schlussfolgerung regelrecht aufdrängte, beim Licht handle es sich um nichts anderes als elektromagnetische Wellen, womit er eine Vermutung bestätigte, die Michael Faraday 1846 geäußert hatte [2].
In gewisser Hinsicht verhält sich das Licht wirklich wie die Wellen, die sich über die Oberflächen der Meere bewegen, oder wie Schallwellen, die sich in der Luft ausbreiten. Tatsächlich sind sichtbares Licht, Radiowellen, Mikrowellen, Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, ultraviolette und infrarote Strahlung letztlich dasselbe: Licht. Der einzige Unterschied liegt in der Wellenlänge – dem Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen. Wie Musik aus Tönen mit unterschiedlichen Tonhöhen zusammengesetzt ist, ergeben sich verschiedene Farben aus Licht mit längeren oder kürzeren Wellenlängen. Beispielsweise hat rotes Licht eine längere Wellenlänge als blaues.
Manchmal bezeichnet man mit dem Wort »Licht« ausschließlich den sichtbaren Bereich des Spektrums – elektromagnetische Wellen mit Frequenzen oder Wellenlängen, die das menschliche Auge wahrnimmt (ungefähr zwischen 400 und 700 nm). Doch alle Arten elektromagnetischer Wellen sind einander, unabhängig von der Wellenlänge, grundsätzlich gleich. Im Prinzip könnten elektromagnetische Wellen so kurz wie die Planck-Länge sein – 10–35 Meter, also zehn Milliarden Milliarden Milliarden Mal kürzer als sichtbares Licht. Am anderen Ende des Spektrums, tief im infraroten Bereich, befinden sich Radiowellen, die einige Hunderttausend Kilometer lang sind. Längere lassen sich auf der Erde nicht entdecken. Jenseits unseres Planeten könnten wir theoretisch elektromagnetische Wellen beobachten, die so lang wie das beobachtbare Universum sind – ungefähr eine Million Milliarden Milliarden Kilometer. Für unsere Zwecke brauchen wir nicht zwischen Wellen im sichtbaren Frequenzbereich und im infraroten oder ultravioletten zu unterscheiden. Wir werden jede elektromagnetische Welle, ungeachtet ihrer Frequenz, als »Licht« bezeichnen.
Licht braucht wie der Schall Zeit, um sich auszubreiten (wenn auch weit weniger). Nach Maxwells Theorie breiten sich Lichtwellen mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch den leeren Raum aus. Zu seiner Zeit ging man davon aus, dass Wellen sich dabei in einem Medium bewegen. So wie Meereswellen Schwingungen des Mediums Wasser sind und Schallwellen sich in vielen verschiedenen Medien fortpflanzen, etwa in der Schnur einer Blechdose, die Kinder als Spielzeugtelefon benutzen (ohne ein Medium, das den Schall trägt, herrscht vollkommene Stille, wie wir seit der unheimlichen Warnung aus dem Film Alien wissen: »Im All kann dich niemand schreien hören.«). Maxwell nahm also an, dass auch das Licht sich durch ein Medium bewegen müsse. Dieses nannte man »Lichtäther« – ein Stoff, der das ganze Universum durchdrang. Die Suche nach Spuren dieses Lichtäthers verlangte ein hohes Maß an experimenteller Genauigkeit, doch die anfänglichen Versuche, ihn nachzuweisen, waren wenig ermutigend. Sie gipfelten in einem der berühmtesten gescheiterten Experimente in der Geschichte der Wissenschaft: dem Michelson-Morley-Experiment. Bevor wir uns mit ihm beschäftigen, schließlich wurde es schon in der Einleitung erwähnt, zuvor einige kleine Vorbemerkungen zur Geschwindigkeit des Lichts.
Bei dieser gab es im Gegensatz zur vergeblichen Suche nach dem Lichtäther bald Gewissheit und auch eine große Genauigkeit bei ihrer Bestimmung – rund 300 Millionen m/s im leeren Raum (den wir das Vakuum nennen). Heute können wir die Lichtgeschwindigkeit noch genauer messen: 299 792 458 m/s.[3] Der Umstand, dass Licht sich immer mit derselben Geschwindigkeit im leeren Raum ausbreitet, ist eine der Weisheiten, die wir alle schon häufig vernommen haben und für selbstverständlich halten. Aber was bedeutet das genau? Auf den ersten Blick scheint es so, dass die Natur es ausnahmsweise einmal gut mit uns gemeint hat, weil diese Konstanz auf eine gewisse Einfachheit schließen lässt. Um dieses Gesetz jedoch in seiner ganzen Bedeutung und Besonderheit zu begreifen, wählen wir ein Gedankenexperiment: Stellen wir uns ein Auto vor, das sich mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h fortbewegt. Und dann einen Fußgänger, der auf dem Bürgersteig steht und sieht, wie ein Auto mit 30 km/h die Straße entlangfährt, gefolgt von einem Fahrrad, das es auf die respektable Geschwindigkeit von 20 km/h bringt. Vom Blickpunkt des Radfahrers bewegt sich das Auto mit einer Geschwindigkeit, die 10 km/h schneller als die eigene ist. Der Radfahrer beschleunigt daraufhin, was ihn keine allzu große Kraft zu kosten scheint, um Seite an Seite mit dem Auto zu fahren. Aus dem Blickwinkel eines Fußgängers fahren Auto und Fahrrad nun mit der gleichen Geschwindigkeit. Aus Sicht des Radfahrers bewegt sich das Auto weder schneller noch langsamer als sein Rad: Die Geschwindigkeit des Autos relativ zum Fahrrad wäre dann gleich null. Zumindest würden wir das aus unserem instinktiven Verständnis der Addition von Geschwindigkeiten schließen, eine Idee, die uns nach der Begegnung mit dem galileischen Relativitätsprinzip in der Einleitung vertraut ist (tatsächlich ging Galilei von genau dieser intuitiven Idee über die Addition von Geschwindigkeiten aus, als er den Beobachter beschrieb, der mit Faltern in der Kabine eines fahrenden Schiffes eingeschlossen ist).
Nach dieser Logik lautete der wissenschaftliche Konsens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass die Geschwindigkeit des Lichts bei seiner Bewegung durch den Lichtäther nur für diejenigen Beobachter ein und denselben Wert hätte, die sich relativ zum Lichtäther in Ruhe befänden. Wer sich wiederum durch den Äther bewegte, würde jeweils eine andere Geschwindigkeit messen. Beispielweise müsste unser Radfahrer eine etwas andere Lichtgeschwindigkeit messen als jemand, der auf dem Bürgersteig steht oder bequem in seinem Wohnzimmer sitzt. Natürlich wäre der Unterschied zwischen dem, was der Radfahrer misst, und dem Wert, den die stehende/sitzende Person ermitteln würde, lächerlich klein im Vergleich zur tatsächlichen Lichtgeschwindigkeit – ungefähr um acht Größenordnungen kleiner. Außerdem ist es ein Unterschied, der mit den technischen Geräten des 19. Jahrhunderts nicht nachweisbar gewesen wäre. Wenn wir allerdings höhere Geschwindigkeiten betrachten, wie etwa die Bewegung der Erde bei der Umkreisung der Sonne, sollten wir interessante Effekte entdecken können. So lautete also der Konsens Ende des 19 Jahrhunderts.
Während Sie im Sessel sitzen und dieses Buch lesen, rasen Sie zusammen mit dem ganzen Planeten auf dessen Umlaufbahn um die Sonne, mit der beachtlichen Geschwindigkeit von 30 km/s. Zwar gibt es in Hinblick auf unser Leben und das Schicksal der Erde keine großen Gewissheiten mehr, doch ich erwarte trotzdem, dass sich die Erde in einem halben Jahr auf der anderen Seite der Sonne befindet und sich dann in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Wenn Galilei recht hat, folgt daraus, dass eine Messung der Lichtgeschwindigkeit zum jetzigen Zeitpunkt ein Ergebnis zu Tage fördern sollte, das sich geringfügig von dem unterscheidet, das wir in sechs Monaten bekommen werden. Da sich die Erde außerdem fortwährend um sich selbst dreht, während sie die Sonne umkreist, und da die Sonne das Zentrum unserer Galaxie (mit rund 230 km/s) umrundet, sollte sich die Messung der Lichtgeschwindigkeit ständig ändern und davon abhängen, wohin wir blicken. Zumindest sollte es so sein, wenn wir Galileos Regel für die Addition von Geschwindigkeiten mit der Vorstellung verbinden, dass sich Licht mit einer bestimmten Geschwindigkeit innerhalb eines Lichtäthers ausbreitet wie Meereswellen auf dem Wasser.
Ein gescheitertes Experiment
Albert A. Michelson, ein Physiker vom Case Institute of Technology in Cleveland, Ohio, und Edward W. Morley, Chemiker an der benachbarten University of Western Reserve, taten sich Ende des 19. Jahrhunderts zusammen, um den Effekt des Lichtäthers, den sie mit dem des Windes verglichen, zu ermitteln. (Das war kurz bevor beide Hochschulen sich zur heutigen Case Western Reserve University vereinigten, der Universität, an der mein Mann und ich rund 135 Jahre später Arbeit fanden.) Für das von ihnen entworfene Experiment konstruierten sie eines der ersten Interferometer, ein raffiniertes Gerät, das heute in vielen Forschungsfeldern Verwendung findet.
Abbildung 1.1. Verspätungen bei Flügen mit sehr starken Winden. Licht, das sich in einem bewegten Lichtäther ausbreitete, würde einem ähnlichen Muster folgen.
Um zu verstehen, wie ihre Versuchsanordnung funktioniert, stellen Sie sich vor, Sie fliegen zwischen zwei Flughäfen hin und her. Bei ruhigen Bedingungen und unter Vernachlässigung von Verkehr und Erdrotation nähme jeder Flug die gleiche Zeitspanne in Anspruch. Doch was geschieht, wenn ein kräftiger Wind weht? Kommt der Wind genau von der Seite (senkrecht zur Flugbahn), wie in Abbildung 1.1, wird das Flugzeug seine eigene Flugrichtung entsprechend anpassen müssen, daher braucht es für jeden Weg etwas länger. Bläst der Wind dagegen in Richtung unseres Hinwegs, machen wir mit dem Rückenwind Zeit gut, aber verlieren etwas Zeit durch den Gegenwind auf dem Rückweg. Man könnte meinen, dass die Zeit, die wir durch den Rückenwind gewinnen, diejenige Zeit, die uns durch den Gegenwind verloren geht, einfach ausgleicht, sodass unsere Reisezeit durch den Wind insgesamt nicht beeinflusst wird. Leider kosten Gegenwinde mehr Zeit, als wir durch Rückenwinde gewinnen. In Windrichtung hin- und zurückzufliegen dauert tatsächlich länger, als senkrecht zum Wind zu fliegen.
Diese Einsicht nutzten Michelson und Morley für ihr Interferometer, um den »Lichtwind« und darüber den Lichtäther nachzuweisen. Stellen Sie sich vor, in einem Flughafen befindet sich eine Lichtquelle und in einem anderen ein Spiegel, der das Licht reflektiert. Wenn sich das Licht mit einer bestimmten Geschwindigkeit innerhalb eines Lichtäthers ausbreitete, aber der Äther relativ zu den Flughäfen in Bewegung wäre, würde der Äther auf das Licht genauso einwirken wie der Wind auf unser Flugzeug. Für Licht, das sich genau in Richtung des Ätherwinds ausbreitet, wird der Hin- und Rückweg länger dauern als für Licht, das senkrecht zur Richtung des Ätherwinds fliegt. Etwas genauer gesagt, teilt das Interferometer das Licht in zwei Strahlen auf, und jeder Strahl läuft durch einen von zwei rechtwinklig zueinander ausgerichteten Armen. Am Ende jedes Arms ist ein Spiegel, der das Licht reflektiert, sodass es anschließend denselben Arm wieder zurückläuft. Am Ende werden die beiden Lichtstrahlen wieder zusammengefügt. Benötigt das Licht beider Strahlen bis zu diesem Punkt genau dieselbe Zeit, sind die beiden Lichtanteile phasengleich: Die Berge und Täler ihres Wellenprofils fallen dann jeweils miteinander zusammen, Berg auf Berg, Tal auf Tal. Die beiden Strahlen interferieren in diesem Fall konstruktiv; das heißt, sie verstärken sich. Doch wenn einer der Strahlen hinter dem anderen zurückbleibt – etwa weil die Bewegung des Äthers den einen mehr als den anderen abbremst –, kommen ihre Wellenmuster beim erneuten Zusammentreffen nicht perfekt zur Deckung. Sie sind nicht mehr synchron, sondern phasenverschoben. Die Amplitude des resultierenden Signals ist infolge destruktiver Interferenz schwächer. Jede Modulation, jede Veränderung der Interferenzeffekte mit der Zeit ist folglich ein eindeutiges Anzeichen, dass sich die Geschwindigkeit des Lichts aufgrund der Bewegung der Erde durch den Äther verändert hat.
Abbildung 1.2 zeigt eine Skizze der Versuchsanordnung von Michelson und Morley. Bemerkenswerterweise war die ganze Interferometer-Apparatur im Keller von Michelsons Labor an einem riesigen Sandsteinblock befestigt, der wiederum in einer Wanne voll Quecksilber schwamm. Daher konnte sie sich in alle Richtungen drehen und verschiedene Richtungen relativ zum Ätherwind ausprobieren.
Als die Ergebnisse des Michelson-Morley-Experiments im November 1887 veröffentlicht wurden, offenbarten sie, was damals unmöglich erschien: Die Messung der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ergibt, anders als zuvor gedacht, immer denselben Wert, egal, wie schnell sich der Beobachter bewegt. Michelson und Morley entdeckten nicht den geringsten Hinweis auf irgendeine Änderung der Lichtgeschwindigkeit, obwohl sich die Erde und damit ihre Apparatur während des ganzen Experiments unstrittig durch das All bewegt hatte.
Abbildung 1.2. Skizze des Interferometers von Michelson und Morley. Wenn die Geschwindigkeit des Lichts in alle Richtungen gleich wäre, würden sich beide Strahlen vollkommen synchron am Schirm überlagern. Liefe das Licht dagegen in eine Richtung langsamer als in in die andere, weil die Erde sich durch den Lichtäther bewegte, wären die Signale bei ihrem Zusammentreffen nicht mehr synchron.
Dieses Ergebnis ließ nur zwei Schlussfolgerungen zu. Entweder befand sich der Lichtäther durch ein unglaubliches und unerklärliches Wunder die ganze Zeit relativ zum Labor in Ruhe – woraus möglicherweise zu schließen war, dass Cleveland der Mittelpunkt des Universums ist –, oder das Konzept des Lichtäthers musste ein für alle Mal ad acta gelegt werden. Angesichts dieser Alternative ist es keine Überraschung, dass man sich für die zweite Möglichkeit entschied, obwohl das Meinungsbild damals nicht so eindeutig war.
Die Genauigkeit, mit der Michelson seine optischen Experimente durchführte, trug ihm 1907 schließlich den Nobelpreis für Physik ein, womit er zum ersten amerikanischen Nobelpreisträger in seiner Disziplin wurde. Dabei wäre er fast über eine Geschichte gestolpert, in der er sich alles andere als mit Ruhm bekleckerte: Zur Zeit des berühmten Michelson-Morley-Experiments war Michelson fünfunddreißig Jahre alt und befand sich in einer bösen Klemme. Ihm wurde vorgeworfen, er habe sich »unziemliche Freiheiten« gegenüber seiner Haushälterin herausgenommen, die nun gemeinsam mit ihrer Tante versuchte, ihn zu erpressen. Doch statt den Forderungen seiner Erpresserinnen nachzukommen, inszenierte er am Morgen des 10. Oktobers – einen Tag bevor Michelson und Morley ihre Ergebnisse zum ersten Mal im Cleveland’s Civil Engineers’ Club vortragen sollten – ein Treffen mit den Erpresserinnen. Im Beisein von Morley und einem Kriminalbeamten, der sich im Labor versteckt hatte, forderte Michelson die beiden Frauen auf, ihre Forderung zu wiederholen. Die Erpresserinnen wurden auf der Stelle festgenommen – Michelson ereilte zwei Tage dasselbe Schicksal. Aus diesem Grund musste die Bekanntgabe der Versuchsergebnisse bis Dezember warten.