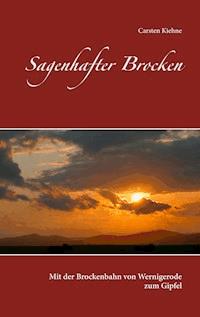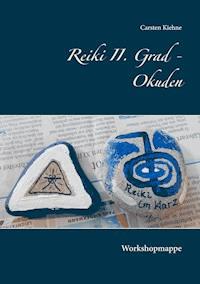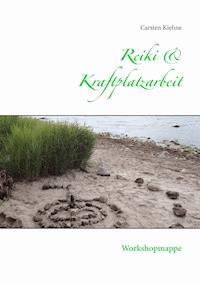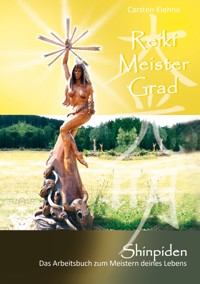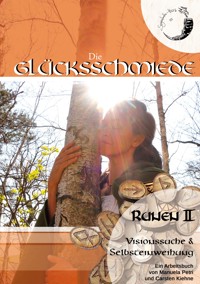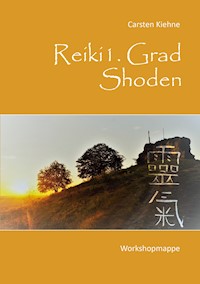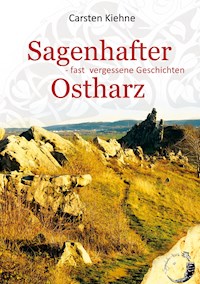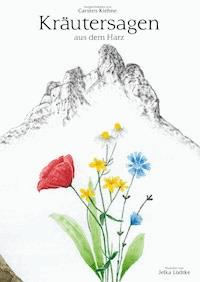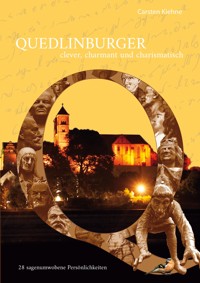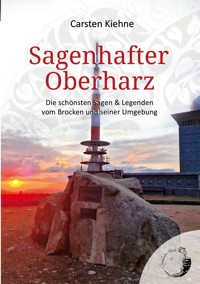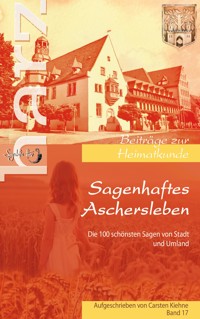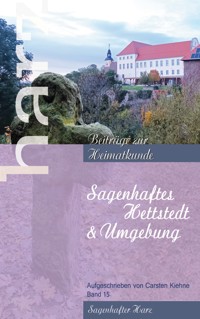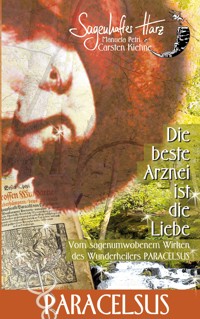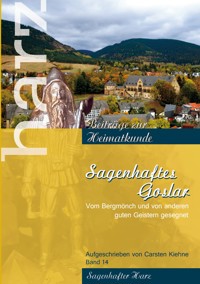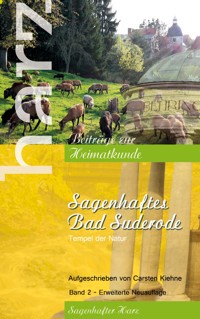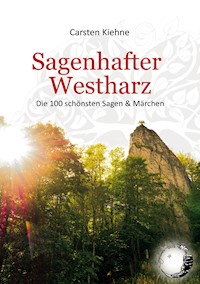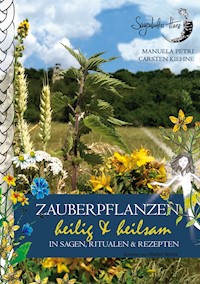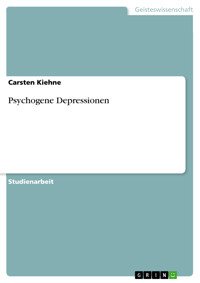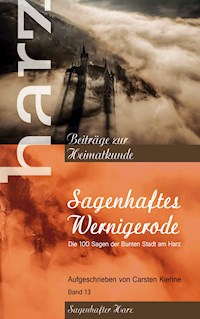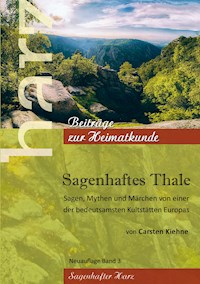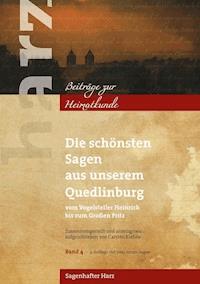
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Harz - Beiträge zur Heimatkunde
- Sprache: Deutsch
Wunderbar, dass Quedlinburg - die über tausendjährige Stadt - eine Fülle von Sagen zu erzählen hat: Von Nonnen, die sich heimlich mit Mönchen trafen; von Gottesstrafen und dem Fisch-Gewitter; dem kopflosen Reiter; dem üblen Raubgrafen; einer Brautentführung durch tapfere Ritter. Was hat Quedlinburgs Name mit einem kleinen Hund zu tun und was fing Heinrich der Vogler beim Jagen? Ob sich Zwerge heute noch in die Hauptstadt wagen? Und womit bezahlte der Narr einst das Huhn? Von all dem und mehr berichten die Sagen. Sie mahnen und antworten auf unsere Fragen. Ja, wer den Gemäuern zu lauschen versteht, kann ihre Geheimnisse erahnen! Eine zweite Auflage wurde nötig, da nach einer weiteren Recherche noch andere Quedlinburger Sagen wiederentdeckt wurden, die es wert sind, unvergessen zu bleiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Woher Quedlinburg seinen Namen hat
Das Hündchen Quedel
Heinrich der Vogler
Wie König Heinrich zum Spitznamen „Vogler“ kam
Geister am Aholz
Zwei Kaisertage
Das Attentat
Der Brautraub
Die Schäferin
Ein seltsamer Fang
Das Johannishospital
Die drei Jungfern
Eines Kaisers größter Wunsch
Der Dieb aus der Hölle
Der St. Annen-Tag
Die Kornengel
Wassergeister in der Bode
Sagen aus dem Brühl
Das wilde Wasser auf dem Münzenberg
Die Schäferkirche
Eine Feuersbrunst verschlingt die Stadt
Vom Raubgrafen
Die unsichtbaren Helfer
Die Zwerglöcher am Münzenberg
Die große Donnerbüchse
Till Eulenspiegel im Harz
Der Mönch straft die faulen Mägde
Eine menschenleere Stadt
Spuk im Klosterhof
Der letzte Fehde-Brief
Das quellende Silber
Ein Streit der Quedlinburger mit den Herren von Hoym
Die Hexe
Der eine Wunsch
Das Wunder der Einhornhöhle
Der blinde Zeuge
Der Kurfürst von Brandenburg besetzt Quedlinburg
Soldatensagen
Der Schatz am Schmökeberg
Friedrich der Große
Eine Sauhirtin wurde Äbtissin
Ein verlockendes Geschenk
Der Grabhügel über der Bode
Schlussworte und Verzeichnisse
So oft streife ich mit meiner lieben Frau abends durch die engen, verwinkelten Gassen unserer Lieblingsstadt Quedlinburg. Jeder Pflasterstein ist sicher schon hundertmal von unseren Füßen berührt worden, und doch bleiben unsere Augen bei jedem Ausflug an neuen Details hängen, die wir nie zuvor wahrgenommen haben: Kratzspuren an der St. Blasii, Runen gegen bösen Zauber an den Häuserpforten, ein Kreuz in der Mauer und hundert liebevoll restaurierte Häuschen.
Mein Herz ahnt: Hier kann uns jeder Stein, jedes Haus und jeder alte Baum wunderbare Geschichten schenken – zumal große Teile unserer schönen Stadt ja seit weit über tausend Jahren besiedelt sind. Und fürwahr, die Geschichten gibt es zuhauf – über Quedlinburgs Historie und seine malerischen und mystischen Orte, wie das Schloss und seinen Finkenherd, die Hölle und den Spukwinkel, die Zwergenlöcher, den Stein des Wegeglücks und das Taubenei, …
… aber wer weiß sie noch zu erzählen?
Oft liegt eine dicke Schicht Staub auf den Werken über Stadt, Land und Leute, die einst von Quedlinburgern verfasst wurden in der Absicht, altes Wissen und denkwürdige Begebenheiten zu bewahren. Doch Sagen wollen nicht nur bewahrt, sondern verbreitet werden. Sie sollen uns einladen, die Geschichte zu erleben, in den Alltag und den Glauben unserer Vorfahren einzutauchen. Freilich ist nicht alles an einer Sage wahr, oft aber gibt es einen wahren Kern, ein tatsächliches lokales Ereignis, auf dem sie fußen und um das die Sagenerzähler dann ihr goldenes Garn gesponnen haben. Mir ist es aber gar nicht wichtig, was wahr oder hinzugedichtet ist, zumal sich jeder Mensch diese Frage anders beantwortet. Aber was glauben Sie, liebe Leserin und lieber Leser, ist dann für mich an einer Sage von größtem Interesse?
Mein Herz weiß um dreierlei Dinge, die es wertvoll machen, eine alte Sage gründlich zu betrachten. Alle drei sind untrennbar miteinander verwoben und führen uns zu einem Ziel. Welches Ziel aber am Ende des Weges Ihres märchenhaften Lebens liegt, können Sie nur selbst herausfinden! Jetzt aber zu den wertvollen Dreien:
Beziehung zum Land:
Was weiß mir die Sage über die Gegend, ihre Geschichte und ihre magischen Orte zu berichten? Hilft sie, mir die Schönheit meiner Heimat vor Augen zu führen?
Beziehung zu Leuten:
Sagen haben oft eine moralische und spirituelle Komponente. Vielleicht helfen sie mit weisem Rat, aus den Steinen, die auf meinem Weg liegen, ein Häuschen zu bauen.
Beziehung zu meinem Leben:
Gibt es in dem vom Herzen Erlauschtem etwas, das mich berührt? Steigen Gedanken oder Gefühle auf, die der Heilung bedürfen? Allein Berührt-Sein hilft!
Quitilingaburg
Ich weiß eine alte, tiefheimliche Stadt
Mit vermorschten Türmen und Bronnen,
Da hat sich in trauten Gärten entlang
Mein Jugendtraum gesponnen.
Da sind in mein Kinderlachen hinein
Kaiser Heinrichs Glocken geklungen
Und haben mir Lieder fromm und rein
Ins junge Herz gesungen.
aufgeschrieben von B., in Schwanecke III.
Die singen und läuten mir noch in der Brust,
Und hör’ ich sie gehen in stiller Nacht,
Dann fühl’ ich einer stürmenden Lust,
Wie meine Heimat mich reich gemacht.
Gedankt sei allen, die halfen, dieses Werk erst entstehen zu lassen:
Meinem guten Eheweibe Sabrina Kiehne, die mir den Rücken freihielt und so manche freie Stunde zum Recherchieren und Schreiben gewährte.
Meiner Mutter Hildegard Kiehne und meiner Schwester Katrin Kiehne für die wunderbaren Zeichnungen, die dieses Büchlein schmücken.
Meinen Herzensfreundinnen Julie-Sophie Himpe (für die grafische Gesamtbetreuung, Buchlayout & Satz), Jelka Lüdtke (für die Bearbeitung & Stilisierung vieler Bilder) und Sina Wiedfeldt (für das Lektorat).
Den guten Seelen in den Thalenser und Quedlinburger Archiven, die mich mit den fast vergessenen Schätzen beschenkten, mit denen ich nun Sie zu beschenken gedenke!
Steffen Wenske für das Quedlinburger Foto auf dem Cover des Buches.
Den Sponsoren, die halfen, das Werk auf sichere Beine zu stellen..
Liste der Sponsoren am Ende des Buches eingefügt.
Nun aber wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Lesen oder dem Erlauschen der Sagen. Mögen Sie sich von ihnen in alte Zeiten oder in Kindertage entführen und mit wachem Herzen berühren lassen, um Quedlinburg anschließend mit den Augen derer zu sehen, die unsere Heimatstadt liebten und noch immer hochhalten.
Lorenz, 1922
Die meisten anderen Deutungen beruhen auf willkürlichen Abänderungen des Ortsnamens. „So in Quellenburg, weil hier viele Quellen gewesen sein sollen, wie in Quadenburg, weil einst der deutsche Volksstamm der Quaden in unserer Gegend gewohnt habe, in Quendelburg, weil hier viel Quendelkraut gewachsen sei, in Qualenburg, weil man hier christliche Märtyrer gequält habe.“ An die Qual, wenn auch im andern Sinne, erinnert eine heute im Volksmunde gehende, mehr scherzhafte Abänderung in dieser Sage:
Lorenz
Einst kam ein Pilger auf seinem Weg zum Himmel an dessen Pforte, meinte, er hätte sein Ziel erreicht und klopfte ans große Tor. Lange wartete er auf Einlass ins Elysium. Als Petrus endlich die Tür öffnete und den Pilger sah, hätte er am Liebsten die Tür gleich wieder zugeschlagen oder ihm den Weg zur Hölle gewiesen. Weil es sich aber im Himmel so ziemt, fragt ihn Petrus nach dem Grund des Klopfens. „Ich möcht‘ hier meinen Tag nach dem Lebtag verbringen, lang genug bin ich auf der Erde umher gewandelt!“, antwortete der Wandersmann. Petrus erwiderte zornig: „An Herzenskrepel wie du im Himmel? Du hast dek unden wie’n Sauhund uffjetragen. Aber jut, kannst dek anma bewasen und kummst annen Ort an dem de diene Schuld abtrajen kannst. Quäl dek durch, dann werd‘sch ma sehn.“ So gab es dann also in der Mitte der deutschen Lande einen heiligen Ort, an dem die Leute Buße tun sollten, um vielleicht doch noch in den Himmel zu gelangen. Hier duldete man weder Jammer noch Selbstmitleid. „Quäldekdurch“ ward er geschimpft. Immer mehr Menschen, denen der Einlass ins Elysium verwehrt war, kamen hierher und mittlerweile ist dieser Ort zu einer wunderschönen Stadt angewachsen und heißt nun Quedlinburg.
aufgeschrieben von Kiehne, nach Lorenz, 1922
Ob aber alle Quedlinburger ihr Ziel, zum lieben Gott zu kommen, stets vor Augen tragen, bezweifle ich ab und an mit sorgenvollem Herzen.
Einst ist also aus dem Flecken unweit des Harzrandes ein ansehnliches kleines Städtchen geworden. Richtung Süden und Osten fand es seinen Schutz durch den angrenzenden, vor allem jetzt im Frühling wilden und ungezügelten Fluss – die Bode. Zu beiden Seiten des Flussbettes gab es einen breiten morastigen Grund, so dass kein Feind so schnell seine Füße darüber setzen würde. Und zum Westen und Norden hin standen gewaltige Mauern aus festem Sandstein mit großen Türmen daran, jederzeit bereit, alle Eindringlinge abzuwehren.
Außerhalb dieser Mauern im nahen Harzwald war es ein gefährliches und raues Leben. Nicht nur die wilden Slawen machten es den christlichen Bauern schwer, ungehindert ihrer Arbeit nachzugehen, auch vor wilden Tieren und Räuberbanden musste man auf der Hut sein. Innerhalb der Stadtmauern aber war das Leben sicher vor diesen Sorgen. „Stadtluft macht frei“, hörte man die Leute sagen, und es war ein emsiges Treiben und Bauen. Die Luft vibrierte nahezu vor lauter Tatendrang und Aufbruchstimmung, und man spürte: Aus dieser Siedlung würde etwas wirklich Schönes und Bedeutsames erwachsen!
Ja, diese Stadt bot den Menschen alles, hatte aber bisher nicht einmal einen Namen erhalten. So traf sich der Rat der Stadt eines Tages, um ihre Ansiedlung endlich würdevoll benennen zu können. Doch wie viel auch beredet ward, ein Ergebnis blieb aus. Schon brach die dunkle, mondlose Nacht herein und während der Rat noch tagte, schliefen die Bewohner längst und selbst die Torwachen taten ihre Augen zu, nachdem sie manchen Schoppen guten Mets geleert hatten.
Doch niemand ahnte, welch großer Haufen Krieger sich da draußen im Walde gerade versammelte. Eine Horde Slawen war bereit und geschult, sich mucksmäuschenstill auf schnellem Pferde den weit geöffneten Stadttoren zu nähern. Und heute war eben jene Stadt ihr Ziel. Sie würden ihre Wachen überrumpeln, die junge Stadt ausrauben und sie wie eine Fackel in der Dunkelheit lodern lassen. Was wäre das für ein Sieg, solch wunderbares Feuer würde ihren Göttern sicherlich größte Freude bereiten. Die Horde setzte sich heimlich in Bewegung und die Stadt schlief weiter. Niemand ahnte die Gefahr. Wirklich niemand? Doch, ein kleiner Hund hielt seine Nase vor einem der Stadttore in die laue Frühlingsnacht und nahm einen seltsamen Geruch war. Dann hörte er auch das Aufschlagen von hunderten von Pferdehufen und gab laut knurrend und böse bellend Antwort. Die Torwachen schreckten auf, wollten dem kleinen Hund schon rügen, aber was war das? Nun hörten auch sie den heran nahenden Feind und dass ihre Stadt in unmittelbarer Gefahr lag. Ein Griff zur Trompete: „Traritrara!“ – ein schriller, ohrenbetäubender Mahnruf an alle Wachen, die Tore zu schließen, die Schwerter zu ziehen, die Bögen zu spannen. Und dieser Ruf kam keine Sekunde zu früh!
Die ersten Slawen waren bereits an der Stadtmauer angekommen, als sie das Trompetensignal der Wachen vernahmen. Sie konnten den Soldaten der Stadt schon in die verängstigten Augen blicken und keine Pferdelänge vor ihnen wurden die schweren Eichentore zugeschlagen und fest verrammelt. Und plötzlich strömten von überallher Mannen auf die Brüstung und die Türme, und gleich darauf schwirrten den Angreifern hunderte von Pfeilen um die Ohren. Mit den Fäusten drohend bliesen sie ihren Angriff ab und kehrten zurück in ihren dunklen Harz. Ja, sie flohen um ihr Leben und das, was ein sicherer Sieg zu werden schien, wurde durch einen kleinen Hund zu einer argen Niederlage. So rasch würden sie keinen weiteren Angriff wagen können. Die Stadt war nun wach und gewarnt.
Die Kirchenglocke der St. Blasii läutete Sturm und endlich kam auch der hohe Rat aufgeschreckt auf die Straße gelaufen. „Was ist passiert?“, wollten die Bürgermeister wissen. Die Torwachen gaben schließlich vor ihrem Hauptmann zu, dass sie eingeschlafen wären und dieses schwarze Hündchen hier Alarm geschlagen hätte. Ihm allein würde die Stadt verdanken, dass es noch Lachen und Freude in den Gassen geben würde. Der Hauptmann verzieh es seinen Wachen, hatten sie doch dennoch die Feinde wacker in die Flucht geschlagen. Welchen Namen das Hündchen tragen würde, fragte er seine Soldaten, doch niemand wusste Antwort zu geben. „Herr Hauptmann, verzeihen Sie, das ist mein Hund und er heißt Quedel!“, sagte ein kleiner, schwarzhaariger Junge, der aus der Menge heraustrat. „Und wer bist du?“, fragte der Hauptmann neugierig. „Ich bin Quitilo, mein Herr!“, antwortete der Junge.
Der hohe Rat beugte sich geschlossen über Quedel und der Hauptmann der Stadtwache streichelte ihm das Ohr. „Denkt der hohe Rat auch, was ich denke?“ „Ja, Herr Hauptmann, ich denke, wir haben nun einen ehrwürdigen Namen für unsere Stadt!“, sagte der Älteste, lächelte und wandte sich zum Volke: „Hört mich an, ihr Bürger unserer schönen Stadt! Dieser kleine Hund hat soeben unser aller Leben gerettet. Ihm zum Dank soll unsere Stadt von nun an seinen Namen tragen. Es ist die Burg des Quedel – unser Quedlinburg!“
„Quedel lebe hoch, lebe hoch, er lebe hoch!“ jubelte die Menge und … „Es lebe unser Quedlinburg!“ Und aus der stillen, mondlosen Nacht wurde ein gewaltiges Fest, das drei Tage währte!
Noch heute ist Quedel im Stadtwappen von Quedlinburg zu sehen. Wachhaft sitzt er im Stadttor, jeden offenen Herzen begrüßend, der für Land und Leute Gutes möchte; jeden in die Waden beißend, der nur um seines eigenen Vorteils willen das ehrwürdige Pflaster betritt.
Herr Heinrich
saß am Vogelherd recht froh und wohlgemut
aus tausend Perlen blinkt und blitzt der Morgenröte Glut
In Wies und Feld, in Wald und Au horch, welch ein süßer Schall
Der Lerche Sang, der Wachtel Schlag, die süße Nachtigall
Herr Heinrich schaut so fröhlich drein: wie schön ist heut die Welt
Was gilt‘s, heut gibt‘s ‚nen guten Fang, er schaut zum Himmelszelt
Er lauscht und streicht sich von der Stirn das blondgelockte Haar
Ei doch! Was sprengt denn dort heran für eine Reiterschar?
Der Staub wallt auf, der Hufschlag dröhnt, es naht der Waffen Klang
Dass Gott, die Herrn verderben mir den ganzen Vogelfang
Ei nun! was gibt‘s? Es hält der Tross vorm Herzog plötzlich an
Herr Heinrich tritt hervor und spricht: Wen sucht ihr Herrn? Sagt an!
Da schwenken sie die Fähnlein bunt und jauchzen: Unsern Herrn!
Hoch lebe Kaiser Heinrich, hoch des Sachsenlandes Stern.
Sich neigend knien sie vor ihm hin und huldigen ihm still
und rufen, als er staunend fragt: ‚s ist deutschen Reiches Will'?
Da blickt Herr Heinrich tief bewegt hinauf zum Himmelszelt:
Du gabst mir einen guten Fang, Herr Gott, wie dir's gefällt!“
aufgeschrieben von Johann Nepomuk Vogl, 1835
Heinrichs erste Ehe mit Hatheburg, die 906 geschlossen ward, löste er kurzerhand mit der Begründung auf: „Sie habe ja bereits den Schleier genommen, möge sie denn also ins Kloster – woher sie kam – zurückkehren!“
Die umfangreichen Besitzungen freilich gab er nicht zurück, in einem Kloster lerne man schließlich Freigiebigkeit! Was also sollte die Nonne Hatheburg mit profanen Reichtümern?
Nun wurde dieser mittlerweile über dreißigjährige Mann der vierzehnjährigen Mathilde vorstellig, die in einem Stift aufgezogen wurde. Heinrich arrangierte sich heimlich mit deren Großmutter, die das Stift in Engern leitete, und nahm die junge Mathilde, ohne die Einstimmung ihrer Eltern abzuwarten, im Jahre 909 unseres sicher verdutzt schauenden Herrn zur Frau.
Der eins und eins zusammenzählende Geist (freilich nur wenn er forsch, frech und frei wäre), könnte nun den Gedanken erschließen, dass Heinrich seine erste Frau beklaut und seine Zweite geraubt hätte. Für eine solche Freveltat wäre der derbe Spitzname „Vogelere“ – der Flatterhafte – natürlich angebracht gewesen.
aufgeschrieben von Kiehne nach Wozniak aber nicht für unseren ersten deutschen König ziemt, sagt man, sei er zum „Vogelsteller“ umgedichtet worden.
Da sich eine solch ungezügelte Benennung vom gemeinen Volke
Geister am Aholz? Aberglaube. Törichtes Volk!“, spottete der junge Schäfer, als er seine Schafe zu eben diesem Waldstück führte.
Der Schäfer hatte erst wenige Tagen lang die Neinstedter Luft gekostet. Sein Oheim war verstorben, Gott habe ihn selig. Und nun lag es in seinem Geschick, den Gutshof weiterzuführen und die Aufgaben des Verstorbenen zu übernehmen. Er war jetzt ein gemachter Mann, dieser junge Schäfer. Und viele junge hübsche Weibspersonen warfen ihm vielsagende, neugierige Blicke nach. Blicke, die er nicht bemerkte, hinterrücks geschenkt. Denn saßen zwei Frauen am Brunnen, taten beide unbeeindruckt und waren doch heimlich hingerissen, wenn der Schäfer singend und sich selbst genügend mit Bocksgespann, seinen Wolfshunden und den gut fünfzig Schafen aus dem Ort herauszog.
Und fürwahr: Der Schäfer war stattlich anzusehen. Seine Hände waren harte Arbeit erprobt, hatten schon vielerlei geschaffen und manches Licht erlöschen lassen. Das blonde Haar lag kraus, halb im narbenlosen Gesicht. Es fiel auf breite Schultern. Sein Lächeln verriet die Lust auf Abenteuer, für die er bisher nicht einen einzigen Zahn einbüßte. Nur einen Makel zeige er, meinten die alteingesessenen Bewohner. Und wie die Neinstedter an den Türen ihrer kargen und schiefen Lehmhütten standen und ihm nachschauten, schüttelten sie besorgt die Häupter.
„Einen Makel?“, sprach der Schäfer ebenso kopfschüttelnd zu sich selbst. Er hatte vom Gerede Wind bekommen – wie auch nicht, in einem so winzigen Flecken. Langsam zog er mit seiner Herde gen Osten in den grauenden Morgen. In einiger Entfernung sah er die Quitlingaburg - ein erhabener Anblick, der ihn aus seiner inneren Schattenwelt riss: Die Sonne küsste zuallererst die himmelhohen Kirchtürme, die Klosterhallen und das Stift auf dem Berge.
Sogar die Wehrmauern schienen von den frühen Strahlen besänftigt den Tag zu begrüßen. Der Schäfer konnte sich an diesem erhabenen Anblick kaum sattsehen. Und im Innehalten stürmten plötzlich tausend wunderbare, sommerliche Gerüche auf ihn ein! Mohn und Weizen fochten auf dem Felde miteinander und doch war ihr Ringen nur ein Tanz auf dem Grunde der frisch gesensten Gräser. Eine süße Note aus Lavendel und Thymian aber drang aus dem nahen Wald zum Schäfer herüber und besiegte die Großen in heimlicher Wonne. Zu diesem Fest zirpten die Grillen ihre Hymne, die den Schäfer fast wehmütig an seine Heimat erinnerte.
„Ah, wir sind da. Dort drüben liegt das Aholz, von dem so viel Schauriges geredet wird! – Wie viele Jahre hat hier wohl kein Schäfer mehr seine Tiere weiden lassen? – Es wird uns laben und uns guten Schatten spenden, und den werden wir auch brauchen!“, sagte er. Zwar war es noch früh am Tage, aber schon jetzt kündete die Sonne von der Kraft, die sie zu ihrem Zenit erreichen würde.
„Einen Makel?“ Die Gedanken hatten den Schäfer eingeholt und tünchten das unendlich weite, wolkenlose Blau über ihm in drückende, allgewaltige Grautöne. „Sie nennen es einen Makel, wenn man nicht an Geister glaubt! Pah, es wird sie lehren, wenn sich meine Schafe das fette Grün am Aholz munden lassen, während ihre dürren Dinger sich auf den kargen Hügeln die Beine in den Bauch stehen. Narren, die sie sind!“
„Er ist so mutig!“, flüsterte Katarin. Ihre Blicke ruhten auf dem Schäfer, seitdem er Neinstedt verlassen hatte. Gerade eben gaben ihre Augen ihn am Aholz verloren. Wie schön das junge Mädchen anzusehen war! Lange braune Locken tanzten verspielt bis zu ihrer schmalen Taille. Und ein Gesicht, sag ich euch: Selbst die Sterne funkelten heller, um sie beim Schlafen zu beobachten. Doch leider war ihr Antlitz so bedeckt von Schmutz, dass es der Schäfer bestimmt nicht einmal wahrgenommen hatte.
„Mutig jenug, um innen juten Tod zu ailen!“, sagte die alte Bäuerin des Gehöfts, in dem Katarin sich dienlich tat. „Komm man Kind, halt nicht Moulaffenfal, wir müssen Quellwasser schöppen.“ „Wird er morgen wohlbehalten ins Dorf zurückkommen, Muhme?“ „Waß net, man Kind. Noch keener hats jewagt, ane Nacht am Aholt zu schlapen. Net so wat ik denken kann. Und dieser Haßsporn globt net an det, was ik schon oft jesehen hap: Große menschliche Jestalten, die mit dem Nebel kummen. Sie raiten uf Wesen, die Flammen us ihren feurich roten Augen werfen unds Gras ankokeln.“ „Oh Gott, ich werde für ihn beten! Die Geschichten kenn‘ ich nur zu gut.“, sagte Katarin, „Vom schwarzen Hund, der hier in der Quelle sitzt, vom Lügenstein oben am Kirchlein und vom weißen Schimmel, der auf dem Lindenkopf tanzt. Um der Geschichten willen bin ich ja auch so besorgt um meinen lieben Schäfer!“ „Dan lieber Schäfer, daner?“ lachte die Alte. „Im Herzen schon. Dort ist er mein, ja! Aber bitte sprecht zu niemandem ein Wort darüber!“, bat Katarin. „Ik jelobe’s!“, sagte die Alte und lächelte in Erinnerung ihrer jungen Jahre!
Die Schafe grasten, die Hunde schliefen, der Bock zerrte halb gelangweilt an seinem Strick. Selbst der Schäfer konnte sich erlauben, auf dem Karren zu liegen und in Tagträumen zu versinken. Gab es nicht in jenem Dorfe, das seine neue Heimat ist, ein hübsches Mägdelein, das den Namen Katarin trägt? Und hatte sie ihn vorhin nicht beim Auszug mit seinen Tieren beobachtet? Er spürte jeden ihrer Blicke und spürte er nichts, dann suchten seine Augen nach der Sanften, für die er stark sein wollte. Doch sie einfach anzusprechen, nein. Das war ein Abenteuer, das er sich dann doch nicht wagte.
Mittlerweile war es Abend geworden und mit der Dämmerung kam der Nebel. Nichts Ungewöhnliches zwar, doch ließen die Tiere das Grasen und rückten immer dichter zusammen. Die Hunde schärften ihre Ohren. Hellwach glänzten ihre Augen, als wollten sie den immer dichter werdenden Nebel durchleuchten.
Selbst der Bock, der stets und ständig am Seil zu zerren pflegte, schmiegte sich ganz nah an den Karren. Jetzt begann auch der Schäfer dieser süßen Stille, die so schmeichelnd zum Schlafe rief, zu misstrauen.