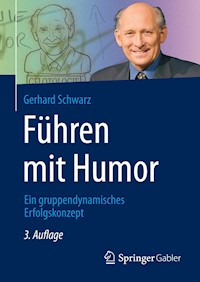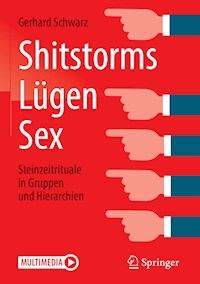Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Schweizer Pavillon an der Weltausstellung 1992 in Sevilla behauptete, «La Suisse n'existe pas». Gemeint war, dass es nicht eine Schweiz gibt, sondern viele Schweizen. Allerdings: Vielfalt ist kein Monopol der Schweiz. Was also macht die Schweiz zur Schweiz? Grundrechte, Rechtsstaat, Gewaltentrennung, Wohlstand oder Sozialstaat gibt es auch anderswo. Was die Schweiz zum Unikat macht, zum von den einen zelebrierten, den anderen verteufelten Sonderfall, sind ihre politischen Institutionen. Sie halten die Willensnation voller Gegensätze zwischen Jung und Alt, Arm und Reich, Stadt und Land, Zugewanderten und Einheimischen, zwischen Regionen, Religionen, Sprachen und Kulturen zusammen. Gerhard Schwarz zeigt in seinem Essay, wie die identitätsstiftenden politischen Eigenarten weiterentwickelt werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCHRIFTEN DES SCHWEIZERISCHEN INSTITUTS FÜR AUSLANDFORSCHUNG
Begründet vonDr.Dr.h.c. Martin Meyer
Gerhard Schwarz
Die Schweiz hat Zukunft
Von der positiven Kraft der Eigenart
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2021 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2021 (ISBN 978-3-03810-446-9)
Lektorat: Ingrid Kunz Graf, Stein am Rhein
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN 978-3-03810-446-9
ISBN E-Book 978-3-907291-45-0
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Inhalt
Zum Geleit
1.Vorwort
A.Ein von unten gebauter Staat
2.Zukunft braucht Herkunft
3.Die Idee Schweiz – der unbehagliche Sonderfall
4.Subsidiarität und Solidarität – der Staat als Genossenschaft
B.Institutionelle Eigenarten
5.Die direkte Demokratie – das Volk im Führerstand
6.Das Milizprinzip – Partizipation im Bürgerstaat
7.Der Non-Zentralismus – Zusammenhalt dank Autonomie
8.Die Konkordanz – der Kompromiss als Teil der Kultur
C.Mitten in der Welt
9.Immerwährende Neutralität
10.Selektive Offenheit
11.Der Platz in Europa und in der Welt
D.Raum für Unternehmertum
E.Arbeit am Morgen
12.Zukunft braucht Reformen
13.Reformieren, um zu bewahren
14.Anpassung der institutionellen Eigenarten
a)Verwesentlichung der direkten Demokratie
b)Revitalisierung des Milizgedankens
c)Stärkung des Non-Zentralismus
d)Erneuerung der Konkordanz
15.Interesse und Teilhabe an der Welt
a)Gute Dienste
b)Veritabler Freihandel
c)Kontrollierte Offenheit
16.Wettbewerb, Privateigentum und Eigenverantwortung
a)Mehr Wettbewerb, weniger Überregulierung
b)Mehr Privateigentum, weniger Staat
c)Mehr Eigenverantwortung, weniger Paternalismus
d)Mehr nachhaltiges Wachstum, weniger Umverteilung
F.Exzellent anders
Die Schweiz und ihre Zukunft als Sonderfall (Ein Nachwort von Lars P. Feld)
Der Autor
Anmerkungen
Weitere E-Books
Zum Geleit
Wie es sein Name sagt, richtet das Schweizerische Institut für Auslandforschung seit seiner Gründung im Jahr 1943 den Blick auf das Weltgeschehen. Vorträge, Diskussionen und Publikationen befassen sich mit dem, was früher und noch lange «Ausland» war und hiess, doch inzwischen näher herangerückt ist: als der globalisierte Globus, dessen Verbindungen und Verflechtungen doch nicht darüber hinwegtäuschen können, dass wachsende Nähe die Konnotationen und Erfahrungen des Fernen keineswegs einfach durchstreichen kann. Daran ändert auch ein gestiegenes Bewusstsein für die Schicksalsgemeinschaft auf unserem Planeten im Zeichen von Seuchen, Klima und anderen Verwerfungen wenig.
Der Ausgangspunkt des mit der Universität Zürich assoziierten Instituts ist freilich die Schweiz. Das Bedürfnis, aus der Freiheit, dem Verständnis und den Eigenarten unseres Landes heraus die Welt in ihren Komplexitäten besser zu verstehen und kritisch zu analysieren, markierte die Geburtsstunde des Siaf in bedrängter Zeit. Orientierung tat not, und sie wurde bald im regen Kontakt mit Wissenschaftern und Forschern insbesondere auch aus dem Ausland nachhaltig geschaffen. Nach dem Zusammenbruch des Totalitarismus von rechts rückte derjenige von links in den Fokus. Das atlantische Bündnis war und blieb immer ein wichtiger Brennpunkt. Und bald wurde auch die Dritte Welt zum Thema von Veranstaltungen, Schriften, Gesprächen und Berichten.
Dies alles jedoch immer wieder auch vor dem Hintergrund dessen, was der grosse Schweizer Schriftsteller und Nobelpreisträger Carl Spitteler anlässlich einer berühmt gewordenen Rede vom Dezember 1914 mit dem Titel «Unser Schweizer Standpunkt» versah. Der Blick auf die Welt als Blick aus der Schweiz: Das war und ist keine perspektivische Verkrümmung, sondern offen oder auch unausgesprochen eine Voraussetzung unserer Tätigkeiten. Bisherige Arbeit hat gezeigt, dass daraus niemals Provinzialismus erwachsen ist. Im Gegenteil: Austausch mit Selbstbewusstsein und Neugier für das Verstehen von anderem ist schon grundsätzlich ein wesentlicher Teil der «success story» dieses Landes.
Dies gesagt, ist es uns eine besondere Freude, die dritte Publikation unserer neuen Schriftenreihe begrüssen zu dürfen. Sie stammt aus der Feder des profilierten Wirtschaftswissenschafters und Publizisten Gerhard Schwarz und ist dem Thema der Zukunftsfähigkeit der Schweiz gewidmet. In einer Epoche weltweit zunehmender, aber auch kontrovers wahrgenommener Interdependenzen und Abhängigkeiten ist immer wieder auch energisch zu fragen, wo unser Land steht, wie es aufgestellt ist, woher es seine geistigen und materiellen Ressourcen bezieht, weshalb es Erfolg hat und weiterhin haben kann, wo umgekehrt Defizite registriert werden müssen oder Schönfärberei und Illusionen die Realitäten verdecken.
Jedermann, der Geri Schwarz kennt und seine Publikationen studiert, schätzt den Denker und Debattierer, der unbeeindruckt von Moden und politisch hochgefahrener «Korrektheit» die Dinge beim Namen nennt, auf den Punkt bringt und auf weitere Perspektiven hin entwickelt. Man kann es auch so sagen: Liberalismus soll, ja muss auch unbequem und unangepasst sein, wenn er seine Werte und Überzeugungen in einem Klima verteidigt, das vielerorts diverseste Ansprüche und Begehrlichkeiten einerseits, den Dirigismus von oben mit einem immer längeren Schweif von Vorschriften und Zwängen anderseits begünstigt.
Die gute Nachricht lautet: Die Schweiz hat Zukunft. Sie hat dank eines ziemlich einzigartigen Mixes aus Herkunft, Offenheit, institutioneller Balance, wirtschaftlicher Kompetenz, Innovationskraft und kultureller Diversität alle Chancen, in einer Welt von morgen nicht einfach aufzugehen, sondern diese selbsttätig mitzugestalten.
Dr.
1. Vorwort
Beim Schreiben des Buchs Wirtschaftswunder Schweiz1 habe ich begonnen, mich eingehender mit den Ursachen des ungewöhnlichen wirtschaftlichen Erfolgs der Schweiz nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu befassen. Erste Anstösse dazu waren allerdings schon früher erfolgt. Während meiner Zeit als NZZ-Korrespondent in Paris hatte mir mein Kollege Paul Keller, langjähriger Frankreich-Korrespondent für die Basler Nachrichten, die Basler Zeitung und zuletzt auch für die NZZ, als Willkommensgeschenk sein Buch Die Schweiz warum?2 überreicht. Später beeindruckte mich Jonathan Steinbergs Why Switzerland?.3
Die an Stammtischrunden jeglichen Niveaus meist mit viel moralischem Tremolo vertretene These, die Schweiz sei auf Kosten der anderen Staaten reich geworden, liess sich nur begrenzt erhärten. Die Schweiz überholte schon vor den grossen Kriegen viele Staaten in Europa – in einer Zeit also, in der sie weder von Bankgeheimnis und Kapitalflucht noch von der Unversehrtheit im Krieg profitierte. Die naheliegende und partiell richtige These, es seien vor allem marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes entscheidend, genügte als Erklärung ebenfalls nicht. Zum einen war und ist das Land keineswegs immer so marktwirtschaftlich, wie es scheint. Zum anderen – und vor allem – zeigte sich, dass es das politische System und einige weiche Faktoren sind, die letztlich den Unterschied ausmachen. Schon Gottfried Keller hatte die Schweiz einst als politische Idee bezeichnet.4 Halbwegs marktwirtschaftliche Länder gibt es nämlich noch einige mehr auf dieser Welt. Ein zweites Land mit einem politischen System, das dem der Schweiz ähnelt, gibt es hingegen nicht. All diese Beobachtungen haben dazu geführt, dass ich mich in den vergangenen zehn Jahren in Vorträgen und kürzeren Texten immer wieder mit diesem eigenwilligen politischen System befasst habe. (Vgl. dazu die Angaben zum Autor am Schluss des Buches.)
In der vorliegenden Schrift versuche ich nun, diese Vorarbeiten zu einem schlüssigen Ganzen zusammenzufügen. Der Essay enthält – ohne eigene Kenntlichmachung – viele Textbausteine, die ich an anderer Stelle bereits einmal mündlich oder schriftlich formuliert oder gar veröffentlicht habe.
NZZ-Wirtschaftsredaktor Thomas Fuster und der Ökonom Rudolf Walser haben das Manuskript gegengelesen und viele wertvolle Anregungen geliefert. Ihnen gilt mein Dank ebenso wie dem Wirtschaftshistoriker Roman Wild, der mich bei der Sichtung von Zitaten und Daten unterstützt hat. Mit beidem bin ich allerdings im Interesse einer flüssigeren Lesbarkeit sparsam umgegangen. Mein besonderer Dank gilt Professor Lars Feld für ein sehr spontan geschriebenes Nachwort. In ihm sieht er «mit Augenzwinkern, aber einem ernsten Kern» die Rolle der Schweiz ausserhalb der EU unter anderem darin, dass sie zeigt, dass politische und wirtschaftliche Lösungen selten alternativlos sind.
Gegenüber dem Ausgangsmaterial ist der vorliegende Text ausführlicher, er enthält neue Überlegungen, und er fokussiert vor allem nicht allein auf die Wirtschaft.
Als liberaler Ökonom habe ich immer die Auffassung vertreten, der wirtschaftliche Erfolg sei nicht alles, ja aus liberaler Sicht sei – unbesehen ihres Erfolgs in Sachen Wohlstand – jene politische und jene wirtschaftliche Ordnung vorzuziehen, die den Menschen in Politik und Wirtschaft am meisten Souveränität, also Selbstbestimmung, gewährt. Dieser sehr grundsätzliche liberale Tenor, der von vielen Vertretern der Wirtschaft nicht geteilt wird, die sich immer wieder einmal vom Staatskapitalismus Chinas, von der Effizienz, Schnelligkeit und Wachstumskraft autoritärer Regime wie Singapur oder von den wirtschaftlichen Vorteilen grosser Märkte beeindrucken lassen, prägt auch dieses Buch. Es ist Ausdruck der Überzeugung, dass einerseits der weit über 150 Jahre anhaltende Erfolg der Schweiz mehr auf ihrem System ausgeprägter politischer Selbstbestimmung als auf ihrer – gerade auch wegen des politischen Systems keineswegs ungebrochenen – Bejahung des Marktes beruht und dass anderseits dieses politische System trotz all seiner Schwächen den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mitbestimmung und Freiheit gewährt als alle real existierenden Alternativen.
Gleichzeitig kann dieses Erfolgsmodell Schweiz kein Modell, kein Vorbild für andere Staaten sein. Die Schweiz ist ein Staat sui generis, der nicht auf dem Reissbrett entworfen wurde, sondern durch die Zufälle von Geografie und Geschichte zu dem geworden ist, was er heute ist. Insofern führt auch der beliebte Begriff der «Willensnation» auf eine falsche Fährte. Die vielen Eigenarten der Schweiz lassen sich nicht ohne Weiteres übertragen, sie können höchstens da und dort als Inspiration dienen. Und sie sollten dem Land ohne Neid oder Trotz als Eigenwilligkeiten belassen werden. Leider kann dies nicht einfach erwartet werden, weshalb die Schweiz viel stärker bereit sein müsste, für ihre institutionellen Eigenheiten zu kämpfen.
Die Ausarbeitung des Manuskripts fiel in die Zeit der vielleicht grössten Krise, die die reichen Industriestaaten seit dem 2. Weltkrieg durchgemacht haben. Obwohl sich in dieser Pandemie im Schweizer Krisenmanagement viele Schwächen gezeigt haben, was sofort die üblichen Kritiker auf den Plan rief, haben sich die institutionellen Eigenheiten des Landes zumindest nicht schlechter bewährt als andere politische Systeme. Das Modell Schweiz ist kein Schönwettermodell.
Mein früherer Arbeitgeber, der liberale Thinktank Avenir Suisse unter seinem damaligen Präsidenten Andreas Schmid, und das Schweizerische Institut für Auslandforschung unter der Leitung von Martin Meyer haben es mir ermöglicht, Zeit zum Nachdenken und zum Schreiben zu nehmen, und mich ermuntert, meine Gedanken zu Papier zu bringen. Und die Bonny-Stiftung war mir durch die Vergabe ihres Bonny-Preises der Freiheit ein zusätzlicher Ansporn. Ihnen allen gilt mein grosser Dank.
A. Ein von unten gebauter Staat
2. Zukunft braucht Herkunft
Wer die Schweiz von heute in die Zukunft hinein weiterdenken will und dabei an den bestehenden – zum Teil vormodernen – Institutionen des Bundesstaats anknüpft, setzt sich leicht dem Vorwurf der Rückwärtsgewandtheit und Vergangenheitsromantik aus. Solches Festhalten an den institutionellen Eigenwilligkeiten sei unzeitgemäss, heisst es. Es ist noch der mildeste Vorwurf, den man zu hören bekommt – mild deshalb, weil sich der Vorwurf so offensichtlich als versteckte Anmassung, genau zu wissen, was und wer denn zeitgemäss sei, entlarven lässt. Gerne wird man auch bezichtigt, den zum Teil sich widersprechenden Geschichtsmythen aufzusitzen, etwa dem Rütlischwur, dem Bundesbrief, der Tell-Sage oder den vielen, bis zur Niederlage in Marignano sehr erfolgreichen Schlachten (wie Morgarten, Sempach und Näfels). Man erliege dem Irrglauben, die direkte Demokratie, die starke Autonomie der Kantone und Gemeinden und die Partizipation der Bürger seien unmittelbare Folgen des Freiheitskampfes einfacher Bauern.
Doch trotz aller Bedenken gegen mythische Überhöhung – Mythen und Symbole gehören zur Identität jedes Landes, sie müssen nur den rechten Stellenwert haben. Man muss Geschichten und Geschichte auseinanderhalten. Dass es sich bei den Mythen um Geschichten, um Konstruktionen und Fantasien handelt, ist zweitrangig. Länder brauchen Ursprungsgeschichten, die ihre Werte und Haltungen zum Ausdruck bringen und verständlich machen, die auch Kraft geben können. Diese Erzählungen dürfen nur nicht in die anachronistische Erstarrung führen. Und die Geschichte und die Erinnerung daran braucht es erst recht. «Eine Gesellschaft ohne Erinnerung ist nicht viel mehr als ein Menschenauflauf», meinte der polnische Filmemacher Andrzej Wajda einmal.5 Sehr vieles, was die Schweiz ausmacht, ist im historischen Gedächtnis tief verankert. Und man kann eine Ordnung nicht bewahren und nicht weiterentwickeln, wenn man nicht weiss, auf welchen historischen Grundlagen sie beruht. «Zu wissen, wie es gekommen ist, den Prozess zu begreifen, den wir selbst weiterführen müssen, das können wir uns nicht ersparen.»6
Dazu kommt, dass nur die pragmatische Weiterentwicklung des Bestehenden einigermassen realistisch ist. Änderungen können und sollten immer schrittweise erfolgen. Utopien führen nicht zu nachhaltigen Lösungen, sie können höchstens eine vage Orientierung geben, wobei aber der Versuch einer perfektionistischen Umsetzung utopischer Zukunftsentwürfe fast notwendigerweise in die totalitäre Verirrung führt. Mein Doktorvater Walter Adolf Jöhr plädierte daher für das Prinzip der «Anknüpfung an das Bestehende».7 Heute würde man wohl eher von der Pfadabhängigkeit aller Politik sprechen. Das gilt besonders ausgeprägt für die Schweiz, die sich noch ausgeprägter als andere Länder gemäss Herbert Lüthy «nur historisch definieren» lässt.8 Die Institutionen des Landes sind zwar reformbedürftig – welche wären es nicht? –, aber so schlecht auch wieder nicht, dass man sie über Bord werfen müsste. Sie brauchen lediglich eine Frischzellenkur. Und vor allem: Womit sollte man sie ersetzen? Wo sind die in der Praxis erfolgreicheren und auf die Schweiz und ihre Geschichte passenden Alternativen?
Anknüpfung an das Bestehende bedeutet in keiner Weise eine nostalgische Verklärung der Vergangenheit. Man sollte die Vergangenheit kennen, man kann aus ihr lernen, man sollte sich aber vor der Illusion hüten, früher sei alles besser gewesen, etwa in der Aufbruchstimmung der Gründung des Bundesstaates von 1848 und den Jahrzehnten danach. Auch die insgesamt als positiv wahrgenommenen Phasen der Geschichte waren nicht ohne Schatten, selbst wenn dies der Erinnerungsoptimismus gern ausblendet. Der Staatsgründung von 1848 war mit dem Sonderbundskrieg ein Bürgerkrieg vorausgegangen, der so unblutig und «zivil» nicht war, und den Zweiten Weltkrieg konnte das Land nur weitgehend unversehrt, nicht aber unschuldig durchstehen.
Schliesslich bedeutet der Blick zurück und die Anknüpfung an das Bestehende schon gar nicht, dass man sich ein Zurück zu früheren Zuständen wünscht, ganz abgesehen davon, dass ein Zurückdrehen der Geschichte auch gar nicht möglich ist. Selbst Werte wandeln sich, aber sie tun es, wenn überhaupt, nur langsam. Darum gibt es gute Gründe, wertkonservativ zu sein. Strukturen wandeln sich dagegen sehr viel schneller, nämlich mit dem technischen Fortschritt. Das Sträuben der Strukturkonservativen gegen diesen Fortschritt ist vergeblich und sinnlos. Strukturen müssen immer wieder angepasst werden. Und gerade wer Werte in einem sich wandelnden Umfeld möglichst bewahren oder jedenfalls nur behutsam anpassen will, muss den Strukturwandel bejahen.
3. Die Idee Schweiz – der unbehagliche Sonderfall
Es fällt vielen Menschen schwer, sich zu sehr von der Gruppe, in der sie sich bewegen, zu unterscheiden. Nach einem Umzug übernehmen Kinder in der Schule und im Freundeskreis meist erstaunlich rasch den lokalen Dialekt oder die lokale Sprache, auch wenn zu Hause ein ganz anderes Idiom gesprochen wird. Sie wollen dazugehören und sich nicht zu sehr von ihrem Umfeld unterscheiden. Gewiss pflegen sie da und dort eine gewisse Individualität, etwa bei der Identifikation mit dem Fussballklub ihrer Herkunftsregion, aber gänzlich anders zu sein als der Rest, das halten nur wenige besonders starke Charaktere aus. Das gilt selbst dann, ja dann vielleicht erst recht, wenn man sich in vielen Bereichen positiv vom Rest der Gruppe abhebt. Schnell gilt man dann als Streber, als jemand, der sich bei den Lehrern, den Erwachsenen oder den Vorgesetzten einschmeicheln will, oder als jemand, der sich den anderen überlegen dünkt. Vielleicht wird man beneidet, aber das kann ziemlich unangenehm sein.
Sich dem Niveau anpassen und mit den anderen mitmachen ist einfacher, selbst wenn es um Aktivitäten geht, vor denen man sich fürchtet oder denen man von Hause aus mit Vorbehalten begegnet. Es ist nicht nur bequemer, sondern entspricht auch der menschlichen Natur. Der Mensch ist ein soziales Wesen, und der Gruppendruck ist gross. Wer in zu vielen Belangen anders denkt und handelt als seine Umgebung, hat Mühe, die Akzeptanz, das Wohlwollen, die Bewunderung und die Zuneigung der Mitmenschen zu gewinnen. Vielleicht erhält man Respekt, aber das ist schon fast das Höchste der Gefühle – und eher die Ausnahme.
Ähnlich wie Menschen in einer Gruppe an ihrem Anderssein leiden, tut sich die Schweiz im Verband der Staaten schwer mit ihrem Anderssein. Als ich 1969 in die Schweiz kam, um hier zu studieren, empfand ich die geradezu selbstzerfleischende Auseinandersetzung so mancher 68er-Kommilitonen mit der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg irgendwie übertrieben. Nicht dass es nichts aufzuarbeiten gegeben hätte: Auch die Schweiz hat grosses menschliches Leid angerichtet oder nicht abgewendet; da soll nichts verharmlost werden. Gleichwohl, da waren die Gräueltaten, die Verbrechen, der Horror jener Nachbarländer, die den Krieg mit Begeisterung begonnen und auf industrielle Weise Millionen unschuldige Menschen in Lagern vernichtet hatten, da waren jene Nachbarn, die den Faschismus als Erste gehegt und im letzten Moment die Seiten gewechselt hatten, und da waren jene, die dem siegreichen Gegner mit einem willfährigen und kollaborierenden Regime entgegengekommen waren, aber im Rückblick fast nur von der Résistance sprachen. Unmenschlichkeit lässt sich zwar nicht aufrechnen, aber irgendwie vermittelte die Beschäftigung der Schweiz mit ihren Schatten des Zweiten Weltkriegs manchmal den Eindruck, man wolle sich nur ja nicht besser fühlen als die anderen, man wolle unbedingt auch zu den Schuldigen gehören.
Diese Betonung der Verfehlungen etwa durch Max Frisch (Dienstbüchlein), Alfred Häsler und Markus Imhoof (Das Boot ist voll) sowie Niklaus Meienberg und Richard Dindo (Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.)9 wurde ohne Zweifel auch provoziert durch die weitverbreitete helvetische Heroisierung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und den Widerstandsmythos. Sie war also auch eine Art Trotzreaktion. Doch ironischerweise ging es ja in den selbstverklärenden Erzählungen der Aktivgeneration irgendwie ebenfalls um das Dazugehören, das «nicht zu sehr anders sein wollen als die anderen» – nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Man konnte mit Bekannten von jenseits der Grenze mitreden, denn man hatte schliesslich auch Krieg geführt, wenn auch einen Verteidigungskrieg. Man meinte also zu wissen, wovon die anderen redeten. Doch auch hier: Die Härten sollen gewiss nicht geringgeschätzt werden, aber in den Nachbarländern waren die jungen Männer vielfach jahrelang an der Front, nicht Hunderte, sondern Tausende Kilometer entfernt von ihren Familien, auf klimatisch und kulturell völlig fremdem Territorium. Und in fast jeder Familie gab es Gefallene, Vermisste, politisch oder rassisch Verfolgte. Und jene, die zurückkamen, waren schuldig geworden, weil es in einem Krieg fast unmöglich ist, keine Schuld auf sich zu laden.
Die Schweiz blieb also verschont, was ihr die Siegermächte zum Vorwurf machten, denn sie habe sich durchgemogelt, sie habe ihre Unversehrtheit durch die Kollaboration mit den faschistischen Staaten erreicht, womit sie den Krieg verlängert habe. Wie dem auch sei: Die Schweiz blieb von dem unermesslichen Leid der Krieg führenden und besetzten Länder genauso verschont wie von den allergrössten moralischen Verfehlungen. Niemand hat dies so differenziert, so austariert zum Ausdruck gebracht wie Friedrich Dürrenmatt, der überaus kritische Schweizer, der zugleich betonte, dass er gerne Schweizer sei. Im Essay «Zur Dramaturgie der Schweiz» schreibt er – ausgerechnet im Jahr 1968 –, wie sich die Schweiz im Krieg verantwortungsethisch verhielt, was ihr die nachgeborenen Gesinnungsethiker bis heute vorhalten:
«Die Schweiz hatte politisch nur eine Aufgabe zu lösen, die alle anderen politischen Aufgaben nebensächlich machte: Den Krieg vermittels ihrer Politik zu vermeiden, und sie vermied ihn vermittels ihrer Politik. Eine andere Frage ist natürlich, wie sie ihn vermied […] Die Politik ist nicht besser als die Menschen, die sie betreiben […] So zogen wir uns denn schweizerisch aus einer unmenschlichen Lage: Nicht unklug, mit hohem moralischem Anspruch und mit moralisch oft bedenklicher Praxis. Neutralität ist eine politische Taktik, keine Moral. Neutralität ist die Kunst, sich möglichst nützlich und möglichst ungefährlich zu verhalten. Wir waren auch Hitler gegenüber möglichst nützlich und möglichst ungefährlich. So sparte er uns für die Siegesfeier auf, und wir wurden nicht gefressen, damit hatten wir spekuliert […] Unsere Fehler und unsere Tugenden, unsere Feigheit und unser Mut, unsere Unterlassungen und unsere humanen Gesten, unsere Dummheit und unsere Klugheit, unser Nachgeben und unser Widerstand dienten unbewusst und bewusst nur dem Ziel, davonzukommen. Und so kamen wir denn davon.»10
Das Leiden eines Teils der Bevölkerung an der Aussergewöhnlichkeit, der Einzigartigkeit der Schweiz, das gelegentlich geradezu in Selbstschmähungen kippt, zeigt sich in der helvetischen Befindlichkeit immer wieder. Sie ist fast eine Konstante der Geschichte, jedenfalls der jüngeren Geschichte. Da ist etwa die heutige Kritik am Profitieren von Schweizern (und indirekt der Schweiz) vom Sklavenhandel, diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit,11 oder am Profitieren der Schweiz, die im Gegensatz zu anderen kleineren Staaten wie den Niederlanden, Belgien oder Dänemark nie koloniale Ambitionen hegte, vom Kolonialismus. Wie hätte es angesichts der damals herrschenden Wertvorstellungen auch anders sein sollen, in einer schon damals vernetzten Welt? Da ist sie erneut, diese Scham über das Davonkommen, dieses Verschontwerden in zwei Weltkriegen, obwohl zu Scham genauso wenig Grund besteht wie zu moralischer Überheblichkeit. Und da ist das Unbehagen am wirtschaftlichen Erfolg, am beneidenswerten und vielfach beneideten Wohlstand, an einer weit über das Wirtschaftliche hinausreichenden privilegierten Situation.
Die Schweizer sind nicht nur, wie Umfragen immer wieder zeigen, mit ihrer wirtschaftlichen Situation sehr zufrieden, ihr Wohlergehen ist auch real und keineswegs bloss gefühlt.12 Es geht ihnen, gemessen an vielen harten Indikatoren, objektiv sehr gut. Einige Belege hierzu: Der Durchschnittslohn liegt kaufkraftbereinigt rund 40 Prozent höher als im Mittel der vier grossen Nachbarländer (also ohne Liechtenstein).13 Die Primärverteilung der Einkommen, also vor der Umverteilung durch Steuern, zählt in Europa zu den gleichmässigsten, die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt liegt nur in Japan höher, in Sachen Umweltqualität können von den hoch entwickelten Ländern nur wenige mithalten, die Schweiz ist pro Kopf Weltmeister bei der Anmeldung von Patenten, ihre beiden technischen Hochschulen ETH und EPFL bilden zusammen mit Oxford und Cambridge das Spitzenkleeblatt in Europa, der Finanzplatz ist der wichtigste auf dem europäischen Festland und neben der Londoner City der einzige, der weltweit mithalten kann. Hinsichtlich der persönlichen, bürgerlichen und wirtschaftlichen Freiheiten liegt die Schweiz weltweit an zweiter Stelle, hinter Neuseeland.14 Ausserdem ist nicht nur der soziale Friede ausgeprägt, die Schweizer sind gemäss Ergebnissen der Glücksforschung auch ausgesprochen glücklich. Da erstaunt es kaum, dass die Schweiz im «Where to be born»-Index des Economist, der weltweit fragt, wo man seine Kinder am liebsten geboren und aufwachsen sähe, regelmässig ganz vorn rangiert.
Wie um dies zu kompensieren, diese vermeintliche «Ungerechtigkeit» der Geschichte also auszugleichen, gibt es eine Strömung in der Schweiz, die nur ja nichts von einem Sonderfall Schweiz wissen will, die sich von den Besonderheiten des politischen Systems trennen und dieses an den Rest Europas und der Welt anpassen möchte, um sich ja nicht einer unsympathischen Eigenbrötelei oder eines notorischen Nonkonformismus verdächtig zu machen.15 Stellvertretend für viele schreibt Adolf Muschg, der «reelle Sonderfall würde mit der Einsicht beginnen, dass jedes Land der Welt ein solcher ist, also auch keines».16