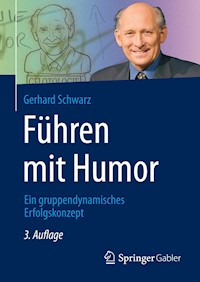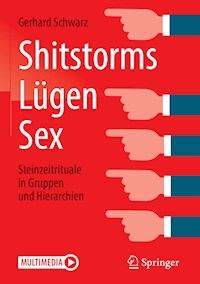Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit 2016 kommentieren Gerhard Schwarz und Claudia Wirz mit ihren Kolumnen in der NZZ Woche für Woche das Zeitgeschehen. Die kleinen Stücke sezieren in unterhaltsamer Weise die wachsende Staatsgläubigkeit, die zunehmende Angst vor dem Wettbewerb, den unbändigen Regulierungsdrang der Politik und die Gefahren des Zentralisierungs- und Harmonisierungsdrucks. Der vorliegende Band versammelt eine Auswahl von 101 Kolumnen und ist eine facettenreiche Zeitdiagnose. Nie dogmatisch, nie parteipolitisch, nie moralisierend, aber ausgestattet mit der nötigen Portion Skepsis wollen Schwarz und Wirz je auf eigene Weise ihre Leser zum nach- und selberdenken anregen. Mit einem Geleitwort von Lino Guzzella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
Geleitwort
Weckrufe wider die Denkfaulheit
Liberal ist weder «lechts» noch «rinks»
Progressiv ist manchmal ausgesprochen konservativ
Die libertäre Utopie
Die Gefahr utopischer Würfe
Liberale Gewissenserforschung
Vereinnahmung von allen Seiten
Toleranz heisst nicht Beliebigkeit
Wo sind die Bürgerlichen?
Ist Faulheit Freiheit und umgekehrt?
Urliberale Etatisten
Ist die Linke noch links?
Des Kapitalismus schlechte Presse
Liberal bedeutet Wahl
Gute und faule Kompromisse
Bedeutet direkte Demokratie «Zustimmung der Dummen»?
Herrschaft auf Zeit
Dankbarkeit ist eine Tugend, keine Pflicht
Die schleichende Verstaatlichung der Familie
Plädoyer für einen Pilz
Politisches Anti-Aging
Schenken ohne Widerspruch
Liberale misstrauen der Gewissheit
Die Krise des Milizsystems
Wie das Modell Schweiz verblasst
Die Kurzfristigkeitsfalle der Politik
Der Kipppunkt der Demokratie
Die unsensible Bevölkerung
Ausbruch aus dem Elend
Die Wohlfahrt als Dämon
Lohntransparenz für Arbeitnehmer
Der Wohlfahrtsstaat ist eine tragische Figur
Hochqualifizierte Bedürftigkeit
Immer das Gleiche über Reiche
Falsche Tabus in der Altersvorsorge
Der Lohn des Jammerns
Ist Reichtum eine Schande?
Dem Staat zu Diensten
Chancen statt Ergebnisse
Alle Macht dem Mittelmass
Island – für Frauen der beste Ort der Welt
Ungleichheit ist nicht per se ungerecht
Das Gymnasium ist überschätzt
Die apokalyptischen Reiter der Nivellierung
Hurra, wir sind diskriminiert
Klassenkampf im Haushalt
Gleichheit ist oft das Gegenteil von Gerechtigkeit
Das Klavier, der Sexist
Jenseits von Gut und Böse
Von Privilegien und unverdientem Wohlergehen
Die Banalisierung der Solidarität
Der transparente Mensch
Fünf Rappen für das gute Gewissen
Kostenwahrheit – das «Grün» der Ökonomen
Aufstand der Gutsituierten
Das eine tun verlangt das andere zu lassen
Mehr Markt bringt mehr Ökologie
Die Meisterflieger
Grün ist auch ein schönes Rot
Liberale Klimapolitik ist möglich
Von Schuld und Steuern
Sollen wir alles genau so erhalten, wie es ist?
Muss Klimaschutz weh tun?
Muss denn Essen Sünde sein?
Rhetorische Tugendschau
Gelenkte Begeisterung
Mohrenkopf und Meitlibei
Wie aus Vielfalt Diversity wurde
Der dressierte Mensch
Der Flirt mit der Genügsamkeit
Leben in der Grauzone
Die Sittenwächter der Moderne
Heilfasten für Kinder
Gendern im Betrieb
Durch Dick und Dünn
Der Mann, der Feminist
Die dreieinhalb Freiheiten der EU
Kontrolle ohne Heimattümelei
Pragmatismus statt Prinzipientreue
Auf Augenhöhe mit der EU
Was wir vermuten und was wir wissen
Der Charme der Kleinheit
David gegen Goliath
Das völlig andere Staatsverständnis der Schweiz
Für einen genügsamen Bilateralismus
Das Nashorn neben dem Elefanten im Raum
Einwanderung in den Arbeitsmarkt?
«Jedermann» und die Managerlöhne
Der Markt als Menschenwerk
Totengräber der Marktwirtschaft
Unbequeme Ergebnisoffenheit
Die «Wirtschaft» und der «Markt»
Die Beere des Bösen
Wirtschaft und Gemeinnutz harmonieren
Unfaire gleiche Wettbewerbsbedingungen
Verdienen Frauen, was sie verdienen?
Gute Shareholder pflegen die Stakeholder
Machtlos in der Pensionskasse
Alles für den (Non-)Profit
Jede Arbeit ist Care-Arbeit
Das ägyptische Kartoffelmärchen
Für moderne Hofnarren in Wirtschaft und Politik
Zehn Gebote des gesunden Menschenverstands
Namensregister
Über die Autoren
Über das Buch
Gerhard SchwarzClaudia Wirz
Weder lechts noch rinks
101 Kolumnen aus der Neuen Zürcher Zeitung
Mit einem Geleitwort von Lino Guzzella
und Vignetten von Peter Gut
NZZ Libro
Publiziert mit freundlicher Unterstützung der NZZ und der Progress Foundation.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Coverabbildung: Vignette Links und Rechts von Peter Gut (Winterthur)
Korrektorat: Ruth Rybi, Gockhausen-Zürich
Layout: icona basel gmbh, Basel
Satz: 3w+p, Rimpar
Druck: Finidr, Tschechische Republik
Printed in the EU
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungs-anlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN Print 978-3-907396-77-3
ISBN E-Book 978-3-907396-78-0
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Vorwort
Nichts sei schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen, besagt ein geflügeltes Wort, dessen Ursprung wahlweise Goethe, Luther, Fontane oder einem anderen Granden des deutschen Kulturraums zugeschrieben wird. Wer auch immer es erfunden hat, es liegt viel Weisheit in dieser Beobachtung. Denn ein konstantes Zuviel des Guten kann für das menschliche Zusammenleben zum moralischen Risiko werden.
Seit Jahrzehnten geniessen wir in unseren Breitengraden schon das gute Leben, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, ja ein Menschenrecht. Es fehlt den meisten Menschen an nichts, zumindest an nichts wahrhaft Existenziellem. Armut und Elend sind von gestern. Verzicht und Entbehrung sind uns weitgehend fremd. Nur das Beste ist für uns und unsere Kinder gut genug. Einkaufen ist nicht mehr nur eine Notwendigkeit, sondern ein Zeitvertreib. Und Zeit zu vertreiben haben wir reichlich, denn nie hatten wir mehr Freizeit als heute – bei gleichzeitig wachsendem Wohlstand.
Dieser Zustand ist für den Einzelnen eine Herausforderung, führt aber auch den Staat in die Bredouille – in zweierlei Hinsicht. Einerseits wird der Staat in einem Klima wachsender Ansprüche seinerseits zu einer Ware, die es zu konsumieren gilt, wenn man nicht zu den Dummen zählen möchte, die nur in die Staatskasse einzahlen und nichts beziehen. Der Ausbau der Sozialleistungen, der seit der Corona-Pandemie um sich greifende Subventionswettlauf und die immer grosszügigere Auslegung der Menschenrechte im Sinn von einklagbaren Forderungen an den Staat legen davon Zeugnis ab. Der Staat wird so zum Getriebenen der wohlstandsverwöhnten Anspruchsgruppen, die jede Missachtung ihrer Wünsche als Verletzung oder Diskriminierung verstehen. Politiker wollen gewählt werden, und sie wissen, dass Geschenke die Freundschaft erhalten.
Anderseits leidet der Staat insofern am Wohlstand, als er – Schulden hin oder her – über grosse finanzielle Mittel verfügt. Das Wachstum von Bevölkerung, Einkommen, Konsum und Vermögen lässt die Steuereinnahmen sprudeln. Und da Kasse sinnlich macht, wächst die Gefahr, dass der Staat Dinge tut, die er besser bleiben liesse. Ein Staat, der viel Geld hat, kann kaum anders, als sich stetig aufzublähen, die Verwaltung aufzustocken und immerzu neue Aufgaben zu übernehmen oder zu erfinden. Mit dem Arbeits- und Personalvolumen des Staates wächst die Regulierung unseres Lebens bis tief ins Private hinein. Mit jeder Regulierung pflanzt sich die Bürokratie selber fort und verdrängt Stück für Stück unsere Freiheit.
Zwar gibt es Politiker, die diese Gefahr erkennen, zu Zurückhaltung sowie Bürokratieabbau aufrufen und das Loblied auf die Freiheit und den «schlanken Staat» anstimmen – zumindest fürs Protokoll. Doch es sind wenige und ihre Rufe sind schwach. Sie verhallen in den weitläufigen Gängen von Parlamenten und Amtsstuben. Solange genügend Geld vorhanden zu sein scheint, gibt es keinen politischen Willen zum Masshalten, weder in der Bevölkerung noch beim Staat. Der Wohlfahrtsstaat wird ausgebaut, auch per Volksentscheid, und beglückt breite Bevölkerungsteile bis weit hinauf ins akademische Milieu. Und niemand weiss so genau, wer die Zeche zahlt.
Ähnliches gilt für die Privatwirtschaft. Bürokratieaufbau ist mitnichten eine staatliche Spezialität. Grosse Unternehmen können es sich leisten, ihre Stäbe, Vorschriften und bürokratischen Abläufe auszubauen. Sie spielen im Rösselspiel der politischen Korrektheit und des «woke capitalism» eifrig mit und sehen ihre Aufgabe zunehmend nicht nur darin, mit ihren Dienstleistungen und Produkten Gewinne zu erwirtschaften (und Steuern zu zahlen), sondern wollen Haltung zeigen, die Welt retten und allen möglichen Gruppen gerecht werden. Woke zu sein ist keine Exklusivität der politischen Linken mehr, Wokeness ist vielmehr zu einem Geschäft geworden, das intensiv bewirtschaftet wird. Die Rechnung zahlen die Konsumenten, aber auch die Angestellten, die sich den Regeln der Wokeness unterwerfen müssen und so persönliche Freiheit einbüssen.
Wir haben in den letzten acht Jahren versucht, diesen Entwicklungen publizistisch gegenzusteuern. So sind mit der Zeit rund 400 Kolumnen entstanden, solche, die Diskussionen angestossen oder sogar unmittelbar etwas bewirkt haben, andere, die zumindest ein wenig den Zeitgeist hinterfragt haben. Eine Auswahl dieser Kolumnen, die wir im Zeitraum von 2016 bis 2024 zunächst separat, dann unter dem Titel «Schwarz und Wirz» im wöchentlichen Wechsel in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) veröffentlicht haben, hier zusammengetragen und innerhalb der Kapitel chronologisch geordnet. Sie basieren auf den Texten, wie sie online publiziert wurden, und wurden sanft retuschiert. Ein besonderer Dank geht an Dieter Bachmann von der NZZ-Wirtschaftsredaktion. Seit 2018 hat er sich um die sorgfältige Redaktion der Texte gekümmert, und das mit einem stets offenen Ohr für die Autoren.
Die meisten Texte sind ordnungspolitische Betrachtungen zu den mannigfaltigen Entwicklungen in den Wohlstandsgesellschaften. Wir haben die Themen jeweils nicht miteinander besprochen, aber die starke Überzeugung, dass die Idee der Freiheit gefährdet ist und dass es sich lohnt, sich für sie einzusetzen, bildet bei allen Unterschieden in Stil, Interessen und Erfahrungshintergrund die Klammer, die die Texte zusammenhält. Bei der Auswahl haben wir versucht, besonders stark beachtete Texte zu berücksichtigen, die Vielfalt der von uns behandelten Themen abzubilden und zu sehr aktualitätsbezogene Texte wegzulassen. Gleichzeitig macht das am Schluss jeder Kolumne angegebene Erscheinungsjahr den einen oder anderen Bezug zu einem Ereignis verständlich. Das eine oder andere würden wir mit heutigem Kenntnisstand vielleicht etwas anders formulieren, milder oder schärfer, aber kaum grundsätzlich anders.
Der Titel des Buches bezieht sich auf das Gedicht des Wiener Dichters Ernst Jandl (1925–2000), in dem er formulierte, dass man «lechts» und «rinks» sehr wohl verwechseln könne. Er soll zum Ausdruck bringen, dass wir uns an der Idee einer offenen Gesellschaft und einer liberalen Marktwirtschaft orientieren, aber jenseits des Rechts-Links-Schemas und vor allem frei von parteipolitischer Vereinnahmung. Auf dieser Basis sezieren wir die zunehmende Staatsgläubigkeit, die wachsende Angst vor dem Wettbewerb, den unbändigen Regulierungsdrang der Politik, die Exzesse der Klientel- und Schuldenpolitik, die Fehlanreize und Gefahren in Umverteilungs- und Entlohnungssystemen und die Bedrohung der Meinungsfreiheit.
Die Kolumnen wollen eine Zeitdiagnose sein in Bezug auf das Verhältnis zwischen Bürger, Staat und Wirtschaft, wobei «Staat» mehr als nur das eigene Land meint. In einer Zeit zunehmender Harmonisierungen, Zentralisierungen und internationaler Standards ist «der Staat» immer mehr eine übernationale Kraft, womit sich auch die Frage nach Stellenwert und Zustand der Demokratie stellt. Die Kolumnen wollen die Komplexität dieser Zusammenhänge ausleuchten und zur Aufklärung beitragen, stets aus der Sicht des liberalen Skeptikers, der den Staat und seine Regulierungen zwar nicht grundsätzlich ablehnt, aber auf ein notwendiges Mass reduzieren möchte, auf dass auch die, die nach uns kommen, noch eine Reihe von schönen Tagen haben können.
Gerhard Schwarz (G. S.)Claudia Wirz (crz.)
Geleitwort
Lino Guzzella
Weckrufe wider die Denkfaulheit
«The great enemy of clear language is insincerity.»George Orwell
Manchmal versuche ich mir vorzustellen, was die Historiker des ausgehenden 21. Jahrhunderts so über die 2020er-Jahre schreiben werden. Ich vermute mal, es wird eine ziemlich unvorteilhafte Analyse unserer Unfähigkeit sein, Lebenslügen zu erkennen und echte Problemlösungen anzugehen.
Denk- und entscheidungsfaul geworden durch die grossen Fortschritte der Naturwissenschaften und der Technik, verwöhnt durch die geopolitische Ausnahmesituation nach dem Mauerfall und alimentiert durch die Früchte einer hocheffizienten globalisierten und arbeitsteiligen Weltwirtschaft wurden – vor allem in den OECD-Staaten – einige Jahrzehnte vergeudet, in denen Nebensächlichkeiten zu dominanten Themen aufgebauscht und die wirklichen Erfolgsfaktoren vernachlässigt wurden.
Man kann daher nur hoffen, dass diese Historiker bei ihren Recherchen in der Zukunft die Kolumnen von Claudia Wirz und Gerhard Schwarz nicht übersehen werden. Diese Kleinode des angewandten «critical thinking» werden nämlich einen Beitrag zu unserer Ehrenrettung leisten und beweisen, dass es auch in unserer Zeit Menschen gab, die unbequeme Wahrheiten erkannten und sich nicht scheuten, ihre Gedanken öffentlich zu machen.
Von der realistischen Darstellung der Situation von scheinbaren und echten Benachteiligten bis hin zu Repetition der Grundregeln der Ökonomie leisten die Kolumnen von Claudia Wirz und Gerhard Schwarz das, was in jeder Gesellschaft wichtig und notwendig ist: Sie löcken wider den Stachel der gerade angesagten Ideologie und steigern damit, um einen von Michael Hampe geprägten Begriff zu verwenden, unsere «Verblüffungsresistenz».
Gerhard Schwarz und Claudia Wirz schwimmen in ihren Kolumnen dabei aber nicht einfach immer gegen den Strom, denn manchmal ist dessen Richtung die richtige und einfach gegen alles zu sein, ist noch kein Qualitätskriterium. Nein, sie beide haben ein untrügliches Gespür für die wahren Absurditäten des Mainstreamdenkens und finden immer wieder den Weg – wie das Kind in Andersens Märchen –, die Nacktheit des politisch korrekten Kaisers zu entlarven.
Die Kolumnen von Gerhard Schwarz und Claudia Wirz sind dabei so aufgebaut, dass sie mich manchmal an Beweise von mathematischen Theoremen erinnern. Sie sezieren das Problem und führen in logischen kleinen Einzelschritten den Nachweis, dass ihre Beobachtungen beziehungsweise ihre Aussagen korrekt sind. Mit dieser quasimathematischen Gesellschaftsanalyse decken Claudia Wirz und Gerhard Schwarz Absurditäten in der Wirtschaft, in der Politik und im Alltag auf, die eigentlich offensichtlich sind, die aber zur Erkennung dieser Evidenz ein Minimum an intellektueller Anstrengung und gedanklicher Unabhängigkeit verlangen, die heute leider nicht genügend oft angetroffen wird.
Beachtenswert ist auch die sprachliche Qualität der Kolumnen von Gerhard Schwarz und Claudia Wirz. Nicht nur die inhaltliche, sondern auch die formale Präzision der Kolumnen beeindrucken uns Leserinnen und Leser. Der kritische Umgang mit scheinbaren Selbstverständlichkeiten zeigt sich nämlich auch im sprachlichen, wenn zum Beispiel einzelne Begriffe wie Populismus seziert und als inhaltsleer bzw. beliebig demaskiert werden.
In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern viel Freude bei der Lektüre dieser Sammlung der Kolumnen von Claudia Wirz und Gerhard Schwarz. Ich hoffe, dass sie nicht nur zu unserer Ehrenrettung in der Zukunft dienen werden, sondern dass sie uns allen auch Mut zum Denken und Handeln in der Gegenwart machen.
Lino Guzzella war von 1999 bis 2023 ordentlicher Professor für Thermotronik an der ETH Zürich. Zwischen 2012 und 2014 war er zudem Rektor und von 2015 bis 2019 Präsident der ETH Zürich. Seit seiner Emeritierung widmet er sich vermehrt der unternehmerischen und strategischen Beratung.
Wider die begriffliche Beliebigkeit
Liberal ist weder «lechts» noch «rinks»
Der Liberalismus gehört nicht in die rechte Schmuddelecke
Österreich wird in der Europa-Ausgabe des Time Magazine vom 3. Oktober 2016 die zweifelhafte Ehre zuteil, das Titelblatt zu schmücken und im Zentrum der Titelgeschichte zu stehen. Grund ist nicht die Peinlichkeit um die Wahlverschiebung, sondern der Aufstieg weit rechts politisierender Parteien in ganz Europa. Dass in Österreich die Wahl eines Vertreters einer solchen Partei zum Staatspräsidenten und – nach den nächsten Nationalratswahlen – selbst die Beauftragung des Präsidenten ebendieser Partei, Heinz-Christian Strache, mit der Regierungsbildung nicht mehr ausgeschlossen wird, hält der Autor des Artikels für ein Fanal für den ganzen Kontinent.
Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ist nicht die einzige Partei im europäischen Trend nach rechts, die sich zumindest im Namen liberal gibt. Jenen, denen Markt und Freiheit schon immer suspekt waren, kann das recht sein. So können sie den ihnen verhassten (Neo-)Liberalismus in die rechte Schmuddelecke stellen – wo er aber nicht hingehört. Man muss deshalb wieder einmal in Erinnerung rufen, dass der Liberalismus eine eigenständige, keine rechte oder linke weltanschauliche Strömung ist. Dass der politische Liberalismus oft gezwungen ist, mit Parteien auf beiden Seiten Koalitionen einzugehen, steht auf einem anderen Blatt.
Den Liberalismus zeichnet zum einen das konsequente Bekenntnis zum Privateigentum und zu dessen Schutz aus. Daraus leitet sich das Bemühen um tiefe Steuern, kaum eigentumsbeschränkende Regulierungen, geringe Umverteilung und den Erhalt des Geldwertes ab. Zum anderen setzt sich der Liberalismus für Wettbewerb ein. Er ist den Liberalen wichtig, weil er die wirtschaftliche Macht in Schranken weist und ein hervorragendes Instrument der ständigen Suche nach dem Besseren ist. Daraus ergeben sich gesellschaftlicher Auf- und Abstieg, aber auch Ungleichheit von Einkommen und Vermögen. Das Ja zum Privateigentum und das Ja zum Wettbewerb werden von der Klammer der Selbstverantwortung zusammengehalten. Aus ihr leitet sich die Skepsis gegenüber dem intervenierenden Staat ab, der sich Wissen anmasst und den Menschen Verantwortung abnimmt. Natürlich ist alles mit allem verwoben. So können Regulierungen nicht nur das Eigentum aushöhlen, sondern auch den Wettbewerb beeinträchtigen oder die Eigenverantwortung verdrängen.
Rechts- wie linkspopulistische Bewegungen haben mit den meisten dieser Grundsätze wenig am Hut. Sie sind nicht zukunftsoffen, sie sehen den Staat als Beglücker und schrecken dann weder vor grösseren Staatsausgaben noch vor hohen Steuern zurück. Sie bedienen den Neid der Bevölkerung auf die Reichen, die Ausländer, die gehätschelten Sozialfälle, sie geben vor, mit der protektionistischen Abschottung der Güter- und Kapitalmärkte die einheimische Bevölkerung schützen zu können, sie halten gerne an Strukturen fest, und sie betrachten Absteiger als Opfer und Aufsteiger als Emporkömmlinge. Insofern trifft auf sie zu, was der österreichische Lyriker Ernst Jandl in einem berühmten Gedicht formuliert hat: dass man «lechts» und «rinks» sehr wohl verwechseln kann. Nur schon deshalb sollte man den Liberalismus «tout court» pflegen und ihn nicht zu Links- und Rechtsliberalismen verbiegen.
(G. S., 2016)
Progressiv ist manchmal ausgesprochen konservativ
Die Sprache meint nicht immer, was sie meint
Mit der Sprache ist es so eine Sache. Sie ist unpräzis, subjektiv, beugsam und dem Zeitgeist verfallen. Sie ist alles andere als eine exakte Wissenschaft. Und sie prägt das Denken. Gewisse Begriffe sind positiv, manche negativ besetzt. Manche ändern ihre Wertigkeit komplett. Der «Dilettant» war zu Mozarts Zeiten ein hochgeschätzter Zeitgenosse, heute ist er der Inbegriff für einen üblen Stümper. Wörtlich wäre er ein Liebhaber, also dasselbe wie ein Amateur. Aber der beherrscht sein Handwerk ja auch nicht richtig. Die Sprache meint also nicht immer, was sie meint. Mal geschieht es aus Höflichkeit, mal aus Zweckdienlichkeit, mal aus politischen Überlegungen, dass Begriffsverzerrungen stattfinden. Eine gescheiterte Firma wird heute «abgewickelt» statt aufgelöst, ein Mitarbeiter wird «freigestellt» statt entlassen, ein Sozialhilfeempfänger ist heute ein «Klient», Insassen sind «Bewohner» und «genial» ist heute sowieso fast jeder und alles.
Und so geht es natürlich auch mit politischen Begrifflichkeiten. In der Politik gibt es grob gesprochen die Progressiven und die Konservativen. Doch was heisst das genau im Jahr 2018? Was heisst es, wenn man ständig gesagt bekommt, die (linken) Städte seien progressiv und das (bürgerliche) Land sei konservativ? Und wer von diesen ist nun wirklich fortschrittlich und wer bewahrt Altes? Ist es, ausgerüstet mit der historischen Erfahrung, im Jahr 2018 tatsächlich noch progressiv, von der Abschaffung des Privateigentums und einem starken fürsorgerischen Staat zu träumen, und ist es konservativ, an die Eigenverantwortung des Einzelnen zu appellieren? «Progressiv» nannten sich zum Beispiel die Organisationen, die sich zu Beginn der 1970er-Jahre in Basel zu der Partei Poch formierten. Ihre Rezepte hatten schon damals reichlich Staub angesetzt. Ihr Leitstern war die kommunistische Weltbewegung, eine ideologische Leihgabe. Und er blieb es für etliche Jahre. Erst 1983 wurde der Marxismus-Leninismus offiziell überwunden, das heisst aus den Statuten gestrichen. Dann setzte eine Desorientierung ein, die Partei löste sich auf und ihre Exponenten mussten eine neue Heimat suchen. Die fanden sie auch, bei den Grünen, den Alternativen, den Sozialdemokraten.
Und auch der Klassenkampf von anno dazumal lebt. Noch immer rufen die Sozialdemokraten an ihren Parteitagen zum letzten Gefecht und beklagen den Hunger der Arbeiterklasse, obwohl man doch schon längst gegen das (angeblich von der Nahrungsmittelindustrie verursachte) Übergewicht kämpft. Ist das nicht eher von vorgestern statt progressiv? Das Singen der Internationale sei schlicht Tradition, erklärt SP-Sprecher Michael Sorg. Und dass die SP «den Kapitalismus überwinden» wolle, sei nur eine nutzlose, von bürgerlichen Journalisten rezitierte Floskel. Ist also das vermeintlich Progressive bei der SP nur noch Folklore? Mitnichten. Wer ihr Papier zur Wirtschaftsdemokratie durchblättert, wähnt sich auf einer Zeitreise. Kampf dem entfesselten Kapitalismus, mehr Rechte für die Werktätigen, ein grosser Plan für die Landwirtschaft, mehr Lohn bei weniger Arbeit – während allerdings die Internationale auf die Müssiggänger schimpft. Man merke: Wie in der Medizin, wo positiv oft negativ bedeutet, ist in der Politik progressiv nicht selten sehr, sehr konservativ.
(crz., 2018)
Die libertäre Utopie
Auf der Suche nach der vollkommenen Freiwilligkeit
Seit Jahrzehnten wird von linken Ideologen – die diese Charakterisierung natürlich weit von sich weisen würden – gegen den «Neoliberalismus» gegeifert. Der Ausdruck wird inzwischen fast gedankenlos für einen radikalen, übertriebenen Liberalismus und Marktfundamentalismus verwendet. Dabei meinte er ursprünglich, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das pure Gegenteil, nämlich einen gemässigten Liberalismus. Im Gegensatz zum Paläoliberalismus mit seinem Laissez-faire plädierten die Neoliberalen für einen zwar schlanken, aber starken Staat, für eine existenzsichernde Sozialpolitik und für eine Wettbewerbspolitik. Ein Resultat dieser Weltanschauung war der Aufschwung Europas nach dem Krieg, ganz besonders das «Wirtschaftswunder» in Deutschland.
Als neues Feindbild haben die Staatsgläubigen nun die «Libertären» entdeckt. Der Ausdruck wird in den USA seit den 1950er-Jahren verwendet, als dort im Nachgang zu Franklin D. Roosevelts New Deal «liberal» zunehmend für «sozialdemokratisch» oder sogar «sozialistisch» stand. Anhänger einer auf Selbstverantwortung und freien Verträgen basierenden Gesellschaft mussten sich daher als klassisch Liberale oder Liberale im europäischen Sinne bezeichnen – oder als Libertäre. Libertäre haben eine radikale Sicht von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie basiert auf der Philosophie von John Locke und der Idee des Selbsteigentums, des Eigentums am eigenen Körper, das es unbedingt zu schützen gelte. Daraus folgen die Bejahung der Marktwirtschaft und eine völlig «gesellschaftsliberale» Haltung.
Weil staatliche Eingriffe, vor allem Steuern, immer dieses Privateigentum tangieren, leitet sich daraus eine minarchistische oder sogar anarchistische Sicht des Staates ab. Zu den Säulenheiligen der Libertären zählen vor allem die bedeutenden Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie Ludwig von Mises und Murray Rothbard. Der grosse Sozialphilosoph Friedrich von Hayek, den viele libertäre Gruppierungen in ihrem Namen führen, ist ihnen dagegen meist zu staatsgläubig. So erinnere ich mich an eine Tagung nach dem Tod Hayeks, an der dieser von einem prominenten Libertären als Sozialist beschimpft wurde, weil er in seinem Opus magnum Die Verfassung der Freiheit Bauordnungen oder Systeme sozialer Mindestsicherung gutheisst.
Robert Musil schreibt im Mann ohne Eigenschaften, heutzutage wagten es nur Verbrecher, andere Menschen ohne philosophische Grundlage zu schädigen. Libertäre sehen nicht zuletzt im Begriff der öffentlichen Güter und des «service public» eine philosophische Schutzbehauptung, hinter der sich das Leben auf Kosten anderer gut verstecken lässt. Deshalb streben sie nach einer Gesellschaft vollkommener Freiwilligkeit, umfassender Kostentransparenz und entsprechender Benutzerfinanzierung, ob bei Universitäten, im Verkehr, beim Medienkonsum oder in der Kultur. Das ist aus liberaler Sicht zwar konsequent, zugleich aber meist ziemlich utopisch. Zudem sind die Libertären – wegen ihrer analytischen Konsistenz und schlüssigen Logik – leider fast durchgehend erschreckend intolerant oder zumindest wenig kompromisswillig gegenüber anderen Ideen, nicht zuletzt jenen ihrer liberalen Verbündeten. Trotzdem sollte man den Libertarismus nicht verteufeln. Er taugt als Benchmark, um zu sehen, wie weit weg man sich in der Politik vom Ideal entfernt, und er ist ein anregender intellektueller Stachel im Gedankengut des Liberalismus – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
(G. S., 2018)
Die Gefahr utopischer Würfe
Für eine dezentrale Reformpolitik der kleinen Schritte
Der 200. Geburtstag von Karl Marx, der selbst in liberalen und konservativen Zirkeln fast unanständig festlich zelebriert wurde, liegt hinter uns. Die geistige Leistung des Mannes aus Trier verdient ohne Zweifel Achtung, seine Wirkungsmacht ist unbestritten. Die Verheerungen, die von ihm ausgingen, sind aber so schrecklich, dass es doch erstaunt, mit welch lässiger Unbekümmertheit vielerorts seiner gedacht wurde. Marx’ Wirkungsgeschichte führt uns nämlich vor Augen, wie brandgefährlich jener utopische Idealismus ist, der so viele Weltanschauungen prägt. Utopisten jeglicher Couleur leben in zwei Welten, der greifbaren, angeblich schlimmen Gegenwart und der vorgestellten, utopischen Zukunft. Sie messen die Gegenwart an dieser «perfekten» Zukunft, nicht an der unperfekten Vergangenheit. Daraus ergeben sich zwei gravierende Denk- und Handlungsfehler.
Jene, die die Realität an einer Utopie messen, übersehen, erstens, die atemberaubenden Fortschritte, die die Menschheit in 200 Jahren erzielt hat, nicht nur in Europa und Nordamerika. Für Utopisten ist das Glas halb leer, nicht halb voll. Dabei hat sich seit Marx’ Geburt weltweit die durchschnittliche Lebenserwartung verdoppelt und das durchschnittliche Einkommen verzehnfacht, Armut und Hunger sind massiv zurückgegangen, und der medizinische Fortschritt erspart den Menschen viel Leid – wer daran zweifelt, besuche ein medizinhistorisches Museum. Und das sind nur Beispiele. Die Geringschätzung des Fortschritts ist politisch verderblich; sie geht einher mit der Verurteilung der auf Unternehmertum und freien Märkten basierenden Ordnung, die ihn ermöglicht hat. Allerdings ist unklar, was Ursache und was Wirkung ist: Lässt es die Verteufelung der freiheitlichen Ordnung nicht zu, anzuerkennen, was diese alles ermöglicht hat, oder führt die pessimistische Sicht dazu, überall Mängel zu sehen und sie dem «System» anzulasten?
Für Letzteres spricht, dass Utopisten, zweitens, nicht erkennen, dass die Welt nie perfekt sein wird, weil die Menschen nicht perfekt sind. Das «Problem» aller Utopien ist die Unvollkommenheit des Menschen. «Ni ange ni bête» hat ihn Blaise Pascal beschrieben und angefügt, wer aus ihm einen Engel machen wolle, werde aus ihm leider ein Tier machen. Utopisten tun das. Sie versuchen ihm gegen seine Natur die Ichbezogenheit, die Neigung zu Gier und Neid, den Hang zum Bösen auszutreiben und ihm die Entscheidungsfreiheit zu nehmen. Gerechtfertigt wird dies damit, dass es um das Wahre, Gute und Schöne gehe, wobei klar sei, was darunter zu verstehen sei, oder es eine Gruppe von Menschen gebe, die dies wisse und sich daher durchsetzen müsse. So münden Utopien unter der Guillotine und im Gesinnungsterror. Utopischer Idealismus trägt ein Stück Totalitarismus in sich: «Wer das Gute nicht will, muss dazu gezwungen werden.»
Wo sind «Pfade aus Utopia» (Ralf Dahrendorf), wie lässt sich verhindern, dass man in die Utopiefalle tappt, obwohl man Reformbedarf bejaht? Es braucht dafür einen Blick durch eine weder rosarote noch eingeschwärzte Brille, und es braucht vor allem immer wieder einmal einen Blick zurück – auch er nüchtern, nicht nostalgisch –, um zu erkennen, dass die Realität keinen Eintausch gegen ungewisse Utopien verdient. Und es braucht statt Machtkonzentration und Zentralisierung eine beharrliche Reformpolitik kleiner Schritte, klein im Ausmass, in der Breite und der geografischen Ausdehnung. Grosse utopische Würfe stellen in der Politik immer, diese Erkenntnis kann man aus der Auseinandersetzung mit Marx ziehen, eine Bedrohung für Freiheit und Menschlichkeit dar.
(G. S., 2018)
Liberale Gewissenserforschung
Plädoyer für mehr Differenziertheit
Zu den bedenklichen Aspekten der Bekämpfung der Corona-Pandemie gehört die schnelle Ergebenheit, mit der Bevölkerungen demokratischer Staaten die Notstandsmassnahmen der Regierungen hinnahmen. Nicht dass nicht viele dieser Restriktionen nötig und richtig gewesen wären. Nur bekam man das Gefühl, viele Menschen erduldeten all die Einschränkungen der Grundrechte nicht nur, sondern schwelgten geradezu im gehorsamen Wohlverhalten. Die Freiheit stand in den wohlhabenden Staaten schon vorher nicht allzu hoch im Kurs; zu selbstverständlich schien sie. Bereits nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde sie zugunsten der Sicherheit eingeschränkt. Nun wurde sie ohne grosse Skrupel für die Gesundheit geopfert – und es steht zu befürchten, dass ein Teil dieser Einschränkungen bleiben wird.
Wenn die Marktwirtschaft auf der Anklagebank sitzt, hat dies auch damit zu tun, dass liberale Positionen nicht mit der nötigen Differenziertheit wahrgenommen werden. Und wenn Botschaften falsch verstanden werden, tragen die Absender meist einen Teil der Schuld. Dazu drei Beispiele, die der ordnungspolitischen Überzeugung entspringen, dass der Staat zwar niemals von Fall zu Fall intervenieren sollte, dass es ihn aber sehr wohl braucht, um gleiche Rahmenbedingungen für alle zu schaffen. Die Liberalen treten seit je gegen den Protektionismus und somit für die Globalisierung ein. Aber haben wir Liberale mit genügend Nachdruck betont, dass wir damit unverzerrten Austausch meinen? Und dass nicht nur Zölle, nicht-tarifäre Barrieren oder anderer Sand im Getriebe (etwa eine Transaktionssteuer) verzerrend wirken, sondern auch verfälschte Energie- und Transportpreise sowie generell die mangelnde Internalisierung externer Kosten? Zwar versteht sich das für jeden Liberalen von selbst, aber der Einsatz für diese Anliegen war nicht immer sehr gut sichtbar.
Ferner ist für Liberale das Pendant zur Betonung des Privateigentums das Prinzip der Haftung. Aber haben wir Liberale genügend dafür gekämpft, dass diese Haftung möglich ist und praktiziert wird? Das verlangte, dass der Staat Eigenkapital gegenüber Fremdkapital nicht benachteiligt, den Aufbau von Eigenkapital begünstigt, Konkurse nur in Ausnahmefällen verhindert und eine Eigenkapitalausstattung fordert, die den Unternehmen das Durchstehen längerer Durststrecken erlaubt. Staatshilfen, sosehr sie nun als Notnagel verständlich sind, setzen diesbezüglich Fehlanreize. Diejenigen, die sich mit einer dicken Eigenkapitaldecke gewappnet haben, statt wie die Mitbewerber die Bilanz zu «optimieren», werden düpiert.
Schliesslich denken Liberale langfristig. Sie vertreten keinen Basarkapitalismus. Die Orientierung am Shareholder Value ist für sie deswegen richtig, weil er auf lange Frist nur gesteigert werden kann, wenn die Interessen der Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und der Allgemeinheit berücksichtigt werden. Aber haben wir Liberale uns für die Langfristigkeit engagiert, etwa dafür, dass die Stärkung der Widerstandskraft durch das Vorhalten von Überschusskapazitäten, den Aufbau von Reserven und Lagern und die Diversifikation der Lieferketten belohnt wird oder dass Ankeraktionäre wegen ihrer Langfristorientierung besser gestellt werden als jene, die den schnellen Gewinn an der Börse suchen?
Liberale Positionen sind heute angesichts der erdrückenden staatlichen Präsenz besonders wichtig. Wir Liberale müssen aber klarmachen, dass es sich bei unserem Eintreten für Kostenwahrheit, das Prinzip der Haftung und die Langfristigkeit nicht um Lippenbekenntnisse handelt.
(G. S., 2020)
Vereinnahmung von allen Seiten
Notwendige Abgrenzung nach links wie nach rechts
Es heisst, die Geschichte wiederhole sich nicht, aber sie reime sich. So erinnern die jüngsten Wirren bei der deutschen Ludwig-Erhard-Stiftung an jene bei der deutschen Friedrich-A.-von Hayek-Gesellschaft vor fünf Jahren, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen. Beiden wertvollen liberalen Institutionen bin ich verbunden. Roland Tichy, 2015 von der damaligen Vorsitzenden der Hayek-Gesellschaft, Karen Horn, mit der Hayek-Medaille ausgezeichnet, gibt auf Ende Oktober die Führung der Erhard-Stiftung auf. Das Fass zum Überlaufen brachten frauenverachtende Äusserungen in Tichys Einblick. Diese Publikation (Webportal und Monatsmagazin) steht wegen ihrer als extrem rechts empfundenen Linie schon lange unter Beschuss. Nun haben prominente Mitglieder die Erhard-Stiftung verlassen, drohen mit Austritt oder lassen die Mitgliedschaft ruhen. Bei der Hayek-Gesellschaft hatte umgekehrt die Vorsitzende die Abgrenzung nach rechts angemahnt und war dafür mit Respektlosigkeit, ja Hass, aus dem Amt gemobbt worden. Zusammen mit gut 50 Mitgliedern kehrte sie dem Verein den Rücken.
Die Vorfälle machen deutlich, dass der auf Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, Wettbewerb, Privateigentum sowie subsidiäre Sozialhilfe setzende klassische europäische Liberalismus mit Problemen der Abgrenzung zu kämpfen hat – nach links wie nach rechts. Er ist nämlich weder links noch rechts. Wäre der Begriff der Mitte nicht so beliebig, würde er auf den Liberalismus passen. Die Vereinnahmung von allen Seiten kommt also nicht von ungefähr. Der «Linksliberalismus» verbindet freiheitliche Elemente wie Toleranz (meist allerdings nicht gegen rechts) und Chancengleichheit selektiv mit einer Affinität zu staatlicher Freigebigkeit, moralisierendem Paternalismus, Kollektivismus und Interventionismus. Der grundsätzlichen Bejahung des Marktes folgt der Nachsatz, dass er natürlich gezähmt werden müsse. Da diese Mischung vielen nicht bewusst ist, nagt der Linksliberalismus an den liberalen Grundfesten. Darin liegt seine Gefährlichkeit.