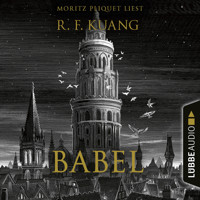13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Goldie, Lyiana, Scarlet und Bea sind Halbschwestern. Geboren am selben Tag, sind sie die Töchter von verschiedenen Müttern und eines Vaters – des mächtigen Dämons Grimm. Getrieben von dem Wunsch, die Erde zu beherrschen, verlieh er jeder Tochter die Macht über ein Element: Erde, Luft, Wasser und Feuer. Um ihr volles Potenzial zu entfalten müssen sie als erwachsene Frauen in das Reich ihres Vaters zurückkehren. Kurz vor ihrem achtzehnten Geburtstag stehen Die Schwestern Grimm vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens: Streben sie nach der dunklen Macht ihres Vaters, oder wollen sie die Welt und die Menschen, die sie lieben vor dem düsteren Grimm retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 737
Ähnliche
Das Buch
Wenn der Mond im ersten Viertel steht, durchschreiten Wilhelm Grimms Söhne, gefallene Sterne, seine Soldaten, nachts um 3:33 Uhr die Tore von der Erde nach Everwhere, um Jagd auf die Grimm-Schwestern und ihre weiblichen Angehörigen zu machen.
Goldie, Bea, Liyana und Scarlet sind vier Schwestern Grimm. In Everwhere sind sie Gefährtinnen, in ihrem Alltag in England kämpft jede von ihnen ihren eigenen Kampf: Goldie verdient mehr schlecht als recht den Unterhalt für sich und ihren heiß geliebten jüngeren Bruder als Zimmermädchen in einem Nobelhotel und muss sich dort tagtäglich gegen ihren fiesen Chef wehren. Die umwerfend schöne Bea studiert in Cambridge und nutzt ihre Attraktivität, um Männer zu verführen. Doch auch die zahlreichen Flirts vermögen die Leere, die sie in sich verspürt nicht zu füllen. Liyana fürchtet, ihre Geliebte Kumiko zu verlieren und eine arrangierte Ehe eingehen zu müssen, um sich und ihre Tante vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Und Scarlet versucht mit aller Kraft, das Café ihrer schwerkranken Großmutter zu retten.
Den vier Schwestern ist gemeinsam, dass sie Macht über die Elemente besitzen und mächtige Gegner haben, von denen sie nichts ahnen. Denn alle vier nähern sich ihrem achtzehnten Geburtstag, dem Tag der Entscheidung. Wählen sie in Everwhere die Seite ihres Vaters, die Seite des Bösen, bleiben sie am Leben. Wenn nicht, werden sie und alle, die sie lieben, sterben …
Die Autorin
Menna van Praag wurde in Cambridge geboren und studierte Geschichte in Oxford. Sie mehrere realistische Romane veröffentlicht, bevor sie mit »Die Schwestern Grimm« ihr Fantasy-Debüt vorlegte.
MENNA
VAN PRAAG
DIE
SCHWESTERN
GRIMM
ROMAN
Aus dem Englischen übersetzt
von Anu Katariina Lindemann
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Titel der englischen Originalausgabe THESISTERSGRIMM
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 11/2021
Redaktion: Uta Dahnke
Copyright © 2020 by Menna van Praag
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,
unter Verwendung des Originalentwurfs von Beci Kelly
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28150-2V001
www.heyne.de
Für meine Mutter, meine Tochter, meine Schwester und für alle Grimm-Schwestern.
Und für jeden, der um 3:33 Uhr wach ist.
Der Träumende erwacht,
die Schatten vergehen.
Diese Geschichte, die ich dir nun erzähle,
diese Geschichte ist erlogen.
Aber nun höre mir gut zu,
holde Jungfer, stolze Jugend,
die Geschichte ist zwar erlogen,
aber was sie erzählt, ist wahr.
Ende eines traditionellen Volksmärchens
PROLOG
Alle Seelen sind etwas Besonderes. Ob Sohn oder Tochter, Grimm oder nicht, das Leben berührt mit seinem Geist jede seiner Schöpfungen. Doch die Empfängnis einer Tochter ist ein besonders mystisches Ereignis, das bestimmte alchemistische Einflüsse voraussetzt. Denn um ein Lebewesen zu empfangen, das selbst Leben hervorbringen und gebären kann, braucht es schon ein gewisses Etwas … extra.
Jede Tochter ist einem Element entsprungen, ist erfüllt von ganz eigenen, besonderen Kräften. Manche entstammen der Erde: sie sind fruchtbar wie der Boden, stark wie Stein, beständig wie eine uralte Eiche. Manche entstammen dem Feuer: sie sind explosiv wie Schießpulver, verlockend wie das Licht, wild wie eine entfesselte Flamme. Andere dem Wasser: sie sind ruhig wie ein See, erbarmungslos wie eine Welle, unergründlich wie das Meer. Die Grimm-Schwestern sind Töchter der Lüfte – zumindest anfangs –, geboren aus Träumen und Gebeten, aus Glauben und Vorstellungsgabe, aus strahlend weißem Wünschen und schwarz geränderter Begierde.
Es gibt Hunderte, vermutlich sogar Tausende von Grimm-Schwestern auf der Erde und in Everwhere. Du könntest eine von ihnen sein, auch wenn du es vielleicht nie erfahren wirst. Du glaubst, du bist gewöhnlich. Du bist nie davon ausgegangen, dass du stärker bist, als du zu sein scheinst. Mutiger, als du dich fühlst, oder bedeutender, als du dir vorstellen kannst.
Aber ich hoffe, dass du, wenn du diese Geschichte beendet hast, beginnen wirst, auf das Flüstern zu hören, das von unbekannten Dingen erzählt. Dass du auf die Zeichen achten wirst, die in ungesehene Richtungen weisen, und auf die kleinen Anstöße, die ungeahnte Möglichkeiten andeuten. Und ich hoffe auch, dass du deine eigene Großartigkeit, deinen eigenen Zauber entdecken wirst.
DER COUNTDOWN
29. September
Noch 33 Tage
9:17 Uhr – Goldie
Solange ich denken kann, bin ich schon eine Diebin. Und eine Lügnerin dazu. Ich könnte sogar eine Mörderin sein, wenngleich du dir darüber deine eigene Meinung bilden musst.
»Goldie – komm her!«
Ich stopfe das Notizbuch und den Stift in meine Schürzentasche, streiche die Bettlaken glatt, wische einen letzten Schmutzfleck von dem vergoldeten Flurspiegel, werfe der rosa gesprenkelten Orchidee auf der Ablage darunter eine Kusshand und eine Gedichtzeile zu, bevor ich aus dem Zimmer Nummer 13 auf den Gang laufe.
Mr. Garrick wartet auf mich. Seine eng beieinanderliegenden Augen blinzeln, sein Gesicht glänzt unter der Deckenbeleuchtung. Mit fettigen Fingern streicht er sich über den Schädel. Wenn er die Haare von seinen Handrücken auf seinen Kopf transplantieren könnte, dann wäre er auf dem richtigen Weg.
»Komm runter zum Empfang, Goldie. Cassie hat sich krankgemeldet.«
»Was?« Ich runzle die Stirn. »Aber … Nein, das ist nicht …«
»Jetzt!« Garrick rückt den Knoten seiner Krawatte zurecht – zu fest um seinen fetten Hals, der wie ein wogendes Laken über seinem Kragen Falten wirft. Dann versucht er, mit seinen dicken Fingern zu schnipsen, aber er schwitzt zu stark, und der Ton, der dabei herauskommt, ist armselig. Ich versuche, meinen Ekel nicht zu zeigen.
Ich folge Garrick in den Aufzug und lehne mich an die Wand. Aber es nützt nichts. Seine fettigen, gierigen Hände kommen trotzdem rüber, um mich zu begrapschen. Garrick überschreitet wieder einmal Grenzen, wozu er kein Recht hat.
Als seine Fingerspitzen die Rundung meiner Brust streifen, bleibt mir die Luft weg, jeder einzelne Muskel angespannt, und ich kämpfe gegen den Harndrang an. Als Kind konnte ich das nie kontrollieren, heute kann ich es meistens.
Als sich die Tür mit einem Ping öffnet, stürze ich hinaus in die Empfangshalle. Garrick nimmt sich Zeit, streicht sich die Polyesterweste über seinem aufgedunsenen Bauch glatt und rückt seine Polyesterkrawatte zurecht, bevor er zur Rezeption schlendert.
Ich bin bereits dort und warte auf ihn. Wenn ich diesen verdammten Job nicht so dringend brauchen würde – um Teddy etwas zu essen und zum Anziehen geben zu können –, dann würde ich die Knochen seiner fetten Finger brechen. Einladend würde ich meinen Mund öffnen, und dann würde ich so lange zubeißen, bis sein Blut von meinem Kinn tropft.
»Wo ist Cassie?«, frage ich.
»Krank.« Garrick senkt seine Stimme und grinst dreckig. »Frauenprobleme.«
»Kann Liv nicht einspringen?«, protestiere ich. »Ich bin gar nicht für die Rezeption ausgebildet.«
»Ich weiß.« Garrick seufzt, stößt abgestandenen, nach Rauch stinkenden Atem aus. »Aber sie geht nicht ans Telefon. Jedenfalls erwarten wir heute sowieso nur ein halbes Dutzend Gäste.« Er lächelt wieder dieses dreckige Lächeln. »Du musst also nur hinter der Rezeption stehen und hübsch aussehen. Ich bin mir sicher, dass sogar du das hinkriegst.«
Ich starre auf den leeren Platz und sage nichts.
»Hey, Goldie.«
Ich schaue auf und sehe Jake, den Portier, der mir schüchtern zuwinkt. Wir daten sozusagen. Er ist ein bisschen langweilig, aber ganz süß und nett und verlangt nicht viel. Was gut ist, weil ich nur wenig zu geben habe.
Jake schleicht sich an die Rezeption heran. »Was machst du denn hier unten?«
Er sieht ziemlich gut aus, aber das wird nicht von Dauer sein. Ich weiche immer zurück, wenn er versucht, mich anzufassen. Das ist nicht seine Schuld, und ich kann es auch nicht einmal wirklich erklären.
»Cassie ist krank«, erzähle ich.
»Hast du denn vorher schon mal am Empfang gearbeitet?«
»Ja«, lüge ich. Jake arbeitet erst seit sechs Wochen in diesem Hotel, deshalb kann ich ihm erzählen, was ich will. Ich kann die Mutige spielen und so tun, als ob es mir scheißegal wäre, dass ich an die Rezeption geschubst wurde und mich so fühle wie ein Stück Vieh, das auf dem Marktplatz zum Verkauf angeboten wird.
»Ich wäre ziemlich nervös«, gibt Jake zu. »Und wüsste gar nicht, was ich sagen soll.« Zaghaft stützt er sich mit der rechten Hand auf dem Rezeptionstisch ab. Er will seine Hand nach mir ausstrecken, aber lässt es dann doch bleiben.
»Keine Ahnung.« Ich zögere. »Ich nehme an, es ist besser, als Klos zu putzen.«
»Jake … wo zur Hölle steckst du? Jake!«
Jake lässt seine Hand sinken. Wir drehen uns beide in die Richtung, aus der das Geschrei kommt.
»Ich geh mal lieber«, sagt er und ist schon auf halbem Wege zur Treppe. Er dreht sich nicht noch mal um, um zu lächeln oder um mir zuzuwinken – er kann es nicht. Es gibt eine ganze Menge, was unser Boss nicht tolerieren kann, und warten zu müssen ist eine Sache, die die Adern an seinem Glatzkopf am ehesten hervortreten lässt.
Hinter der Empfangstheke starre ich auf das Telefon, will es durch Suggestion dazu bringen, still zu bleiben. Ich zupfe ein paar vereinzelte lange Haare vom Ärmel meines Hotel-Polyesterhemdes. Ich bin zu unordentlich für diesen Job. Ich verfluche Cassie. Sie sollte jetzt hier sein. Die Empfangs-Prinzessin. Die wunderschöne Cassie. Sinnlich wie eine Vase voller Pfingstrosen. Neben ihr bin ich wie eine Narzisse. Früher haben wir zusammen die Zimmer geputzt, aber Cassie wollte schon immer um jeden Preis befördert werden. Der Job an der Rezeption bringt mehr Geld, mehr Prestige. Man muss keine schäbige Uniform tragen, und man verdient sich seinen Lohn, indem man Gäste angrinst, statt seinen Kopf in Kloschüsseln zu stecken, die (hoffentlich) nach WC-Reiniger riechen. Meine persönliche Meinung dazu ist: je weniger Menschen ich sehe, umso besser. Wenn man jeden Tag etwas mit Garrick zu tun haben muss, dann hat man schon allein daran schwer zu schlucken.
Apropos schlucken: es ist kein großes Geheimnis, dass Cassie genau das gemacht hat, um sich von den Toiletten zur Rezeption befördern zu lassen. Bei mir hat es Garrick mit seinen gierigen Händen nicht besonders weit geschafft – ich habe immer darauf geachtet, dass wir nie lange genug allein sind, sodass er nur grapschen, fummeln und Andeutungen machen kann.
Eines Tages werde ich mir etwas Schweres schnappen und es mit ganzer Kraft auf seinen Glatzkopf niedergehen lassen.
Ich stehe hinter der Rezeption, mit dem Hotel-Emblem auf meiner Uniform und einem angespannten Grinsen auf dem Gesicht, und spüre das Notizbuch in meiner Tasche. Ich kann hier nicht mal schnell etwas hineinkritzeln, was vielleicht das Schlimmste daran ist, an den Empfang versetzt worden zu sein. Wie du siehst, bin ich nicht nur eine Diebin, sondern auch eine Schriftstellerin. Vielleicht sogar eine Poetin, wenn auch nur nach meinen eigenen Maßstäben. In meinem Kopf herrscht ein ständiges Geplapper – eine Bemerkung zu jedem banalen Ereignis in meinem Leben. Ich kann das nicht kontrollieren, schreibe aber alles Interessante auf, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Es beruhigt meinen Geist ein bisschen.
Da ich jetzt gerade nicht schreiben kann, denke ich an Teddy. Ich frage mich, was er wohl gerade lernt, welche neuen Fakten gerade seine Augen vor lauter Aufregung größer werden lassen. An meinen Bruder zu denken beruhigt mich immer. Er ist fast zehn und ist alles, was ein Kind sein sollte: unschuldig, fröhlich, lieb. Ich werde dafür sorgen, dass er immer so bleibt. Koste es, was es wolle. Er hat eine gute Seele. Ich war dagegen vor langer Zeit ein hoffnungsloser Fall.
Nach dem Bezahlen der Miete und der Rechnungen fließt der Großteil meines Gehalts in Teddys Schulgeld: £8 590 pro Jahr. Und da ich £7,57 pro Stunde verdiene, bei 63 Stunden pro Woche, kommt an diesem Punkt das Stehlen ins Spiel. Ich weiß ja, dass Teddy auch an eine staatliche Schule gehen könnte, aber er ist so glücklich in St. Faith’s. Und nach allem, was passiert ist, möchte ich, dass er so lange wie möglich glücklich ist. Deshalb erleichtere ich hin und wieder unsere reicheren Gäste um ihre belanglosen Besitztümer. Es ist schon erstaunlich, was die Leute nicht vermissen, wenn sie zu viel haben.
»Entschuldigung?«
Ich blicke auf und sehe einen Gentleman mit einer römischen Nase, der auf mich herunterstarrt.
»E… Entschuldigung, S… Sir, ich habe nicht … Wie kann ich Ihnen helfen?«
Er ignoriert mein Lächeln, meine Versuche, meine Unaufmerksamkeit wettzumachen.
»Charles Penry-Jones«, sagt er. »Wir bleiben zehn Nächte. Meine Frau hat um ein Zimmer mit Blick auf den Hof gebeten.«
Ich nicke, habe keinen Small Talk anzubieten. Ich bete, dass der Wunsch seiner Frau befolgt wurde. Ich besitze nämlich keinerlei Geschick im Umgang mit wütenden Gästen. Die machen mich immer ganz nervös mit ihrem herablassenden und geringschätzigen Verhalten.
Ich tippe den Namen in den Computer, und in Sekundenschnelle erscheinen die Informationen auf dem Bildschirm, der Wunsch seiner Frau und alles andere auch. Als ich wieder aufschaue, steht er plötzlich neben Penry-Jones.
Er ist groß und schlank, aber stark wie eine Weißbirke und fast genauso außergewöhnlich blass, seine Haare so blond, als ob das Sonnenlicht die obersten Zweige erklommen hätte. Die Iriden seiner Augen haben ein halbes Dutzend Grüntöne: der hellste davon hat die Farbe von frisch gesätem Gras, die anderen sehen aus wie frische Triebe im Frühling, dunkles Waldgrün, graues Lorbeergrün, helles Piniengrün, leuchtendes Myrtengrün, cremiges Avocadogrün … Er schenkt mir ein kleines, selbstbewusstes Lächeln. Ich starre zurück, und dann fühle ich auf einmal etwas, was ich noch nie zuvor gefühlt habe: plötzlich bin ich voll entflammt.
»Wo warst du, Leo?«
Ich muss schmunzeln, jetzt kenne ich seinen Namen. Bei den beiden muss es sich um Vater und Sohn handeln, auch wenn sie sich nicht besonders ähnlich sehen. Der Vater passt perfekt in diesen lupenreinen Raum, wie ein gepflegter Kaktus aus dem Gewächshaus. Wohingegen der Sohn ein bisschen fehl am Platz wirkt.
»Wo ist deine Mutter?«
»Sie holt etwas aus dem Wagen, sie kommt gleich.«
Leos Stimme ist sanft und klingt vornehm. Seine Hände sind kräftig. Seine Finger sind wie lange Zweige, deshalb stelle ich mir seine Berührung zärtlich und seinen Griff kräftig vor. Ich spüre die Bänder des Verlangens in meinem Innern. Ich zerschneide die seidigen Fäden.
»Sie schmollt«, sagt Penry-Jones. »Sie verlangt immer, dass ich sie zu meinen Geschäftsreisen mitnehme, und dann beschwert sie sich, wenn ich keine Zeit für sie habe, weil ich ein Geschäft abwickeln muss. Aber immerhin wirst du für ein paar Tage hier sein, um mich zu entlasten.«
»Ihre Zimmerschlüssel«, sage ich und schiebe die Schlüssel über das glänzende Holz.
»Ich hätte gern einen Weckanruf um sechs Uhr dreißig.« Der Vater nimmt die Schlüssel. »Wann öffnet das Restaurant fürs Abendessen?«
»Um s… sieben«, antworte ich. »Hätten Sie gerne eine R… Reservierung?«
»Das wird nicht nötig sein.« Er schaut zu Leo hinüber. »Lass uns gehen. Wir können deine Mutter später in der Bar treffen.«
Und dann dreht sich der Vater um und geht durch die Empfangshalle. Der Sohn folgt ihm.
Dreh dich um, flüstere ich. Dreh dich um, befehle ich ihm in Gedanken. Dreh dich um und schau mich an.
Und als er den Aufzug erreicht, tut er es. Aber sobald sich unsere Blicke treffen, schlage ich die Augen nieder. Als ich wieder von der Empfangstheke aufsehe, ist er bereits verschwunden.
22:11 Uhr – Leo
Was passiert, wenn ein Stern vom Himmel auf die Erde fällt? Leo kann es sich lediglich vorstellen, weil er selbst nie diesen Luxus hatte. Er wurde heruntergeholt, herbefohlen, vom Himmel abkommandiert. Hätte er vielleicht seine Reinheit und seine Unschuld bewahrt, wenn er stattdessen gefallen wäre? Vielleicht war es der Akt des vorzeitigen Herausgerissenwerdens, der ihn verdorben hat. Wut und Verzweiflung schlugen in seinem kalten Herzen aus Stein Wurzeln und wurden immer größer. Bis er zu solchen Dingen fähig war, die Sterne niemals tun würden. Abgesehen von den Hunderten, die auf ähnliche Weise herabgeholt worden waren, um seinen Befehlen zu gehorchen.
Manchmal erkennt Leo andere Sterne, auch wenn sie mittlerweile Jungen und Männer sind und nicht mehr himmlische Gebilde aus brennendem Gas. Die Bezeichnung »Stern« ist nicht mehr passend, nachdem sie einmal vom Himmel geholt sind. Sie scheinen nicht mehr, werfen kein Licht mehr auf etwas, nur noch Dunkelheit und Tod. Die Bezeichnung »Soldat« ist passender. Weil er sie schließlich nicht zum Funkeln auf die Erde herabgeholt hat. Sondern um zu töten, um andere zu beseitigen, um andere zu vernichten. Eine Armee mit einer einzigen Mission: das auszulöschen, was erleuchtet wurde.
Da sie früher selbst einmal Erleuchtete waren, sind diese Soldaten auf einzigartige Weise begabt für diese Aufgabe. Auf der Erde erkennen sie ein Grimm-Mädchen aus einer Meile Entfernung. In Everwhere können sie diese Mädchen bemerken, verfolgen und (manchmal) töten, ohne irgendwelche ihrer menschlichen Sinne zu benutzen. Diese Stern-Soldaten oder Lumen Latros, wie er sie auch etwas prahlerisch nennt, brauchen nur zu warten, bis ihr eigenes inneres Licht flackert, sobald es sein Pendant erkennt.
Es dauerte lange, bis Leo klar wurde, dass der Begriff »Soldat« ebenfalls irreführend war, denn er impliziert den Kampf für eine gerechte Sache gegen einen ungerechten Gegner. Aber die Grimm-Mädchen sind gar nicht die Feinde seines Vaters, sondern seine größte Hoffnung. Und in Wirklichkeit sind seine Soldaten nichts anderes als Kanonenfutter für seine Töchter, um ihre Stärke zu testen, um sie auf den Geschmack von Blut und Mord zu bringen, um ihnen die Dunkelheit schmackhaft zu machen. Wilhelm Grimm will keinen Krieg, er will eine Schlacht. Er will, dass seine Soldaten verlieren und seine Töchter gewinnen. Er will ein Blutbad.
Manchmal macht das Leo dermaßen wütend, dass er den Drang verspürt, diese Armee zu verlassen und den Heerführer im Stich zu lassen. Dass er das nicht tut, hat etwas damit zu tun, dass er es nicht kann – sein Vater bestraft alle Deserteure mit dem Tod – und dass er töten muss, um zu überleben. Wenn er ihre Strahlkraft aufnimmt, lässt das sein Licht weiterleuchten. Und zu guter Letzt bleibt er auch ein Soldat, weil er noch immer den Tod eines geliebten Menschen rächt.
Manchmal sieht Leo andere Soldaten, wenn er draußen auf der Jagd ist, obwohl es eher selten vorkommt, weil die Soldaten in der Regel nicht dazu neigen, in fremden Revieren zu wildern. Jeden Monat gehen sie auf die Jagd, wenn der Mond im ersten Viertel ist. Dann durchschreiten sie um 3:33 Uhr bestimmte Tore. Sie verlassen die Erde und betreten Everwhere.
Everwhere ist der Ort, an den sie kommen, an dem sie sich versammeln, wo er sie findet. Die Grimm-Schwestern besuchen diesen Ort, wann immer sie es wollen, unabhängig von der Uhrzeit und davon, welcher Tag es ist. Wohingegen er nur an dem festgesetzten Tag und zur festgesetzten Uhrzeit kommen kann. Und die Grimm-Schwestern müssen keine Tore durchschreiten, auch wenn sie das manchmal ganz gern tun. Ihr Ritual, um Everwhere zu betreten, ist sehr angenehm – sie müssen lediglich einschlafen, ihre Augen schließen und gelangen dann an diesen Ort zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen der wachen Welt und der Traumwelt. Einige von ihnen, besonders die jüngeren, erinnern sich hinterher noch nicht einmal daran, dass sie dort gewesen sind. Sie wachen auf, ohne zu wissen, was los ist. Aber die meisten kommen ganz bewusst dorthin, um ihre Schwestern zu treffen und um ihre Kräfte zu trainieren. Sie bereiten sich auf die Nacht vor, in der sie um ihr Leben kämpfen müssen.
Ein Blick genügt, und Leo weiß, dass Goldie sich nicht an Everwhere erinnert. Sie hat sich selbst vergessen, hat keine Ahnung, wer sie ist. Sie weiß weder, wie geschickt noch wie stark sie ist. Was – wenn ihre Ahnungslosigkeit anhält – den Ausschlag zu seinen Gunsten geben wird. Leo lächelt. Er kann fast schon spüren, wie das Licht ihres dahinschwindenden Geistes durch seine Adern strömt – wie ein Stromstoß, der ihn wieder zurück ins Leben bringt.
23:11 Uhr – Goldie
Der überraschende Anblick dieses Mannes – Leo – führt mich zu der Frage, wie ich mich wohl selbst beschreiben würde. Wir haben das gleiche Haar, glaube ich zumindest, auch wenn ich Locken habe und mir meine Haare bis zu den Schultern reichen. Meine Locken waren mal länger, aber nach Mas Tod habe ich mir die Haare geschnitten. Meine Haut ist nicht ganz so blass, und meine Augen sind blau und nicht grün. Ich würde gerne behaupten, dass sie ein halbes Dutzend Blautöne haben: die Farbe von Rittersporn, Glockenblumen, Kornblumen, Hortensien, Klematis … Aber damit würde ich lügen, und ich versuche, mich nicht selbst zu belügen. Das Blau meiner Augen ist ein helles, wässriges Vergissmeinnicht-Blau. Gewöhnlich, unscheinbar.
Es war nur ein Zufall, dass er zurückgeschaut hat. Auch wenn es sich natürlich so angefühlt hat, als ob ich es ihm befohlen hätte. Ich weiß, dass es total albern ist, aber trotzdem kann ich nicht anders, als darüber nachzudenken. Die Gedanken, Fragen, Vorstellungen kreisen in meinem Kopf, vermehren sich, bis mir der Kopf wehtut.
Um mich abzulenken, besprühe ich die lilafarbene Orchidee, die auf dem Kaminsims steht, mit Wasser. Ich streichele ihre Blätter, flüstere Worte von Wordsworth in ihre Blüten. Ihre Stängel sind voller Knospen, sodass ich nach Stift und Faden suche, um sie festzubinden. Bevor ich herkam, war hier die Sterblichkeitsrate von Blumen erschreckend hoch. Im Monat starben rund ein Dutzend. Aber seit ich hier bin, hat sich das geändert. Ich hatte schon immer einen grünen Daumen. Danach starre ich auf den Computer, poliere die eh schon auf Hochglanz polierte Theke, ordne die Schubladen mehrfach neu. Ich wünsche mir sogar, dass noch späte Gäste auftauchen. Doch ich kann nicht aufhören, über diesen Moment nachzudenken … den Moment, in dem er sich beim Erreichen des Aufzugs nach mir umgedreht hat. Ich bin schon so daran gewöhnt, immer nervös zu sein – wie ein Kaninchen, das stets bereit ist, in seinen Bau zu huschen –, dass ich gar nicht wusste, dass ich mich auch anders fühlen kann. Aber in jenem Moment fühlte ich mich stark. Als ob ich Armeen befehligen könnte. Als ob ich Nationen stürzen könnte. Als ob ich magische Kräfte hätte …
23:11 Uhr – Leo
Soweit Leo weiß, hat er noch nie zuvor etwas geträumt. Die Regeneration durch den REM-Schlaf braucht er nicht – er braucht überhaupt keinen Schlaf, genießt ihn aber manchmal –, sodass seine Nächte nicht durch unnötige, unsinnige Bilder unterbrochen sind. Als er wegdämmert und dann in dieser Nacht wieder aufwacht und das Bild von Goldie zurückbleibt, ist er erschrocken. Vielleicht ist es eine unterschwellige Warnung, jetzt nicht bequem zu werden. Sein Unterbewusstsein warnt ihn, sie als Gegnerin nicht zu unterschätzen. Er kam zum Hotel, um sie zu beobachten, aber vielleicht sollte er noch genauer hinsehen, ihre Stärken abschätzen, ihr Potenzial ermitteln. Oder vielleicht entwickelt er gerade ja auch so etwas wie eine unnatürliche Besessenheit. Zugegebenermaßen ist es alles andere als unangenehm, ihr Gesicht erneut zu sehen. Dennoch hält ihn die Frage, warum er plötzlich träumt und ob Goldie der Grund dafür sein könnte, bis zum Morgengrauen wach.
30. September
Noch 32 Tage
18:33 Uhr – Bea
Das erste Mal, als Bea mit einem Segelflugzeug abhob, hatte sie schreckliche Angst. Auch wenn sie lieber abgestürzt wäre, als das vor den anderen zuzugeben. Und um ehrlich zu sein, ärgerte es sie auch, sich das selbst einzugestehen. Es war nicht das Fliegen – als sie erst einmal in der Luft war, verspürte sie eine nie gekannte Freude –, aber an das Abheben musste sie sich erst noch gewöhnen. Es war wie der freie Fall der Achterbahn im Rückwärtsgang: das langsame Anziehen der Startschleuder, die Anspannung, ein lauter Knall und dann das Hochgeschleudertwerden.
Das Aufsteigen – oh, das Aufsteigen – war hingegen einfach überwältigend. Nach dem plötzlichen Knall kam das herrliche Aufsteigen. In die Lüfte zu steigen, als ob sie überhaupt nichts wiegen würde, die Startschleuder zu vergessen, das Flugzeug zu vergessen, alles zu vergessen. Jegliche frühere Erfahrung war wie ausgelöscht durch diesen einzigen, besonderen Moment absoluter Gegenwart. Ein Moment, der sich in die Länge zog, bis das Segelflugzeug anfing, zu zittern und sich zu neigen, was dann den Piloten dazu brachte, den Steuerknüppel zu ergreifen und nach Aufwind zu suchen.
Es bedurfte eines halben Dutzends von Flügen, bevor Bea begann, die Startschleuder genauso zu genießen wie das Abheben, den Höhepunkt genauso sehr zu lieben wie das Loslassen. Nun, da sich das gigantische Gummiseil stramm zieht, spürt Bea, wie sich eine Spirale der Vorfreude in ihrem Inneren zusammenzieht. Sie sitzt im Cockpit in einem Zustand absoluter Stille, und dabei zittert sie, als ob ihr ganzer Körper kurz davor stünde, in Gelächter auszubrechen. Sie versteht nichts von der physikalischen Dynamik oder den meteorologischen Phänomenen, die das Segelflugzeug, das keinen Motor hat, in der Luft halten. Und sie will es auch gar nicht wissen. Begriffe zu definieren, um Konzepte zu verstehen, würde es belasten, würde etwas konkret machen, was himmlisch bleiben soll.
Bea wirft einen Blick aus dem Fenster, auf die kleine Gestalt von Dr. Finch, der dort unten steht und winkt. Sie winkt nicht zurück. Uneingeschränkter Zugang zu den Segelflugzeugen der Cambridge University Royal Aeronautical Society ist das Hauptziel ihrer Affäre. Der Sex ist in Ordnung, aber ansonsten hegt sie keinerlei Gefühle für ihn, abgesehen von gelegentlichem Abscheu.
Als sie emporsteigt, wird Beas Atmung tiefer und langsamer. Eine Haarsträhne rutscht aus ihrem Dutt, behindert ihre Sicht. Sie schiebt die Strähne wieder zurück. Wenn sie fliegt, verspürt sie manchmal den Wunsch, sich den Kopf zu rasieren, um die Landschaft ungestört genießen zu können. Das ist etwas, was ihre elegante Mamá in Wut versetzen würde – Grund genug, um es zu tun – und sie befreien würde. Aber auch wenn sie das genauso wenig zugeben würde, ist sie dafür dann doch zu eitel. Wenn sie in den Spiegel schaut, vergleicht sie sich mit dem, was sie gern mag. Manchmal haben ihre Haut und ihre Haare die braune Farbe der weiblichen Amsel und ihre mitternachtsschwarzen Augen die der männlichen. Auch wenn ihr Haar vielleicht, was die Farbe angeht, mehr Ähnlichkeit mit dem Flügel einer Krähe hat und wahrscheinlich auch genauso fein ist – insgeheim wünscht sie sich, es wäre etwas voller. Manchmal …
Sei vorsichtig! Dr. Finchs Gejammer dringt in die heilige Stille des Cockpits. Bea schließt ihn aus ihren Gedanken aus. Vergessen ist die Kopfrasur, jetzt hätte sie gern eine Lobotomie, und sei es nur, um ein bisschen Ruhe zu haben.
Sei doch nicht so unverantwortlich.
Cállate. Bea drückt ihren Zeigefinger und Daumen an ihre Schläfe. Leck mich doch am Arsch.
Bea ergreift den Steuerknüppel, senkt die Nase des Segelflugzeugs, dann zieht sie den Knüppel scharf zurück. Das Flugzeug steigt empor, und für einen langen, himmlischen Moment ist alles, was sie sehen kann, der Himmel – um sie herum, über ihr, in ihr. Sie ist frei.
Bea schreit ihre Ekstase heraus. »Wooooohoooooo!«
Auf dem Platz unter ihr wird ihr Lehrer jetzt fluchen und die Faust gen Himmel heben. Sie schließt ihn aus ihren Gedanken aus, blickt hoch in die Wolken, deren Unterseite von der untergehenden Sonne rosa gefärbt wird. Sie hält das Segelflugzeug noch einen Moment länger in der Luft, als sie sollte, bevor sie ihm erlaubt, sich zur Landung bereit zu machen. Die Nase stürzt nach einem Looping in Richtung Boden, sodass alles, was sie nun sieht, die Landschaft ist – abgeerntete Felder und herbstliche Bäume. Bis die Erde schließlich wieder normal unter ihr ist, das Flugzeug wieder waagerecht ausgerichtet.
Bea stimmt erneut ein vergnügtes Geheul an. »Wooohooooo!«
Richtig so, niña. Du zeigst ihm, dass du nicht irgendein dummes Mädchen bist. Du bist eine Schwester …
»¡Vete a la mierda, Mamá!«, faucht Bea. Sie ist genauso genervt von der mütterlichen Zustimmung wie von der Zurechtweisung durch ihren Lehrer. Fast achtzehn Jahre lang hat ihre Mutter sie angespornt, mutig zu sein. Und obwohl Bea nichts mehr genießt, als sich leichtsinnig zu verhalten, soll sie verdammt sein, wenn sie ihrer Mutter die Genugtuung gönnt und sie das wissen lässt.
Bea macht eine scharfe Linkskurve, neigt das Flugzeug so plötzlich und scharf, dass sie über ihren Sitz rutscht. Dabei knallt sie fast mit ihrer Stirn gegen den Blendschutz. Sie hält den Steuerknüppel ruhig, drückt ihn so weit, wie es nur geht, sodass sich das Segelflugzeug neigt. Der Himmel gleitet dahin. Zu ihrer einen Seite scheint sich der Boden zu erheben, dann dreht sich das Flugzeug ganz plötzlich seitwärts, es fällt, kippt, stellt die Welt auf den Kopf, sodass die Erde der Himmel ist, und der Himmel ist die Erde. Bea hängt jetzt im Cockpit wie eine Fledermaus, die kurz davorsteht, mit dem Kopf voran 2378 Fuß auf die Felder unter sich zu sürzen, in einem heillosen Durcheinander von Körper und Knochen und Flugzeugrumpf. Aber dann dreht sie sich erneut, folgt dem Kreisbogen des linken Flügels, als dieser der Luft High-Fives und Low-Fives und dann noch einmal High-Fives gibt.
»Woohooooo!«
Während das Segelflugzeug das Gleichgewicht hält, werden Beas ekstatische Schreie von Finchs gefluchten Schreien erfasst, und beide steigen zum Himmel empor in einem disharmonischen Zwieklang erhabenen Zorns.
»Woooo-fucking-hoooo!«
»Was für ein Spielchen hast du da oben abgezogen?«
»Ich wusste, dass du sauer bist«, sagt Bea und klettert aus dem gelandeten Segelflugzeug. »Ich konnte es spüren und konnte hören, wie du Obszönitäten gebrüllt hast …«
»Natürlich hab ich das, verdammt.« Dr. Finch ist bereits neben Bea, noch bevor ihre Füße überhaupt den Boden berührt haben. »Was zur Hölle hast du dir nur dabei gedacht? In den fünfzehn Jahren, seit ich fliege, habe ich noch nie so etwas Riskantes gemacht – einen Rückwärtslooping und eine Drehung um die eigene Achse ohne anständige Thermik. Was zur Hölle …«
»Was ich mir dabei gedacht habe? Ja, ja. Ich weiß, ich weiß.« Bea geht auf das schlaffe Gummiseil zu, das sich durch das Gras schlängelt. Jetzt, da sie wieder auf der Erde ist, will sie nichts lieber, als wieder in der Luft zu sein. »Und jetzt hör auf rumzujammern, und hilf mir lieber mit der Startschleuder.«
»Was?« Dr. Finch, der wie angewurzelt auf dem Platz steht, starrt sie an. »Bist du jetzt total übergeschnappt? Du fliegst nicht noch mal. Es ist fast schon dunkel.«
»Fast«, entgegnet Bea und hebt das Seil, findet die Winde, »aber noch nicht ganz.«
»Auf gar keinen Fall.«
»Oh, komm schon«, motzt Bea ihn jetzt an. »Sei doch nicht so ein Arsch.«
»Das sind die Regeln der Gesellschaft«, kontert Dr. Finch. »Deinetwegen werde ich noch rausgeschmissen. Verdammt, deinetwegen bekomme ich wahrscheinlich noch ein Disziplinarverfahren.«
Bea flucht vor sich hin. Sie will fliegen, will sich wieder frei fühlen. Das ist alles, was sie je gewollt hat – das Vermächtnis einer rastlosen Kindheit, die von Fremden bestimmt wurde, die ihre Mamá in das Verlies von St. Dymphna’s steckten, während sie Bea in einem Dutzend verschiedener Pflegefamilien gefangen hielten, aus denen sie immer wieder versuchte zu fliehen.
»Du bist so ein verdammter Feigling.«
»Und du bist verdammt lebensmüde.«
Was soll’s? will Bea sagen. Es ist bestimmt rühmenswert, vor dem Tod nicht den Kopf einzuziehen, aber direkt in seinen Rachen zu springen mit dem Schrei einer Kriegerin? Zumindest hat ihr das ihre wahnsinnige, manische Mutter so beigebracht. Bea öffnet den Mund, will Dr. Finch genau das sagen, überlegt es sich dann aber doch noch mal anders. »Ach, verpiss dich.«
Dr. Finch starrt sie an.
Die angespannte Stille zieht sich zwischen ihnen in die Länge – als wäre die Startschleuder zu weit gespannt worden und sei jetzt bereit, mit einem lauten Knall loszulassen. Mit einem letzten widerwilligen Blick auf das Segelflugzeug lässt Bea schließlich das Gummiseil neben ihren Füßen auf den Boden plumpsen. Stattdessen mustert sie jetzt Dr. Finch: die dünne, schlaffe Gestalt, die relativ ausdruckslosen Gesichtszüge, die leicht anämische Blässe des Übergebildeten, das scheinbar ungepflegte Haar und die Bartstoppeln, um anzudeuten, dass sein Geist mit erhabeneren Themen beschäftigt ist als mit Körperpflege. Was für ein Arschloch. Bea wünscht sich, sie hätte unverzüglich eine bessere Option. Aber traurigerweise hat sie das nicht.
»Also«, sagt Bea. »Wenn ich nicht fliegen kann, dann brauche ich jetzt das Nächstbeste … Erwartet dich deine Frau zu Hause?«
Hinterher liegt Bea auf dem Sofa in Dr. Finchs Büro, während er seine Klamotten vom Boden aufsammelt. Er tut so, als könnte er nicht glauben, wie das eben passieren konnte, als könnte er dann später behaupten, dass es eigentlich gar nicht passiert ist. Sie überfliegt die Titel seiner Fachbücher, sucht nach etwas von ihrem Lieblingsphilosophen.
Sie will hier nicht mehr länger bleiben. Sie will in der Luft sein oder – wenn das nicht geht – ein Buch lesen. Eine Flucht. Eine alternative Welt. Sie hatte sich geirrt. Der Orgasmus, besonders, da er ihr von dem unaufmerksamen Dr. Finch beschert wurde, war ein armseliges Echo des Flugs. Sie hätte in der Luft bleiben sollen. Sie hätte das Flugzeug stehlen sollen. Das nächste Mal wird sie es tun. Das nächste Mal wird sie nicht wieder runterkommen.
Oktober
Noch 31 Tage
5:31 Uhr – Liyana
Der erste Tauchgang ist immer der beste. Der Moment, in dem sie die Wasseroberfläche mit den Armen durchstößt und untertaucht. Genau das ist es. Ihr bester Moment. Ein einziger Rausch der Freude durchströmt ihre Adern wie nach einer Morphiumpritze, als Liyana unter Wasser geht. Ihre Arme sind wie ein Pfeil, sie bewegen sich so schnell und so frei, dass sie sich nicht länger fest fühlt, sondern flüssig.
»Ich hasse es, ein Mensch zu sein«, sagt Liyana oft. »Stell dir nur mal vor, wie es wäre, dein ganzes Leben durchs Wasser zu gleiten, statt durch die Luft zu stolpern.«
»Du stöhnst wie ein gestrandeter Wal«, entgegnet ihre Tante Nyasha dann oft. »Oder wie diese Meerjungfrau in diesem Film, den du …«
»Madison«, fällt Liyana ihr ins Wort. »Splash. Ja, von den blonden Haaren und den blauen Augen einmal abgesehen, wünschte ich mir, ich wäre sie.«
Einmal im Monat gönnt sich Liyana diese Freude. Sie »leiht« sich dann die Mitgliedskarte ihrer Tante aus, läuft die halbe Meile bis zum Serpentine Spa in der Upper Street und schwimmt eine halbe Stunde. Nicht mehr und nicht weniger. Dann verlässt sie das Spa und geht nicht noch einmal hin, ganz egal wie sehr sie es auch will. Bis zum nächsten Monat und dem nächsten erlaubten Ausflug. Die erzwungene Einschränkung ist eine bedauerliche, aber notwendige Disziplin, um die unvermeidbaren Nachwirkungen des Kummers in Schach zu halten.
»Also warum gehst du überhaupt dorthin, vinye?«, fragt Nya. »Wenn es dich doch so traurig macht?«
»Aus dem gleichen Grund, warum du Männern hinterherläufst, die dich unglücklich machen«, antwortet Liyana. »Weil du lieber tot wärst, als das nicht mehr zu machen, oder etwa nicht?«
Vor fast fünf Jahren verbrachte Liyana noch sechs Stunden pro Tag in einem Schwimmbecken. Damals erfüllte sie das Schwimmen mit purer Freude. Mit zehn Jahren hatte sie bereits genügend Trophäen gewonnen, um einen Eichenschrank damit füllen zu können, und mit dreizehn war sie auf dem Weg zu olympischem Ruhm. Aber dann ereignete sich dieser Unfall, der Liyana für ein Jahr ans Bett fesselte und sie für immer in Amateur-Gewässer zurückwarf. Jetzt bringt ihr das Schwimmen in gleichem Maße Freude wie auch Kummer. Der erste Tauchgang ist immer noch der beste, der letzte immer der traurigste. Und dann geht Liyana, bevor das Verlangen, dort zu bleiben, zu überwältigend wird. Es ist bereits schwierig genug, es nach nur einer Stunde auf sich beruhen zu lassen. Und in den darauffolgenden Tagen haftet der Geruch nach Chlor immer noch an ihrer Haut, ganz gleich, wie sehr sie auch versucht, ihn wegzuschrubben. In ihr schnürt sich dann immer alles zusammen, und Tränen brennen in ihren Augen. Wenn das endlich vorbei ist, ist ihre Haut – dunkel wie die Tiefen des Ozeans, ihre Augen schwarz und glänzend wie Steine am Flussufer – wieder pergamenttrocken. Bis zum nächsten Monat.
Unter Wasser, als ihr torpedoartiges Selbst langsamer wird, öffnet Liyana die Augen und sieht die Bahnen der schimmernden blauen Keramikkacheln – das Mosaik einer Seeschlange, die geformt ist wie ein in sich verschlungenes S. Liyana ist bereits im Begriff, sich wieder umzudrehen, um sich von den Kacheln abzustoßen und an die Oberfläche zu gelangen, als sie in der Ecke etwas schimmern sieht: ein Stein, strahlend weiß wie ein Totenschädel. Er ist so groß wie ihre Faust, und als sie darauf zuschwimmt, denkt Liyana an Kumikos Gesicht, knochenbleich, zwischen Vorhängen aus schwarzem Haar. Kumikos Gesicht sieht aus wie ein abnehmender Mond am Mitternachtshimmel.
»Wenn ich der Mond bin«, hatte Kumiko damals zu ihr gesagt, »dann bist du der Nachthimmel, der mich umschlingt.«
Liyana lachte. »Okay.«
»Nein, ich bin nicht der Mond.« Kumiko lehnte sich vor. »Ich bin wie die Zähne in deinem dunklen, feuchten Mund.« Kumiko berührte Liyanas Lippen mit ihren eigenen.
Langsam erwiderte Liyana den Kuss. »Du versuchst mich gerade abzulenken.«
Kumiko lächelte. »Funktioniert es denn?«
»Ich … ich will dich zeichnen.«
»Ich will dich vögeln.«
Liyana lachte wieder. »Du bist ja nicht besonders damenhaft, oder?«
Kumiko zog sich zurück. »Nach wessen Definition?«
»Na ja …« Liyana tippte mit dem Stift gegen ihre Zähne. »Du solltest vielleicht lieber nicht so mit meiner Tante reden.«
»Das hängt ganz davon ab.« Kumikos Lächeln wurde breiter. »Sieht sie denn so aus wie du?«
»Genau«, sagte Liyana und legte ihren Stift beiseite. »Jetzt wirst du sie jedenfalls definitiv nicht treffen.«
Kumiko verdrehte die Augen. »Als ob das jemals passieren würde.«
»Du wirst sie noch kennenlernen«, sagte Liyana. »Ich …«
»… warte nur auf den richtigen Moment«, sagte Kumiko. »Ich hab dein Gelaber schon oft genug gehört, ich kenn’s schon in- und auswendig.«
»Bitte«, sagte Liyana. »Du musst mir …«
»… Zeit geben«, beendete Kumiko ihren Satz. »Ja, ja. Blablabla … Weißt du, was? Du musst endlich aufhören, so damenhaft zu sein und dir mal ein paar Eier wachsen lassen … oder Brüste oder was auch immer das weibliche Pendant dazu ist … und du musst aufhören, so ein verdammter Feigling zu sein.«
Als Liyana an der Oberfläche auftaucht, umklammert sie immer noch den Stein. Sie schüttelt sich das Wasser aus ihrem Haar, dann schaut sie hoch und blickt geradewegs in das Gesicht eines Mannes. Sie runzelt die Stirn und verschränkt ihre Arme über dem Beckenrand. Er sieht zu ihr herunter.
»Ich dachte schon, ich muss die Badeaufsicht rufen«, sagt er.
Liyanas Stirnrunzeln wird stärker und dann zu einem mürrischen Gesichtsausdruck.
»Du kannst die Luft ja ganz schön lange anhalten«, sagt er. »Es sah so aus, als ob du nicht wieder hochkommen würdest.«
»Fünfzehn Minuten, siebenunddreißig Sekunden«, erwidert Liyana. Sie will nicht mit diesem Mann reden und hat auch keine Ahnung, warum er überhaupt mit ihr redet, aber der Wunsch, über das Schwimmen zu sprechen, ist stets präsent, die Worte sind bereits aus ihrem Mund, bevor sie sie zurückhalten kann. »Ich konnte die Luft mal anhalten für zw… länger.«
»Echt?«
Liyana zuckt mit den Schultern. »Bin ein bisschen aus der Übung.« Sie schaut zurück aufs Schwimmbecken. Sie verschwendet gerade kostbare Zeit im Wasser. »Ich sollte …«
»Wie oft kommst du her?«
Liyanas mürrischer Gesichtsausdruck kehrt wieder zurück. »Hast du mich gerade etwa gefragt, ob ich oft hierherkomme?«
Er lacht. »Ja, ich nehme an, das hab ich gemacht … entschuldige, das wollte ich nicht.« Er fährt sich mit einer Hand durchs Haar. Liyana bemerkt, dass er ziemlich attraktiv ist – groß, muskulös, und seine Haut hat die Farbe von feuchter Erde. Sogar äußerst attraktiv, könnte man sagen, wenn man so veranlagt wäre. »Ich hab’s nicht so gemeint. Ich hab nur gefragt … Das hier ist für mich nicht das naheliegendste Fitnessareal. Ich hab mich gefragt, ob es den Mitgliedsbeitrag wert ist.«
Liyana reibt mit dem Daumen über den nassen Stein. Der will wieder zurück ins Wasser. »Ich nehme es an, aber ich hab keine Ahnung. Ich komme nur zum Schwimmen her.«
»Wie oft?«
»Einmal im Monat.«
Er zieht die Augenbrauen hoch. »Echt? Du siehst nicht … du siehst viel fitter aus.«
Liyana bewegt sich im Wasser, zieht ihre Arme näher an ihren Körper, verdeckt den Blick auf ihre Brüste. »Ich denke nicht …«
»Scheiße«, sagt er. »Tut mir leid. Der Satz hätte in meinem Kopf bleiben sollen. Ich hab’s nicht …«
»So gemeint?« Liyana zieht jetzt nur eine Augenbraue hoch.
»Ja«, antwortet er. »Ich, ähm, ich wollte nur sagen, dass du wie eine Athletin aussiehst.«
Liyana schaut ihn sich genauer an. Zusätzlich zu der Tatsache, dass er gut aussehend ist, hat er eine Stimme, die, obwohl er unsicher ist und sich verhaspelt, ansonsten wie ein Fluss klingt, der Felsen glatt schleift. Vielleicht unterhält sie sich ja auch aus diesem Grund schon so lange mit ihm.
Ich war früher mal eine Athletin. Die Worte warten in Liyanas Kehle. Aber wenn sie sie herauslassen würde, dann würde das zu Fragen animieren, die sie nicht beantworten will.
»Ich muss jetzt los«, sagt sie stattdessen. »Ich habe nur noch siebenundvierzig Minuten übrig.«
»Das ist … Du bist sehr … genau.«
Er lächelt wieder, und Liyana ist davon gefangen. Es erinnert sie an etwas längst Vergangenes. An einen Mond, der sich seinen Weg durch die Wolken bahnt. Und einen Fluss, der dessen Licht auffängt.
Oktober
Noch 30 Tage
10:36 Uhr – Scarlet
Scarlet wollte nicht hingehen, aber ihre Großmutter hatte darauf bestanden. Warum sie gedacht hatte, dass eine eintägige Ausbildung bei einem Schmied aus Hatfield ein angemessenes Geschenk zu einem achtzehnten Geburtstag war, ist Scarlet ein Rätsel. Aber wahrscheinlich ist es nur ein weiteres mitleiderregendes Beispiel dafür, wie weit und wie schnell sich der Verstand ihrer Großmutter trübt … Scarlets Geburtstag ist erst Ende des Monats. Aber was bleibt ihr schon anderes übrig, als mitzuspielen?
Der Schmied Owen Baker ist der kräftigste Mann, den Scarlet jemals gesehen hat. Er hat einen Kopf, der so unbehaart ist wie ihr Bauch, einen Hals, der so dick ist wie ihr Oberschenkel, und er hat Hände, die fast so breit sind, wie ihre lang sind. Er könnte sie sich ohne Weiteres über die Schulter werfen und im Nu mit ihr im Wald verschwinden. Auch wenn sie den Wald von hier aus nicht mal sehen kann. Die Schmiede liegt in einem Hof und grenzt an eine Schweinefarm. Aber wenn Scarlet an Schmiede denkt, wenn sie das seit ihrem achten Lebensjahr jemals getan hat, dann denkt sie an Märchen von Wäldern und verletzlichen Mädchen … oder vielleicht von Jägern?
»Alles klar, was möchten Sie als Nächstes machen, Miss Thorne?«
Scarlet schaut auf, für einen Moment ist ihr Kopf ganz leer. Sie hatte bei der Einführung des Schmieds nicht richtig zugehört, dessen Zusammenfassung der edlen Kunst des Anfertigens von Nieten. Und sie hatte nicht damit gerechnet, dass es schon so schnell vorbei sein würde.
»Entschuldigung?« Scarlet fängt an, sich einen Dutt zu machen – die dicken, dunkelroten Locken springen wie Flammen von ihrem Kopf, umrahmen ihre Augen, die braun sind wie das Holz, das die Flammen füttert. »Ich dachte nicht, dass ich …«
»Nun ja, wie ich bereits erwähnte«, sagt der Schmied, legt seine breiten Hände auf seinen Amboss und lehnt sich dann vor. »Sie können anfertigen, was Sie wollen. Eine Niete, einen Nagel, ein Schwert …«
Scarlet starrt ihn an und lässt ihre Haare los. »Ein Schwert?«
»Oh ja.« Der Schmied grinst, seine Augen strahlen plötzlich wie die eines dreijährigen Jungen. »Wollen Sie ein Schwert machen, Miss Thorne?«
Scarlet denkt über diesen merkwürdigen Vorschlag nach. »Nein, eigentlich nicht.«
»Na gut.« Er streckt sich, das Licht in seinen Augen verblasst. »Also, was soll es dann sein?«
Scarlet greift wieder in ihre Haare. »Aber ich dachte, dass Sie mir sagen würden, was ich machen soll.«
Owen Baker schüttelt den Kopf. »Wo bleibt denn da der Spaß? Nein. Das entscheiden Sie selbst.«
Scarlet ist durcheinander. Nervös befingert sie ihre Haare, kaut auf ihrer Lippe. Dann hat sie mit einem Mal eine Idee. »Okay, ich weiß, was ich mache.« Sie grinst, freut sich über die Eingebung. »Ich will ein Tor machen.«
»Ein Tor?«
»Ja.« Ihre Idee gefällt Scarlet immer besser. »Eines dieser schicken Tore, mit all diesen hübschen Wirbeln und gewellten Stücken. Wissen Sie, was ich meine?«
»Sie meinen diese Zierspitzen und dieses Geschnörkel?« Der Schmied verschränkt seine Arme vor der Brust. »Nun ja, ich bewundere Ihren Ehrgeiz, Miss Thorne, das tu ich wirklich. Aber ich fürchte, das könnte ein bisschen zu viel Arbeit für einen einzigen Tag sein. Wir haben schließlich nur fünf Stunden Zeit.«
»Oh, richtig.« Scarlet starrt auf den Hammer, der an der steinernen Wand hängt. »Ich verstehe.«
»Aber wir könnten zumindest schon mal einen Teil des Tores anfertigen«, schlägt er dann vor. »Was halten Sie davon?«
Scarlets Stimmung hellt sich auf. »Super.«
»Also, was bevorzugen Sie?«, fragt er. »Ein gewelltes Stück oder ein spitz zulaufendes?«
»Ja, das ist richtig, benutzen Sie die Ecke, wenn Sie nach unten ziehen … gut, das ist eine gute Technik. Ja, das ist es, und jetzt ein bisschen langsamer.« Er nickt. »Sie sind gut im Umgang mit dem Hammer, Miss Thorne.«
Scarlet schaut auf und grinst, ihr Gesicht ist gerötet. »Wirklich? Ich habe noch nie …«
»Nein, hören Sie jetzt nicht auf!«, ermahnt sie der Schmied. »Lassen Sie es nicht abkühlen. Das ist es, nicht das Flache, sondern die Ecken … Sie wollen das Metall weiterschieben, so wie man das mit dem Nudelholz beim Teig macht … zumindest sagt das meine Frau.«
Die Bemerkung verfehlt ihr Ziel, so konzentriert ist Scarlet auf die Bewegung ihres Arms, auf den Schwung des Hammers, den Knall, wenn er die brennende Metallstange trifft, die Vibration, wenn er danebengeht und den Amboss erwischt.
»Genau, bringen Sie es wieder zurück in die Mitte, das ist es – erinnern Sie sich jetzt an die Hammerfläche, fangen Sie jetzt an, die Form zu verfeinern. Machen Sie leichtere Schläge, oder Ihre Spitze wird abbrechen.«
Scarlet neigt die Stange, klopft auf die Schräge, zuerst auf eine Seite, dann auf die andere, und macht das Metall zur Spitze hin immer dünner. Sie hofft, dass sie Zeit haben werden, um noch eine weitere zu machen, um mehr Metall in den Ofen zu schieben und die Flammen zu sehen, wie diese hüpfen und voller Vergnügen fauchen, dass sie etwas zum Verbrennen haben. Scarlet will das Feuer beobachten, bis es verglüht und nur noch Asche übrig ist. Sie will immer wieder mit dem Hammer auf den Amboss schlagen, um dabei die Kraft des Schlags zu spüren, den herrlichen Knall zu spüren, der sie durchbebt, vom Scheitel bis zur Sohle. Seltsamerweise würde sie gern die Hand in die Flamme tauchen, um die Verbrennung auf ihrer Haut zu spüren. Es ist völlig unmöglich, aber sie glaubt dennoch, dass das Feuer freundlich zu ihr sein wird. Dass es sie wärmen wird, dass sich die Hitze ausbreiten und ansteigen wird, bis sie in ihrem Innersten weiß glühend ist.
Eigentlich sollte Scarlet Angst vor dem Feuer haben, sie sollte es hassen, weil es ihr ihre Mutter und ihr Zuhause genommen hat. Aber sie stellt fest – vielleicht, weil sie keine richtige Erinnerung an den Vorfall hat –, dass sie nur Angst verspürt, wenn sie an Feuer denkt. Wenn sie es sieht, ist sie fasziniert.
»Was tust du denn da mit dieser fürchterlichen Spitze?« Ihre Großmutter, die auf einem Stuhl sitzt, schreckt zurück, so als ob Scarlet ihr die Zierspitze an die Kehle gehalten hätte. »Leg das weg.«
»Ich habe es selbst gemacht«, erzählt Scarlet, schützend drückt sie die Zierspitze an ihre Brust. »Heute Morgen, mit dem Schmied.«
Sie sitzen in der Küche des Cafés, essen gebutterte Crumpets zum Dinner. Das ist ihr wöchentliches kulinarisches Vergnügen.
Esme Thorne runzelt die Stirn. »Dem Schmied?«
Scarlet beißt in ihren Crumpet, unterdrückt den Anflug von Kummer. »Du hast es mir zum Geburtstag geschenkt, weißt du noch?«
Die Augen ihrer Großmutter werden trüb, und Scarlet verflucht sich. Warum hat sie nicht einfach den Mund gehalten? Mittlerweile sollte sie es doch besser wissen. Doch zu oft vergisst sie es einfach.
»Aber du hast doch noch gar nicht Geburtstag.« Auf einmal sieht ihre Großmutter aus wie ein Kind mit weit aufgerissenen, unsicher dreinblickenden Augen und ein paar vereinzelten Sommersprossen auf der Nase – an drei Generationen von Thorne-Frauen weitervererbt. »Ist der etwa heute? Ich hab doch nicht deinen Geburtstag vergessen, oder?«
»Nein, nein, Grandma«, sagt Scarlet schnell. »Natürlich nicht. Der ist erst Ende des Monats.«
Ihre Großmutter entspannt sich wieder. »Ich wusste doch, dass ich nicht den Geburtstag meiner Ruby vergessen würde.«
Scarlet legt ihren Crumpet auf den Teller. »Nein, Grandma, ich bin nicht Ruby.« Aber sobald die Worte ihren Mund verlassen haben, bereut sie es auch schon. »Ich … ich bin Scarlet.«
»Das weiß ich doch«, sagt Esme, die plötzlich genervt klingt. »Das hab ich doch auch gesagt.« Sie streicht sich das lange, graue Haar zurück – mit achtundsiebzig Jahren hat sie erst vor Kurzem die letzten roten Strähnen verloren – und klemmt es sich hinter die Ohren. »Ich wünschte, du würdest aufhören, mich ständig zu verbessern. Das ist wirklich unerträglich.«
Scarlet wartet. Sie ist bereit, die Flammen des Feuers zu löschen, das sie eben entfacht hat, aber dann scheint es ganz von selbst auszugehen. Ihre Großmutter leckt geschmolzene Butter von ihrem Daumen.
»Als du noch ein kleines Mädchen warst, wolltest du Schmied werden.«
»Wirklich?«, fragt Scarlet, zwar erleichtert über den Themenwechsel, aber nicht überzeugt von dem, was ihre Großmutter ihr gerade erzählt.
In den letzten Jahren ist es bei Esme immer schwieriger geworden, Tatsachen von erfundenen Geschichten zu unterscheiden, aber Scarlet spielt trotzdem mit. »Wollte ich das wirklich?«
Ihre Großmutter nickt. »Oh, ja. Einmal habe ich dir sogar einen Hammer und einen Amboss gekauft. Ich glaube, zu deinem zwölften Geburtstag. Es war ein kleines Set, aber echt genug.«
»Das ist ja unglaublich, Grandma.« Scarlet setzt ein Lächeln auf. »Aber ich erinnere mich nicht mehr daran.«
»Das tust du nicht? Oh Gott, ich …« Esme verstummt, blickt auf ihren Teller. »Du warst auf einem Schulausflug gewesen. Danach hast du gar nicht mehr aufgehört, mich anzubetteln, dass ich dir die Sachen kaufen soll.«
Scarlet erinnert sich immer noch nicht daran, aber irgendwie spürt sie, dass ihre Großmutter diesmal die Wahrheit sagt. »Was ist dann passiert?«, fragt sie. »Wo sind die Sachen jetzt?«
»Keine Ahnung.« Ihre Großmutter sieht nachdenklich aus. »Ich glaube … dass du sie irgendwann nicht mehr haben wolltest. Du hast gesagt, es wäre nicht das Gleiche.«
Scarlet runzelt die Stirn. »Was denn?«
»Ich weiß nicht so recht.« Ihre Großmuter schaut von ihrem Teller auf und blinzelt, da sich die Erinnerung verflüchtigt. Sie greift in die Luft, greift nach der Erinnerung. »Ich glaube … Ich glaube, dass du in Wirklichkeit gar nicht das Werkzeug haben wolltest. Eigentlich wolltest du das Feuer.«
Oktober
Noch 29 Tage
1:03 Uhr – Leo
Nachdem er seine Eltern im Hotel abgesetzt hat – auf das Drängen seiner Mutter hin wird er das ganze Wochenende mit ihnen verbringen, noch länger würde er allerdings auch nicht aushalten –, kehrt Leo zum St. John’s College zurück. Heute Nacht steht der Mond im ersten Viertel, und das nächste Tor nach Everwhere ist jenes, welches den Garten des Rektors schützt. Heute Nacht muss Leo auf jeden Fall jagen, um seine Fähigkeiten zu verbessern, und er muss töten, um sein verblassendes Licht zu nähren. Nachdem er Goldie ein paar Tage lang beobachtet und nachts auch weiterhin von ihr geträumt hat, weiß er, dass er sich sorgfältig auf den in Kürze stattfindenden Kampf vorbereiten muss, um überhaupt eine Überlebenschance zu haben. Denn auch wenn sie sich selbst vergessen hat, so ist Goldie dennoch das mächtigste Grimm-Mädchen, dem er jemals begegnet ist. Es wird ein Nahkampf auf Leben und Tod werden, aber wenigstens hat er das Überraschungsmoment auf seiner Seite.
Es ist bereits nach drei, als Leo sein Zimmer verlässt. Vereinzelte Geräusche unterbrechen seinen Gang durch den Korridor – er hört betrunkenes Gelächter aus einem der Schlafräume, enthusiastische Kopulationsgeräusche aus einem anderen.
Leo eilt weiter. Er macht gerade seinen Abschluss am St. John’s, weil es eines der wenigen Colleges ist, auf dessen Grundstück es ein Tor gibt, was bedeutet, dass er in mondbeschienenen Nächten nicht durch die Straßen von Cambridge laufen muss.
Nur die ältesten und renommiertesten Colleges haben solche Zugänge: jene, deren Ziegel, Türme, Bäume und deren Boden seit mehreren Jahrhunderten von Gedanken durchdrungen sind. Leider ist das St. John’s College auch eines der größten Colleges des Landes, und Leos Zimmer ist weit vom Garten des Rektors entfernt, sodass er jedes Mal das Risiko eingeht, von einem überwachsamen Nachtportier erwischt zu werden.
Während er durch steinerne Korridore und über verbotene Rasenflächen eilt, merkt Leo, dass er sich irgendwie nicht so wirklich wohlfühlt. Normalerweise ist das hier seine Lieblingsnacht des Monats, aber heute Nacht fühlt er sich nicht von seinem üblichen Enthusiasmus beflügelt. Was seltsam ist, weil Leo der Beste von ihnen ist, der hellste Stern, der Top-Rekrut seines Vaters, des Dämons. Von allen Soldaten kann er die höchste Tötungsrate verbuchen. Und das mit erst achtzehn Jahren – natürlich abhängig von der Welt, von der man ausgeht.
Leo hat gehört, dass es für einen Soldaten möglich ist – zumindest rein theoretisch –, nach Everwhere im Windschatten eines Traums eines Grimm-Mädchens zu reisen. Dadurch würde das Betreten von Everwhere nicht auf einen bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit beschränkt. Aber das wird er nicht hinbekommen, da es bestimmte Fähigkeiten erfordert sowie eine tiefe Vertrautheit mit dem betreffenden Mädchen. Und Leo könnte es niemals zulassen, sich in eine Grimm zu verlieben. Nicht wirklich. Nicht nach dem, was ihresgleichen seinesgleichen angetan haben.
Zehn Minuten später und ein bisschen atemlos steht Leo vor dem Tor. Er wirft einen Blick auf seine Uhr. Um 3:33 Uhr greift er hoch, drückt seine Handfläche leicht gegen die kunstvollen schmiedeeisernen Windungen. Das Tor schimmert silbern, als ob es in Mondlicht getaucht worden wäre. Leo drückt das Tor auf und schreitet hindurch.
6:35 Uhr – Goldie
Mittlerweile gehören meine Gedanken daran, Armeen zu befehligen und Nationen zu stürzen, der Vergangenheit an, ersetzt durch meine ganz alltäglichen Sorgen – Teddy zu versorgen, Garrick aus dem Weg zu gehen, die Miete zu bezahlen –, und ich bin dankbar dafür. Irgendwie war es ein bisschen verstörend, sich so mächtig zu fühlen.
»G-G, komm her.«
»Was ist denn los?« Ich trete aus der Küche und bin wenige Sekunden später bereits an Teddys Bett, um zu sehen, was er von mir will – alles in unserer Wohnung befindet sich nur wenige Schritte von allem anderen entfernt –, obwohl ich es bereits weiß, weil wir jeden Morgen die gleiche Routine durchgehen. Und tatsächlich ist Teddy nackt, von seiner Batman-Unterhose einmal abgesehen. Er sitzt neben einem Klamottenhaufen.
Mit einem kläglichen Gesichtsausdruck schaut er mich an. »Was soll ich heute anziehen?«
Ich erfasse die Lage. »Grüne Hose mit rotem T-Shirt und blauem Pullover?«
Der Blick auf Teddys Gesicht verrät mir, dass ich seiner Meinung nach den Geschmack einer Vogelscheuche habe.
»Was ist denn mit deinem Lieblingspullover?« Ich zeige auf das Häufchen aus weichem blauen Kaschmir. Den Pullover habe ich vor einem Monat von dem Kind eines Schweizer Bankiers besorgt (Zimmer 23). Es war einer von einem halben Dutzend identischer Pullover – ich hätte auch ohne Weiteres zwei nehmen können. Aber beim Stehlen geht’s um Grenzen – wenn man einmal gierig wird, dann wird man erwischt.
»Ich habe ihn fast jeden Tag angehabt.« Teddy betrachtet den Pullover. »Gestern hat Caitlin zu mir gesagt, dass sie mir einen Zehner leiht, damit ich mir einen neuen Pulli kaufen kann.«
»Kleines Bie…« Ich beiße mir auf die Lippe. Kinder. Manche sind niedlich, aber die meisten bräuchten mal eine ordentliche Ohrfeige. Ich denke an die französische Familie in Zimmer 38, die einen Jungen in Teddys Alter hat.
»Ich besorge dir bald etwas Neues«, verspreche ich ihm. »Mach dir keine Gedanken.«
»Echt?« Mit weit ausgebreiteten Armen läuft Teddy auf mich zu. Ich erwidere seine Umarmung. Er ist klein und schwach wie ein frisch gepflanzter Setzling, seine Gliedmaßen sind so dünn, dass ich mir manchmal Sorgen mache, dass sie brechen, wenn ich ihn zu fest umarme.
»Ja«, antworte ich. Ich werde etwas so Tolles besorgen, dass es selbst diesem kleinen Ding Bewunderung abnötigen wird.
07:07 Uhr – Bea
»Steh auf, steh auf, steh auf.«
Der längliche Klumpen unter Beas Bettdecke stöhnt.
»Komm schon.« Sie findet seinen Schenkel mit ihrer Ferse und gibt ihm einen kräftigen Tritt. »Du faule Sau.«
Ein Kopf mit verfilzten Haaren, ein Gesicht, an das sie sich von letzter Nacht nur vage erinnern kann, kommt unter der Decke zum Vorschein und blinzelt in das milchige Morgenlicht. »Hab ein Herz.« Er lässt seinen Kopf zurück aufs Kissen fallen. »Es dämmert doch gerade erst.«
»Nein, tut es nicht«, fährt Bea ihn an. Sie wünscht sich – nicht zum ersten Mal –, dass sie dazu in der Lage gewesen wäre, Little Cat in ihr Zimmer im College zu schmuggeln, weil der Kater ihr Geborgenheit schenken würde, ohne im Gegenzug irgendwelche Forderungen zu stellen. »Und jetzt verpiss dich, ich hab eine Vorlesung.« Das stimmt nicht, und sie wissen es beide. Aber obwohl Bea ihn loswerden will, hat sie doch auch noch ein anstehendes Date mit der Universitätsbibliothek. Das hat sie jeden Morgen, sobald diese öffnet. Um Philosophie zu studieren. Sie hat sich für dieses Studienfach entschieden, um sich mit Ideen zu beschäftigen, die in einem anderen Kontext vermutlich Fragen bezüglich ihrer mentalen Gesundheit aufwerfen würden. Da sie sich nämlich immer noch Sorgen darüber macht, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt.
Ihre Mamá ist die Erste, die sie daran erinnert. Ihre Mamá mit den Zügen eines Falken, deren Nase fast so scharf ist wie ihre Zunge. »Das hier ist nicht deine Bestimmung, niña«, sagt sie. »Das wirst du noch früh genug herausfinden.«
Jedes Mal spricht sie mit solch einer Autorität, dass Bea es manchmal schwer findet, sie zu ignorieren. Cleo Garcia Pérez klingt immer ehrlich, wenn sie ausgedachte Geschichten erzählt und diese für wahr erklärt, von erfundenen Orten spricht, von denen sie behauptet, dass es sie wirklich gibt. So, als ob sie gar niemanden verspotten würde und nicht verrückt wäre. Obwohl beides der Fall ist. Was auch der Grund dafür ist, dass sie während Beas Kindheit immer mal wieder ins St. Dymphna’s Psychatric Hospital gebracht wurde. Und Bea verbrachte diese Zeit in diversen Pflegefamilien. Cleo verbringt ungewöhnlich viel Zeit damit, die Tugenden des Lasters zu loben, und besteht darauf, dass Bea in ihre finsteren Fußstapfen tritt. Im Gegensatz zu anderen Müttern befürwortet Cleo schlechtes Benehmen und verflucht gutes Benehmen. Sie lobt ihre Tochter für Egoismus, Wut und Unfreundlichkeit und bestraft sie für Rücksichtnahme oder Großzügigkeit. Ihre Mamá – ein frostiger Wind der Grausamkeit weht durch eine ansonsten ruhige Welt – ist ein Paradebeispiel dafür, wie schlecht menschliche Wesen zueinander sein können.
»Das Leben ist ein Überlebenskampf«, sagt Beas Mutter. »Naturgemäß wird das Gute diesen Kampf verlieren und den anderen den Sieg überlassen. ¿Entiendes? Deshalb darfst du nicht gut sein, wenn du überleben willst.«
Na gut, denkt Bea, obwohl das keine Meinung ist, die sie teilen wird. Es kam ihr schon immer irgendwie seltsam vor, dass ihre Mutter bei all ihrem Geschwafel über den Krieg zwischen Gut und Böse nie versucht hat zu behaupten, dass diese Grimm-Schwestern, von denen sie ständig redet und von denen sie behauptet, dass Bea eine von ihnen ist, für das Gute kämpfen. Warum sollte man schließlich gut sein, wenn man auch großartig sein kann? Das Böse, das sagt sie immer, ist Stärke. Das Böse bedeutet, den Mut und die Fähigkeit zu besitzen zu tun, was nötig ist, um zu siegen. Um die Welt von den Schwachen zu befreien.
»Wenn du die Zukunft der Menschheit den Guten überlässt«, sagt Cleo, »dann werden sie eine erbärmliche Rasse erschaffen: Leute, die durch Mitleid, Toleranz und Empathie wie gelähmt sind. Leute, die das, was ist, akzeptieren, statt für das zu kämpfen, was möglich ist. Überlasse das patético Menschengeschlecht ihnen, und wir werden ausgelöscht – von den Naturgewalten, den Tieren, von jeder Rasse uns angreifender Aliens …«
Wenn ihre Mutter so redet, hat Bea schon gelernt, einfach nur zu nicken und nichts dazu zu sagen. Zu argumentieren würde nur dazu führen, dass ihre Mutter dann überhaupt nicht mehr den Mund halten würde. Beas Umzug nach Cambridge war eine Art Flucht, um sich von Cleos faschistischen Meinungen zu distanzieren und um stattdessen in leichtem Grübeln, in Spekulationen und Überlegungen zu versinken. Geselligkeit – sofern sie nicht körperliche Befriedigung zum Ziel hat – ist nichts, was sie interessiert.
Als sie es schließlich schafft, ihr Bett von dem Eindringling zu befreien, radelt Bea (zu schnell) zur Bibliothek. Sie wird erst langsamer, als sie die Queen’s Road kreuzt, um über den Fluss zurückzublicken und die Schönheit der King’s College Chapel auf sich wirken zu lassen. Deren kompliziert gemeißelte Turmspitzen strecken sich wie unsterbliche Finger in Richtung der aufgehenden Sonne. Manchmal stellt sich Bea vor, dass die Turmspitzen versuchen, das große Gewicht des Colleges in den Himmel zu ziehen, um dann im Winter wie ein mächtiger Zugvogel in wärmere Gefilde zu fliegen – vielleicht nach Paris, um neben Notre Dame zu sitzen, oder nach Barcelona, um sich zu der La Sagrada Familia zu gesellen.
Jeden Tag ist Bea dankbar, hier zu sein, inmitten solcher Schönheit und Inspiration. Sie ist dankbar dafür, in der Universitätsbibliothek sitzen zu können, um sich in die Ansichten von Bertrand Russell zu vertiefen, der sich erwartungsgemäß als weitaus bessere Gesellschaft erweist als der linkische Student, den sie aus ihrem Bett geworfen hat.
11:48 Uhr – Liyana
Liyana balanciert das Skizzenbuch auf ihren Knien, um das nächste Bild ihres Comicromans zu entwerfen – an dem sie schon seit fast zwei Jahren arbeitet. Mit Tinte und Feder zeichnet sie, wie BlackBird vom Wipfel der höchsten Eiche in Elsewhere LionEss herunterwirft. BlackBird lacht, als die wild um sich schlagende und nicht fliegen könnende LionEss auf die Steine unter der Eiche knallt. Als Liyana das letzte Blatt des Efeus schattiert hat, beginnt sie, die Geschichte von BlackBird zu schreiben.
BlackBird