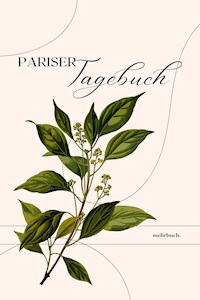Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weidle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Berliner Journalist Theodor Wolff (1868–1943) schrieb auch Sachbücher, Theaterstücke und Romane. Sein letztes Werk war »Die Schwimmerin« und erschien 1937 bei Oprecht in Zürich – Wolff lebte da schon drei Jahre im südfranzösischen Exil. Der »Roman aus der Gegenwart«, so der Untertitel, erzählt die Geschichte der Liebe eines älteren Mannes zu einer jungen Frau vor der Folie der politischen und wirtschaftlichen Erschütterungen der Epoche. Der Mann ist Bankier, Hedonist und »Mann ohne Eigenschaften« (nicht umsonst heißt er Ulrich), der sich aus allem raushält - also das Gegenteil Wolffs. Sie, Gerda Rohr, ist politisch aktiv, brennt für die linksrevolutionären Bewegungen und hält seine Passivität nicht aus. Man kann in ihr Wolffs ehemalige Sekretärin, Ilse Stöbe (1911–1942), erkennen, eine Widerstandskämpferin und sowjetische Spionin, die von den Nazis hingerichtet wurde. Der Roman ist alles andere als ein Thesenstück, gar eine Sammlung von Leitartikeln: Er ist voller Schwung, ungewöhnlichen Formulierungen und atmosphärisch eine fulminante und genaue Schilderung dessen, was wir aus »Babylon Berlin« kennen – oder zu kennen glauben. Wolffs Roman ist vieles zugleich: Liebesgeschichte, Sozialgeschichte, Porträt Berlins - man kann anhand der geschilderten Topographie die Wege der Protagonisten abgehen -, ein wehmütiger Nachruf auf die Weimarer Republik, Vorahnung des bevorstehenden Untergangs, Beschreibung des Lebens im Exil. Und das alles in einer Sprache, die mittels überraschender Bilder erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der Berliner Journalist Theodor Wolff (1868-1943) schrieb auch Sachbücher, Theaterstücke und Romane. Sein letztes Werk war Die Schwimmerin und erschien 1937 bei Oprecht in Zürich – Wolff lebte da schon drei Jahre im südfranzösischen Exil. Der »Roman aus der Gegenwart«, so der Untertitel, erzählt die Geschichte der Liebe eines älteren Mannes zu einer jungen Frau vor der Folie der politischen und wirtschaftlichen Erschütterungen der Epoche.
Der Mann ist Bankier, Hedonist und »Mann ohne Eigenschaften« (nicht umsonst heißt er Ulrich), der sich aus allem raushält – also das Gegenteil Wolffs. Sie, Gerda Rohr, ist politisch aktiv, brennt für die linksrevolutionären Bewegungen und hält seine Passivität nicht aus. Man kann in ihr Wolffs ehemalige Sekretärin, Ilse Stöbe (1911-1942), erkennen, eine Widerstandskämpferin und sowjetische Spionin, die von den Nazis hingerichtet wurde. Der Roman ist alles andere als ein Thesenstück, gar eine Sammlung von Leitartikeln: Er ist voller Schwung, ungewöhnlichen Formulierungen und atmosphärisch eine fulminante und genaue Schilderung dessen, was wir aus Babylon Berlin kennen – oder zu kennen glauben.
Wolffs Roman ist vieles zugleich: Liebesgeschichte, Sozialgeschichte, Porträt Berlins – man kann anhand der geschilderten Topographie die Wege der Protagonisten abgehen –, ein wehmütiger Nachruf auf die Weimarer Republik, Vorahnung des bevorstehenden Untergangs, Beschreibung des Lebens im Exil. Und das alles in einer Sprache, die mittels überraschender Bilder erzählt.
Über den Autor
Theodor Wolff war von 1906 bis 1933 Chefredakteur des »Berliner Tageblatts« und damit der einflußreichste Journalist der Weimarer Republik. Noch heute erinnert der Theodor-Wolff-Preis, der wichtigste deutsche Journalistenpreis, an ihn. Und im Theodor-Wolff-Park in Berlin ist die letzte Zeile seines letzten Artikels zitiert: »Geht hin und wählt!« Wolff emigrierte mit seiner Familie nach Südfrankreich, wurde aber im Mai 1943 in Nizza von italienischen Besatzungssoldaten verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert. Im Gefängnis Moabit zog er sich eine Krankheit zu, an der er am 20. November 1943 im Jüdischen Krankenhaus, Berlin, starb. Ilse Stöbe wurde im September 1942 verhaftet und am 22. Dezember in Plötzensee hingerichtet. An sie erinnert eine Gedenktafel vor dem Haus Frankfurter Allee 233 in Berlin.
Theodor Wolff
Die Schwimmerin
Roman aus der Gegenwart
Mit einem Nachwort von Ute Kröger
Weidle Verlag
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Weidle Verlag, Göttingen 2025
Wallstein Verlag GmbH
Geiststr. 11, 37073 Göttingen
www.wallstein-verlag.de
Der Weidle Verlag ist ein Imprint der Wallstein Verlag GmbH.
Die Originalausgabe erschien 1937 im Verlag Oprecht Zürich.
Offensichtliche Druckfehler im Original sind korrigiert, die Zeichensetzung wurde behutsam angepaßt.
Lektorat: Stefan Weidle
Korrektur: Kim Lüftner
Scan und Kollation: Madeline Bause
Einband unter Verwendung der Titelschrift des Originals von Harry Roth: Kat Menschik
Gestaltung und Satz: Friedrich Forssman
ISBN (Print) 978-3-8353-7534-5
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-7724-0
Inhaltsverzeichnis
I.
An einem Tage im Mai des Jahres 1918 ließ sich Ulrich Faber in seinem Schlafzimmer im Hotel den linken Arm neu verbinden, der in dem Kampfgewühl an der Westfront verwundet worden war. Der Granatsplitter hatte den oberen Armansatz getroffen, als Faber bemüht gewesen war, seinen verschütteten Kameraden, den Leutnant Lorenz Münch, aus dem zerschossenen Graben herauszuziehen. Der Arzt, ein eifriger, freundlicher Herr, war so erfüllt von seiner wissenschaftlichen Mission, wie die über den Jammertälern schwebenden Erzengel von der Gewißheit der göttlichen Gnade erleuchtet sind. Er erklärte mit mildem Ernst, das Ergebnis der Röntgenuntersuchung sei zwar nicht ganz ungünstig, aber auch nicht brillant. Auch der beste Spezialist könne in diesem Stadium nicht sagen, ob der Arm, erfreulicherweise der linke, ganz die frühere Kraft und Beweglichkeit wiedererlangen werde, aber man müsse dem Himmel dankbar sein, denn zwei Zentimeter weiter nach rechts wäre der Geschoßtreffer tödlich gewesen, da hätte die ärztliche Kunst aufgehört. »Daran sind wir« – er pflegte »wir« zu sagen, als ob er sämtliche Verwundungen mit erhalten hätte – »gerade noch glücklich vorbeigekommen.«
Während er vor dem Arzt stand, der den Arm einschiente, umwickelte und in die richtige Lage brachte, blickte Ulrich Faber in offenbar angenehmer Stimmung durch die offene Tür in den Salon, in dem die blonde Dina Holgers sich mit kleinen gymnastischen Übungen drollig die Zeit vertrieb. Immer wenn er ihre feinlinige Anmut betrachtete, bereitete ihm das ein ästhetisches, künstlerisches Vergnügen, und es war ihm klar, daß er sie mehr noch mit den Augen als mit jenen Sinnen genoß, von denen sonst in seinen Beziehungen ein starker Antrieb kam. Ulrich Faber, der neben dem schon recht baufälligen Seniorchef Friedrich Dönhoff das angesehene Bankhaus Dönhoff, die bedeutendste Berliner Privatbank, leitete, war jetzt 43 Jahre alt. Er war, mit seiner mittelgroßen, kräftigen Gestalt, mit Schultern, deren Zuverlässigkeit nicht durch Aufpolsterung vorgetäuscht wurde, und mit einem gebräunten Gesicht, dichten Augenbrauen, einer nicht absolut klassisch geformten Nase, einem ansehnlichen Mund, den ein kleiner, ein wenig abwärts gebogener Schnurrbart überwölbte, und einem Kinn ohne weichliche Fleischlichkeit keineswegs eine einwandfreie Männerschönheit, aber man spürte eine robuste Vitalität. Das volle, über der breiten, gutgemeißelten Stirn noch dunkle Haar begann an den Schläfen bereits zu ergrauen. Ziemlich häufig wurde – Schmeichelei oder Vorwurf – in seinem Gesicht ein ironischer Zug konstatiert, obgleich niemand sagen konnte, ob diese Ironie sich in seinen Augen oder in den Mundwinkeln verriet oder wo und wie sonst sie zu entdecken sei. Seine Haltung und seine Bewegungen hatten eine ruhige, natürliche weltmännische, auch durch die Behinderung des eingeschnürten linken Armes nicht beeinträchtigte Leichtigkeit. Diese sichere Gewandtheit des Auftretens hatte sich in dem Verkehr mit Menschen aus vielen Ländern noch entwickelt und wurde um so mehr bemerkt, da etwas doch auch an den schwäbischen Gastwirtssohn erinnerte, der gewiß recht anständige Flaschenkisten aus dem väterlichen Keller hätte herauftragen können.
Ulrich Faber war nicht, wie manche glaubten, ein Mitglied der berühmten Bleistiftfamilie, sondern, wie die besser eingeweihten Neider gern berichtigten, der Sohn eines Gastwirts bei Stuttgart, des Wirtes vom »Grünen Baum«. Dieser Gasthof war seiner ausgezeichneten Küche wegen allen Feinschmeckern der Gegend bekannt und ein beliebter Treffpunkt der lebenslustigen Gesellschaft gewesen, aber ein tragisches und ziemlich skandalöses Ereignis hatte den Kochkünsten, dem Vergnügen und gleichzeitig dem Dasein des Wirtes Faber ein Ende gemacht. Eberhard Faber war, noch als er die Siebzig schon überschritten hatte, ein großer und erfolgreicher Freund der Frauen. In einer Rauferei erschlug ihn mit einem Stuhlbein ein eifersüchtiger Ehemann, ein Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft. Der »Grüne Baum« büßte unter den späteren, solider wirtschaftenden Besitzern die Sympathien der Kundschaft ein. Ulrich Faber lebte bei seiner Mutter, bis er mit einem Stipendium aus einer englischen Stiftung, das ihm Gönner verschafften, als Student nach Cambridge ging. Ein anderes Stipendium ermöglichte ihm eine Studienreise nach Amerika. Er schrieb eine Broschüre über die Organisation der Arbeit, von der hervorragende Persönlichkeiten der Schwerindustrie ärgerlich sagten, sie sei im Grunde der reine Dilettantismus und in höchstem Grade anfechtbar. Viele fanden es unverständlich, daß dann der konservative Friedrich Dönhoff diesen Ulrich Faber in seine Bank nahm und ihm nach einiger Zeit sogar einen Hauptteil der Führung überließ. Der Abgeordnete Ammon, Syndikus des Westdeutschen Messing-Konzerns, pflegte denjenigen, die sich wunderten, zu sagen: »Das Publikum ist so sehr mit neuen halbwissenschaftlichen Wirtschaftstheorien und sozialen Problemen gefüttert worden – der alte Dönhoff will zeigen, daß seine Firma nicht erstarrt und sich neuen Ideen nicht verschließt –, darum hat er ihr dieses moderne Schmuckstück angefügt.«
Der alte erfahrene Dönhoff hatte sich Ulrich Faber aber nicht nur so geholt, wie manche schöngeistige Dame, um ihre Gäste zu unterhalten und zu verblüffen, einen echten Bolschewisten an ihre Tafel setzt. Er wollte auch nicht nur der Kundschaft mitteilen: »Wir offerieren Ihnen das Neueste auf jedem Gebiet.« Er hatte seiner Firma das ungewöhnliche Talent Fabers, Verhandlungen zu führen, sichern wollen. Auch in den Kreisen der Regierung erkannte man diese Begabung, und Ulrich Faber, der seiner Verwundung wegen nicht mehr zum Kriegsschauplatz zurückkehren konnte, wurde gerade jetzt wieder mit allerlei unbequemen wirtschaftlichen Aufträgen betraut. Besonders gefiel dem alten Bankier der nüchterne Skeptizismus, mit dem Ulrich Faber oberflächliche, tausendfach nachgeschwatzte Meinungen zersetzte, angebliche, niemals bis ans Ende durchdachte Wahrheiten entlarvte und sich von keinen Illuminationen der Phrase blenden ließ. Die Augen Friedrich Dönhoffs blinzelten behaglich, wenn Faber in einer Diskussion dem Herrn Schmidt, dem einen der beiden Direktoren, gegenüberstand. Der Alte konnte den Direktor Schmidt, diesen »bombastischen Feldwebel«, wie er sagte, nicht leiden, aber er hatte die Gelegenheit, ihn loszuwerden, verpaßt. Wenn Herr Schmidt, die Brust wölbend, über eine geschäftliche Angelegenheit Bericht erstattete, wurde eine Nationalhymne daraus.
Dina Holgers hatte ihre Freiübungen beendet und strich, vor einem Spiegel stehend, ihr helles mattgrünes Frühlingskleid glatt. Das Sonnenlicht, das durch das weitgeöffnete Fenster des Salons eindrang, umspielte die Falten dieses mattgrünen Kleides, betastete den Hals und das kleine rosige Ohr und veranstaltete Beleuchtungseffekte in dem blonden Haar. Es näherte sich auch dem Bild von Claude Monet, das neben dem Kamin hing, dem wehenden Kornfeld mit glutroten Mohnblumen – ganz ähnlich dem Bilde der Sammlung Caillebotte. Ulrich Faber fand, daß diese heitere und nicht brennende Maisonne um Dina Holgers die richtige Atmosphäre schuf. Er hatte Dina Holgers in Kopenhagen kennengelernt, als sie dort auf der Bühne die großen Rollen in den erfolgreichsten Operetten spielte, und sie war ihm einige Zeit später nach Berlin gefolgt. Sie hatte eine reizende, an der Spitze amüsant aufgebogene Nase, eine blonde Frisur, die auf Wunsch der Damen alle Haarkünstler kopierten, lange schmale Hände und ein auffallend feines, biegsames Handgelenk. Sie war graziös, immer gut gelaunt, nicht anspruchsvoll, und tadelte es, daß Faber bei den teuersten Schneiderfirmen für sie arbeiten ließ. Jetzt war sie der Star einer Berliner Bühne, aber sie hatte seit langem schon Anträge von Agenten und Filmgesellschaften in New York und Hollywood angenommen, und nur der Krieg war eine Entschuldigung für einen Aufschub, der sehr willkommen war. Sie hatte Faber gern, bei dem Gedanken an die Trennung huschte ein Schatten über die heitere Gegenwartsstimmung, und Faber empfand den Charme eines Liebesverhältnisses, das von dramatischen Zwischenfällen und beengenden Rücksichten frei war, in keiner Minute eintönig wurde oder wie abgestandener Wein erschien. Dabei wußte er, daß es noch etwas Stärkeres gab als die Gefühle, die sich in den übrigens niemals schwächlichen Umarmungen Dinas ausdrückten, und daß die Natur in manchen Frauen drängender strömte als in Dinas reizender Persönlichkeit. Aber die Erfahrung hatte ihn gelehrt, daß dieser unterirdische Trieb in den Frauen selten so mächtig und übermächtig ist, wie man es den Romanlesern erzählt. Wenn sie Medeen sind, oder auf andere Art die Tragödie der Leidenschaft aufführen, entstehen ihre Handlungen zumeist nicht aus dem unwiderstehlichen Bedürfnis, so zu lieben und geliebt zu werden, sondern aus der Verbitterung der Vereinsamten, aus dem Zorn über einen Wortbruch und aus verletztem Stolz, aus Rachsucht und Eifersucht. Gott sei Dank, Dina Holgers spielte nicht tragische, finstere Rollen und war auch, bei aller liebevollen Anhänglichkeit, kein »crampon«, wie man in Frankreich sagt. Einen Moment lang dachte Faber an eine andere – wahrscheinlich würde sie ihm heute noch begegnen –, und in diesem Augenblick fragte der Arzt: »Sie zucken ein bißchen ungeduldig, drückt Sie der Verband?«
Als sie jetzt aus dem Salon hereinkam, sah Dina Holgers zu, wie der Arzt dem kunstvollen Verband die letzte Vollendung verlieh. In ihrem Blick lag eine wohltuende Zärtlichkeit. Sie sagte: »Finden Sie es richtig, daß er morgen nach Amsterdam fahren will? Der Minister hätte auch einen anderen schicken können.« Faber tat beleidigt: »Offenbar findet er nicht wie du, daß ich leicht zu ersetzen bin.« – »Dummer Kerl!« Sie vollzog eine Drehung, die ihre Verachtung ausdrücken sollte, und trällerte das Lied aus der Nitouche: »Ach der Soldat, ach der Soldat, ach der Soldat war nur aus Blei!« Inzwischen steckte der Arzt, nachdem er sein Werk noch einmal anerkennend geprüft hatte, die alles kleidsam verdeckende schwarze Seidenbinde mit Nadeln fest. Er erklärte, auch er sei mit der Reise nach Amsterdam nicht ganz einverstanden, aber er habe schon, für alle Fälle, einen ihm befreundeten holländischen Chirurgen mit den nötigen Instruktionen versehen, und er selbst würde gewiß nicht imstande sein, Herrn Faber von der Erfüllung einer Pflicht, in einer offenbar wichtigen Sache, abzubringen.
»Glaubst du«, fragte sie, wie zur Revanche für seine Stichelei, den nun aus der hygienischen Behandlung entlassenen Faber, »daß dein Herr Lorenz Münch, den du gerettet hast, dir dankbar sein wird?« – »Nein, ich glaube es nicht.« Er antwortete, als ob er dazu den Schwurfinger hochheben wollte, mit einer scherzhaften Feierlichkeit. Aber man konnte aus dem Scherz auch heraushören, daß er im allgemeinen und in diesem besonderen Fall von der menschlichen Dankbarkeit nicht allzuviel hielt.
Der Arzt packte sein Handwerkszeug zusammen. »War dieser Lorenz Münch – es ist doch der Sohn des Philologen in Jena – nicht ein Theosoph oder sogar ein Anhänger von Schrenck-Notzing und all den unwissenschaftlichen Ideen?« – »Ja, und er wollte damals das ganze Bataillon dazu bekehren, nur nicht mich. Ich erschien ihm als ein ungeeignetes Objekt. Als wenn die Leute nicht schon genug marschieren mußten, predigte er ihnen auch noch die Seelenwanderung. Er ist ein wenig davon abgekommen, jetzt ist er ganz links. Er gehört zu den Menschen, die in jedem Jahr einen neuen Glauben oder ein neues Schlagwort brauchen, dagegen läßt sich nichts machen, und er ist immer überzeugt.«
Dina Holgers betrachtete aufmerksam eine Photographie, die eingerahmt an der Wand hing, das Bild eines breitschultrigen, hartknochigen Mannes mit einem stattlichen, dichten, nicht flockig wehenden Försterbart. »Ihr Vater?« fragte mit taktvoller Vermeidung neugieriger Zudringlichkeit der Arzt. – »Ja, er war der Gastwirt vom ›Grünen Baum‹.« – »Und er war über siebzig Jahre alt, als das geschah?« Auch diese Frage sollte nicht indiskret klingen. »Ja, er war über siebzig Jahre alt, als ihn ein eifersüchtiger Gutsbesitzer erschlug. Er liebte noch immer die Frauen.« Dina wandte sich zu ihm um. »Das kann dir auch passieren. Wenn du über Siebzig sein wirst.« Der Mediziner steuerte die Diagnose bei, die Vorbedingungen seien durchaus vorhanden, aber es brauche ja nicht so tragisch auszugehen.
Als der vielbeschäftigte Vertreter der Wissenschaft sich eben verabschiedet, dabei glückliche Reise gewünscht und noch betont hatte, daß der Chirurg in Amsterdam eine Kapazität sei, klingelte es in dem Telefonapparat auf dem Schreibtisch im Salon. Ulrich Faber unterbrach sehr schnell die Worte des Anrufenden: »Ich habe schon gebeten, mich zu entschuldigen, ich bin wirklich für solche Gelegenheiten total unbegabt. Direktor Schmidt wird gewiß eine sehr schöne Rede halten, er hat die warmen Töne, er versteht sich besser darauf. Ja – natürlich –, zeichnen Sie für mich, ganz gleich, wieviel, aber wie immer, damit der respektvolle Abstand gewahrt bleibt, etwas weniger als das, was Herr Dönhoff gibt.«
Mit einem leichten Wehen, ein paar lose Papierblätter auf dem Schreibtisch in Bewegung bringend, kam durch das offene Fenster der Frühlingswind. Drüben, jenseits des Fahrdammes, zog sich die Mauer des Zoologischen Gartens hin, unterbrochen von dem Tor mit seiner kindlichen Elefantenromantik, seiner Jahrmarktsdekoration. Zwischen den Bäumen, halb verdeckt durch das grüne Laubwerk, sah man einige der steinernen Tierhäuser, vergitterte Käfige, und man konnte auch einen Kranich erkennen, der steifbeinig, mit gemessenen, würdevollen Schritten wie ein Professor der Philosophie auf einer Rasenfläche spazierenging. »Eure Dönhoffs haben schönes Wetter für ihr Wohltätigkeitsfest. Du hast wohl reden sollen?« – »Jawohl. Das hätte noch gerade gefehlt. Herr Schmidt ist ergreifend, wenn er von Treue und Dankbarkeit spricht. Es ist seine Spezialität.«
Sie lachte: »Oh, du mußt nicht so tun, als ob die Treue nicht auch deine Spezialität wäre.« In ihrem lustigen Spott war kein Tropfen übelnehmender Mißbilligung. Ulrich Faber antwortete mit einem komischen Seufzer: »Du solltest mich lieber bedauern – es wird ein entsetzlich langweiliger Nachmittag werden, mir graut davor.« Er trat dicht an sie heran, ihre drollige Nase gefiel ihm in diesem Augenblick wieder ganz besonders, und ehe sie ihm ausweichen konnte, berührte er diesen anlockenden Gegenstand mit einem schnellen Kuß. Dina Holgers äußerte eine unwahrscheinliche Empörung: »Du benimmst dich unglaublich. Wie ein ungezogener Boy. Wenn die Haute Finance sehen könnte, welche Dummheiten du machst, würde dich keiner ernst nehmen.« Mit gespielter Würde und lehrhaft den Zeigefinger hebend, erwiderte er: »Nur diejenigen, die nicht aufhören, solche Dummheiten zu machen, nur die sollte man ernst nehmen.« Er umfaßte ihr schmales, biegsames Handgelenk, und während er nachsinnend ganz mit dem Studium ihrer feinen Knöchel beschäftigt schien, sagte er: »Wenn du nichts dagegen hast, hole ich dich vom Theater ab. Ich brauche heute abend, nach diesem festlichen Nachmittag, wirklich eine Entschädigung.« Dina Holgers lachte wieder, lustig und herzlich: er brauche immer eine Entschädigung, jeder Vorwand sei ihm recht. Aber er solle sie vom Theater abholen, es werde ihr äußerst angenehm sein. Aus ihrer zierlichen Handtasche nahm sie die Puderdose, und sie puderte sich das Gesicht, betupfte die ein wenig feucht gewordene Spitze der amüsant aufgebogenen Nase, während er, mit einer geheuchelt boshaften Miene, den kleinen Spiegel hielt. Dann gingen sie zusammen fort.
II.
Als Ulrich Faber in den Garten der Villa Dönhoff trat – einer noch im ruhigen Stil des vorigen Jahrhunderts gebauten Villa –, beendete gerade auf der Freitreppe des Hauses der stattliche schnurrbärtige Direktor Schmidt seine Begrüßungsrede: »... in ewiger Treue und Dankbarkeit.« Das Publikum, das ihm unten vor der Freitreppe zugehört hatte, bestätigte dieses Gelöbnis durch Händeklatschen und Bravorufe, und Direktor Schmidt zog die Brust, die er stark vorgestreckt hatte, wieder ein. Ungefähr wie man ein Segel refft. Es war ihm nur nicht möglich, den Bauch in gleicher Weise einzurollen. Herr und Frau Dönhoff – die immer bescheiden auftretende, im Alter noch zierliche Gattin des Bankiers war eine geborene Schlesinger, aber eine Amerikanerin, was dem Fall ein anderes Aussehen gab – hatten dieses Fest nur widerstrebend veranstaltet, denn sie hielten es für falsch und überflüssig, in einer Zeit, in der die Besitzenden mißgünstig benörgelt wurden, durch solche Schaustellungen aufzufallen. Aber der Sohn Erich, der jetzt Leutnant war, und die Tochter Dorothee, die sich trotz Krieg und perfidem Albion weiter mit englischer Aussprache »Dorothy« nannte, hatten ihnen erklärt, daß ein derartiger Akt der Wohltätigkeit, zu Gunsten der verwundeten Krieger und unter dem Protektorat der Kronprinzessin, der Firma nützliche Sympathien gewinnen müsse – und im übrigen würde man durch eine Einladung vielen Leuten eine Aufmerksamkeit erweisen und sich von allen lästigen Verpflichtungen befreien können. Herr Friedrich Dönhoff, durch dieses Argument überzeugt, hatte dann nur noch die Bedingung gestellt, es dürfe kein Wort, auch nicht die kleinste Notiz, in die Zeitungen kommen. Und die beiden Zimmer Dorothees im Erdgeschoß der Villa müßten an diesem unerquicklichen Nachmittag verschlossen bleiben, weil die Gäste nicht die Bilder der französischen Impressionisten zu sehen brauchten, die Dorothee mit Hilfe von Ulrich Faber gekauft hatte, und noch weniger den »Kuß« von Rodin, diese nackte Unanständigkeit.
Das Fest war begünstigt durch die Sonne, die warm und doch maienhaft milde auf die versammelte wohltätige Menge herunterschien. Sie beglänzte die grünen Rasenplätze, die roten Tulpen, die gelben Kieswege, die grau-weißen Wände des Hauses, die hellen Frühlingskleider der jungen Damen und das im Tageslicht fahle Gesicht des Tenors Strahlendorf vom Königlichen Opernhaus, der jetzt auf der höchsten Stufe der Freitreppe das Preislied Walter Stolzings sang. Aber noch erhebender als die Botschaft des himmlischen Lichtes waren die Nachrichten, die täglich über den Verlauf der Westoffensive eintrafen, diese ununterbrochenen Siegesmeldungen, die nun bewiesen, wie unbegründet, töricht und frevelhaft der Pessimismus der Kleinmütigen gewesen war. Diese Nachrichten mußten auch die aufgehetzten Massen, deren unterirdisch rumorende Unzufriedenheit sich schon spürbar gemacht hatte, zur Besinnung bringen. Freudig angeregt von der Gewißheit des nahen vollständigen Sieges waren zu dem Fest der Dönhoffs bekannte und unbekannte Persönlichkeiten aus allen besseren Berufskreisen und Ständen gekommen. Das diplomatische Korps, die Ministerien, die vielen im Kriege geschaffenen Behörden und Ämter, die Großindustrie, die hohe und die mittlere Finanzwelt und die Wissenschaft waren stark vertreten, sogar einige Künstler und ein Schriftsteller waren geladen, und die Anwesenheit zahlreicher israelitischer Bankdirektoren bewies die harmonischen Verhältnisse im kollegialen Geldverkehr. Man trug, ebenso wie am Abend den Smoking und das steife Oberhemd, die Toleranz. Eine Hofdame der Kronprinzessin, in Trauerkleidung und mit ihrer hohen unbiegsamen Gestalt gleichsam eine parallele Linie zu den Fichten des Hintergrundes, überbrachte die Grüße und Wünsche der Protektorin und sprach von ihrer erdrückenden Arbeitslast so schlicht, wie von einer Kleinigkeit. Eine hochbusige Oberin vom Roten Kreuz war majestätisch in dem strengen, aber bei hinreichender Schneiderkunst nicht unvorteilhaften Kleide der Samariterin und hatte jenen sanft beherrschenden Blick, der in den Lazarettsälen die Stöhnenden daran mahnte, daß es ruhmvoll und schön sei, in Walhall einzuziehen. Zwei Vorkämpferinnen einer würdigen Frauentracht waren in hemdartig herunterhängenden Hüllen erschienen, jedoch unterbrachen unterhalb der Brust künstlerisch verfertigte Gürtel die gerade Linie des Büßergewandes, so daß sich immerhin ein Vorhandensein von Körperformen ahnen ließ. Speisen oder Kuchen wurden nicht gereicht, denn es wäre nicht möglich gewesen, den in dieser Zeit sehr regen Appetit so vieler Personen ohne jede Gegenleistung zu stillen. Aber es gab Selterwasser, den in der eigenen Wirtschaft bereiteten Himbeersaft und sogar ein als »Pilsener« bezeichnetes Bier. Die meist sehr hübschen Freundinnen Dorothees flatterten durch den Park, verkauften Lose und steckten mit graziöser Dreistigkeit Blumen in die Knopflöcher zahlender Herren. Man hatte sie gebeten, die Geheimräte aus den Ministerien und die Vertreter der Armee und der Marine nicht zu geschäftstüchtig zu bedrängen, und hatte ihnen als geeignete Opfer ein paar Finanzgrößen gezeigt, die sie denn auch umsummten, wie die Wespen den Marmeladetopf auf dem Frühstückstisch.
Hinter dem Bierbuffet, das etwas entfernt von der Villa, jenseits der großen Rasenfläche aufgestellt war, sagte der Diener Christian Rohr zu seiner Frau, der alte Friedrich Dönhoff habe heute noch nicht gewagt, ihn anzusehen. Der Bankier Dönhoff, dem es vor kurzem gelungen war, seinen Sekretär, den unentbehrlichen Herrn Ahrens, vom Kriegsdienst zu befreien, hatte für den keineswegs jugendlichen Diener, der nur noch das »Gnadenbrot« aß, nicht das gleiche tun wollen. Darum sollte der friedliche Christian Rohr sich am Morgen nach dem Wohltätigkeitsfest auf dem Kasernenhof einfinden und abtransportiert werden, zum Kriegsschauplatz. »Solch ein Unglück, ich weiß, es ist aus mit mir, ich komme nicht wieder ... und die Gerda, das Kind!« Frau Rohr hatte die Ärmel der Bluse hinaufgeschoben, um sie beim Abspülen der Gläser nicht naß werden zu lassen, und die Sprache, in der sie antwortete, war hart und gänzlich unsentimental. Gar nichts wisse er, er höre ja nicht einmal zu, wenn man ihm klarmache, daß der Krieg so gut wie aus sei und daß er gar nichts mehr zu befürchten habe, und die Gerda habe er nur immer verwöhnt. Seine Schuld sei es, wenn sie sich manchmal benehme und aussehe wie ein Strolch. Er jammerte weiter: »Mir kann keiner etwas vormachen, der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Es ist mir ja auch nur um das Kind bange, die Männer werden ihr nachstellen, mir wäre es beinahe lieber, wenn sie nicht so hübsch wäre, ich würde ruhiger sein.« – »Vorläufig ist sie eine dumme Jöre, der laufen die Männer noch lange nicht nach. Und ich glaube, sie wird sich daraus auch nicht viel machen.« – »Ja«, sagte Christian Rohr ein wenig giftig, »wenn sie wie du wird, dann macht sie sich nichts daraus.«
Auf der Terrasse sang Strahlendorf:
»Auf hohem Berg, unnahbar euren Schritten,
Liegt eine Burg, die Monsalvat genannt.«
Eine Dame mit einem Hörrohr hatte ihren Stuhl so dicht an die Steinstufen herangerückt, daß die Töne aus dem Munde des Sängers gerade in die trichterförmige Öffnung ihres Instrumentes zu fallen schienen, und die Oberin vom Roten Kreuz vergaß für einen Augenblick die Leiden der Menschheit und stieg zu den reinen Gefilden des Heiligen Gral empor. Diejenigen Herren, die der Ansicht waren, Lohengrin brauche ihnen sein Geheimnis nicht mehr zu enthüllen und die Geschichte mit dem Vater Parsival sei ihnen bereits bekannt, lösten sich von dem musikalischen Teil des Publikums los und sprachen, durch den Garten promenierend, über die glänzende Kriegslage, die geschäftlichen Aussichten, die genialen Leistungen der Generale und die beklagenswerte Schwächlichkeit der Diplomatie. Der Abgeordnete Ammon, Syndikus des Rheinischen Messing-Konzerns, ging zwischen zwei Herren, die gelegentlich in wohlwollenden Zeitungen zu den »führenden Köpfen der Wirtschaft« gerechnet wurden, dem Kommerzienrat Werner aus Elberfeld und dem Bankier Jordan, dessen weißer Backenbart an den Bart des alten Kaisers Wilhelm erinnerte, den Eindruck altmodischer Solidität erweckte und Vertrauen schuf. Statt von dem Vater Parsival sprach der Abgeordnete Ammon von dem Vater Faber, der, wie er zu berichten wußte, in dem Hinterzimmer des »Grünen Baum« Orgien zu veranstalten pflegte, bis ihm dann der betrogene Gutsbesitzer mit einem Stuhlbein den Schädel zerschlug. Diese Erzählung amüsierte die beiden anderen Wirtschaftsführer sehr.
Herr Werner fragte, ob denn Ulrich Faber Fräulein Dönhoff heiraten werde, was Ammon bejahte, und der Bankier mit dem Kaiserbart meinte, gewisse Qualitäten habe Ulrich Faber ja, gute Manieren, eine Geschicklichkeit im Kombinieren und Überreden, sonst hätte ihn Friedrich Dönhoff auch nicht herangeholt. »Gute Manieren haben wir alle«, konstatierte der Kommerzienrat, »da hat keiner was von uns voraus. Mir ist er unsympathisch, in meinen Augen ist er eine sehr überschätzte Nummer, Leute, die ebensoviel und mehr als er können, gibt es in Deutschland massenhaft.« Der Abgeordnete betonte, man müsse immer objektiv sein, ganz ohne Talent sei Faber nicht, und es sei nur skandalös, daß die Regierung ihn jetzt für allerhand Missionen verwende und zu Finanzberatungen hinaussende, von denen er weniger als andere verstehe, aber man werfe jetzt mit Reisespesen verschwenderisch herum. Als der Bankier Jordan noch bemerkte, Faber müsse doch schon erheblich über die Vierzig sein, mehr als doppelt so alt wie Dönhoffs Tochter, erklärte Herr Werner mit vielsagendem Lächeln, junge Mädchen hätten darüber ihre eigenen Ansichten und die Zahl der Jahre sei kein Hindernis. Auf die Frage des Herrn Jordan, ob Ulrich Faber wirklich den Sohn des Jenenser Philologen Münch aus dem Trommelfeuer herausgetragen und dabei seine Verwundung erhalten habe, entgegnete der Abgeordnete Ammon, es würden jetzt soviel Heldentaten erzählt, die sich nicht nachprüfen ließen, und jeder – diesen Einfall brachte er mit feiner Pointierung vor – sei heute sein eigener Homer.
Dann machte der Kommerzienrat die anderen Herren darauf aufmerksam, daß er vorhin hier im Garten ein vorzügliches Bier getrunken habe – er würde gern herausbekommen, wie sich Dönhoff das noch verschaffe, und es wäre geradezu eine Sünde, sich einen solchen Genuß entgehen zu lassen. Die anderen sahen das ein, und man begab sich dorthin, wo unter der Obhut des Dieners Christian Rohr und seiner Frau das Faß mit dem »Pilsener« lag. Unterwegs fragte der Abgeordnete Ammon in scherzhaft listigem Ton den Kommerzienrat: »Und wenn nun der Friede über Nacht kommt – ich nehme an, die Werner-Werke haben ihre Vorbereitungen getroffen, um sich gleich wieder auf die freilich weniger lohnende Friedensarbeit umzustellen?« Der Chef der Werner-Werke entgegnete in gleichem Ton: »Wir sind immer auf alles vorbereitet, für uns gibt es keine Überraschungen. Mein Wahlspruch ist der des Marschalls Blücher: ›Vorwärts!‹, in Elberfeld in meinem Büro hängt er über meinem Schreibtisch an der Wand.«
Als sie bei dem Bierbuffet angelangt waren, hob der Erbe des Blücherschen Wahlspruchs das gefüllte Glas, das ihm Frau Rohr reichte, und trank »auf den Einzug in Paris«. Alle hoben mit strammem Zeremoniell ihre Gläser bis zur Höhe der Halskragen und leerten sie dann ernst und gewissermaßen feierlich. In diesem Augenblick kam Ulrich Faber vorbei. Er begrüßte im Vorübergehen die drei Herren, sie hielten ihn freundschaftlich fest, erkundigten sich nach seinem Befinden und luden ihn herzlich, aber vergeblich zum Mittrinken ein. »Es ist eine große Zeit«, sagte der Kommerzienrat Werner so bedeutungsvoll zu Faber, als drückte er ihm mit einem Segensspruch diese ganze Zeit ans Herz. »Ja, nicht wahr, und ein großes Geschäft.« Eben als Faber diese Worte ausgesprochen hatte – ohne bestimmte Betonung, so daß man im Zweifel sein konnte, wie sie gemeint waren –, sah er Dorothee Dönhoff, die quer über den Rasenplatz kam. Er verabschiedete sich von den Herren mit jener etwas eiligen Liebenswürdigkeit, die im Verkehr mit guten Freunden gestattet ist. Während er ihr entgegenging, sagte der Kommerzienrat bedeutungsvoll: »Aha!« Der Abgeordnete Ammon erledigte den Fall mit einem Achselzucken, das ebenso viel Abneigung wie Gleichgültigkeit bewies.
Als Dorothee Dönhoff vor Faber stand, hielt sie ihm mit einer lächelnd gespielten Wichtigkeit ein winziges Päckchen hin. »Ihr Lotteriegewinn, ich habe ihn für Sie herausgesucht – Schokolade, heute etwas sehr Kostbares –, natürlich haben Sie es nicht selber abgeholt, das war Ihnen zu unbequem.« Er nahm das Päckchen und bedankte sich. Dorothee Dönhoff war schlank und schmal, die mattgelbe Farbe ihres Musselinkleides paßte, in wirksamer Gegenüberstellung, zu ihrem schwarzen, weichgewellten Haar, und ihre ungleichen Augen – das linke war ein wenig schräger gelagert als das rechte – hatten eine Zeitlang, im Beginn der Bekanntschaft, Eindruck auf Ulrich Faber gemacht und hätten ihn zu entscheidenden Erklärungen verleiten können. Aber er liebte seine Unabhängigkeit. Und Dorothee Dönhoff war das elegante, reiche Berliner Mädchen mit dem kunterbunten Bildungstrieb und den kleinen Talenten, und diese intellektuellen jungen Damen waren für sein Empfinden so wenig anregend, wie die edelgezüchteten Tulpen auf dem Rasenbeet. Da er bemerkte, daß die drei Herren am Bierbuffet beobachtend herüberblickten, sagte er: »Wenn es Ihnen recht ist, gehen wir ein Stückchen weiter, wir stehen hier wie zwei Gartenfiguren, übrigens sehr dekorativ.« Sie wollte wissen, was für Figuren er meine, und er antwortete: »Caritas, die den verwundeten Krieger mit Schokolade erquickt.« Sie bogen in einen Seitenweg zwischen den Himbeersträuchern ein. »Haben Sie«, fragte er, »Nachricht von dem Rittmeister, von Herrn Markgraf? Er ist noch in den Argonnen?« – »Eine Feldpostkarte, er siegt unablässig, es geht ihm gut.« – »Glücklicher Rittmeister, der unablässig siegt!« Sie erzählte ihm von den Vorträgen, die sie in den letzten Tagen gehört hatte, von einem über Nietzsche und einem anderen über den Grecco, und sagte, daß ihr die italienische Malerei lieber sei als die spanische, denn selbst wenn bei den Italienern gemartert und gekreuzigt werde, sehe das nicht so düster wie bei den Spaniern aus. Als sie fragte, ob sie Karl Marx lesen solle, tat Faber entsetzt: Was soll aus der Firma Dönhoff werden, wenn Marx auch dort schon eindringen darf? Und in ihrem Kopf, diesem netten schmalen Kopf, dachte er, hat sie für jede Sache, mit der sie sich so gründlich beschäftigt, ein eigenes Fach. Wie die Schalter in der Bank des Papas.
In ziemlicher Entfernung von ihnen, auf einem breiten, sauber gehaltenen Kiesweg, begleitete Friedrich Dönhoff, kurz, beleibt und asthmatisch, mit einem dicken weißen Schnurrbart unter der knolligen Nase und leuchtender Glatze, die Hofdame zu dem grauen, kriegsmäßig trotzigen Auto, das wartend vor der Gartentür stand. Die Hofdame hatte sich sehr freundlich von Frau Dönhoff verabschiedet, die nach allgemeiner Ansicht den seelischen Kummer über das kriegerische Vorgehen ihrer amerikanischen Heimat wirklich sehr würdig trug. Ungemein bedauerte sie, daß es ihr nicht vergönnt sei, länger in diesem herrlichen Garten und bei diesem mit so viel Liebe und Geschmack organisierten Fest zu verweilen. Aber in Potsdam war soviel zu tun, was sich nicht aufschieben ließ. Auch der ehemalige Gesandte mit dem lockig in den Nacken herabfallenden weißen Haar und der immer noch blond beschimmerte Historiker Preußens strebten frühzeitig dem Ausgang zu. »Es ist entsetzlich«, sagte der Historiker, »sie alle haben den Sieg schon in der Tasche, und es ist doch nur ein vergeblicher Heldenkampf. Ein unerhörter, beispielloser Heldenkampf, alles, was früher einmal war, bleibt weit dahinter zurück.« – »Wahrscheinlich war es«, wendete der weißhaarige Diplomat ein, »immer so ziemlich das gleiche, seit die Menschen sich gegenseitig totschlagen, und der Unterschied liegt weniger in der Qualität als in der Quantität.« Von der Terrasse der Villa her folgten ihnen die Schmettertöne des Sängers Strahlendorf. Er sang jetzt »Winterstürme wichen dem Wonnemond«. Friedrich Dönhoff, der zurückkam, begrüßte den Diplomaten und den preußischen Geschichtsschreiber im Vorübergehen. Während er an der dichten Wand von Buchen, Birken, Flieder, Rotdorn und exotischem Gebüsch entlangschritt, die man, wie eine Kulisse, vor den dürren märkischen Kiefern aufgebaut hatte, pustete er kurzatmig und wischte sich mit dem Taschentuch Schweißperlen von der Stirn. Flüchtig blickte er mit den kleinen, zwischen den Fleischfalten eingeklemmten Augen dorthin, wo hinter dem Bierbuffet der Diener Christian Rohr grollend zu ihm hinüberschielte, und obgleich er sich keinen Vorwurf zu machen brauchte, hatte er ein peinliches Gefühl.
Vier junge Mädchen warteten mit den Sammelbüchsen in der Hand auf Dorothee. Ihre hellen und in dem Luftzug wehenden Kleider waren »fußfrei«, was in dieser Kriegszeit die Erinnerung an die schnell schreitende Siegesgöttin von Samothrake wachrief, aber jene höhere Anmut war noch verdeckt, die erst später sichtbar werden sollte, als die Verwilderung der Friedensjahre begann. »Meine Freundinnen werden schon ungeduldig«, sagte Dorothee, »sie wollen Kasse machen, hoffentlich haben sie recht viel eingenommen. Dort kommt ja auch Ihr Freund Lorenz Münch, er sucht seinen Lebensretter, also auf Wiedersehen!« Sie eilte fort, vermutlich ein wenig enttäuscht von der Unterhaltung, die hastige Bewegung ihrer Füße in den hübschen Silberschuhen drückte Abkehr und Unzufriedenheit aus.
Ein Offizier, ziemlich groß und in einer Felduniform, die seiner abgemagerten Gestalt zu weit geworden war, schritt langsam heran. Jeder, der Lorenz Münch sah, mußte sich sagen, daß er wohl eine ernste Krankheit kaum überwunden habe – noch vor kurzem war er vermutlich, zwischen den verordneten Liegestunden, so in dem Garten eines Krankenhauses oder eines Sanatoriums herumgegangen. Die länglichen Gesichtsflächen zu beiden Seiten der riffartig scharfkantigen Nase hatten Senkungen und Falten, und über den dunklen Augen trat der Stirnknochen hart hervor. Auch ohne diese Spuren der Fiebertage hätte der Leutnant Münch wenig Ähnlichkeit mit dem glatten und unbeschwerten Normaltyp des preußischen Reserveoffiziers gehabt. Schon das in gewellten Strähnen auseinanderstrebende, sehr dunkle Haar eignete sich nicht für eine gescheitelte Leutnantsfrisur. »Wann ist die Hochzeit?« fragte er zur Begrüßung in einem Ton, der spöttisch und mürrisch klang. »Welche Hochzeit? Ach so, man sagt es ... dummes Geschwätz! Aber dieses Vergnügen am Tratsch rottet kein Weltkrieg aus.«
Lorenz Münch hatte Fräulein Graff besucht. Aus einem Liebesverhältnis mit Edith Graff, einer Kunstgewerblerin, hatte Ulrich Faber einen jetzt vier Jahre alten Sohn. Seit einiger Zeit lebte Fräulein Graff zusammen mit dem Maler Steinhausen, und Lorenz Münch, der mit diesem nicht sehr bedeutenden Künstler befreundet war, sah sie ziemlich oft. Als Faber fragte, wie er den Jungen gefunden habe, antwortete Münch, er verstehe nichts von kleinen Kindern, aber da Faber seinem Sohn vieles schicken und verschaffen könne, was andere Kinder jetzt entbehren müßten, so gedeihe er sicherlich gut. Dann, mit der Hand zu dem Platz vor der Villa hindeutend, wo nun immer mehr Gäste sich dankerfüllt von dem Ehepaar Dönhoff verabschiedeten: »Das Vergnügen scheint ja zu Ende zu sein. Dieser Genuß ist mir entgangen. Ist das nicht eine Schamlosigkeit – in dem entsetzlichen Trommelfeuer da draußen sterben wieder Hunderttausende, und hier läßt man sich den Siegfried oder den Tristan vorsingen, man amüsiert sich, und man spricht von Patriotismus, wenn man ein paar Mark in die Büchse wirft.« – »Ja, die schönsten Worte müssen dazu herhalten, um die schäbigste Gesinnung zu verdecken, aber das ist, glaube ich, das gleiche überall.« – »Und diese Schmarotzer behaupten, sie seien die Elite der Intelligenz. Aber wir werden Schluß machen mit dieser ganzen Schweinerei, wir werden alles gegen sie aufrufen, was leben will, und auch die Toten, die Hingemordeten in den Gräbern.«
Er sprach mit einer nervösen Heftigkeit, aber der Klang seiner Stimme war auch in der Überreiztheit nicht brüchig und keineswegs unangenehm. Bisweilen waren die dunklen tiefliegenden Augen unter der wie ein Mauersims knochig vorstehenden Stirnplatte starr geradeaus wie auf ein fest erfaßtes Ziel gerichtet, dann wieder waren sie auf den Boden gesenkt, als sollte er durchbohrt werden, und häufig irrte der Blick, an Faber vorbei, unruhig umher. Er ist noch verdammt mit seinen Nerven herunter, dachte Faber, aber wenn er gesund wird, kann sich sein Rednertalent entwickeln, daß er reden kann, hat man ja auch schon im Schützengraben gemerkt – nur hat er damals nicht ganz so gesprochen wie jetzt.
»Eigentlich«, sagte er, »ist es merkwürdig, daß Sie ein solcher Pazifist und ein solcher Radikaler geworden sind. Sie hatten die Kriegsbegeisterung, die mir fehlte. Ich glaube nicht, daß Sie an Völkerversöhnung dachten, als Sie – ich sehe es noch vor mir – den eingedrungenen Franzosen niederstachen. Sie hatten einen fabelhaften militärischen Ehrgeiz. Und außerdem waren Sie Theosoph.«
»Es ist ganz falsch«, entgegnete Lorenz Münch, »wenn Sie zwischen den Teilen einer Gedankenwelt nur Widersprüche, unüberbrückbare Gegensätze sehen wollen. All das, der Glaube an das Überirdische, das mit unseren Sinnen nicht faßbar ist, und der unerschütterliche Wille, den Massen ein irdisches Glück zu schaffen, die Kriegsbegeisterung und die Idee der Völkerverbrüderung kommen aus der gleichen Quelle, aus dem Idealismus.«
»Ja, da kann vieles herausfließen. Aber die Quelle ist schön.«
»Wünschen Sie etwa, daß die Welt immer so bleiben soll?« – »Nein, ich wünsche das nicht. Eine Sintflut wäre gar nicht so übel. Aber in der Arche würden immer wieder dieselben Menschen mit denselben Instinkten und dieselben Leidenschaften, Gemeinheiten und Scheußlichkeiten sich auf die trockene Erde hinüberretten. Als in London und in Hamburg die alten Stadtteile niederbrannten, sagte man, das habe sein Gutes, die abscheulichen Pesthöhlen seien zerstört. Ich fürchte, der Weltkrieg hat nicht das gleiche Resultat.«
»Mich wundert nur«, begann Lorenz Münch wieder, ohne Faber anzusehen, »daß es Ihnen möglich ist, mit diesen Leuten zu arbeiten, mit ihnen und für sie. Sie stützen diese Gesellschaftsordnung, über die Sie doch genauso denken wie ich. Sie sind sehr klug, aber kalt.«
»Ich besitze nicht Ihr beneidenswertes Talent – das Talent, sich und gewiß auch ein ganzes Publikum fortzureißen. Was wollen Sie, ich bin ein Antipathetiker. Manchmal denke ich sogar, daß das pathetische Wort der schlimmste Feind der Menschheit ist.« – »Sie werden den Anschluß versäumen.« – »Kann sein. Aber muß man denn immer in den nächsten Zug steigen, der abfährt?«
Aus den ausgedehnten Dönhoffschen Zonen, die halb Garten und halb Wald waren, kam man zu dem baumlosen Gebiet, in dem nicht der ästhetische Sinn die Dinge gestaltet hatte, sondern nur der wirtschaftliche Zweck entschied. Rechts stand das Haus des Dienstpersonals, ein Stückchen weiter das lange niedrige Gebäude mit den jetzt vermutlich ausgeleerten Stallungen, Remisen und Garagen, zur Linken hatte man die Gemüsefelder und das Treibhaus, und am Ende dieses ungefähr quadratischen Hofterrains sah man die Mauer mit einem breiten Tor. Als Faber und Münch den Rand des Wirtschaftshofes erreichten, hörten sie einen Stimmenlärm. Es klang nach einem nicht sehr gefährlichen Kampfgetümmel, mit Gelächter und Gekreisch. Ein kleines Mädchen rang mit einem etwas größeren Jungen, der sich, durch die Gebote der Ritterlichkeit gehemmt, nur scherzhaft und unzulänglich verteidigte und infolge seiner galanten Bedenken in eine schwierige Situation geriet. Die Angreiferin vergalt seine schonungsvolle Taktik mit wilden Püffen, drängte ihn zurück, kämpfte ganz rabiat. Obgleich sie noch ein Kind war, lag schon sehr viel Kraft in ihrem gutgeformten Körper, ihre Glieder waren gelenkig, sie preßte sich zornig gegen den etwas verlegenen Ritter, boxte ihn mit den Fäusten, stieß ihn auf eine drollig rücksichtslose Art mit dem rechten Knie. Ein dichter blondbrauner Haarschopf pendelte auf dem Nacken hin und her, und wenn sie den Kopf zur Seite drehte, sah man ein erhitztes hübsches Gesicht. Zwei Zuschauer, beide ungefähr in dem gleichen Alter wie der bedrängte Kamerad, beobachteten aus nächster Nähe das Turnier. Der eine war lang, weißblond und blaß, mit einem von dem schlechten Ersatzbrot verursachten pickligen Ausschlag und ganz wie der Kämpfer in einem abgeschabten, geflickten und zu kurz gewordenen Anzug, während der andere eine stämmige Figur und harte Züge hatte und in unbeschädigter Kleidung – mit einem blechernen Anker, offenbar einem sportlichen Abzeichen, auf der Jacke – und soliden Stiefeln neben dieser Dürftigkeit beinahe geckenhaft erschien. Gerade in diesem Augenblick rief der Stämmige: »Halt sie mal fest, halt das kleine Biest einmal fest!« und trat mit einer bösen Lust, sich einzumischen, an die Ringenden heran. Der so Angespornte, ein wenig unentschlossen und dann doch dem Befehl gehorchend, umschlang seine Gegnerin, so daß sie die Arme nicht rühren konnte, und als sie so gefesselt war, versetzte ihr der Bursche, der den Rächer und Schiedsrichter spielte, mit der Fläche einer groben und großen Hand, als passende Zielscheibe die zurückgestreckte körperliche Rundung benutzend, einen derben, schwer klatschenden Schlag. Sie versuchte, sich umzuwenden, und schrie: »Du Schuft! Du Schuft! Du Schuft!« Er brüllte: »Du kleines Biest, da hast du deine Strafe!« und schlug, brutal und wie von der Freude des Züchtigens besessen, noch einmal zu. Der Blasse mit der pickeligen Haut rief beschwörend: »Laß sie doch los, das ist gemein!« Lorenz Münch, der jetzt dicht bei der kämpfenden Gruppe stand, packte den Bengel, der schon wieder, um über einen empfangenen Fußtritt zu quittieren, zum Hieb ausholte, an der Schulter, aber seine Hilfe wurde nicht mehr gebraucht. Denn der Kleinen gelang es bereits, sich loszustrampeln und sich der Umklammerung zu entwinden, aus der sie der braunhaarige Ritter, beschämt und voll Schuldgefühl, bereitwillig entließ. Mit einem boshaften Seitenblick ging der Raufbold, um die Fortsetzung des Vergnügens gebracht, absichtlich langsam und pfeifend zu dem Hoftor, öffnete es und verschwand. Sein Opfer, rotglühend vor Wut und von der Anstrengung, brachte mit einer schüttelnden Kopfbewegung den Haarschopf wieder in die richtige Lage und lief zu dem Brunnen beim Spargelbeet. Unterwegs sah sich die Kleine zweimal nach den beiden Herren um, die sich von dem Fest bei Dönhoffs hierher verirrt hatten, und als sie sich gewaschen, gekühlt und mit dem Taschentuch abgetrocknet hatte, und mit einem Kamm, den sie vornehm aus einer Hülse zog, durch das widerspenstige Haar strich, lugte sie, mehr neugierig als wohlwollend, zu ihnen hin. »Das war ein nichtswürdiger Bursche«, sagte Münch, während sie den Rückweg antraten, »ein gefährliches, vielversprechendes Produkt des sozialen Sumpfbodens.« – »Er hat sich«, entgegnete Faber, der während der ganzen Prügelszene keine Teilnahme gezeigt hatte, »hier einstweilen nur geübt – Training –, jedenfalls war es schön, daß Sie der Gerechtigkeit zu Hilfe gekommen sind.«
Sie durchquerten wieder den Garten und gerieten zwischen die Menge derjenigen, die ebenso wie sie zum Haupttor gingen. An einem Tisch unter den Lindenbäumen blieben nur noch der Leutnant Dönhoff und einige jüngere Damen und Herren. Eine Dame, die zwischen Erich Dönhoff und dem schwedischen Gesandtschaftsattaché saß, erhob sich, erklärte, daß es kühl geworden sei, und verabschiedete sich mit einer für alle bestimmten Handbewegung, obgleich der Leutnant lebhaft protestierte und versicherte, es sei eine tropische Hitze und jetzt sollte das Vergnügen ja erst beginnen. Von Frau Helene Martius, der Gattin des Legationssekretärs Martius, der in Brüssel beim Generalgouvernement des besetzten Gebietes arbeitete, wurde in ihren Kreisen behauptet – wie freilich auch bei Gelegenheit von anderen Damen –, daß sie die Frau sei, die sich am besten anzuziehen verstehe, und da sie wirklich dieses Talent besaß, tadellos gewachsen war und sich mit souveräner Sicherheit bewegte, wurde sie bei allen gesellschaftlichen Ereignissen, namentlich auch bei den Empfängen in den Botschaften, sehr umschwärmt. Sie sagte dem schwedischen Attaché, der ihr den Mantel nachtrug, dankbar lächelnd, daß sie nur rasch eine geschäftliche Sache, Angelegenheit ihres Bankkontos, erledigen wolle, und erwartete den herankommenden Faber, dessen Rat allen Kunden und Kundinnen der Dönhoff-Bank wertvoll war. Münch trat zur Seite – sie dankte auch ihm mit einem liebenswürdigen Lächeln, wobei sie mit einem rasch gleitenden Blick eine Musterung seiner Person vollzog.
»Du hast mich«, sagte sie zu Faber, »hier noch kaum begrüßt. Ich weiß, du bist diskret. Warum bist du gestern nicht zum Tee gekommen? Ich habe dich erwartet. Du machst dich rar.«
»Ich bitte dich um Verzeihung, aber ich glaube, es war nichts verabredet. Obgleich die Leute schon herstarren, muß ich dir sagen, daß du fabelhaft aussiehst, und das Kleid – wirklich, nur du hast soviel Geschmack.«
»Danke. Spar dir deine Komplimente für Dina Holgers auf! Ist das dein Freund dort, dem du deinen verwundeten Arm verdankst? Stelle ihn mir vor!«
Faber winkte Lorenz Münch heran, dem Frau Martius erklärte, sie habe allerlei von seinen Kriegserlebnissen und seiner Tapferkeit gehört. Der Himmel habe ihn behütet, denn es sei doch ein großes Wunder, daß er dem Tode entronnen sei. Münch erwiderte, ohne Herrn Faber, der sich beinahe für ihn geopfert hätte, wäre er nicht entronnen. »Gewiß, aber der Himmel tut doch immer das Eigentliche, die Menschen sind für Wunder zu schwach.« Sie machte dem jungen schwedischen Diplomaten ein Zeichen, daß das Gespräch beendet sei, Faber küßte ihr die Hand, Münch verneigte sich, und nachdem sie sich in ihren Mantel gehüllt und an der Gartentür noch einmal mit einem Lächeln zurückgegrüßt hatte, schritt sie hinaus.
Lorenz Münch erklärte, er wolle in der Gegend hier einen Besuch machen und komme nicht mit in die Stadt. Faber, der allein den Heimweg antrat, stieß auf eine Schülerabteilung, die mit ihrem graubärtigen Lehrer müde trottend aus dem Grunewald nach Hause zog. Fast alle Knaben waren dünn, unterernährt, und die fleischlosen Arme mit den vortretenden Knöcheln hingen weit aus den Ärmeln heraus. In den ersten Kriegsjahren war es bei der Rückkehr von solchen Schulausflügen ein Marschieren im Takt gewesen, in soldatischer Haltung und mit hellem, allen Feinden Deutschlands trotzendem Gesang. Heute bewegte sich der Zug schleppend, trippelnd, stolpernd, ungeordnet und ohne Lieder vorwärts, und der graubärtige Klassenlehrer, ein kleiner, von Sorgen bedrückter Mann, hatte es aufgegeben, seine Schar anzufeuern, und schien nur mechanisch der Schüssel mit den aufgewärmten Kohlrüben entgegenzustreben, die auch bei ihm alltäglich der Inbegriff der Lebensfreude war. Dort, wo sich nicht mehr ein Villengarten an den anderen reihte und statt der dunklen Fichten die durchaus unpoetischen hohen Mietshäuser aufragten, wurde die Straße belebter, Portiersfrauen saßen vor den Haustüren, Spaziergänger genossen die Abendkühle, Chefs und Angestellte kamen aus den Büros, ein Häuflein Publikum verließ ein Kino, dessen buntes Plakat einen aufregenden Detektivfilm und bildliche Berichte über die Taten der U-Boote versprach. Als Ulrich Faber in der Nähe des Bahnhofes bei einem Tanzlokal, einem Tanzgarten, angekommen war, trat er ein. Der schiefschultrige Klavierspieler hämmerte wie immer auf die Tasten, aber nur wenige Tanzpaare schoben sich, dem Rhythmus dieser Töne folgend, über die splitterig gewordene Holzdiele, und auf den Geschäftsgang, der vor einigen Wochen noch blühend gewesen war, hatte der Beginn der Offensive im Westen, hatte die schleunige Abberufung fast aller »Urlauber« äußerst nachteilig gewirkt. In Abwesenheit der jüngeren Generation beherrschten zwei dickbäuchige, protzige, wie Hähne sich aufpustende Häuptlinge des verbotenen Lebensmittelhandels – Leute, die gewohnt waren, auf jede Weise vom Kriege zu profitieren – den armen Hühnerhof und benahmen sich dabei so ungeniert wie reiche Käufer auf dem Sklavenmarkt. Sie hatten sich die beiden nettesten Mädchen ausgesucht, gaben ihnen zu trinken, befühlten sie, umarmten sie und schleiften sie, schwitzend und klobig, im Tanze herum. Faber betrachtete die eine der beiden Tänzerinnen, die ein sehr angenehmes blasses Gesicht hatte und ersichtlich einen Widerwillen empfand, wohl auch an ihren fernen Freund dachte, wenn der triumphierende Schleichhändler sie fest gegen seinen feisten Bauch drückte und sie dabei mit den wulstigen Fingern kniff. Aber sie war wahrscheinlich ohne Arbeit, die zu Hause hungerten, der erfahrene Lebemann hatte mit dem Geld in der Hosentasche geklimpert und, die Verführungskunst bis zur Vollendung steigernd, mit schlauem Augenblinzeln versichert, diejenigen, die ihm gefällig seien, erhielten von ihm Schinken und Wurst. Faber versöhnte den Kellner, der ihm schon zum zweiten Male einen Tisch anbot, durch ein Markstück und ging fort. Ja, der Krieg verschlang allerhand Opfer, die keine Statistik berücksichtigen wird.
In den Bahnhof war ein Zug eingefahren, der rußige Qualm der Lokomotive quoll aus der tiefen Schlucht, auf deren Boden die Geleise lagen, zur Straßenhöhe hinauf. Männer und Frauen mit Körben, Bandtaschen, Koffern, Rucksäcken und Säcken traten aus der Halle des Stationsgebäudes ins Freie, dann teilte sich die Menschenkarawane, die bepackten Pilger wanderten nach verschiedenen Richtungen hin, und bisweilen blieben sie stehen, um einen Augenblick lang zu verschnaufen und auszuruhen. Sie waren bei Verwandten oder bei befreundeten Bauern auf dem Lande gewesen und hatten Kartoffeln, Rüben, vielleicht sogar noch ein wenig Speck geholt.
Faber kam an einer Familie vorbei – Vater, Mutter, kleiner Sohn und kleine Tochter –, die ihre Säcke und Koffer müde auf das Pflaster gesetzt hatte und hier an der Straßenecke stand wie ein viermaliger Beweis für die Wirkungen einer konsequent durchgeführten Entfettungskur. Als Faber die Gesichter der Kinder sah, fiel ihm die Schokolade ein, die ihm Dorothee gegeben hatte, und er reichte sie dem kleinen Knaben hin. Der Junge hatte einen fragenden, ungewissen, verständnislosen Blick, zeigte das flache Päckchen den Eltern und der Schwester, der Vater nickte nur, niemand sagte danke, alle vier betrachteten den fremden Herrn mißtrauisch, frohere Empfindungen regten sich anscheinend nicht. Offenbar, sagte sich Faber, haben die Eltern mich für einen Einbrecher gehalten, oder für einen Lebensmittelschieber, der sie mit der Polizei in Konflikt bringen kann.
Die Fahrstraße war, so weit man die lange, gerade Strecke überblicken konnte, verödet und leer. Wagen der Elektrischen fuhren noch, in großen Zwischenräumen, knirschend und klappernd infolge der Materialabnützung und der Überlastung, immer wahnsinnig überfüllt. Die Schaffner und Wagenführer waren durch Frauen ersetzt worden, die in dem entsetzlichen Gedränge mit einer verzweifelten Tapferkeit todmüde, zerbeult und vor Erhitzung dampfend den Dienst versahen. Jede Spur einer weiblichen Anmut mußte durch die Uniform, die man ihnen aufgehängt hatte, vernichtet werden, durch den Rock aus grauem, hartem, dickfilzigem Stoff, die barbarische dunkle Bluse und die von den Männern zurückgelassene Mütze, unter der, wie Regenwasser aus einer Dachtraufe, der Schweiß an der Gesichtsfassade herunterrann. Auch die Straßenkehrer waren auf dem Schlachtfeld, und weibliche Wesen, die früher nur die Stube und die Küche fegten, säuberten jetzt mit dem Besen den Bürgersteig und den Damm. Diesen Dienerinnen der öffentlichen Sauberkeit hatte man weite dunkle und unbestreitbar hygienische Hosen verliehen.
Die Gedanken Fabers gingen, als die Schaffnerinnen und Straßenkehrerinnen in filzig grauen Uniformen und den weiten Hosen vorüberkamen, in einer jener plötzlichen Seitenschwenkungen und Anknüpfungen, die sich im Gehirn vollziehen, zu der Frau zurück, die sich am besten anzuziehen versteht. Unter dem Eindruck des Kontrastes verstärkte sich noch das ärgerliche Unbehagen, das Faber empfand. Frau Martius hatte nichts von dem Typ, der ihn erfreuen konnte, und er begriff nicht, was ihn veranlaßt hatte, ihr jene Worte zu sagen, mit denen selbst das banalste Abenteuer beginnt. Der heimkehrende Krieger, dachte er spöttisch und sah dann, eine Ablenkung suchend, Dorothee Dönhoff vor sich, mit ihren ungleichen Augen, dem blaßgelben Kleid und den Silberschuhen und mit ihrer intellektuellen Betriebsamkeit. Die Gedanken übersprangen wieder den Raum. Wenn er daran dachte, daß er einen Jungen habe, einen Sohn – das Wort klang ihm ein bißchen komisch und geschraubt, obenein bei einem Kinde in diesem Alter –, waren seine Gefühle nicht einheitlich, und er war sich nicht klar darüber, ob da eine erfreuliche oder eine im Grunde überflüssige Tatsache geschaffen worden sei. Man lebt, heißt es, weiter in den Nachkommen, und derjenige, der niedersinkt, reicht nur ganz einfach die Fackel dem nächsten Geschlecht. Ach ja, man baut noch ein Atom weiter in das Unendliche der Zeit hinein.
Ulrich Faber liebte eigentlich solche Grübeleien nicht. Er zwang seine Gedanken, wie man ein widerspenstiges Pferd zwingt, davon abzubiegen, und ohne daß er sie gerade in diese Richtung drängte, gingen sie zu dem netten und bedauernswerten Mädchen in dem Tanzgarten, das der dicke Pascha des Schleichhandels wie eine gekaufte Sklavin prüfend umschlang. Daneben tauchte der andere Frauenbändiger auf. Der jüngere, stämmige, der mit seiner großen brutalen Hand auf die Rückseite der wütend zappelnden kleinen Ringkämpferin losschlug, ein gefährlicher Bursche, ein vielversprechendes Talent.
Dann erreichte er sein Hotel. Die Raubtiere drüben im Zoologischen Garten waren hungrig, wie die Menschen, und sie ließen es sich nicht verbieten, ihren Zorn laut hinauszubrüllen.
III.
Wenige Wochen nach der Revolution sank Herr Friedrich Dönhoff im Lehnstuhl ganz plötzlich zusammen, die Zigarre, die er eben noch geraucht hatte, glitt aus der entspannten Hand. Selbstverständlich hatten die tragischen Ereignisse auch den alten Dönhoff sehr betrübt, aber man konnte nicht behaupten, daß sein Tod durch die militärische Katastrophe und durch den Sturz des Kaiserthrones verursacht worden sei, und es war ein durchaus unpolitischer, privater Schlaganfall. Die Bestattung der sterblichen Überreste vollzog sich ganz in der Stille, denn die Zeit war voll von anderen Tragödien und anderen Sensationen, die Presse konnte in ihren Spalten soviel Weltgeschichte kaum unterbringen, und nur von wenigen beachtet, trieb in dem gewaltigen, entfesselten Strom die Mitteilung vorüber, daß Herr Friedrich Dönhoff, tiefbetrauert von den Seinigen, im Alter von 76 Jahren sanft entschlafen sei. Auf dem Waldfriedhof, wo die Dönhoffs einer früheren Periode in ihren Erbbegräbnissen lagen, stellte der Pastor in seiner Rede eine Verbindung zwischen dem Unglück Deutschlands und der für uns ebenfalls unfaßbaren Fügung her, die dem Vaterlande wiederum einen seiner besten Söhne nahm. Der Rittmeister Dönhoff war rechtzeitig eingetroffen und sah im schwarzen Gehrock – die Offiziersuniformen hingen jetzt in den Schränken – sehr elegant und stattlich aus. Dagegen fehlte der Diener Christian Rohr, denn er hatte seiner Gattin die Richtigkeit seiner Ahnungen bewiesen und sich während des Rückzuges der Armee gerade an der Stelle aufgehalten, an der eine der letzten feindlichen Fliegerbomben todbringend niederfuhr.