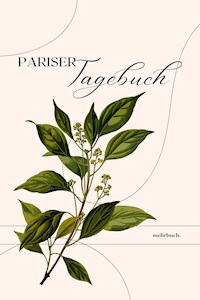
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Blätter dieses Tagebuches sind bunt und fast wahllos aus dem Bündel herausgegriffen, aber vielleicht gibt ein Farbendurcheinander, bei dem der Zufall mitgewirkt hat, am ehesten einen matten Abglanz von der reichen Lebensbuntheit der Stadt Paris. Wenn man solche schnell hingeworfenen Tagebuchnotizen wieder hervorkramt, solche nun etwas verblaßten und zerstäubten Schmetterlinge noch einmal aus dem Kasten nimmt, so sucht man gewöhnlich nach einer Entschuldigung. Ich möchte darauf verzichten, eine Entschuldigung vorzubringen, denn es ist mir, offen gestanden, nicht recht ersichtlich, wie und wo ich sie entdecken sollte. Früher, in jenen Jahren, als die Jünglinge noch Gemüt hatten, schlang man um die Tagebuchblätter seiner Liebeszeit ein tränenbenetztes rosaseidenes Band und schrieb auf den Umschlag den Namen der Geliebten: »Adelaide«. Ich umwickele diese losen Blätter, die ebenso viele Liebesbriefe sind, mit einem Bande, das nicht rosaseiden zu sein braucht, und schreibe darauf den teuren Erinnerung weckenden Namen »Paris«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodor Wolff
Pariser Tagebuch
Impressum
Instagram: mehrbuch_verlag
Facebook: mehrbuch_verlag
Public Domain
Pariser Tagebuch
Albert Langen Verlag für Litteratur und Kunst München 1908
Herrn
Antoine Bavier-Chauffour,
Neuilly sur Seine,
in herzlicher Freundschaft
Die kleinen Skizzen dieses Tagebuches sind, mit einer großen Anzahl anderer, für das »Berliner Tageblatt« geschrieben worden. Sie sind im Laufe von zwölf Jahren entstanden, unter sehr verschiedenartigen Luftströmungen und Eindrücken, und ich brauche nicht erst zu sagen, daß im bunten Wechsel der Zeiten und der Ereignisse auch die Anschauungen und Ideen sich bisweilen gewandelt haben. Ich habe über manche Persönlichkeiten und Fragen im zwölften Jahre naturgemäß anders gedacht als im ersten, und einiges, was ich früher frohgläubig hingeschrieben, erscheint mir heute eigentümlich fremd. Wäre es richtiger gewesen, diese älteren Tagebuchblätter ganz zu unterdrücken und nur die gefestigten Überzeugungen hier wiederzugeben? Aber wenn es mir vergönnt wäre, noch einmal zwölf Jahre in Paris zu verleben, so würden diese gefestigten Überzeugungen vielleicht abermals sich wandeln, und die Weisheit des reiferen Alters würde fortfahren, über die frühere Unreife zu lächeln.
In der fortgesetzten Erneuerung der Auffassungen habe ich, nur in steter Steigerung, eines unablässig empfunden: eine große Liebe für die Stadt Paris. Diese Liebe kann nicht völlig begreifen, wer nur dann und wann flüchtig in diese Stadt hineinblickt, und es kann sie auch keiner von jenen deutschen Brüdern begreifen, die noch draußen in der Fremde den Gewohnheiten und dem Ideenkreise ihres heimatlichen Stammtisches treu bleiben. Ich gebe gern und ohne Umschweife zu, daß andre Städte mancherlei Vorteile bieten, daß die Straßen anderswo sauberer, die Wohnungen geräumiger und die Klosetts hygienischer sind und auch andere soziale Einrichtungen von allgemeinerer und größerer Bedeutung sich durch ihre Vortrefflichkeit auszeichnen. Aber in Paris liegt über den Dächern, über dem Arc de Triomphe und über den Bäumen auf den Kais ein so feiner silberdurchglitzerter Duft, die Menge in den Straßen ist nicht griesgrämig und nicht eintönig grau, alles hat Hintergrund und Tiefe, Fülle und Farbe, und an jeder Straßenecke sitzt verführerisch das Leben und bietet dir seinen Strauß.
Die Blätter dieses Tagebuches sind bunt und fast wahllos aus dem Bündel herausgegriffen, aber vielleicht gibt ein Farbendurcheinander, bei dem der Zufall mitgewirkt hat, am ehesten einen matten Abglanz von der reichen Lebensbuntheit der Stadt Paris. Wenn man solche schnell hingeworfenen Tagebuchnotizen wieder hervorkramt, solche nun etwas verblaßten und zerstäubten Schmetterlinge noch einmal aus dem Kasten nimmt, so sucht man gewöhnlich nach einer Entschuldigung. Ich möchte darauf verzichten, eine Entschuldigung vorzubringen, denn es ist mir, offen gestanden, nicht recht ersichtlich, wie und wo ich sie entdecken sollte. Früher, in jenen Jahren, als die Jünglinge noch Gemüt hatten, schlang man um die Tagebuchblätter seiner Liebeszeit ein tränenbenetztes rosaseidenes Band und schrieb auf den Umschlag den Namen der Geliebten: »Adelaide«. Ich umwickele diese losen Blätter, die ebenso viele Liebesbriefe sind, mit einem Bande, das nicht rosaseiden zu sein braucht, und schreibe darauf den teuren erinnerungweckenden Namen »Paris«.
Erster Teil
Paul Bourget in der Akademie
(Juni 1895)
Erst nachdem ich eine kleine Odyssee durchlebt hatte, kam ich in den Saal der Akademie. Der alte Gaston Boissier, der neulich für den in die einzig wahre Unsterblichkeit hinübergegangenen Camille Doucet zum Secrétaire perpétuel gewählt worden war, hatte freilich die Freundlichkeit gehabt, mir eine Einlaßkarte zu senden, auf der zu lesen stand: »Commencement à deux heures très précises«. Aber als ich zehn Minuten nach eins auf dem Quai Conti anlangte, kam ich nur noch bis auf die Treppe des Palastes. Dort warteten bereits viele Herren und Damen auf den Moment, wo drinnen im Saale jemand ohnmächtig werden möchte, was vorzukommen pflegt und erst neulich bei der Aufnahme des Poeten Heredia vorgekommen war. Eine Weile wartete auch ich auf der Treppe, den Augenblick erharrend, da man anfinge, die ohnmächtigen Damen herauszutragen. Aber baue einer auf die Schwäche der Frauen! Sie werden plötzlich so stark, wenn sie sich amüsieren!
Obwohl es schon ein erhebendes Gefühl sein mochte, 4 so auf der Treppe der Akademie zu stehen, wie Zola der auch nicht weiter kommt, trieben mich die innere Unruhe und der Wunsch, Bourget mit dem Palmenfrack zu sehen, doch von dort fort; ich überließ alle Vorteile, die aus einer Schwäche der Damen erwachsen konnten, meinen Vor- und Hintermännern und gelangte schließlich nach mancherlei Abenteuern, die ich hier nicht erzählen will, dann doch in den Festsaal der Akademie. Dort habe ich zwei Stunden lang auf einem Fuß gestanden, weil ich keinen Raum fand, den anderen niederzusetzen, und habe eine Wand aus grauem Segeltuch, welche die Tribüne von einem Korridor abschloß und über uns zusammenzuschlagen drohte, zwei Stunden lang mit ausgestrecktem Arm über dem Haupte einer jungen Frau und meinem eigenen gehalten, etwa wie auf dem bekannten Gemälde der junge Paul das Palmenblatt über sich und Virginien hält. Aber trotz dieser Fuß und Hand in gleicher Weise lähmenden Situation waren diese zwei akademischen Stunden ganz ausnahmsweise amüsant und ich habe sogar vieles abzubitten.
Denn da man so viel gegen die Akademie geschrieben und sie so oft ein altes Möbel genannt hat, wird jeder, der zum ersten Male dort hinkommt, wie ich, auf das Schlimmste gefaßt sein. Man ist beinahe überrascht, daß die Leute, die dort sitzen, keine Zöpfe tragen, und ist doppelt dankbar für jede angenehme Enttäuschung. Man ist entzückt, statt in einem Schulsaal mit weißen Büsten sich in einem Salon zu befinden, der ganz und gar Salon ist, bis in den letzten Winkel. Es ist ein literarischer Salon, sehr elegant und sehr behaglich, und wie ein echter literarischer Salon gibt er Gelegenheit zur 5 Bewunderung und zur Satire. Die Gesellschaft dieses Salons besteht ans wirklichen Rittern des Geistes, aus posierenden Komödianten, und aus Personen, die von den beiden Arten ein wenig in sich vereinigen. Die großen Arbeiter der Wissenschaft, die kleinen Piraten, welche geschickt die herabgefallenen Brocken aufgreifen, die ästhetischen Schöngeister, die dann am meisten bewundern, wenn sie am wenigsten verstehen, sind dort beieinander, und diese Gesellschaft, die zum Teil etwas ist, zum Teil etwas sein will, ist zugleich die Welt der eleganten, angenehmen Form und scheint wie durchdrungen von einem modischen Parfüm. In diesem literarischen Salon führen zwei der Anwesenden das Gespräch, der neue Akademiker, den man heute aufnimmt: Paul Bourget, und der Direktor, der ihm antwortet: Vicomte de Voguë. Die übrige Gesellschaft hört nur zu, bald mit einer echten, bald mit einer etwas geheuchelten Aufmerksamkeit, spendet dann und wann Beifall und wiegt sich in einer angenehmen, behaglichen Stimmung. Die Worte der beiden Redner fallen nicht zu scharf auf diese ein wenig träge Gesellschaft, keine Adler fliegen auf, nur Schmetterlinge. Aber wo gibt es ein Vergnügen, das reizvoller und scharmanter wäre als dieses – zwei geistreichen, weltmännischen Rednern zu lauschen, die nie zu tief in die Dinge niedertauchen, die dort, wo ein Problem vor ihnen aufsteigt, es nicht mit gewaltigen Fäusten anpacken, die nur leise darüber hinstreichen, einige kluge Artigkeiten darüber sagen, und die den Blumenkelch nicht zerstören, da sie ihn nicht ergründen wollen, sondern nur ein wenig Honig aus ihm heraufholen, um unserem Gaumen angenehm zu sein? Gibt es eine 6 feinere und liebenswürdigere Unterhaltung als die, welche der literarische Salon der Pariser Akademie an diesem Nachmittag seinen Gästen bot?
***
Von jener höchsten Stufe der Tribüne, wo ich auf einem Fuße stand und das Zelttuch über meinem Kopf und dem Kopf meiner lächelnden Nachbarin emporhielt, konnte man sehr schön den kleinen Saal übersehen. Es gibt drei solcher Tribünen, an drei Seiten des Saales; sie sind in die Wände hineingebaut und steigen in die Nischen hinauf. Über den drei Nischen befinden sich, in halber Höhe des Saales, noch einmal Logen, wieder mit tribünenartig aufgebauten Sitzbänken.
Ich zählte, daß meine Tribüne zwanzig Stufenreihen habe. Ich stand oben auf der höchsten, und die zwanzigste war unten im Saal. Da fast lauter Damen auf der Tribüne waren, so war das, wegen der bunten Blumenhüte, wie eine lustige, absteigende Blumentreppe. Doch waren fast all diese Hüte klein und es war merkwürdig, wie hier der sonst so ungewöhnlich gewordene Kapottehut herrschte. »Capotes-Institut« nennt ein Chronist diese Hüte.
Unserer Tribüne gegenüber hatten wir jene vierte Saalwand, die einzige tribünen- und nischenlose. In ihrer Mitte eine hohe, dreiteilige grüne Tür zwischen den gelb gewordenen Statuen Bossuets und Fenelons. Vor der grünen Tür, auf einem kleinen Podium, ein grünbedeckter Tisch. Und hinter dem Tisch sitzen drei Akademiker im grünbestickten Palmenfrack: Voguë, Albert Sorel, Gaston Boissier.
7 Von dem grünen Tisch gehen in einem Halbkreis nach rechts und links die Sitzreihen der Akademiker und der Mitglieder des Instituts. Es sind grün gepolsterte Bänke, sechs hintereinander, auf Stufen ansteigend. Die vierzig Unsterblichen sind fast vollzählig, zwischen ihnen etwa sechzig »vom Institut«. Man sitzt sehr zwanglos, viele haben den Spazierstock mit hereingebracht. Alexander Dumas sitzt links auf der obersten Reihe – sein hochstehendes, lockiges, reiches Haar jetzt ganz weiß; auch der elegante, langgezwirbelte Schnurrbart ist weiß, aber das Gesicht ist noch jung und es ist da alles Energie, überlegene Klugheit, Selbstbewußtsein, skeptische Kühle. Halevy sitzt in seiner Nähe, mit auch schon mehr als ergrautem breitem Vollbart, Meilhac mit dem etwas geröteten starken Doggengesicht, dem blanken, nur von einem Haarkranz umgebenen Schädel; dann der alte Herzog von Aumale, der eben erst vom Krankenbett aufgestanden ist, mit seiner scharfen Habichtsnase, dem weißen herabhängenden Schnauzbart, dem kahlen Kopf. Drüben, auf der anderen Seite, Brunetière, der Erfinder des Wortes vom »Bankerott der Wissenschaft«, ein rundes Büreaukratenhaupt mit einer Brille vor den kurzsichtigen Augen – Freycinet, die »weiße Maus«, mit dem weißbärtigen kleinen Mäuseköpfchen, Sardou, ganz oben, allein auf seiner Bank, mit dem glattrasierten Altfrauengesicht, den etwas zusammengekniffenen Augen, der alte Herzog von Broglie, dem das lange weiße Haar über den Ohren wie die untere Schwingung eines Fragezeichens absteht, Jules Simon, als Sekretär der Akademie im Palmenfrack, gebückt, mit fast geschlossenen Augen hinter dem Kneifer, mit sehr wenig 8 Haar, sehr starker Nase, das Gesicht gewissermaßen von unten nach oben zusammengeschoben, wie man das bei sehr alten Leuten oft findet – und etwa neunzig andere.
Man denke sich einen Siegelring in der Mitte durchschnitten. Es bleiben zwei kleine Bogen und in der Mitte das Siegel. Die beiden kleinen Bogen sind die Akademikerbänke, das Siegel, das sie zusammenhält, ist der grüne Tisch der Direktoren. In der halbmondartigen Fläche, die nun dazwischen bleibt, stehen Stühle für die Gäste der Akademie. Man sitzt bis eng an die Akademikerbänke heran. Man sitzt beinahe den Akademikern auf dem Schoß. Dem blonden Jaurès, dem »Tenor«, dem lyrischen Rhetor der Sozialdemokratie, hat das Schicksal einen Stuhl gerade vor seinem politischen Gegner, dem silberweißen republikanischen Greis Challemel-Lacour beschert. Dicht dabei sitzt Hanotaux, der junge Minister des Auswärtigen, der, ehe er zum Auswärtigen kam, ein etwas trockener Geschichtsforscher war. Und dann Damen, alte und junge, und möglichst nahe an den Akademikerbänken und am Direktorentisch! Drei oder vier lehnen sich gegen den grünen Tisch und sind sehr glücklich.
Auf der dritten Bank im linken Bogen sind zwischen den Akademikern drei Plätze frei geblieben. Vor dem mittelsten der drei steht ein einfaches Lesepult – ganz wie ein Dirigentenpult. Dorthin schieben sich, an den Akademikern vorbei, kurz nach zwei Uhr drei Männer im Frack mit den grünen Palmen auf den Aufschlägen, den Akademikerhut, der wie ein Admirals- und Ministerhut aussieht, in der weißbehandschuhten Rechten. Der 9 eine von den dreien trägt unter dem Arm ein Manuskript. Das ist Bourget. Die andern beiden, zum Glück ohne Manuskript, sind der ewig lächelnde Coppé mit dem glatten Gesicht und den glatten Versen, und der Comte d'Haussonville, ein richtiger blonder Comte mit einem Monokel, der auf dem Sessel des in Schönheit gestorbenen Salonphilosophen Caro, des Urbildes von Paillerons Bellac, sitzt.
Bourget legt das Manuskript auf das Pult und fängt an zu lesen. Er hat kein schönes Organ, es ist hart, ein wenig schnarrend und ohne Wohllaut. Obgleich er mit seinen Freunden am Tage vorher zwei Leseproben in diesem Saale abgehalten hat, scheint er ein wenig befangen und nervös. Die Zeremonie ist ihm ersichtlich peinlich, und er macht nicht gerade das freundlichste Gesicht. Indessen, das Publikum, das rund um ihn herum sitzt – man sieht erst jetzt, wie behaglich sich der ganze Saal um dieses Rednerpult gruppiert – ermutigt ihn durch freundlichen Beifall, und wenn er einmal aufsieht, lächeln ihm alle Damen, in deren Salons er verkehrt, ihren Glückwunsch und ihr Bravo zu. So ergibt sich aus alledem die warme, liebenswürdige Gesellschaftsstimmung.
Ich habe Bourget früher nur einmal gesehen, und das war vor vier Jahren in Palermo. Wir wohnten in demselben Hotel de France, dem er dann bei der Abreise ein etwas zu großes Bild von sich geschenkt hat. Er war mit seiner jungen Frau dort, eben verheiratet, und ich reiste mit seinen gerade erschienenen »Sensations d'Italie« im Koffer und empfand, wie vielleicht auch andere, in den kleinen Städten Oberitaliens 10 nur noch bourgethaft. Dergleichen gewöhnt man sich dann bei späteren Besuchen wieder ab.
Wenn ich an jene Palermotage zurückdachte und mir den Bourget von damals ins Gedächtnis rief, so hatte ich ihn nicht ganz so voll und stark vor Augen, wie er mir jetzt erschien. So überraschte mich beinahe dieser kräftige Kopf auf diesem kräftigen Nacken. Das glatte dunkle Haar war auf der rechten Seite ein wenig auf die massive Stirn herabgestrichen, und der vorderste Haarstreifen hatte sich von der Frisur gelöst und lag, gebogen wie ein Türkensäbel, auf dieser Stirn. Über den dunklen, wohl nur in der Peinlichkeit der Stunde so finster aussehenden Augen schoben sich die starken Brauen ein wenig gegeneinander. Im rechten Auge saß unbeweglich das Monokel. Von Zeit zu Zeit faßte die rechte Hand nervös an dies Augenglas, oder sie strich den kleinen dunklen Schnurrbart. Die Locke auf der Stirn deutete auf den Dichter, das Monokel auf den Weltmann. Der grünbestickte Frack schließlich gab ihm etwas vom Marineoffizier.
Man erlasse mir, bitte, das nähere Eingehen auf Bourgets Rede. Es war eine Rede auf seinen Vorgänger in der Akademie, Maxime du Camp, der unter dem Einfluß von Chateaubriand, von Byron, von Musset, von Goethes Werther als Romantiker begann und als ein braver und tüchtiger Arbeiter endete, indem er die Posteinrichtungen und die Organisation der Wohltätigkeit in Paris in fleißigen Werken schilderte. Bourget widmete diesem braven Literaturbürger einen ausgezeichneten, klaren, würdigen Nachruf, er feierte ihn als den Mann, der am Abend seines Lebens heiter, zufrieden 11 von seiner Arbeit sagte: »mon humble métier de plumitif auquel je dois les meilleurs jours de ma vie et le calme de ma veillesse.« wenn der Redner das Bedürfnis fühlte, seine Worte einen höheren Aufschwung nehmen zu lassen, dann flocht er in die Schilderung dieses bon ouvrier eine Schilderung Flauberts ein, des großen Meisters, der dem schlichten Chronisten der Stadt Paris ein treuer Freund gewesen ist.
Man erlasse es mir auch, den Inhalt, oder den Gedankengang der Rede des Vicomte de Voguë hier nachzuerzählen. Der Vicomte, der wie irgend ein blondbärtiger deutscher Bundesratsbevollmächtigter aussieht, las seine Rede anspruchslos, gefällig, ohne jede Prätension vor, während er hinter dem grünen Tische sitzen blieb. Ich weiß sehr wohl, daß er vieles schuldig geblieben ist, was über Bourget zu sagen war . . . Gutes und Schlechtes. Er hat im Grunde den echten Bourget nicht gezeigt. Er ist vielleicht auch ungerecht gewesen, wenn er, mit etwas zuviel überlegener, direktorialer Ironie andeutete, daß nur ein Wort von Bourgets Werk auf spätere Zeiten sich vererben werde: dieses Titelwort »Cruelle énigme«. Bourgets Werk wird doch erwähnenswert bleiben, weil es an zwei großen Bewegungen teilgenommen hat, die uns nicht sympathisch zu sein brauchen, die doch aber nun einmal da sind: an dem Übergang vom naturalistischen Roman zum psychologischen, und dann an der Einführung des »Neo-Christianismus«. Wie weit Bourget beide Male Führer war, wie weit er nur einer von denen war, die aus der Ferne den Trommelschlag hörten und dann mitliefen, das ist freilich schwer zu sagen. In jedem Fall 12 hat er durch sein Geschick und durch seine Persönlichkeit die Aufmerksamkeit des Publikums so gewonnen, daß es bereit war, ihn für einen Führer zu halten.
Von alledem zu sprechen, hat Voguë mit einer eleganten Handbewegung abgelehnt, er hat eine Reihe kostbar geschliffener Sätze hingestreut, von denen jeder wie eine reizvolle Überraschung und ein prickelndes Vergnügen war. Er hat länger nur bei Bourgets letztem Buche, bei »Outre-Mer« verweilt und hat am Schluß den neuen Akademiker eingeladen, sich vor dem großen allgemeinen Schiffbruch, den »Outre-Mer« für das greise Europa verkündet, in den ruhigen Hafen und die alte Barke der Akademie zu der hohen Arbeit zu retten: »exercer sur le monde la maîtrise des idées et des belles formes.« 13
»Cause célèbre«
(1898)
Draußen veranstaltete ein köstlicher sonniger Herbst etwas wie eine Nachfeier des Sommers. Ich verspürte den Wunsch, in eine Gegend zu entfliehen, wo man nicht von Dreyfuß sprach, und wo der Herbstzauber die cause célèbre vergessen läßt. Ich nahm den ersten Zug, der nach Montmorency abging, und fuhr hinaus. In Montmorency, wo in der »Eremitage« der Madame d'Epinay einst Jean Jacques Rousseau wohnte, leben jetzt zur Sommerszeit viele Deutsche – meist Kommissionäre, die in Paris im Viertel des Nordbahnhofes wohnen und deswegen Montmorency sozusagen »vor der Tür« haben. Jetzt waren all die etwas feucht aussehenden Villen geschlossen, und man traf keinen jener lieben grauen Esel, auf denen im Sommer die jungen Mädchen in den nahen Wald traben.
Beinahe noch öder sah es in Enghien-les-Bains aus, das man von Montmorency in einer knappen halben Stunde erreicht. An dem schnurgerade abgesteckten, von Villen umgebenen See saßen nur drei Engländerinnen in ziemlich vorgeschrittenem Alter – die eine malte, die beiden 14 anderen lasen. Seltsam, wie dieser Ort, der vielen Pariser Familien im Sommer als Badeort dient, so ganz den englischen Charakter hat, und wie die Landschaft mit dem schnurgeraden, unter leichten Herbstnebeln schlummernden See zu den drei einsamen Engländerinnen paßte! Das Kasino, wo während der Saison das »Pferdchenspiel« floriert, war geschlossen. Und die letzten Blumen in den Kübeln auf der Terrasse sahen so melancholisch aus wie ein alter verwelkter Brautkranz.
Ich fuhr mit der elektrischen Bahn nach Montmorency zurück, um dann von Montmorency nach Saint-Leu zu gehen, das acht oder neun Kilometer weiter nordwestlich liegt. Man kommt durch die Orte Margency, Mangarny und Montlignon, hat die Waldhügel von Montmorency immer zur Rechten und erblickt zur Linken, weit hinten, als dunklen Abschluß einer großen Ebene, die bewaldeten Höhenzüge von Saint-Germain.
Und hier war er wirklich, der Herbstzauber. Die Landschaft hat hier nicht das allzu Gepflegte, Elegante, fast Parfümierte, das sie im Westen von Paris, bei Saint-Cloud, bei Ville d'Avray und bei Saint-Germain hat. Man ist mehr »auf dem Lande«. Aber auf welch einem Lande! Es gibt in der ganzen, so reichen Umgebung der großen Stadt wenige Plätze, die von einer so breiten, würzigen, kräftigen Schönheit wären wie dieses Tal zwischen den beiden Waldhöhen. Rousseau hätte in Saint-Germain nicht hausen können. Hier durchlebte er, was er später in den »Confessions« niedergeschrieben.
Man möchte das goldene Braun der Wälder auf den Höhen mit dem dunkelen Goldton Rembrandts oder 15 anderer Niederländer vergleichen, würde man nicht fürchten, durch diesen Vergleich den Eindruck von etwas Künstlichem zu erwecken und den vollen, warmen, natürlichen Reiz zu schmälern. Hier und da ragt der weiße Turm eines Landhauses aus dieser Waldpracht empor. Und wie ein zarter Schleier liegt der Herbstdunst über den Hügeln.
Die Landstraße unten im Tale führt abwechselnd zwischen großen, von grauen Steinmauern umhüteten Schloßgärten und zwischen Wiesen und Feldern dahin. Auf den Feldern liegen in langen Reihen die schweren, blauroten Kohlköpfe; auf den Wiesen schmiegen sich lange grüne und gelbe Gräser aneinander, weich wie im Winde wogendes Seidenhaar. Durch hohe Gitterportale sieht man in die Schloßgärten mit ihrer herbstlichen Einsamkeit. Eine breite, mit roten Blättern bestreute Buchenallee führt zum Schlosse, und unter den Bäumen steht ein marmorner Amor, der vergeblich nach einem Opfer für seine Pfeile sucht.
Saint-Leu ist eine kleine, stille Landstadt, wo die Menschen fleißig zur Kirche gehen, weil Vergnügungslokale nicht existieren. Die Priester wissen, weshalb sie Gegner der großen Städte, der »Wasserköpfe«, sind! Als ich nach Saint-Leu kam, fand gerade eine Beerdigung statt, die Beerdigung einer reichen alten Dame, und die meisten Frauen und Jungfrauen hatten die Gelegenheit benutzt, um sich schwarz zu kleiden, was ihnen in dem ewigen Einerlei ihrer Tage offenbar schon eine angenehme Abwechselung schien. Vor dem Café in der Nähe des Bahnhofes besprach der Wirt mit mehreren Gästen den Trauerfall und die Hinterlassenschaft. 16 Gegenüber, vor einem Kramladen, über dessen Tür zu lesen war: »Hier werden Fahrräder verliehen und repariert«, ließen ein magerer Jüngling und ein dickes Mädchen den Gummireifen ihrer Fahrräder neue Luft einpumpen. Das dicke Mädchen trug schwarze Hosen, die sich wie zwei große Ballons über den Knien wölbten. Und ein kleiner Bengel stand dabei, ein Eingeborener von Saint-Leu, und pfiff selbstzufrieden das alte Volkslied vom König Dagobert, der seine Hosen verkehrt angezogen hat:
»Le bon roi Dagobert A mis sa culotte à l'envers.«
***
Wie ich so durch die Straßen dieses wenig aufregenden Städtchens schlenderte, entdeckte ich plötzlich hinter einem Gartengitter zwischen alten Bäumen ein verwittertes Denkmal. Es war ein ziemlich geschmackloser hoher Obelisk, zu dessen Füßen zwei steinerne Genien saßen. Ich fragte einen Mann, der vorüberging, was das für ein Platz und für ein Denkmal wäre. »Ach,« sagte er, »das ist das Schloß der Condé.« Er sagte es wie jemand, der versichert: »es ist nichts von Bedeutung«, und ging weiter.
Die Worte »das Schloß der Condé« enthielten eine leichte Übertreibung. Von dem Schlosse war nichts mehr zu sehen – es ist verschwunden und dort, wo es gestanden, sind jetzt Wohnhäuser, Stallungen und Schuppen aufgerichtet. Von der ganzen Herrlichkeit ist nur das Stückchen Park noch übrig, wo jetzt der Obelisk mit den beiden Genien steht.
17 Aber indem ich den Obelisk noch betrachtete, erinnerte ich mich . . . Richtig, hier war es, wo der letzte Prinz von Condé ermordet worden – hier in seinem alten Schlosse zu Saint-Leu! Welch eine »Cause célèbre« war das für das Publikum von 1830 gewesen!
Am Morgen des 27. August 1830 fand man den vierundsiebzigjährigen Herzog von Bourbon, Prinzen von Condé, in seinem Schlafzimmer am Fensterriegel hängend. Die Trösterin seiner alten Tage, die abenteuerliche, intrigante, lasterhafte und ehrgeizige Baronin von Feuchères – sie hieß mit ihrem Mädchennamen Sophie Dawes und stammte aus England – befreite mit Hilfe ihres Beichtvaters und einiger Diener den toten Greis von dem Strick, an dem er hing. Drei aus Paris gesandte Mediziner, Marr, Pasquier und Marjolin, gaben ihr Gutachten ab und schlossen auf Selbstmord.
Aber der vierundsiebzigjährige Fürst hatte nie daran gedacht, freiwillig, mit Hilfe einer Schnur und eines Fensterriegels, aus dem Leben zu scheiden. Er hatte dagegen in der letzten Zeit seines Lebens oftmals gefürchtet, man möchte ihn gegen seinen Wunsch und Willen ins Jenseits spedieren, und er hatte alle Vorkehrungen getroffen, um am Morgen des 28. August nach seinem Schlosse Chantilly zu fliehen, und von dort nach England. Wen er fürchtete? Seine Freundin Feuchères. Warum er sie fürchtete? Er hatte vor einem Jahre nach langem Kampf, nach langem Widerstreben, endlich besiegt durch die Feuchères, sein kolossales Vermögen – das Vermögen der Condé – dem jungen Herzog von Aumale, dem Sohne des Louis Philippe und der Marie Amélie, vermacht und zugleich 18 Saint-Leu, Boissy, die Wälder von Montmorency und Morfontaine als Erbteil der Feuchères bestimmt. Diese kluge Dame hatte sich gesagt, daß sie ihr eigenes Erbteil gegen die rechtmäßigen Erben nur würde verteidigen können, wenn sie mächtige Bundesgenossen hätte. So hatte sie das Vermögen der Condé dem Hause Orleans zugeführt – der geizige Louis Philippe und die gute Marie Amélie (nichts interessanter als ihr Briefwechsel mit der Feuchères!) wurden ihre Komplicen. Aber der Sturz des legitimen Königtums und die Rücksichtslosigkeit, mit welcher Louis Philippe seinen Vetter Charles X. behandelte, empörten den alten Fürsten von Bourbon, und er wollte nach England zu den Verbannten und dort sein Testament umwerfen. Da, am Morgen, wo er heimlich Saint-Leu verlassen wollte, fand man ihn tot am Fensterriegel . . .
Es kam zu einer Untersuchung, aber die Untersuchung wurde niedergeschlagen. Es kam trotzdem, auf Betreiben der Prinzen von Rohan, zu einem Prozeß, aber die Kläger wurden abgewiesen. Die Familie Orleans behielt das Vermögen des ermordeten Condé – Schloß Chantilly, das der Herzog von Aumale der Akademie hinterlassen, ist ein Teil davon – und Madame de Feuchères starb hochbetagt in jenem England, wo heute Esterhazy weilt.
Seltsam, es gab auch damals die drei Experten, auf deren Gutachten hin Madame de Feuchères freigesprochen wurde, wie heute Esterhazy auf das Gutachten der drei Experten Conrad, Belhomme und Varinard. Es gab auch damals den unerschrockenen Untersuchungsrichter, welcher »volles Licht machen« wollte: der Bertulus von 19 heute hieß damals de la Huproye. Und es gab den Generalprokurator Persil, welcher dem braven Huproye die Untersuchung abnahm, ganz, wie der Generalprokurator Bertrand sie Bertulus abgenommen. »Es gibt nichts Neues unter der Sonne«, hat der Philosoph gesagt. Und der weise Marc Aurel hat sich gewundert, daß uns die Ereignisse, die an uns vorüberziehen, immer wieder erstaunen: »Wenn man dir im Theater eine gleichmäßige Wiederholung derselben Vorgänge zeigt, langweilst du dich. Du müßtest das Gleiche während deines ganzen Lebens tun, denn in dieser Welt siehst du oben und unten stets nur die gleichen Wirkungen und immer dasselbe Spiel der ewig gleichen Ursachen. Ach, und das wird niemals enden!«
Gewiß, ich will die »cause célèbre« von heute nicht mit der »cause célèbre« von 1830 vergleichen. Die »cause célèbre« von damals war im Grunde nur ein interessanter Kriminalfall – heute steht ein ganzes Volk, von einer tragischen Schuld belastet, auf der Bühne. Aber vieles, was uns neu scheint, ist nur Wiederholung – Wiederholung aus der Affäre von 1830 oder aus anderen Affären. Und ich glaube auch, daß diejenigen, die fortwährend über »décadence« schreien, ein wenig den Theaterfreunden gleichen, die uns unablässig von einer früheren Blüte der Kunst erzählen, und denen vielleicht nur deswegen die Gegenwart so heruntergekommen scheint, weil sie die Vergangenheit nicht gesehen haben.
***
20 Natürlich – ich hatte Paris verlassen, um der »cause célèbre« zu entfliehen, und hier in Saint-Leu fand ich sie wieder. Wirf die Katze, wie du willst, sie fällt immer wieder auf die Füße. Drei kleine Mädchen standen hinter mir, streckten verlegen die Finger in die Nasen und wunderten sich, daß ich so lange den alten Obelisken betrachtete, an dem eigentlich gar nichts zu sehen war.
Und diese drei kleinen Mädchen waren nicht die einzigen in Saint-Leu, die von der alten Mordgeschichte, die vor siebzig Jahren so viel Staub aufgewirbelt hatte, nichts oder nur wenig zu wissen schienen. Schon der Mann, der mir die erste Auskunft über die Bestimmung des Obelisken gegeben, schien mit dieser Affäre nur höchst oberflächlich vertraut. Andere waren nicht besser unterrichtet. Sie wußten allenfalls so ungefähr, daß man den letzten Condé hier ermordet hatte – denn daß die Selbstmordshypothese der drei medizinischen Experten ein gefälliges Märchen war, haben spätere Enthüllungen sonnenklar ergeben.
Die herbstlich roten Blätter fallen von den Buchen auf den Obelisken und die zwei sitzenden Genien. Wie schnell ist das, was gestern eine »cause célèbre« war, vergessen! Aber das ist vielleicht sehr gut, sehr beruhigend und sehr erfreulich, und im höchsten Grade unerfreulich ist nur, daß mit der »cause célèbre« auch die Lehren, die sich aus ihr ergeben, so schnell vergessen werden.
Ich ging zum Bahnhof und kam wieder bei dem Café und bei dem Kramladen vorbei, wo Räder »verliehen und repariert werden«. Der magere Jüngling 21 und das dicke Mädchen waren mit frischer Luft davongeradelt. Aber vor dem Café standen noch der Wirt und seine Gäste. Diese Gäste waren aus Paris gekommen und erzählten jetzt von den letzten Vorgängen, den letzten Zwischenfällen der »Affäre«. Ich trat heran und mischte mich bescheiden in das Gespräch. Man sprach von Esterhazy und vom berühmten »Bordereau«. Die Pariser waren halb und halb überzeugt, daß Esterhazy der Verfasser des »Bordereau« wäre. Aber der Wirt schüttelte den Kopf und sagte mit der Bestimmtheit eines Mannes, der den Respekt vor den Wissenschaften zu einem Dogma erhebt: »Meine Herren! Sie vergessen das Urteil der drei Experten!« 22
Die Erinnyen
(Juni 1899)
Seit fünf Jahren habe ich kaum eine der großen Sitzungen, der großen Theatervorstellungen im Palais Bourbon versäumt. Welch eine Reihe schöner Premieren seit fünf Jahren! Die letzten Panama-Ringkämpfe fielen noch in diese Zeit, und der zyklopische, rundschultrige Rouvier verteidigte sich wie ein Eber gegen die Meute. Dann kamen die Südbahnkomödien, dann die olympischen Kampfspiele, welche Kammer und Senat um das Ministerium Bourgeois aufführten. Und dann die einzelnen Akte des größten Spektakelstückes, der Dreyfus-Affäre mit ihren wechselnden Helden: dem fuchsartigen Méline, der ein etwas verkleinerter Guizot ist, dem verbohrten Cavaignac der die Robespierre-Rollen spielt, dem alten Brisson, dessen treue, ehrliche Röcke so unmodern scheinen wie seine feierliche republikanische Rhetorik und der so seltsam an Verrina erinnert. Von meinem Platz auf der engen und dunstigen Tribüne habe ich die sozialistischen Fäuste die nationalistischen Köpfe verprügeln gesehen, und die nationalistischen Fäuste die sozialistischen Köpfe. Ich habe alle Arten von 23 Schimpfworten, alle Nuancen des Tumultes, die ganze Tonleiter menschlicher und tierischer Laute kennen gelernt. Ein Irrenhaus, eine Menagerie oder die Hölle selbst, wie der gute Fra Angelico sie gemalt, sind nur stille Nervenheilstätten, verglichen mit diesem Palais der Parlamentarier. Aber was auch immer in diesen fünf Jahren sich ereignet hat, und so weit ich zurückdenke – ich erinnere mich an nichts, was dieser gestrigen Sitzung vergleichbar wäre, die unter dem Geschrei »Mörder! Mörder!« so vielversprechend begann.
Längs der halbkreisartig gebogenen Wand (der Saal hat die Form eines Halbkreises, an dessen geradliniger Seite sich der Sitz des Präsidenten und die etwas niedrigere Rednertribüne erheben) in allen Logen ein Geflimmer bunter, lichter Sommertoiletten. Diese Logen sind so überfüllt, daß man glaubt, die Wände müßten auseinandergesprengt werden. Die Damen halten einander auf dem Schoß, die Herren balanzieren dahinter auf den Fußspitzen, und ich sehe Coquelin, der mit gespreizten Beinen auf dem Rande einer Bank steht, und zwischen dessen Füßen eine Gott sei Dank nicht umfangreiche Dame sitzt. Und längs der ganzen Bogenlinie ein fortwährendes Auf- und Niederflattern zahlloser Fächer, wie rund um die spanische Arena am Tage des Stiergefechts.
Unten auf den amphitheaterförmig aufsteigenden Bänken, Schulter an Schulter, die Vertreter der Nation. Dort der runde Kopf Dupuys mit einem halb verlegenen, halb bösen Lächeln, dort der kahle, dürftige Schädel Cavaignacs, dort das Fuchsgesicht Mélines. Auf den ersten beiden Bänken der Mitte, dem 24 Präsidenten und der Rednertribüne zugewandt, die neuen Minister. Waldeck-Rousseau im kurzen blauen Jackett auf der vorderen Bank. Neben ihm der erste Sozialistenminister Millerand. Auf der zweiten Bank, hinter ihnen, der General de Gallifet, sehr mager, sehr elegant, in schwarzem Rock und hellen Hosen. An seiner Seite ein anderer, sehr eleganter, noch junger Mann, fast kahl, aber mit einem hübschen blonden Schnurrbart: der neue Finanzminister Caillaux, Sohn einer Ministerfamilie. Und ringsherum ein Geschwirr und ein Gesumme wie das verhaltene Dräuen eines Meeres, das gleich zum tollwütigen, besessenen Toben werden wird.
Der Präsident Deschanel – noch ein Elegant – ergreift die Glocke (er hat schon zwei in diesem Jahre ruiniert) und sagt: »Die Sitzung ist eröffnet.« Kaum ist das Wort heraus, als auf der linken Seite des Saales, auf den höchsten Stufen des Amphitheaters – dem »Berge« – etwa zwanzig Männer emporspringen, drohend die Arme in die Luft werfen und dieses wilde Geschrei beginnen: »Mörder! Mörder!« Es sind zuerst nur zwanzig, aber ihre Tobsucht wirkt ansteckend und gewinnt wie ein Feuer, das sich schnell, vom Winde begünstigt, weiterfrißt, die benachbarten Bänke, wo die Déroulède und Drumont sitzen, und dann immer andere Bänke. »Mörder! Mörder!« Man denkt, es müsse alles zusammenbrechen. Und die Erinnyen selber scheinen auferstanden!
Mein Gott, und welche Erinnyen! Da ist Coutant, ein ehemaliger Mechaniker, ein Mann mit wirr durcheinanderhängenden Pudellocken und revolutionärer, 25 langflatternder Krawatte; er hat vor einem Jahre die Gattin eines Arbeitskollegen entführt, die sich in das revolutionäre Genie verliebt hatte, und hat dann eine ziemlich komische Rolle im Ehescheidungsprozesse gespielt. Er schreit für zehn, und von seinem tiefroten Gesichte trieft der Schweiß. Dann Vaillant, ein ehemaliger Chirurg, Politiker schon in den Kommunetagen, ein kleiner, fetter Mann mit weißem Schädel und einer großen Brille auf der dicken, roten Nase. Dann Legitimus, ein Neger von Guadeloupe, der eine Art Niggertanz aufzuführen scheint, Dejeante, ein Hutmacher, und eine Anzahl ganz junger Leute, die den mageren Gallifet noch heftiger hassen, da sie nur von Hörensagen wissen, was er eigentlich getan hat.
Während der ganzen Sitzung währt das Geschrei – und je später es wird, und je mehr die Hitze im Saale zunimmt, desto tobender, wahnsinniger wird es. Der Deputierte Mirman steht auf der Rednertribüne, ein Bursche mit einem langen, rotblonden, spitzgeschnittenen Vollbart und frisierter, geölter Mähne, ein widrig hohler Phrasenschwätzer, der den entrüsteten Biedermann spielt – ein Individuum, das Taine unter »die grünen Früchte der Advokatur« gezählt hätte, die in den Revolutionsjahren das Gros der Revolutionsarmee bildeten. Er nennt die Minister »Schurken und Mörder«. »Das Land braucht Sie nicht!« ruft er ihnen pathetisch zu. »Schurken und Mörder!« brüllt und heult die Kammer, und zweihundert Arme strecken sich drohend gegen die Minister aus, und oben über dem Saale flattern die bunten Fächer auf und nieder, wie geängstigte Schwalben in einem Orkan.
26 Waldeck-Rousseau sitzt regungslos auf seinem Platz. Er weiß sich meisterhaft zu beherrschen – er gleicht mehr einem kühlen Engländer als einem Franzosen – aber seine eiserne Ruhe ist gespielt. Er hält die Fäuste in den Taschen des blauen Jaketts vergraben, seine Kinnbacken arbeiten nervös. Millerand liest scheinbar eifrig in einem Buch. Es ist verabredet, daß weder er noch Gallifet sich rühren dürfen, um die Meute nicht noch mehr zu reizen. Während die Kammer um ihn herum kreischt und tobt, liest er. Gallifet blickt fest in den Tumult; dann und wann beugt er sich mit einem Lächeln zu seinem Nachbarn Caillaux, um die Namen der Hauptschreier zu erfahren. Und seine Ruhe reizt die Wütenden noch mehr und sie verdoppeln ihr betäubendes Geschrei: »Mörder! Mörder!«
***
Wie sich über dem Bett der Märchenkinder zwei Feen streiten, wie über dem Haupte der Hunnenkämpfer in der Luft noch die Geister miteinander stritten, so streiten sich über dem Haupte Gallifets unsichtbar zwei Legenden – eine gute und eine böse. Es gibt zwei Gallifets: den »glänzenden Marquis« und den »Bluthund und Mörder«. Zwei Gallifets der Legende!
Welches der Memoirenwerke aus dem Kaiserreich man auch aufschlägt, man begegnet fast überall dem ersten Gallifet, dem glänzenden Marquis. Er ist der geistreich-spöttische, abenteuerlustige, todverachtende Held, der überall, auf der Krim, in Algier, in Italien, in Mexiko, Kriegestrophäen und Frauenherzen erobert. Er 27 führt die Reiterregimenter in der Schlacht mit derselben lustigen Eleganz, wie er am Kaiserhofe die Quadrillen führt. Man sagt, daß ihm in Mexiko eine Granate einen Teil des Unterleibes fortgerissen, und daß er das fehlende Stück durch eine silberne Platte habe ersetzen lassen. Er selber sagt lachend, als das Silber im Werte fällt: »Meine Platte ist um fünfzig Prozent entwertet, was werden meine Gläubiger sagen!« Er überwindet im Duell berühmte Schläger und Schützen und im Zweikampf der Liebe berühmte Schönheiten des Hofes und der Stadt. Und wie es den glücklichen Helden der Legende so geht, man schreibt ihm alle witzigen Worte zu, die im Umlauf sind, und alle kühnen Taten, deren Vollbringer man nicht kennt. Daß er mutig bis zur Tollkühnheit ist, hat er bei dem berühmten Reiterangriff von Sedan gezeigt. Daß er die hinreißende Kraft seiner eigenen Tollkühnheit kennt, beweist sein Wort: »Der Soldat wird mir überallhin folgen, wo er mich auf meinem Pferde sehen wird.«
Dann der Gallifet der anderen Legende – der »Mörder«! Die böse der beiden Legenden erzählt, daß der General in den Tagen des Kommuneaufstandes auf der Straße von Versailles einen Zug gefangener Kommunards getroffen habe. Er habe den Zug halten lassen, habe die Ältesten ausgewählt – dreißig sagen die einen, achtzig die anderen, hundert und elf noch andere –, habe ihnen gesagt: »Ihr seid doppelt schuldig, denn ihr habt schon die Revolution von 1848 gesehen und wißt, was das bedeutet!« und habe sie erschießen lassen. Er soll jedem der Opfer gesagt haben: »Ich heiße Gallifet!« und soll eine Zigarette dabei 28





























