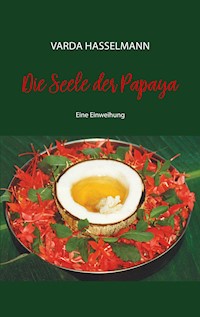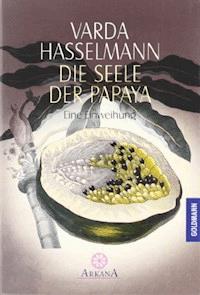
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In Südindien findet die Münchner Ärztin Doris auf abenteuerliche Weise ihre wahre Bestimmung. Sie gelangt zu einem Stamm von Ureinwohnern, dessen Sitten und Gebräuche unverändert erhalten geblieben sind. Sie lernt viel über das Weltbild der Stammesleute und nimmt Einblick in deren Spiritualität. Nach und nach muß sie ihre alten Denk- und Verhaltensmuster in Frage stellen.
Doch ist dies nur die Vorbereitung auf eine noch größere Prüfung. Bevor sich für Doris das Tor zu ihrem wahren Selbst öffnet, muß sie die Initiation der Papaya-Gottheit bestehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 773
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Die Münchner Ärztin und Psychoanalytikerin Doris Guthknecht gerät im südindischen Kérala in das Abenteuer ihres Lebens. Sie gelangt zu einem Stamm von Ureinwohnern, dessen Sitten und Gebräuche seit Jahrhunderten unverändert erhalten geblieben sind. Ein Unfall zwingt Doris zu einem längeren Aufenthalt bei den Taki. Sie lernt das Weltbild der Stammesleute kennen und nimmt Einblick in deren urtümliche Spiritualität. In dieser Ausnahmesituation als Fremde, Hilflose und Kranke gerät sie an die Grenzen ihrer alten Persönlichkeit. Nach und nach muß sie ihre alten Denk- und Verhaltensmuster in Frage stellen. Sie begegnet ihrem Seelenzwilling. So wird sie herausgefordert, die Welt mit neuen Augen zu sehen.
Die erzwungene Ruhe ist nur die Vorbereitung auf eine noch größere Prüfung. Viele Zeichen deuten darauf hin, daß Doris davorsteht, ihren eigentlichen Lebens- und Seelenauftrag zu erkennen. Aber bevor sich für Doris das Tor zu ihrem wahren Selbst öffnet, muß sie die Initiation der Papaya-Gottheit bestehen.
Autorin
Dr. Varda Hasselmann entschied sich gegen eine Universitätskarriere als Mediävistin und für den Ausdruck ihrer außerordentlichen medialen Begabung. Seit 1983 arbeitet sie als Trancemedium und hat sich durch ihre zusammen mit Frank Schmolke veröffentlichten Sachbücher, Seminare und Vorträge einen Namen gemacht. »Die Seele der Papaya« ist ihr erster Roman.
Inhaltsverzeichnis
Rührmichnichtan
Seit vielen Stunden starre ich durch das kleine Fenster ins Dunkel. Ich kann nicht schlafen. Meine Mitreisenden dösen unruhig in ihren unbequemen Sitzen. Indien, das Land der wundersamen Begebenheiten, liegt schon sehr weit hinter uns.
Bald werden wir in München sein. Dann nimmt alles wieder seinen gewohnten Gang. Einkaufen, heizen, Rechnungen bezahlen, Bekannte anrufen, mich zurückmelden. Fragen beantworten. Ich werde mich zusammenreißen. So tun, als ob. Das habe ich schließlich früher gut gekonnt. Trotzdem überkommt mich Verzweiflung, wenn ich daran denke.
Was soll ich bloß antworten, wenn Freunde und Nachbarn mich fragen, was ich auf meiner langen Reise erlebt habe? Soll ich sagen, daß ich monatelang verschollen war – gefangen, vergiftet und krank, gemartert von einem Stamm wilder Ureinwohner? Alles nicht falsch, gewiß, und trotzdem nicht die Wahrheit. Ich kann mir vorstellen, wie die Boulevardzeitungen es gern für eine saftige Schlagzeile hätten: »Münchnerin überlebt grausamen Blutkult in Indien«, zum Beispiel. Stimmt, stimmt genau. Aber mit dem, was wirklich geschehen ist, hat das nur indirekt zu tun.
Mir war beschieden, etwas Großes zu erleben – erschrekkend, schwer verständlich und beglückend. An mir, einer ganz gewöhnlichen, nicht besonders vergeistigten Psychoanalytikerin, ist die Prophezeiung eines indischen Wandermönchs in Erfüllung gegangen.
Die Maschinen des großen Flugzeugs dröhnen unerträglich laut. Beunruhigt stelle ich fest, daß ich während der neun Monate meiner Abwesenheit niemals so empfindlich und heillos durcheinander war wie gerade jetzt. Wie bin ich überhaupt in dieses wirre Abenteuer hineingeraten? Die bunten Splitter und glitzernden Spiegelscherben im Kaleidoskop meiner Erinnerung bilden ständig neue Bilder, wenn der Wille, sie zu ordnen, an ihnen rüttelt. Wann kam das erste Steinchen ins Rollen? Welche meiner Entscheidungen hat es gelöst?
Sinn und Zweck kann ich in dem Wirrwarr nicht ausmachen. Ich habe ja noch nicht einmal begriffen, was mit mir geschehen ist, weiß nur, daß ich mich nicht mehr kenne. Mein analytischer Verstand wird in den nächsten Tagen seine Pflicht tun müssen. Ich möchte verstehen. Endlich verstehen.
Wie ich das Ereignis, das mich so verändert hat, bezeichnen soll, weiß ich nicht. Manchmal frage ich mich, ob es vielleicht etwas mit Erleuchtung zu tun hat. Aber darunter habe ich mir etwas völlig anderes vorgestellt – vollkommene Bewußtheit zum Beispiel, unablässige Liebe, Bedingungslosigkeit, Bedürfnislosigkeit, leuchtende Weisheit. Mit solchen Eigenschaften kann ich gewiß nicht aufwarten. Totale Souveränität? Mitnichten. Eher Humanität, im tiefsten Wortsinn. Ja, das ist es wohl. Mutter India hat mich zum Menschen gemacht.
Grelle Angst, dumpfes Entsetzen und auch die vielen körperlichen Schmerzen, die ich erlitten habe, lauern wie hungrige Raubtiere hinter dem dünnen Gitter der verstreichenden Zeit, die – so sagt man – alle Wunden heilt. Im Grunde muß ich mich als schwer traumatisiert betrachten. Und trotzdem fühle ich mich unbeschreiblich glücklich! Merkwürdiges Krankheitsbild.
Bin ich denn froh, daß alles vorbei ist? Nein, das wäre nur die halbe Wahrheit. Mit jeder Faser meines Leibes sehne ich mich in das palmengesäumte Dorf zurück, aus dem ich erst vor zwei Wochen unter Lebensgefahr entkommen bin. Bei der Heimkehr nach München, mit dem Eintauchen in das einst Gewohnte, beginnt die Feuerprobe. Jetzt erst wird sich erweisen, was die Veränderungen, die ich in der Tiefe meines Wesens wahrnehme, wirklich bedeuten.
Zwischen Vergangenheit und Zukunft klafft der Abgrund meiner noch unverarbeiteten Erlebnisse. Mache ich mir Illusionen über meine Wandlung? Niemand kehrt völlig unverändert von einer so langen Reise zurück. Man möchte ja gern etwas ganz Besonderes sein, weil man seine eigene Bedeutungslosigkeit nur schwer ertragen kann. Bin ich auch so? Zum Teufel, wie soll ich das herausfinden?
Wieder schirme ich meine Augen gegen das Licht in der Kabine ab und blicke aus dem Fenster. Die Sterne verblassen. Durch eiskalte Luft fliegen wir über das menschenleere Arabien. Nichts als Sand und Steine. Hier kann ein Mensch erfahren, was Einsamkeit ist. Ich warte auf das Glutrot des Morgens. Dann blenden mich die ersten Sonnenstrahlen wie Blitze von kosmischer Gewalt, zu stark für meine müden Augen. Ich muß sie schließen.
Was soll ich nur tun? Der Schmerz hinter meiner Stirn wird schärfer. Krampfhaft überlege ich, was ich wirklich brauche, jetzt bei meiner Rückkehr. Es macht mir Mühe. Dann erhellt ein Blitz der Erkenntnis meine Gedanken. Natürlich, das ist es: Ich muß noch eine Weile allein sein!
Erleichterung läßt mich aufatmen. Zum Alleinsein brauche ich keine Wüste. Mein Zuhause soll meine Einsiedelei sein. Isolation von der Welt wird mir Klarheit schenken.
Rückkehr braucht Zeit. Niemand drängt mich, Gott sei Dank. Ich bin sehr empfindlich, fühle mich fast hautlos. Deshalb werde ich mich erst einmal verkriechen. Ich möchte nur für mich dasein. Daß ich zurück in Deutschland bin, geht schließlich keinen etwas an.
Der Kopfschmerz ist plötzlich verflogen. Man reicht mir ein heißes, feuchtes Tuch. Damit reibe ich die letzten Verspannungen von Stirn und Nacken. Ich fühle mich befreit von der quälenden Sorge; ich weiß jetzt, was der nächste Schritt sein wird.
Duft von Semmeln und frischem Filterkaffee zieht durch die Kabine, deutsches Frühstück, heimatlicher Gruß. Und während ich Erdbeerkonfitüre auf Vollkornbrot streiche, stelle ich mir die kommenden zehn, zwölf Tage und Nächte vor wie das Leben unter einer Inkubationshaube. Ja, ich brauche Schutz, einen Ort der Sammlung. Dort muß ich bleiben, bis ich weiß, wer ich bin.
In der Halle bedrängen mich nervöse Leute von allen Seiten. Ich rieche Ungewaschenes und Kölnisch Wasser, höre aufgekratztes Schnattern. Sie tauschen noch Adressen aus, trotz ihrer von Schlaflosigkeit kleinen Augen. Drogenhunde umkreisen uns. Kleinkinder quengeln. Die Reisenacht ist lang gewesen. Raucher zünden sich ihre Zigarette an, während wir vor der Paßkontrolle Schlange stehen.
Der Morgenhimmel, aus dem ich soeben herabgestiegen bin, wölbt sich in einem ungewohnt sanften, lichtzarten Oktoberblau über mir. Diese Herbstluft macht mich glücklich. Ich atme tief ein und rüste mich für den nächsten Schritt.
Es riecht feucht und erdig. Der Duft erinnert mich an frühmorgendliche Schulwege, an den ersten Tag nach den Herbstferien. Die deutsche Welt wirkt sauber gewaschen, ordentlich gekämmt, grau und angespannt. Das Taxi fährt mich nach Alt-Solln, vorbei am Einkaufszentrum mit Müller-Brot, Wurst vom Vinzenz Murr, Reinigung, Haltestelle und Apotheke. Die Gegend ist mir in allen Einzelheiten bekannt wie aus einem Déjà-vu. Hier ist mein Zuhause. Ich weiß es, aber es will mir nicht in den Kopf.
Beim Öffnen der Wagentür rutschen Paß und Flugschein von meinem Schoß. Wie ungeschickt! Erst das Geld geben, auf den Rest warten, und dann mußt du den Schlüssel aus der Tasche holen. Du weißt doch noch, wie das alles geht, stell dich nicht an, konzentriere dich. Sei nicht albern, Doris, schließlich warst du ja nicht zwanzig Jahre lang fort, sondern kaum zehn Monate. Oh, die alte vertraute Stimme, die immer so ungeduldig mit mir redet, da ist sie wieder!
Laß nur! kontert eine andere, die verständnisvoller klingt. So, wie du dich fühlst, kommst du von einem anderen Stern. Du hast dich nicht unter Kontrolle. Wozu auch? Du bist hilflos. Aber das macht nichts.
Die zweite Stimme ist neu und tröstet mich. Interessiert höre ich ihr zu. Ein halbes Jahrhundert lang bin ich effizient gewesen, hatte immer alles im Griff. Darauf war ich sehr stolz. Eine fähige Person. Nicht gerade ein Superweib, nein, keine perfekten Kinder, atemberaubenden Karrieresprünge und berauschenden Liebhaber. Auf meine bescheidene Art war ich funktionstüchtig und durchaus mit mir zufrieden. Die Traumfrau war ich nie. Aber in meinem Leben herrschten einst Ruhe und Ordnung.
Damit ist es wohl vorbei. Als mir das klar wird, mischt sich ein wenig Besorgnis in meine Zuversicht. Neugierig, ohne besondere Beteiligung, betrachte ich diese Gemütsbewegung, als sei sie eine Ameise, die über den Fußboden läuft. Das ist auch neu.
Umständlich sammle ich die Dokumente, mit denen ich nachweisen könnte, wer ich einmal war, wieder auf, wische den Paß an meinem Rock sauber. Dann packe ich entschlossen die Griffe meines Beutels und stehe vor dem niedrigen Gartentor, wie tausendmal zuvor.
Hoffentlich sieht mich keiner. Feuchte Blätter wehen mir entgegen, ein Windstoß unterstützt mich beim Niederdrücken der Klinke. Eingraviert in das ungeputzte Messingschild liest man die Aufschrift: Dr. med. D. Guthknecht, Psychotherapie, Psychoanalyse, alle Kassen, Sprechstunde nur nach tel. Vereinbarung.
Nun ja, das bin ich. Das war ich.
Das Gartentor hängt ein wenig schief. Auf diesem morschen Holz habe ich als Kind gehangen, um zu schaukeln. Und ich höre Mutter zetern, was es kosten wird, die Pfosten zu erneuern, wenn ich die rostigen Türangeln endgültig aus ihrer Verankerung gerissen habe. Meine Füße frieren in den Sandalen, die nackten Zehen berühren das feuchtglänzende Weinlaub, das die ganze Hausfassade überwuchert und den Weg bedeckt mit seinem abgeworfenen bunten Schuppenkleid.
Das Häuschen wurde noch vor dem Krieg erbaut, bescheiden und schmalbrüstig. Inzwischen gilt die Gegend wegen der Villen und Gärten als nobel. »Da wohnt der Unhold!« sagten die Nachbarn und zeigten anklagend auf unsere Tür. Nach Vaters Tod, als Mutter und ich endlich allein, ohne den bedrohlichen Mann, im Haus lebten, haben wir eine Panzertür einsetzen lassen. So fühlten wir uns sicher. Nichts konnte hinausdringen. Niemand konnte hinein.
Meine brave Bürgerlichkeit, meine leicht spießige Fassade, die sich nicht nur an Haus, Kleidern, Schuhen und Brille zeigte, sondern im Laufe der Jahrzehnte wie ein Pilzmyzel mein innerstes Wesen zu befallen drohte, ist mir selbst manches Mal auf die Nerven gegangen. Aber das war nicht zu ändern, ich wollte es so. Die Leute sollten mich, die Tochter des Unholds, für hausbacken und rechtschaffen halten. Ich brauchte das dringend, nach allem, was ich in meiner unseligen Jungmädchenzeit durchgemacht hatte. Üble Nachrede, Getuschel und Gespött sollten bei Doris Guthknecht keinen, aber auch gar keinen Ansatzpunkt finden. Niemals! Lieber soweit als möglich unsichtbar bleiben, lieber bieder als kokett wirken.
Ich wollte wirtschaftlich unabhängig sein, selbstbestimmt leben, hatte meine Arbeit, meine Bücher, die Reisen. Anfangs gab es auch nette Freundinnen, doch unsere Lebensschicksale trennten uns. Die meisten Frauen in meinem Umfeld waren verheiratet oder hatten das, was man eine Beziehung nennt. Sie konnten nie begreifen, warum ich keinen Freund hatte. Ich mochte es ihnen nicht erklären, weil ich selbst keine überzeugende Antwort wußte. Sex mit Männern interessierte mich wenig, mit Frauen schon gar nicht. »Prüde ist sie eben, unsere Doris!« tuschelten sie. Nun ja. Nicht prinzipiell, nicht geistig. Nicht, wenn es die Patienten und ihre erotischen Geheimnisse betraf. Aber persönlich eben doch. Über eine altjüngferliche Verklemmtheit, ein bißchen ungewöhnlich angesichts der neunziger Jahre, konnte ich mich nicht hinwegtäuschen – Unsicherheit, Schamgefühle und altmodische Einstellungen. Ich bin eine anständige Frau, sagten Blick und Bluse. Und dabei war es dann auch meistens geblieben.
Bis zu dieser Indienreise. Meine Güte! Das Schicksal hielt für mich noch ungeahnte Abenteuer bereit. »Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elefanten und Tiger zu Hause sind.« Das steht in den Wahlverwandtschaften, obgleich die Heldin niemals einen Fuß aus Deutschland hinausgesetzt hat. Ich hingegen habe es am eigenen Leib erlebt. Dabei wollte ich nur Urlaub machen. Ist das Los der Menschen nun vorbestimmt, oder nicht? Wer, zum Donnerwetter, befindet über mein Leben? Wer außer mir? Ich bin verwirrt.
Das Sicherheitsschloß dreimal rechtsherum und dann den Knauf etwas vorziehen. Es ist vielleicht das größte aller Wunder, daß ich diesen Schlüsselbund auf all meinen Irrwegen durch inneres und äußeres Niemandsland nicht verloren habe.
Verstört bin ich und dankbar zugleich, daß niemand mir freudestrahlend mit Schürze und Kuchenduft in den Haaren entgegenkommt. Da bist du ja, liebes Kind! Wie geht es dir? Wie war es denn, erzähl mal! Und warum hast du denn gar nicht mehr geschrieben? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Aber nun bist du ja heil wieder da, wo du hingehörst.
Dankbar für die Stille, aber auch enttäuscht von der Leere. Ich könnte jetzt unmöglich erzählen und erklären, vermisse trotzdem den mütterlichen Jubel, ihre Wiedersehensfreude und die besorgten Fragen, weil ich nie wieder ihre Stimme hören werde und heute, bei meiner Heimkehr, keinen zärtlichen Kuß auf meiner Wange spüre. Ihre Arme umfangen mich nicht. Das verschmitzte Lächeln der weit vorstehenden Zähne, der Geruch ihrer alten Haut – vorbei, für immer. Ihre Strickjacke hängt an der Garderobe, daneben der Hut, den sie zum Einkaufen aufsetzte. Meine Hände streicheln sehnsüchtig über weiche Mohairwolle. Ich habe ja selbst beschlossen, vorerst niemandem zu sagen, daß ich wieder da bin. Aber daß sie nicht da ist, daß mich kein Mensch empfängt, das schmerzt auch.
Alles ist genau wie immer, und alles ist ganz anders. Die Welt ist mir neu, als sei ich soeben geboren, ein Säugling mit alten Erinnerungen. Was ich hier sehe, rieche und höre ist wie das Echo einer vergangenen Existenz, deren Bilder mit visionärer Kraft in mein Bewußtsein von heute drängen.
Als sei ich zu Besuch, gehe ich zögernd durch das Haus. Dabei habe ich das seltsame Gefühl, ein sanft strahlender Leuchtkörper zu sein. Eine Wunderlampe.
Im Arbeitszimmer steht gut verschlossen der metallene Aktenschrank mit der Patientenkartei. Ringsumher Bücher, die mich geprägt haben. Der alte Ledersessel trägt den Abdruck meines Körpers. Wie viele Jahre habe ich hier gesessen! Meine Augen schauen sich um. Ich erinnere jeden einzelnen Gegenstand, aber es ist ein Wiedererkennen wie im Traum oder wie auf alten Fotografien. Diese unendlich vertrauten Dinge erzeugen ein Echo, das mein Herz berührt und wärmt. Und auch eine vollkommen gleichgültige Distanz. Mein Kopf fühlt sich an, als trüge ich ihn sorgfältig abgetrennt unter dem Arm.
Im Wohnzimmer knarzt an der altgewohnten Stelle der Holzfußboden. Mit kalten Füßen gehe ich durch die unbewohnten Räume, spüre die Grabesruhe dieses Hauses. Die Fenster sind ungeputzt, die Luft riecht abgestanden. Ich werde heizen müssen. Das wird keiner merken. Und die Lampen? Ihr Licht könnte mich verraten. Lieber im Dunkeln hocken. In Indien hatten wir nachts auch kein Licht.
Nein, ich will in den nächsten Tagen niemanden sehen, sprechen oder hören. Nichts erzählen müssen, bevor ich selbst verstanden habe, was mit mir geschehen ist.
Mein Mund ist trocken, der Speichel schmeckt zäh und salzig. Ich drehe den Hahn im Badezimmer auf. Wasser spritzt leicht bräunlich in das Becken, und in dem Rohr hinter den Fliesen ächzt es, daß ich zusammenfahre. Gesicht und Hände werden gewaschen. Ich trinke lange. Ein Handtuch ist nicht da; es muß erst aus dem Wäscheschrank geholt werden.
Im Spiegel erblicke ich mein Gesicht. Das also ist die Person, die hier wohnt. Sie gefällt mir, auch wenn sie mir noch ein wenig fremd vorkommt, als sei sie eine Cousine, die mir ähnlich sieht. Eine weiche, unter der Bräune blasse Nase, der Mund ungeschminkt. Die grünblauen Augen blicken mir suchend entgegen. Das Gesicht ist geschmückt mit ein paar Sommersprossen, schmal und fest in den Konturen. Wassertropfen glitzern auf meiner Haut, bahnen sich über die winzigen Fältchen hinweg ihren Weg.
Mit beiden Händen löse ich den Knoten, bis mein starkes, gewelltes Haar in voller, prächtiger Schwere nach unten schwingt. Es reicht mir lang den Rücken herab, weil ich es mein Leben lang nicht habe schneiden lassen. Ich kann mich damit zudecken wie Maria Magdalena, die herrliche Sünderin auf Tizians Bild.
Heute gefalle ich mir und freue mich an meinem Anblick. Am liebsten möchte ich singen. Diese rotblonde Mähne, leicht gelockt an den Schläfen und ungewöhnlich dicht, ist schon immer mein heimlicher Stolz gewesen. Heimlich, weil ich sie fast niemals offen trug, sondern immer brav geflochten oder hochgesteckt. Einer Frau Doktor angemessen.
Ich habe mich immer für einen Menschen gehalten, dem man nichts vormachen kann, der in allen Lebenslagen allein zurechtkommt. Willenskraft war mein höchstes Gut, meine stärkste Eigenschaft. Jedenfalls war ich vor meiner Abreise noch klar definiert: Psychotherapeutin, alleinstehend, 49 Jahre, 183 cm, 95 kg, Autorin mehrerer Zeitschriftenbeiträge, Hausbesitzerin. Und wer ist die Frau, die mir heute aus dem Spiegel entgegensieht?
Das ganze Ausmaß der Wandlung erahne ich erst jetzt. Meine Augen mustern mich eher neugierig als analytischstreng. Trotz aller Mattigkeit zeigen sie einen munteren und milden Ausdruck, unvertraut. Dabei sehen sie uralt aus, müde von vielen Leben, wissend und voll tief menschlichen Mitgefühls. Meine Nasenspitze berührt die kühle Spiegelfläche, als sich mein Gesicht dieser anderen, jünger scheinenden Frau nähert, wie um sie zu küssen. Ihr Blick weicht dem meinen nicht aus. Sie strahlt mich an, ohne zu lächeln.
Ein Handtuch, Strickjacke und dicke Socken brauche ich jetzt. Das Haus ist ausgekühlt. Als ich die Tür zu Mutters Schlafzimmer öffne, muß ich schlucken, und mein Herz beginnt zu flattern. Hier hat sie ihr Leben verbracht, hier ist sie hinübergegangen. Hier habe ich ihr in den Monaten der Bettlägerigkeit beigestanden, in diesem Raum sind wir uns endlich wirklich nahegekommen. Ob du mich jetzt sehen kannst? Mutter und Kind erkennen sich am Geruch und am Herzschlag. Seit sie begraben wurde, habe ich keine Familie mehr. Beide Eltern sind Einzelkinder gewesen.
Ihr großes Bett ist frisch überzogen, als käme sie wieder, um darin zu schlafen. Hier wurde ich gezeugt und geboren. Wie viele Stunden habe ich als Kind unter ihrem Federbett verbracht, wenn sie mir Geschichten und Märchen erzählte, vom bösen Wolf, der die sieben Geißlein und das Rotkäppchen frißt und am Ende mit aufgeschlitztem Bauch daliegt. Hier saßen wir auf der Bettkante, als die Nachricht von Vaters Selbstmord kam. Hier wusch ich sie, fütterte sie, hielt ihre Hand und flüsterte in ihr Ohr, bis sie den letzten Atemzug tun konnte.
Es hat gar keinen Zweck, daß ich mich zusammennehme. Ich kann das nicht mehr so wie früher. Meine Augen sind schon ganz heiß und trocken, das Kinn bebt, der Atem geht schneller. Es ist nicht die Trauer, die mich überwältigt, sondern eine dankbare Freude. Mama, du hast mir eine zweite Geburt geschenkt! Wärst du nicht gestorben, hätte ich mich von den Flügeln meiner Seele nicht forttragen lassen und vielleicht niemals erfahren, daß ich fliegen kann.
Dann hast du mich mutterseelenallein und gut versorgt zurückgelassen, frei von allen Bindungen. In dem Umschlag mit dem Testament fand ich nach deiner Beerdigung einen rührenden Zettel, schon mit zittriger Hand geschrieben.
Doris, meine große Kleine,
Du hast von mir ja noch nie einen Brief gekriegt, und wenn Du den hier liest, bin ich schon tot. Jetzt ist bald Abschied. Gar nicht so einfach. Schau mal in das Sparbuch! Freust Du Dich über das Geld? Hundertachtzigtausend! Das habe ich alles nur für Dich gespart. Die Erbschaft von der Oma und den Lotto-Fünfer. Und viel vom Haushaltsgeld. Erst sollte es ja für Deine Aussteuer sein, aber nun hast Du Dich so lieb um mich gekümmert, statt für Mann und Kinder zu sorgen. Haben doch noch gute Zeiten zusammen gehabt. Obwohl Enkelkinderle auch herrlich gewesen wären. Vielen Dank für alles, das war so schön für mich auf meine alten Tage, wie es dann gekommen ist. Wenn Du das Sparbuch findest, schau ich vielleicht von oben runter und freu mich über Dein Gesicht.
Aber nicht weitersparen! Sei nicht albern, genieß das Geld! Schließ die Praxis zu, und erhol Dich von der langen Pflege. Sonst wirst Du noch krank! Du könntest doch mal ein Jahr freinehmen und verreisen. Meine Doris. Bist auch bald fünfzig! Ich wünsch Dir noch ein gutes Leben. Daß ich Dich auf die Welt gebracht habe, war mein größtes Glück.
Deine alte Mama
Kurze Zeit später beschloß ich, die damit verbundene zärtliche Aufforderung wie einen »letzten Willen« zu betrachten. Zunächst fiel es mir schwer, mich innerlich zum Nichtstun bereit zu finden. Ich hatte immer mehr geleistet, als eigentlich nötig war. Das war mir völlig klar, ohne daß ich es deshalb zu ändern vermochte. Schon seit längerer Zeit hatte ich allerdings mit meiner Lebensenergie auf Kredit gelebt, hatte mit energischer Willenskraft das Letzte aus mir herausgeholt. Doch immer häufiger ertappte ich mich dabei, wie ich morgens um sieben wünschte, die Patienten würden absagen oder ich hätte eine fiebrige Grippe, die mir eine Rechtfertigung bieten würde, liegenzubleiben. Nur mein eiserner Wille hielt mich noch aufrecht. Ich war müde, sehr müde.
Meinen Beruf mit der Möglichkeit, einem Menschen durch aufmerksames Lauschen und einfühlsames Fragen zu helfen, daß er wieder heil werden kann, habe ich immer geliebt. Ich hatte Freude am Entdecken verborgener Zusammenhänge, am Deuten der Träume und am Diskutieren neuer Lebensstrategien. Doch als Mutter mich mehr brauchte als alle anderen Menschen, habe ich keine neuen Patienten mehr angenommen. Nachdem dann mein Entschluß, nach Indien zu reisen, feststand, konnte ich die wenigen, die ich noch betreute, bei einem Kollegen in gute Hände geben.
Seinerzeit mochte ich mir nicht eingestehen, daß ich nicht nur körperlich erschöpft war. Ich verbarg meine beginnende Depression unter Aktivismus, schlief schlecht, litt unter den Beschwerden der Menopause. Vor allem aber plagte mich – bei aller Rechtfertigung meines Lebens als erfolgreich Helfende – ein mir völlig unerklärliches Sinnlosigkeitsgefühl. Ich stand vor einer dicken Wand aus milchigem Glas, für Blicke gänzlich undurchdringlich. Mein Alltag war erfüllt. Und trotzdem bewegte mich immer häufiger die Frage: Wozu arbeite und helfe ich, wozu lebe ich überhaupt? Aus dem Nebel jener Tage kam keine Antwort.
Ohne es mir eingestehen zu wollen, war ich dort angelangt, wo jede Suche beginnt: am Ende. Ich fühlte mich trocken, leer und kühl, trotz der heftigen Hitzewallungen. Meine Theorien über Welt, Menschheit und Geschichte, über Gott und den Tod und die Liebe konnten mich weder satt machen noch wärmen.
Mama hat offenbar mit der erhöhten Sensibilität der Sterbenden gespürt, daß ihre Tochter, die immer für andere dasein wollte, selbst nicht mehr heil war.
Während jetzt warme Tränenströme der Dankbarkeit über mein Gesicht fließen und auf meine Hände tropfen, wird meine Brust ganz weit, und ich bin mir sicher, daß sie weiß, was ich empfinde. Ich habe das Geschenk gewürdigt und mit meinem Pfunde gewuchert. Die Zinsen der Liebe und der Erkenntnis, die mir in Indien zugewiesen wurden, werde ich bald großzügig verteilen, das verspreche ich.
Wieder fällt mein Blick auf das große, weiche Bett. »Darf ich heute bei dir schlafen?« bettelte ich als kleines Mädchen, wenn Vater nicht da war. »Bei dir ist es viel schöner!« Und wie damals flüchte ich mich heute, am Tag meiner Rückkehr aus dem mystischen Indien, in die Geborgenheit und Wärme der mütterlichen Federn. Selig krieche ich unter das dicke Plumeau und fühle mich endlich einmal wieder vollkommen sicher.
Gewürzküste
In diesem großen, weichen Bett, gekuschelt in Kissen und Federn, eingehüllt in den animalischen Geruch von zu Hause und Mutter erwache ich nach vielen Stunden tiefen Schlafs. Es herrscht Totenstille, kein Kind schreit, kein Vogel ruft.
Ich nehme nichts anderes wahr als meinen Atem und das kaum vernehmbare Rascheln der Daunendecke, die sich auf meiner Brust hebt und senkt. Ohne die Augen zu öffnen, weiß ich sogleich, wo ich bin und daß es stockfinster ist im Zimmer und im Garten. In Narvan, meinem südindischen Dorf, färbte sich zu dieser Stunde der Himmel schon graugrün, und die großen schwarzschillernden Krähen, die sich zur Nacht auf ausladende Palmwedel gesetzt hatten, hoben zu Tausenden an mit Schnarren, Kreischen und Krächzen, alle auf einmal. Das Sternenlicht der tropischen Nacht verlöschte schnell. Kaum hatte man sich von dem harten Lager erhoben, wurde der Himmel erst grün und dann weiß. Der Feuerball tauchte steil aus dem Horizont auf. Am frühen Morgen erntete man die Früchte der Papaya.
In München hingegen sind die Nächte im Oktober schon lang, und nur langsam wird es am Morgen hell. Ich ahne, will aber nicht nachschauen, wieviel Uhr es sein könnte – vier, fünf Uhr vielleicht, und ich kann weder schlafen noch wachen. Meine Gliedmaßen rühren sich nicht. Mit einer Bewegung würde unweigerlich ein Bann gelöst, der mich im Niemandsland festhält, in der Zeit zwischen gestern und morgen, im Gleichgewicht von einst und jetzt, wo der Geist Traumfarben wählt.
Die Arbeit kann beginnen. Jetzt ist meine Zeit. Wieder beschäftigt mich die Frage nach den Gesetzen, unter deren Macht die Sinnhaftigkeit eines menschlichen Lebens sich entfaltet. Im Muster eines Lebensteppichs wirken Zufall und Absicht zusammen. Ich denke an meine Ahnen, an die Freunde und Kollegen. Sogar meine Patienten haben mich beeinflußt. Ich denke an all die wunderbaren Menschen, denen ich auf meiner Reise begegnet bin. Sie haben mich ebenso unauslöschlich geprägt wie die Gene von Vater und Mutter, mit ihrem Sein und mit ihrem Tun.
Geborgen in Mutters Bett lasse ich mich fallen. Tief und tiefer schwebe ich in den kühlen Brunnenschacht der Erinnerung hinab. Ich weiß, dort unten kann ich alles aus einer neuen Ruhe und Sicherheit heraus betrachten. Die Bilder des vergangenen Jahres entrollen sich rasch, die bezaubernden und die schrecklichen. Ich kann sie riechen, schmecken, in allen Schattierungen sehen. Ich falle und falle und lande in Bombay.
Wieder einmal betrat ich Indiens Boden, diesmal an einem Januarmorgen noch vor Sonnenaufgang. Mit wollüstiger Ekstase sog ich die feucht-schwere, übelriechende Luft ein, ah!
Schon während der Studienzeit hatte ich alles Geld zusammengekratzt, um reisen zu können, anfangs immer wieder in die herrlichen Hauptstädte Europas, dann kam, nach dem Staatsexamen, mein erster Flug in die Vereinigten Staaten. Da war mir schon, als hätte ich alles gesehen, was ein Mensch sehen muß. An Asien hatte ich niemals gedacht. Die Länder der dritten Welt waren mir unheimlich und erschienen mir reichlich unappetitlich. Ich fürchtete mich vor dem Anblick des Elends, und es schauderte mich bei der Vorstellung, irgendwo mit Amöbenruhr oder Malariafieber in einem kahlen Hotelzimmer zu schmachten. Jemand hatte mir von rattengroßen Kakerlaken und von giftigen Kröten in der Dusche berichtet. Das war nichts für mich!
Mitte der siebziger Jahre wollte das Schicksal mir auf die Sprünge helfen. Es sorgte dafür, daß ich ein Preisausschreiben der Air India in die Hand bekam. Einige Monate später wurde mir mitgeteilt, ich sei die glückliche Gewinnerin einer zweiwöchigen Flugreise, Namasté! Die Gewißheit, daß mir in indischen Nobelherbergen, die von amerikanischen Reisegruppen gebucht werden, unter hygienischen Aspekten nichts Übles zustoßen konnte, ließ mich den Gewinn mit Freuden annehmen.
Also flog ich im Januar 1976 voller Spannung und heimlicher Vorbehalte von Frankfurt nach Delhi. Von dort aus nächtigte ich innerhalb von zwei Wochen in neun verschiedenen märchenhaften Hotelpalästen, wurde mit Blumenkränzen, Räucherwerk, Elefanten, bestickten Seidenstoffen und Musikanten feierlich von Station zu Station geleitet. Ganz Indien lag mir zu Füßen, nur berührten meine Füße kaum den Boden. Den Palast der Winde in Jaipur und die Tempelstadt von Madurai, Goas weiße Strände und der britische Gerichtshof von Bombay, hagere Turbanträger auf ihren Kamelen in Rajastan und arglose Kindergesichter bei den Tamilen, Computerwelt in Bangalore und Höhlenheiligtümer in Ajanta, schreiende Affen und steinerne Stiere, Gestank und Hitze, Saris und Curries – alles bildete in mir am Schluß ein heilloses Durcheinander, verschmolz zu einer psychedelischen, schwindelerregenden Vision dieser fremden Welt und endete in einem vollklimatisierten, abgedunkelten Raum mit einer regelrechten Nervenkrise, mit Durchfall und Erbrechen. Gerade noch rechtzeitig erreichte ich meinen Heimflug.
Trotz allem – Indien wurde meine große Liebe. Die immerwährende Sehnsucht, dieses obskure Objekt meiner Begierde wiederzusehen und besser kennenzulernen, zu begreifen, was ich nur mit flüchtigem Entzücken erblickt hatte, mündete in die verwirrende Einsicht, daß mir dies niemals gelingen würde. Unzusammenhängende Eindrücke, Bruchstücke von Informationen und einzelne sinnliche Kostbarkeiten: Farben, Stimmen, Gerüche, Gesichter – das war alles. Ich fühlte mich wie eine Prinzessin auf der Suche nach dem ihr ewig vorherbestimmten Geliebten. Seltsam, nun weiß ich, was es damit auf sich hatte.
Danach reiste ich einmal mit bleischweren Koffern voller ängstlicher Absicherungen und einem vorgebuchten Hotelarrangement umher, und beim drittenmal wagte ich es, schon etwas mutiger, als ältere Rucksacktouristin in die exotische Welt der Globetrotter einzutauchen. Sie kam mir manchmal noch merkwürdiger vor als das mystische Indien.
Im Kontakt mit der Bevölkerung kam mir mein gewandtes, britisch gefärbtes Englisch sehr zustatten. Als alleinreisende Frau erregte ich natürlich auch Neugier, und manches Mal genoß ich die Gastfreundschaft von Einheimischen. Immer wieder gab es irgendeinen ehrgeizigen Ingenieur mit reizender Gattin, eine Lehrerin auf der Suche nach einer Brieffreundin, ein Industriellenpaar mit Sehnsucht nach Europa, die mich einluden. Man akzeptierte und lobte mich, weil ich so anständig gekleidet auftrat, mit langem Rock und halbem Ärmel, oft auch mit einem Tuch auf den Haaren, und mein Doktortitel öffnete mir Türen, die den Trampern und Junkies verschlossen blieben. Nicht selten wurde ich auch als glückbringender ausländischer Gast zu einer der fabelhaften Hochzeiten gebeten. In Überlandbussen kam ich mit Menschen aller Kasten und Berufe ins Gespräch. Mit ihren kontaktfreudigen Reisenden aus aller Welt boten die kleineren Hotels, die einfachen Unterkünfte und einsam gelegenen Rasthäuser vielfältige Anregungen und Begegnungen. Manchmal gab es auch mit jüngeren Männern namens Johnny oder Sven einen schnellvergessenen Flirt.
Dieses Mal war ich gut vorbereitet und hatte eine deutliche Vorstellung von dem, was ich wollte: Erst einmal gründlich ausruhen am Meer, dann die Tempelanlagen von Hampi erkunden und später vielleicht nach Madras fahren. Eine Kollegin wunderte sich, daß ich keinen »Meister« im Programm hätte, so ein langer Urlaub sei doch eine einmalige Gelegenheit! Aber ich hielt nicht gerade viel von Gurus. Eine meiner Patientinnen war aus einem Ashram mit einer Störung zurückgekehrt, die wohl durch täglich acht Stunden Meditation hervorgerufen worden war. Außerdem hatte ich bestürzt mitansehen müssen, wie einige Kollegen zwischendurch mit entrückt leuchtenden Augen in lila Pluderhosen herumliefen. Andere machten morgens um sechs die »Dynamische« oder berieten gar in tibetanischer Mönchstracht mit kahlgeschorenem Schädel ihre Patienten. Das war nichts für mich.
Jetzt, bei meiner vierten Reise, stand ich nicht unter Termindruck, und alles andere würde sich zur rechten Zeit ergeben. Nach einer Jet-lag-Nacht und einem Anpassungstag in Bombay bestieg ich am übernächsten Vormittag ein kleineres Flugzeug nach Trivandrum, der Hauptstadt des südlichsten Bundesstaates.
Kérala! Malabar! Koromandel! Travancore! Cranganore! Allein schon diese klangvollen Namen erfüllten mein Herz mit Entzücken. Ein übers andere Mal ließ ich sie über meine Zunge rollen. Hier in Kérala lag die Küste der Gewürznelken und Zimtrinden, der uralten Handelsstationen, wo Phönizier, Griechen und Römer, Juden, Portugiesen und Holländer ihre Vermögen gemacht und wieder verloren hatten. An diesen Stränden befanden sich die Häfen der Reisenden aus Tausendundeiner Nacht und auch die Missionsstation des Apostels Thomas. Lange vor der Zeitenwende schon nannten sich die Fürsten dieses Landes »Herren der drei Ozeane«. Auf einem so paradiesisch schönen Fleckchen Erde wollte ich einen Urlaub ohne Ziel und festgelegtes Ende verbringen.
Die offene Motorriksha brachte mich nach Kóvalam, dem bekanntesten und schönsten Badeort an der Spitze des riesigen Landes. Ein Zimmer mit berückender Aussicht fand ich sofort in dem kleinen »Rockholm Hotel«, das auf einem ins Meer ragenden Felsvorsprung erbaut war und von nimmermüden schaumgekrönten Wogen umtost wurde. Ich war erschöpft, erregt und glücklich. Hier bleibe ich jetzt, solange ich mag, beschloß ich, ganz gleich, was es kostet, es kommt ja nicht darauf an!
Das Bett war hart, die Matratze dünn, die Einrichtung gewiß nicht gemütlich. Bettwäsche und Handtücher wiesen Löcher auf. Auf dem brandungsumtosten, zerklüfteten Felsmassiv unter meiner Terrasse verrichteten früh am Morgen Männer ungeniert ihre Notdurft, und jenseits der Mauer, die das Hotel umgab, beleidigte eine Müllhalde mit unzähligen bunten Plastiktüten und leeren Wasserflaschen das Auge der westlichen Touristen. Das alles störte mich kaum. Vielmehr faszinierten mich solche Kontraste, und ich machte mir Gedanken über die kulturellen Prägungen im Orient, die Unappetitliches mit der Schönheit der Natur und dem Anspruch eines weltberühmten Badeortes vereinbaren konnten. Meine Fenster blickten auf die kleine Bucht. In der Ferne schimmerte wie eine Fata Morgana über dem Wasser die filigrane weißrosa Moschee des Nachbarortes. Brach die Dunkelheit herein, lange vor dem Abendessen, wurde sie pulsierend erhellt von den mächtigen Strahlen des alten Leuchtturms, der dem Strand unter meinen Fenstern seinen Namen gegeben hatte.
Eine Zeitlang schlief ich zwischen den Bädern in Sonne und Meer zu den unerhörtesten Tageszeiten, mich den ungewohntesten körperlichen Impulsen hingebend. Nachts betrachtete ich den Sternenhimmel, lauschte dem Ozean, schlief wieder, bewunderte abends den fulminanten Sonnenuntergang, las träge in den alten Zeitschriften vom Tisch in der Halle oder durchstöberte den muffigen, verstaubten Bücherschrank nach leichter Reiselektüre. Trotz Ozonloch und Hautkrebsgefahr wollte ich hübsch braun werden, was mir bei meiner sommersprossigen Haut und den rotblonden Haaren nicht gerade leichtfiel.
Da die Hochsaison vorbei war und Touristen das Hotel nicht mehr ganz füllten, war es ruhig. Abgesehen von den vielen, die nach zwei Übernachtungen schon weiterreisten und einigen kleineren Reisegruppen, die ganz unter sich blieben, gab es ein amerikanisches Flitterwochenpaar, älter als ich, mehrere sympathische, kultivierte Schwule aus Zürich und eine indische Familie, die zwei Zimmer im ersten Stock belegte.
Später kam eine kleine Reisegruppe aus Bayern hinzu, die sich vierzehn Tage lang um einen spirituellen Lehrer scharte. Der fast Achtzigjährige, aus Bombay angereist, hieß Ramesh Balsekar. Von weitem wirkte er auf mich klug, angenehm, normal. Seine Augen unter der glatten Stirn blickten freundlich, waren aber von tiefen Schatten umflort. Sein ganzes Gesicht war ein Lächeln. Ich hörte, er sei Bankmanager gewesen, ein studierter Mann mit glasklarem Verstand. Am Strand,wo die Teilnehmer nach den Vorträgen in der Nachmittagssonne lagen, fragte ich eine Frau aus Bad Tölz, was denn die Botschaft dieses Gurus sei. Sie sagte: »Ganz einfach: Alles, was ist, ist. Und weil es ist, ist es Gottes Wille. Nichts geschieht gegen seinen Willen. Wir können lernen, darauf zu vertrauen. Kommen Sie doch mal mit zum Vortrag. Dagegen hat der Meister bestimmt nichts.« Ich spürte aber keine rechte Lust. Mir war das zuviel. Ich wollte nicht lernen während meines Urlaubs, nur entspannen und herumhängen. Bei Tisch saß ich allein. Die Gruppe reiste ab, ohne daß ich mich aufraffen konnte, diesem Balsekar einmal zuzuhören.
Eines Abends, als ich, verführt von der frühen Dunkelheit, vor dem Abendessen ein seliges Nickerchen hielt, hämmerte es an meine Tür. Man rief nach mir: »Madam, please, Madam, please!« Erstaunt lief ich zur Tür. Da stand ein atemloser Kellner mit entsetzensgeweiteten Augen und stammelte: »In der Küche … Unglück! Bitte kommen, du Doktor, schnell schnell!«
Ich rannte mit ihm hinunter in die Küche. Sie war nur ein dunkles, rußgeschwärztes Loch in einem primitiven Anbau mit mehreren urtümlichen Kochstellen, Mörsern, Tandoori-Ofen, Gasflaschen und offenem Feuer. Der Raum war voller aufgeregter Menschen, die alle durcheinanderredeten. Ein junger Mann wand sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Der noch glühendheiße Topf lag neben ihm, das Fritieröl verbreitete sich über den glatten Lehmboden. Alle schauten mit rührender Erwartung auf mich, die große Autorität aus dem Westen, und versuchten gleichzeitig, mir radebrechend zu erklären, was passiert war.
»Einen Eimer mit kaltem Wasser und alle Eiswürfel, die ihr auftreiben könnt!« rief ich, und schon liefen die meisten aus dem Raum. Plötzlich war es ruhig. Meine Gedanken und Gefühle waren klar und konzentriert. Ich hatte noch nie eine solche Verbrennung behandelt, aber einiges weiß man eben doch. Ich wußte, daß von mir Hilfe erwartet wurde.
Der Mann auf dem Boden ächzte leise. Ich hatte den Eindruck, daß er sich schämte, vor einer Frau, einer fremden Frau noch dazu, seine Schmerzen zu zeigen. Mir fiel ein, daß ich nicht nur medizinisch Erste Hilfe leisten konnte. Wozu war ich Therapeutin? Also näherte ich mein Gesicht dem seinen, legte ihm die linke Hand unter das Kinn und bat ihn: »Mach die Augen auf, sieh mich an!« Einer der Anwesenden übersetzte eifrig, aber er hatte mich schon verstanden. Dann nahm ich seine Hand in meine Rechte. Auf meine Autorität vertrauend, schaute ich leise lächelnd tief und ruhig in seine gequälten Augen und sagte langsam: »O. k., ist alles o. k., alles o. k., ich helfen, no problem, ich helfen, gleich besser, no problem, ja, ja, alles o. k.«
Sofort spürte ich, wie er sich ein wenig entspannte. Sein Blick erwiderte den meinen und ließ ihn nicht mehr los. Die Pupillen weiteten sich, das konnte ich sogar im Halbdunkel dieser schrecklichen Küche erkennen. Er stöhnte noch einmal tief auf. War das Schmerz oder Erleichterung? Dann begann er wie Espenlaub zu zittern, während dicke, lautlose Tränen seine dunklen Wangen herabrollten. Warum lächelte er dabei, als hätte er einen Engel gesehen?
Ich sagte noch einmal: »O. k., o. k.!« und wandte mich ein wenig ab, um ihn nicht allzusehr zu beschämen. Seine dunkle Hand ruhte in meiner wie die eines Kindes. Ich drückte sie vorsichtig. Am liebsten hätte ich ihn aufgefordert: »Schrei, so laut du kannst!« – wohl wissend, daß die Schmerzen dann ein wenig nachlassen würden, wie bei einer Gebärenden. Aber er hätte nicht schreien können, sein mannhafter Stolz hätte darunter gelitten.
In der Zwischenzeit hatte jemand einen Eimer Wasser herangeschleppt und Eiswürfel hineingeworfen. »Einen Stuhl, schnell!« befahl ich. Für Höflichkeiten war jetzt kein Raum. Ich faßte ihn unter den Achseln und zog ihn hoch, damit er sitzen konnte. Das Bein wurde in den Eimer getaucht, und ich schöpfte mit meinen Händen das kalte Wasser über sein Knie, während ich weiter meine beruhigenden Beschwörungsformeln murmelte. Eine Welle der Erleichterung ging von meinem Patienten aus.
»Good?« fragte ich und hielt wieder seinen Blick fest. Er nickte dankbar, konnte aber nicht sprechen, denn er preßte seine Lippen zusammen, um nicht zu schreien. Ich gab weiter beruhigende Worte und Geräusche von mir. Vielleicht wäre es gut, ihn abzulenken, überlegte ich, und gleichzeitig meine hypnotische Stütze weiter aufrechtzuerhalten.
»Wie heißt du?« erkundigte ich mich. Hinter mir rief eine feste Stimme: »Das ist Rama Raj, mein Koch!« Mr. Varghese, der Besitzer des Hotels, war eingetreten, ein stattlicher Mann mit großer Nase und feurigem Blick, mit dem ich mich bisweilen unterhalten hatte. »Danke, daß Sie gekommen sind, entschuldigen Sie vielmals, daß man Sie gestört hat, es ist mir sehr peinlich, gehen Sie nur auf Ihr Zimmer, es geht schon!« Aber mir war vollkommen klar, daß ich Rama Raj hier unten nicht allein lassen wollte.
Der nette Amerikaner brachte Aspirin und kümmerte sich um ein Glas Wasser, um mehrere Tabletten darin aufzulösen. Ich hatte inzwischen einen der Umstehenden beauftragt, mit Hilfe einer Schüssel ununterbrochen kaltes Wasser auf Knie und Bein zu gießen. Das Eis darin war schon fast geschmolzen. Rama Raj trank inzwischen die Schmerzmittellösung. Ich wandte mich an den Hotelbesitzer: »Wir brauchen die Vorräte aus Ihrem Gefrierschrank, um das Wasser zu kühlen! Bitte!«
Er schaute mich entsetzt an. Ich wollte gerade Luft holen, um zu rufen: »Ich zahle das alles, setzen Sie es auf meine Rechnung!«, da nickte er etwas widerwillig und machte sich davon, um die entsprechenden Anweisungen zu geben. Wahrscheinlich wollte er auch verhindern, daß allzu Kostbares aus seinen Vorräten vergeudet würde, zum Beispiel Langusten und Hummer, die bei ihm angeblich jeden Tag fangfrisch auf den Tisch kamen.
Bald darauf brachte jemand zwei gefrorene Hähnchen. Eines davon ließen wir vorsichtig neben das kranke Bein in den Eimer gleiten, das andere schickte ich zurück, für später. Rama Raj fand das komisch. Er lachte, und da brachen auch alle seine Freunde aus der Küche in befreites Gelächter aus.
Der Hotelbesitzer kam zurück. Ich erinnerte mich, daß er ein Thomaschrist war und zu einer Gemeinde gehörte, die älter war als die katholische Kirche in Rom. Sicher hatte Mr. Varghese jetzt, nachdem er schon sein Huhn für einen Mitmenschen geopfert hatte, noch ein bißchen mehr Nächstenliebe im Herzen.
Natürlich war auch in Kérala trotz Urchristentum und kommunistischer Regierung die Vorstellung eines hierarchischen Kastenwesens überall vorhanden. Vieles wurde hier sogar strenger gehandhabt als anderswo in Indien. Die Kastengesetze von varna und jaata waren weiterhin so lebendig wie in alten Zeiten. Manche Brahmanen weigerten sich sogar, dieselbe Luft zu atmen wie die Unberührbaren. Und ein Hotelchef hat mit einem Küchenjungen nirgends auf der Welt viel gemein. Arbeitskräfte gab es in diesem Land reichlich. Ob nun Rama Raj oder ein anderer in seiner Küche stand, war ihm sicherlich völlig gleichgültig.
Aber ich beschloß, es noch einmal zu probieren: »Mr. Varghese, jetzt rufen Sie bitte einen Krankenwagen! Er muß in die Klinik, sonst entzünden sich die Wunden. Ich kann hier nichts weiter für ihn tun.«
Das war natürlich ein bißchen naiv von mir. Einen Krankenwagen gab es hier möglicherweise gar nicht. Es kamen eine Menge Einwände von allen Seiten. Aber der Chef war am Ende doch bereit, etwas zu unternehmen – wohl mehr mir zuliebe als aus Mitgefühl für den armen Hilfskoch.
»Die nächste große Klinik ist in Trivandrum, die kann er gar nicht bezahlen«, klärte er mich auf. »Haben Sie denn eine Ahnung, wie es in indischen Krankenhäusern zugeht? Seine Frau kann doch nicht täglich fünfzig Kilometer fahren, um ihn mit Essen zu versorgen! Und sie hat auch nicht das Geld, das man braucht, um Personal und Ärzte zu bestechen. Die kleinen Dorfkliniken können solche Brandwunden gut versorgen. Außerdem ist es vielleicht gar nicht so schlimm mit dem Bein, wie Sie denken. Lassen Sie sich jetzt ein Sandwich servieren, und gehen Sie dann schlafen. Ich muß den anderen Gästen erklären, warum es heute kein Abendessen geben wird. Morgen früh werden wir weitersehen.«
Ich sah ein, daß ich jetzt nicht mehr viel tun konnte. Das Schmerzmittel begann inzwischen zu wirken, auch schien Rama unter Schock zu stehen, denn er saß teilnahmslos auf seinem Schemel, ohne einen Laut von sich zu geben. Dicht an ihn gedrängt standen jetzt seine Kollegen und schwiegen. Jeder von ihnen hatte das Bedürfnis verspürt, eine Hand auf seinen Rücken oder seine Schulter zu legen, und er ließ es geschehen. Emotional wußte ich ihn in guter Obhut. Ich winkte ihm zu und wunderte mich über die warme Zuneigung, die in dieser Stunde der Not und der Schmerzen zwischen uns entstanden war. Es war, als hätte er in mir eine alte Freundin erkannt, der er sich unbedingt anvertrauen konnte.
Mir war der Hunger vergangen. Das unhygienische Küchenloch und die Ereignisse dort unten hatten mir den Appetit verdorben. Ich kaute geistesabwesend ein paar Erdnüsse, setzte mich noch eine Weile auf den Balkon, um das Geschehen verklingen zu lassen, und ging dann wieder schlafen.
»Rama wird länger als eine Woche im Krankenhaus bleiben müssen. Die Ärzte waren erstaunt, wie gut das Eiswasser geholfen hat«, berichtete man mir am nächsten Morgen.
»Wann kann er wieder in der Küche arbeiten?« Es war mir klar, daß es in Indien keine Krankschreibung und keine Verdienstausfallversicherung gibt, und ich war besorgt.
»Ach«, druckste der Kellner, »ich glaube, er wird wohl nicht mehr in diesem Hotel arbeiten können. Der Chef braucht ja schon heute jemanden in der Küche, so lange kann er also nicht warten. Rama ist bestimmt ganz verzweifelt, weil er nun nichts verdienen kann. Er selbst ist nicht aus dieser Gegend, aber seine Frau ist von hier. Wenn er sie nicht ernähren kann, muß er vielleicht in die Golfstaaten. Aber die nehmen lieber Moslems. Und woher soll das Geld für den Flug kommen?«
»Mein Gott, das ist ja schlimm!« entfuhr es mir. »Wie plötzlich so etwas geschehen kann!« Angesichts der Erkenntnis, wie innerhalb von wenigen Sekunden aus einer bescheidenen Geborgenheit eine finanzielle Katastrophe mit unabsehbaren Folgen für die ganze Familie werden kann, wurde mir ganz mulmig in der Magengrube.
Ramas Situation berührte mich ungewöhnlich stark. Den ganzen nächsten Tag erinnerte ich mich an seine Augen, die mir trotz Schmerz und Schrecken soviel Vertrauen gespendet hatten. Ich werde ihm etwas Geld schenken, überlegte ich, als ich später im Schatten der Palmen am Strand lag. Dazu ist es doch auch da! Er kann es sicher sehr gut gebrauchen, und ich habe mehr als genug. Wenn er zurückkommt, werde ich es ihm geben.
Am meisten erschütterte mich die Plötzlichkeit des Ereignisses, die unvermutete Wende in seinem Leben, der Fall ins Bodenlose. Wo war der Sinn eines solchen Bruchs? An diesem Unglück war ja niemand schuld. Welcher Gott hatte hier seine Hand im Spiel? War es Schicksal oder Fatum? Bei uns im Westen sprach man neuerdings – nicht nur in der Psychotherapie, sondern auch in der Politik – viel von Selbstverantwortlichkeit und daß man sogar Unfälle unbewußt herbeiführt. Aber galt das auch in Indien? Gab es denn gar keine Opfer?
Zum erstenmal in meinem Leben fühlte ich mich von einem Ereignis wie diesem unmittelbar berührt und betroffen, während ich zuvor selbst Schlimmes in meiner näheren Umgebung oder bei den Patienten mit einem gewissen Stoizismus als ein unausweichliches Geschehen hingenommen hatte. Aber an diesem Tag war das anders. Wenn ich daran dachte, was einem Menschen aus heiterem Himmel passieren kann, liefen mir kalte Schauder über den Rücken. Vielleicht war ich durch die Entspannung und den vielen Schlaf etwas weicher und emotionaler geworden.
Völker und Sitten
Nach dem Mittagessen kam ich mit der indischen Familie ins Gespräch. Der Vorfall in der Küche hatte uns alle kontaktfreudiger gemacht; außerdem hatten wir nun einen guten Anknüpfungspunkt, denn ich hatte mit meiner raschen Hilfsaktion ein gewisses Aufsehen erregt.
Wir saßen in der luftigen Halle, die mit schweren, geschnitzten Kolonialmöbeln ausgestattet war. Dort blätterte ich in der Times of India, die täglich auslag. Das Familienoberhaupt war ein Mann in meinem Alter, nicht sehr groß und ein bißchen rundlich, mit einem Wohlstandsbäuchlein, das sich unter seinem lockeren weißen Gewand, der kurta, wölbte. Sein Kopf war schon etwas kahl, und eine goldgeränderte Brille verlieh ihm ein lehrerhaftes Aussehen. Wie sich herausstellte, war er tatsächlich Professor. Er hatte einen Lehrstuhl für Völkerkunde an der Universität von Bangalore. Ich fand ihn sympathisch. Er lächelte mich an.
»Meine Frau ist eine Schwester von Mr. Varghese, dem Besitzer. Sie kennen ihn ja. Wir machen jedes Jahr ein paar Wochen Ferien in seinem Hotel, wenn ich Semesterferien habe. Unsere Söhne nehmen wir einfach aus der Schule. Ich unterrichte sie dann selbst in den wichtigsten Fächern, und sie sind intelligent genug, um den Rest des Stoffs leicht nachzuholen.«
»Nette, kluge kleine Burschen«, sagte ich freundlich. »Und sie benehmen sich sehr ordentlich, das habe ich bei Tisch bemerkt. Deutsche Kinder sind da ganz anders, sie schreien und laufen herum und sind überhaupt oft ganz ungezogen. Sie haben ja vielleicht von unserer antiautoritären Erziehung gehört«, fügte ich hinzu und meinte es sogar fast ernst, wenn ich auch in erster Linie ein Kompliment für die Eltern damit beabsichtigt hatte. Inder sind für Lob von Ausländern immer sehr empfänglich, und eine bescheidene Selbstkritik an der eigenen Heimat bricht das Eis.
»Ja, wir legen in unserem Land noch viel Wert auf gute Manieren«, sagte der Vater geschmeichelt.
Seine Frau lächelte süß-säuerlich dazu. »Ich glaube, es ist sehr gesund für die Kinder, die gute Meeresluft zu atmen, und ich bin natürlich gern bei meiner Familie«, sagte sie etwas steif. War sie nicht gewohnt, mit Fremden zu sprechen? Vielleicht wollte sie besonders wohlerzogen wirken. Oder ihre Zurückhaltung war Zeichen einer unausgesprochenen, vielleicht sogar unbewußten Kritik.
Manchmal sind die Damen der indischen Mittelschicht ziemlich mißtrauisch gegenüber alleinreisenden ausländischen Frauen, die mit ihren wohlbehüteten Ehegatten freizügige oder gar akademisch-gelehrte Gespräche führen. Sie können ein solch ungebührliches Verhalten in keine ihrer moralischen oder sozialen Kategorien einordnen. Ob ich auf sie anstößig wirkte? Ich fand es immer schwierig, in Indien die Gefühle der Einheimischen zu dechiffrieren. Eigentlich hatte ich es schon längst aufgegeben, verstehen zu wollen, was der Kontakt mit einer ausländischen Frau in ihren Köpfen bewirkte. Bekam ich bisweilen einen Einblick in das, was ein muslimischer Mann, ein hinduistischer Priester, ein Schulmädchen oder eine unberührbare Latrinenreinigerin über mich dachten, war ich ungeheuer verblüfft, weil es so gar nichts mit mir zu tun zu haben schien. Einerseits konnte ich es schon aus Gründen professioneller Gewohnheit nicht lassen, mir darüber Gedanken zu machen, was in den Leuten vorging, was sie verbargen oder verdrängten, was ihre Motivationen und Intentionen in der Interaktion mit mir waren. Andererseits wußte ich um die Fruchtlosigkeit solcher Spekulationen in Indien.
Der Professor schien erfreut über einen Austausch und fragte interessiert nach meinem Woher und Wohin. Dann machte er mir Komplimente über mein Englisch, das er gut verstehen konnte, während ich etwas Mühe hatte, seinen angloindischen Singsang zu entschlüsseln. Anschließend wies er mich stolz auf einen Artikel in der Zeitung hin, die ich gerade aus der Hand gelegt hatte.
»Einer meiner Kollegen hat ihn geschrieben. Wir unterrichten am selben Institut und haben auch schon gemeinsam Feldforschung betrieben. Wir interessieren uns beide für die Ureinwohner Indiens, aber es gibt so viele halbwilde Stämme in diesem riesigen Land, daß wir uns wissenschaftlich nicht ernsthaft ins Gehege kommen können.«
»Halbwilde Stämme?« frage ich verwundert. »Was bedeutet denn das?«
»Unsere tribals haben Schulen und eine Verwaltung, sie zahlen manchmal sogar Steuern. Trotzdem bleiben viele den übrigen Indern vollkommen fremd, weil sie Lebensweisen aus der Urzeit der Menschheit bewahrt haben. Oft handelt es sich nur um kleine Gruppen von jeweils wenigen tausend Menschen, und viele ihrer Sitten sind überhaupt noch nicht erforscht. Lesen Sie den Artikel! Dann werden Sie sehen, daß mein Kollege einen Stamm ausgegraben hat, über den noch niemand je berichtet hat, obwohl diese Leute mitten unter uns leben. Er hat dort Riten und Gebräuche entdeckt, von denen bislang kein Mensch gehört hat.«
»Seltsam«, entgegnete ich, »so etwas würde man in Neuguinea oder Afrika eher vermuten, aber hier, in dieser uralten Kulturlandschaft …«
»Ja, Indien ist eben nicht nur für die Reisenden aus fremden Ländern ein Mysterium«, sagte er nachdenklich. »Auch für uns sind diese Leute völlig rätselhaft. Unser Land ist so unendlich groß und so vielfältig an Rassen und Sprachen! Bedenken Sie nur, was jemand aus Delhi oder aus Kashmir, ein stolzer hakennasiger, schmalgebauter und helläugiger Rajasthani, bereits uns Südindern gegenüber empfindet. Die Leute aus dem Norden sehen uns oft wie Halbaffen an, die man nicht ernst zu nehmen braucht. Sie würden sich schämen, eine unserer wunderschönen Frauen zu heiraten.«
»Ach, wirklich? Warum denn das?« fragte ich erstaunt.
»Für sie ist dunkle Haut etwas Schlimmes, ein Makel. Dunkle Bräute müssen riesige Summen an Mitgift mitbringen, keiner will sie so recht haben. Wir gehören hier zu der dravidischen Rasse, den kleinen, rundlichen, kindlich aussehenden Menschen mit fast schwarzer Haut und, zugegeben, leicht negroiden Zügen. Negroid nennt man sie natürlich nur, wenn man keine Ahnung von Menschenrassen hat. Dunkle Haut und einen großen, weichen Mund mit kräftigen Lippen zu haben ist keine Schande. Die Draviden sind außerdem schon so lange in diesem Land, wie es überhaupt Menschen gibt, und die arischen Inder mit ihren Turbanen sind die eigentlichen Eindringlinge. Wußten Sie das? Sie sind es, die unsere wundervolle uralte Kultur verdrängt haben. Eine aggressive, kriegerische und arrogante Bande! Lange bevor ihre Veden und Upanishaden entstanden, gab es hier schon eine hochinteressante Literatur. Sie hätten sie fast zerstört, weil sie sie nicht einmal lesen konnten.«
Na, na, dachte ich, das müßte man wohl erst noch einmal nachprüfen. Er regt sich ja mächtig auf. Wahrscheinlich übertreibt er aus lauter Nationalstolz. Schließlich mag keiner gern für einen Affen gehalten werden, schon gar nicht, wenn er einen Lehrstuhl innehat. Vielleicht hat ihn jemand aus dem Norden irgendwann beleidigt.
»Sagen Sie, wo leben denn diese Stämme?« nahm ich das Gespräch wieder auf. Damit wollte ich nicht nur unauffällig von seinem Chauvinismus ablenken, das Thema begann mich wirklich zu interessieren.
»Sie haben Siedlungen, die über Tausende von Kilometern verstreut sind, teils im Bergland, teils in der heißen Ebene. Manche sind Halbnomaden, ähnlich wie die Sinti aus dem Norden. Ihre Kleidung ist oft sehr bunt, manchmal aber auch ganz weiß, und sie tragen schönen Silberschmuck. Bei Ihnen in Europa kennt man Nachfahren von ihnen als Zigeuner. Oder die Beduinen in Nordafrika und Arabien – auch sie weisen manche strukturelle Ähnlichkeit mit unseren Ureinwohnern auf.«
Er hatte das Wort »Zigeuner« deutsch ausgesprochen und schien, mit einem Seitenblick auf mich, froh zu sein, daß ich in der Lage war, seiner akademischen Bildung Respekt zu zollen. Ich lächelte ein kleines Anerkennungslächeln und sagte: »Oh, Sie sprechen auch Deutsch!« Aber er schüttelte nur den Kopf: »Nur so viel, wie Sie Malayálam sprechen!« Das sagte er recht flüssig in meiner eigenen Muttersprache. Wir lachten.
»Einige laufen noch fast nackt herum«, fuhr er ermuntert fort, »und fressen sich sogar gegenseitig auf.« Er schaute mich erwartungsvoll an, um zu sehen, wie ich wohl auf eine solch waghalsige Bemerkung reagieren würde.
Ich lächelte ihn wohlwollend an. Die Zeitung mit dem Artikel hielt ich noch immer auf dem Schoß. »Daß es so was hier noch gibt, wo doch die Jaina mit Tüchern vor dem Mund herumlaufen aus Angst, eine Eintagsfliege zu verschlucken, und bei jedem Schritt den Boden vor ihren Füßen fegen, damit sie nur nicht auf eine Ameise treten! Gut, daß sie nichts von Bakterien und Viren wissen!«
Meine Erwähnung der Jaina, einer im Westen wenig bekannten Religionsgemeinschaft, sollte die gebildete Retourkutsche für meinen Professor sein.
In der Tat warf er mir einen freudig-erstaunten Blick zu und schien mich von nun an als Gesprächspartnerin noch etwas ernster zu nehmen. Ich spürte, daß es mir guttat, ein wenig zu reden, denn ich hatte seit meiner Ankunft vor Tagen mit niemandem außer Angestellten und Ladenbesitzern ein Wort gewechselt – die plötzliche Aufregung am Abend zuvor einmal ausgenommen. Der Professor war mir angenehm. Es schien mir, als könne er mir eine Menge Interessantes über mein geliebtes Indien erzählen. Nicht, daß ich mir ernsthaft einbildete, je wirklich etwas von diesem Land begreifen zu können. Indien gab sich kaum Mühe, verstanden zu werden, war schonungslos zu seinen Besuchern und Fremden, wollte keine Erklärungen für das Unerklärliche abgeben. Es blieb auf schockierende Weise unbegreiflich. Trotzdem würde ich nie aufhören, Fragen zu stellen.
Der kleine Mann mit der Goldbrille schien meine Bereitschaft zu weiterer Unterhaltung aufzufangen und unser Gespräch ebenso als angenehm zu empfinden, denn er unterbrach seine Belehrung und neigte sich vor, um in ganz verändertem, ausgesprochen herzlichem Ton zu bemerken: »Wie schön, daß Sie nicht nur meine Sprache sprechen, sondern mich auch noch geistig verstehen! Wir scheinen bei aller Verschiedenheit eine ähnliche Wellenlänge zu haben – so sagt man doch? Ich habe selten Gelegenheit, über Dinge zu sprechen, die mir am Herzen liegen. Mit meinen Studenten ist das unmöglich, und es würde auch gegen die guten Sitten verstoßen. Hier ist jeder an seinem zugewiesenen Platz und achtet auch ganz genau auf die feinen hierarchischen Unterschiede.«
»Vielleicht ist das auch völlig richtig und macht vieles einfacher«, versuchte ich ihn zu trösten. Aber er rief mit einem Anflug von Verzweiflung aus: »Und mit den Menschen, deren Kulturen ich erforsche, kann ich ja auch nicht reden! Sie sprechen Sprachen, die überhaupt keiner versteht!«
»Wie kommen sie dann mit der staatlichen Verwaltung, mit den Gesetzen und Steuern zurecht?« wunderte ich mich.
»Ja, das ist natürlich ein Problem, aber es gibt bei manchen Stammesmitgliedern eine primitive Zweisprachigkeit für das Nötigste. Einige verlassen ihr Dorf, gehen in die Städte und assimilieren sich. Andere ziehen nicht mehr umher, sind seßhaft geworden, bebauen ihr Land und sind oft sogar ganz unauffällig, was Kleidung und Gebräuche angeht. Das dauert so lange, bis man dahinterkommt, daß dies alles nur Fassade ist. Sie geben sich weitgehend normal, aber ich glaube, das tun sie nur, damit man sie in Ruhe läßt.«
»Hat man denn etwas gegen sie? Würden Sie meinen, es handelt sich bei diesen Stammesangehörigen um diskriminierte Minderheiten?«
»Offiziell sind sie natürlich gleichberechtigte Staatsbürger, aber wen kümmert das schon? Bei den Wahlen ist mit ihnen kein Gewinn zu machen. Und sie wirken beunruhigend und merkwürdig, weil man sie nicht einordnen kann. Deshalb hat es schon manchen Versuch gegeben, sie einfach auszurotten oder zwangsweise zu egalisieren, auch in unserer modernen Demokratie. Es ist eine Schande! Außerdem ein Verlust für die Wissenschaft. Ich kann verstehen, daß die Ureinwohner mit ihren seltsamen Bräuchen auf die meisten Inder bedrohlich wirken. Die allgemeine Haltung der Bevölkerung ist aber schlichtweg Verachtung. Jeder, der nicht gerade Ethnologe ist wie ich, hält sie für Untermenschen, Kastenlose, Unberührbare. Man lacht nicht einmal über sie, wie man über Menschenaffen lachen würde. Man mißhandelt sie eher oder geht ihnen aus dem Weg.«
»Wenn diese Leute so urtümlich und primitiv sind, wie sieht es dann mit ihrer Religion aus? Sind sie Hindus oder Moslems? Oder bringen sie sogar noch Menschenopfer dar?« Meine Frage war halb scherzhaft gemeint, doch der Professor nahm sie ganz ernst. Unter seinem dünnen Hemd zeichnete sich die Brahmanenschnur ab.
»Moslems sind sie nicht. Dann hätten sie ihre skurrilen Eigenarten niemals bewahren können. Der Islam und das Christentum bemühen sich ja um Einheitlichkeit und haben feste Vorschriften. Der Hinduismus ist viel toleranter, er hat Platz für zehntausend verschiedene Arten der Anbetung. Wir haben eine reiche Götterwelt, wenn auch alle wieder einem Urprinzip unterstellt sind, dem brahma. Aber nein, die meisten Angehörigen dieser Stämme sind reine Animisten. Erd- und Fruchtbarkeitskulte, Vergöttlichung von Nutzpflanzen, Spiritismus – ganz wie in der Steinzeit! Sie verehren die merkwürdigsten Dämonen und Erdgeister und pflegen unheimliche Rituale.«
»Es wundert mich, daß sie nicht unter dem großen, weiten Mantel des Hinduismus Unterschlupf gefunden haben, denn animistische Züge findet man doch dort auch. – So will es wenigstens uns Christen scheinen«, fügte ich nach einer kleinen Pause vorsichtshalber hinzu, falls ich damit ins Fettnäpfchen getreten sein sollte. Es hätte mir leid getan, seine privaten religiösen Gefühle, von denen ich natürlich nichts Genaueres wußte, verletzt zu haben.
Aber er entgegnete ganz ruhig: »Ja, da haben Sie recht, einige Stammesgemeinschaften hängen dem hier in Südindien sehr verbreiteten Shivaismus an, setzen aber andere, eher animistische Schwerpunkte. Nun, wenn Sie mich fragen: Das sind im Grunde Menschen, die in kein Raster passen. Sie respektieren im allgemeinen nicht einmal das alte Kastensystem. Ihre Religionsformen sind überhaupt nicht recht zu begreifen, weil sie nicht in der Lage sind, darüber zu reden, oder es nicht wollen. Am Ende kann man natürlich, wie überall auf der Welt, an ihren Bestattungen, Festen und Initiationsriten erkennen, daß unter der dünnen hinduistischen Kulturtünche irgendwelche obskuren, uralten Fruchtbarkeitsreligionen oder Baumkulte verborgen sind. Darauf muß man als Forscher achten, aber wer hat schon die Zeit und das Geld, so etwas in jahrelanger Arbeit zu untersuchen? Wir sind mit Forschungsmitteln nicht so reichlich gesegnet wie Sie in Europa.«
»Hätten Sie denn überhaupt Lust, so etwas zu machen? Würden Sie gern eine Zeitlang unter diesen Menschen leben?« erkundigte ich mich.
»Ach, wissen Sie, Madam«, gestand er nach einer kurzen Pause, »inzwischen habe ich mich ziemlich an das bequeme Professorenleben gewöhnt. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, in Bangalore haben wir eine hübsche Villa mit gekacheltem Badezimmer und Fernsehen, meine Söhne brauchen mich, und meine Frau würde mich vermissen. Mit dem Essen ist es für einen Brahmanen auch schwierig…«
»Das ist aber wirklich schade! Was Sie mir von diesen tribals erzählen, klingt doch hochinterssant!« Ich bedauerte seine zögerliche Haltung aufrichtig, und mein Interesse an diesem Mann und seiner Sache als Völkerkundler bestand nicht mehr, wie noch zu Anfang unserer Konversation, aus reiner Höflichkeit. »Außerdem«, fiel mir ein, »wenn Sie auch nicht über so viel Geld verfügen wie Wissenschaftler aus Amerika oder Europa, haben Sie doch einen unschätzbaren Vorteil: Sie sind hier zu Hause, kennen Land und Leute und brauchen sich nicht erst an völlig fremde Welten zu gewöhnen wie unsereins. Das ist nämlich gar nicht so einfach, und bis man sich akklimatisiert hat, ist schon das halbe Geld verbraucht, das die Regierung zur Verfügung gestellt hat.«
»Sie haben sicher recht. Doch ich glaube, in diesem Leben wird es damit nichts mehr«, antwortete er etwas ausweichend. »Vielleicht sollte ich ein paar junge Doktoranden, die noch keine Familie haben, dorthin schicken. Ich werde bei Gelegenheit darüber nachdenken.«