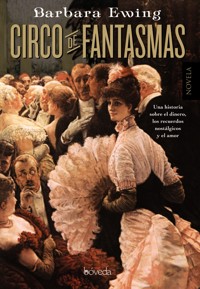9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn die Seele Trauer trägt London 1838: Cordelia Preston und ihre Freundin Rillie sind zwei so liebenswerte wie bettelarme Schauspielerinnen. Um nicht Hungers zu sterben, eröffnen die beiden ein Hypnosestudio – schauspielern können sie ja. Bald jedoch zeigt sich, dass Cordelia tatsächlich über die verblüffende Gabe verfügt, Menschen in Not von körperlichen wie seelischen Schmerzen zu befreien. Und das ist eigentlich nicht verwunderlich, hat sie doch selbst in ihrer Jugend Furchtbares erleben müssen. Cordelia wird zu einer Sensation, von der ganz London spricht. Doch mit dem Ruhm kehren die Gespenster aus dunkelster Vergangenheit zurück …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Barbara Ewing
Die Seelenheilerin
Aus dem Englischen von Elvira Willems
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Wenn die Seele Trauer trägt
London 1838: Cordelia Preston und ihre Freundin Rillie sind zwei so liebenswerte wie bettelarme Schauspielerinnen. Um nicht Hungers zu sterben, eröffnen die beiden ein Hypnosestudio – schauspielern können sie ja.
Bald jedoch zeigt sich, dass Cordelia tatsächlich über die verblüffende Gabe verfügt, Menschen in Not von körperlichen wie seelischen Schmerzen zu befreien. Und das ist eigentlich nicht verwunderlich, hat sie doch selbst in ihrer Jugend Furchtbares erleben müssen. Cordelia wird zu einer Sensation, von der ganz London spricht. Doch mit dem Ruhm kehren die Gespenster aus dunkelster Vergangenheit zurück …
Über Barbara Ewing
Barbara Ewing, geboren 1944 in Neuseeland und seit längerem in London lebend, hat mit der Heldin dieses Buches den Beruf gemeinsam: Ursprünglich machte sie sich als Schauspielerin einen Namen. Daneben hat sie zahlreiche Bücher verfasst. Auf Deutsch ist bisher ihr Roman «Am Ende des Ozeans» erschienen. «Die Seelenheilerin» macht den Leser mit einer äußerst erfolgreichen esoterischen Mode des neunzehnten Jahrhunderts vertraut: Der Mesmerismus war der Vorläufer der Hypnose, wie wir sie heute kennen. Ein wunderbarer Stoff für einen Roman aus dem London der Dickens-Zeit – Barbara Ewing erzählt ihn mit so viel Zeitkolorit, Humor und Tempo, dass der Kampf der braven Cordelia mit dem Frauen verachtenden Zeitgeist und diversen Bösewichtern den Leser bis zum Schluss fesselt.
Inhaltsübersicht
Für Chad und Kath
… Ich erinnere mich an eine Miss Preston in Bloomsbury … die kürzlich verstarb und den größten Teil ihres Lebens Magnetismus praktiziert hat; und ich weiß auch, dass vor etwa zwanzig Jahren viele zu einem Magnetiseur in Kennington gingen …
Professor John Elliotson, Human Physiology I, 1835
Teil 1 1838
1
Es donnerte.
Doch es war kein echter Donner, der Inspizient probierte nur das Gewitterblech aus. Wenn es brach, wurde der Klang zu blechern und verlor seine Erhabenheit.
Den Mantel gegen die kälte eng um sich geschlungen, lehnte Mrs. Cordelia Preston an der dilettantisch gemalten und irgendwie missratenen Schlossmauer, der man auch mit viel Phantasie keinerlei Erhabenheit bescheinigen konnte.
«Der dicke Intendant ist eine Bestie aus der Hölle», murmelte sie wütend Mrs. Amaryllis Spoons zu, die auf einem viereckigen Baumstumpf saß. In dem leeren, hallenden Theater roch es nach dem Öl aus den vielen Lampen, nach Kerzenfett und Staub, nach dem Publikum des vergangenen Abends und vielleicht auch ein wenig nach Schauspielern. Das Fußlicht war mit kleinen Rädern in den Raum unter der Bühne versenkt worden, wo die Dochte der Lampen gestutzt wurden; einzelne Kerzen beleuchteten die Bühne und tauchten sie in ein trübes, flackerndes Licht. Die frierenden Schauspieler rieben die Hände aneinander, der Atem stand ihnen in kleinen Wölkchen vor dem Gesicht. Von ihrer mageren Gage mussten Mrs. Cordelia Preston und Mrs. Amaryllis Spoons, zwei der drei singenden Hexen (die andere wurde von der Schwiegermutter des Intendanten gespielt), nicht nur ihre Kostüme, Perücken, Puder und Schminke kaufen, sondern auch noch für ihre Verpflegung aufkommen, Miete zahlen und reisen. Der Intendant hatte die Schauspieler so früh einbestellt, um ihnen ihr Salär auszuhändigen. Jetzt wippte er am Rand der trübe beleuchteten Bühne auf den Fersen vor und zurück und verkündete, dass er die Gagen noch einmal gekürzt hatte.
«Das Publikum will keine Schauspieler mehr», holte er zu einem letzten, kräftigen Schlag aus, und Cordelia überlegte in aufwallendem Zorn, wie befriedigend es wäre, ihn mit einem Tritt in den Zuschauerraum zu befördern. «Heutzutage will das Publikum Spektakel! Und unter Spektakel versteht es keine Schmierenkomödianten und ein räudiges, altes Pferd. Morgen kommt ein Elefant, und nächsten Monat bekomme ich einen Performing Boy.» Dann hörte er auf zu wippen und verschwand unvermittelt im Dunkeln im hinteren Bereich des Theaters.
Schmierenkomödianten? Ein Elefant in Macbeth? Der Hauptdarsteller, Mr. George Tryfont, stand in einem qualvollen Zustand, voller Zorn und Protest, mitten auf der Bühne und schaute ungläubig auf das Geld in seiner Hand. Die Aktrice, die Lady Macbeth spielte, war bereits laut weinend davongestürmt, die anderen standen in kleinen Gruppen zusammengedrängt, murrten leise und zogen die Mäntel noch enger um sich. Der verdammte Winter, keine Spur von Frühling, und als Mr. Tryfont sich jetzt theatralisch auf die Zweige des Birnam-Waldes stützte (der nach der Aufführung des vergangenen Abends noch nicht von der Bühne gefahren worden war), warfen er und die spitzen Äste lange, gespenstische Schatten auf die Bühne. Amaryllis Spoons sah, dass auch Cordelia Preston, deren Silhouette vom Kerzenschein gegen die gemalte Schlossmauer geworfen wurde, wütend war; und doch war sie immer noch schön: Die ungewöhnlich weiße Strähne auf ihrer Stirn schien zwischen den düsteren Schatten fast zu leuchten.
Der Requisiteur stapfte über die Bühne und schleppte große Weißbleche und Kelchgläser für die Bankett-Szene. Falls er über die Zukunft dieser Inszenierung mehr wusste als die Schauspieler und ob wirklich ein Elefant eingesetzt wurde, dann behielt er es für sich. Seine Schritte hallten in den Kulissen nach.
Mr. Tryfonts Stimme dröhnte – er konnte nicht anders – durch den leeren Zuschauerraum und erreichte sogar die Logen und den obersten Rang. Er besaß genau das richtige Timbre. «Ein Elefant in einem Shakespeare-Stück! Oh, hätte ich doch einen ehrenvollen Beruf gewählt! Dieser Intendant ist eine Schande, er zahlt Pferden mehr für einen Auftritt als Schauspielern meines Kalibers.» Der Requisiteur stapfte zurück, immer noch schweigend, diesmal mit dem Hexenkessel auf dem Rücken. «Ich habe übrigens aus hervorragender Quelle gehört, dass, sobald der Elefant da ist, die älteren Damen …», hier warf Mr. Tryfont einen gehässigen Blick über die Bühne, «entlassen werden. Das Publikum mag keine alten Frauen.»
Mrs. Cordelia Preston und Mrs. Amaryllis Spoons blickten einander an. Mit «älteren Damen» waren sie gemeint, obwohl sie beide sogar noch ein wenig jünger waren als Mr. Tryfont. Es stand ihnen nicht zu, zu beurteilen, ob ein Elefant bei einer Aufführung von Macbeth die Stelle der drei singenden Hexen einnehmen könne, doch dies war eine drittklassige Tournee, da musste man mit allem rechnen. Sie hatten kaum genug Geld, um nach Hause zu gelangen. Doch so etwas war schon unzählige Male passiert. Für den äußersten Notfall hatten die beiden unter den Dielenbrettern zu Hause in London Geld versteckt, und jetzt überschlugen sie rasch die Beträge.
Dann scheuchte ein lauter Warnruf von unten und das Knarren etlicher Räder die Schauspieler plötzlich auseinander. Die Räder zogen die gemalten Bäume des Birnam-Waldes auseinander, um sie bis zum Höhepunkt der abendlichen Vorstellung in den Kulissen links und rechts der Bühne zu verstauen. Der Requisiteur tauchte mit einer großen Schüssel roter Flüssigkeit in den Händen zwischen den sich bewegenden Bäumen auf: das Blut an ihren Händen, den Händen der Macbeths, wenn sie allabendlich mordeten.
Die Schauspieler waren in einigen schmutzigen, kalten Räumen in einer Scheune außerhalb von Guildford untergebracht. Einige kippten vor der abendlichen Vorstellung in der Ecke mürrisch billigen Whisky in sich hinein. Mrs. Cordelia Preston röstete Brot über dem Feuer. Mrs. Amaryllis Spoons aß traurig zwei Äpfel. Sie wussten, sie hätten die Finger von dieser Tournee lassen sollen, sie kannten die Bedingungen so einer drittklassigen Tournee: die niedrigste Gage, Vorstellungen an den übelsten Spielstätten. Doch Mrs. Preston und Mrs. Spoons waren über vierzig, was gemeinhin – Mr. Tryfont hatte herzlos darauf hingewiesen – als alt galt, und sie brauchten das Geld.
«Und ob dieser fette Intendant eine Bestie aus der Hölle ist», sagte Rillie Spoons.
An diesem Abend öffnete sich der rote Vorhang spät wie immer, während das ungeduldige Publikum bereits stampfte und pfiff. Das Fußlicht vor der Bühne verlosch langsam und tauchte die Bühne in Halbdunkel. Die singenden Hexen (der Intendant hatte darauf bestanden, das Publikum wolle Gesang) waren auf der Bühne gerade so zu erkennen, geisterhaft, hinter ihnen stieg Rauch auf. Die Schwiegermutter des Intendanten musste wegen des Rauchs würgen, und der Inspizient ließ das Blech sehr laut scheppern, um ein Gewitter zu erzeugen (und das Husten der Hexe zu übertönen). Doch als die drei alten Vetteln sich im Halblicht über den Kessel beugten, breitete sich die alte Stille aus, und die vertrauten Worte ergriffen die Herzen:
Wann kommen wir drei uns wieder entgegen,
im Blitz und Donner oder im Regen?
Wenn der Wirrwarr stille schweigt,
wenn der Sieger ist, sich zeigt.
In dieser Inszenierung kam Macbeth auf einem Pferd daher: Mochte es auch räudig sein, das Publikum jubelte. Es blieb der einzige Jubel an diesem Abend. Das Pferd ging bald ab, doch Mr. Tryfont blieb. Der Macbeth-Darsteller hatte eine Vorliebe für Pausen, und an diesem Abend schien er sie noch eifriger auszudehnen als sonst; Enttäuschung und Langeweile waberten durch den Staub, den Gestank des Lampenöls und den Geruch von Fettschminke und Zuschauern zur Bühne hinauf. Das Publikum wollte etwas erleben, mehr qualmenden Rauch, mehr Pferde, Trommeln, bewegliche Bühnenbilder. Die Vorstellung näherte sich ihrem Höhepunkt, und Mr. Tryfont machte eine besonders lange Pause und richtete den Blick dramatisch nach oben. Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild, kam ein lautes Flüstern aus dem Souffleurkasten am unteren Rand der Bühne, worauf Mr. Tryfont dem Souffleur, der doch nur versuchte behilflich zu sein, einen wütenden Blick zuwarf.
Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild;
ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht
sein Stündchen auf der Bühn’, und dann nicht mehr
vernommen wird …
Ein Apfelbutzen landete auf der Bühne.
«Und dann nicht mehr vernommen wird, Gott sei Dank!», rief jemand aus dem Parkett.
«Mach weiter!», rief ein anderer. «Ein Märchen ist’s, erzählt von einem Dummkopf, das kann man wohl laut sagen. Das nichts bedeutet, genau wie du, du alter Bock!»
«Du lausiger Schmierenkomödiant!», rief der Erste. «Du solltest mal langsam voranmachen, du bist doch steinalt!»
Wie durch ein Wunder tauchte surrend der Birnam-Wald auf, doch in dem Augenblick explodierte Mr. Tryfont, weil andere seine bedeutsame, poetische Rede unterbrochen hatten. Er machte einen großen Satz von der Bühne («Ziemlich gefährlich, in seinem Alter!», flüsterte Cordelia im hinteren Bereich der Spielfläche) und ging mit beiden Fäusten auf seine Peiniger los. Das Publikum pfiff begeistert, andere Schauspieler mischten sich ein und schließlich auch noch mehr Zuschauer. Es war aufregend. Mrs. Cordelia Preston und Mrs. Amaryllis Spoons schauten einander an. Keine Arbeit, kaltes Wetter und von Frühling keine Spur. Sie zuckten die Achseln. Dann wies Cordelia auf den Requisitentisch und pustete die nächststehenden Kerzen aus. Sie und Rillie packten die große Schüssel mit Blut, schütteten die rote Brühe im dämmrigen Licht über den Rand der Bühne und tauchten Schauspieler und Publikum in die glänzende rote Flüssigkeit, dass die blutigen Tropfen nur so flogen. Dann sammelten sie in dem ganzen Handgemenge leise ihre Habseligkeiten zusammen und verschwanden, wobei sie ihre Hexenkostüme anbehielten; die Kostüme gehörten ihnen, sie mussten sie stellen, und in der Nacht war es sicherer, als Hexe verkleidet durch die Straßen zu gehen und nicht als Dame.
Folgendes Bild war in jener Nacht zu sehen: zwei ziemlich seltsame Gestalten, die in der kalten Dunkelheit stoisch in Richtung London Road trotteten, zwei gute Freundinnen, Schauspielerinnen mitderen Alters, ohne Arbeit, im kalten Februar.
«Wenn meine arme tote Mutter mich jetzt sehen könnte!», sagte Cordelia. «Sie würde es verstehen!»
«Wenn meine arme lebendige Mutter mich jetzt sehen könnte», sagte Rillie, «würde sie überhaupt nichts verstehen», und lachte halbherzig. Es war nicht ganz ernst gemeint, denn Rillies Mutter war senil.
Wann kommen wir drei uns wieder entgegen,
im Blitz und Donner oder im Regen?
Sie sangen, um in Stimmung zu bleiben und die Straßenräuber zu vertreiben, und irgendwann glaubte Cordelia sie auf der kalten nächtlichen Straße zu hören: die starken lachenden Geister ihrer Mutter und ihrer Tante, die ihr sagten, wie sie es immer getan hatten, dass sie weitermachen solle, was auch geschah, und alles ertragen solle.
2
Einige Tage später saß Miss Cordelia Preston – obwohl sie, wie es bei älteren Schauspielerinnen Sitte war, auf Theaterplakaten immer als Mrs. Preston angekündigt wurde, war sie in Wirklichkeit gar nicht verheiratet – abends in einem Keller in der Little Russell Street, Bloomsbury, halb eingedöst, immer noch müde von dem langen Fußmarsch von Guildford nach Hause, und trank ab und an einen Schluck Portwein.
Sie hatte die Vorhänge nicht vorgezogen, denn man hätte sich draußen auf Hände und Knie begeben müssen, um in die Kellerräume zu schauen. Sie sah und hörte jeden Tag Schritte vorbeigehen: Stiefel und Schuhe und unbeschuhte schmutzige Füße. Um diese späte Stunde wurden es weniger, nur die Nachbarskatze hockte wie ein schwarzes Fragezeichen auf den eisernen Kellerstufen, vom Lampenschein hinter dem Fenster beleuchtet. Cordelias Mutter Kitty war gestorben, als Cordelia zehn gewesen war, und danach war sie mit ihrer Tante Hester in den Kellerräumen wohnen geblieben. Als Tante Hester starb, waren ihre letzten Worte an Cordelia gewesen: Das ist dein Zuhause, Mädchen, bleib da wohnen und sorg dafür, dass du die Miete pünktlich zahlst. Und lass meineSterne hängen, wenn ich nicht mehr bin, sie passen auf dich auf
Also hatte Cordelia die schimmernden, aus billigem Schmuck, Glas und Farbe gefertigten Sterne ihrer Tante an der Decke hängen lassen und immer pünktlich die Miete bezahlt. Auch die Spiegel waren noch da, die die Sterne reflektierten, und die zerfledderten Bücher über Magnetismus und Phrenologie im Eckregal und der weiße Marmorkopf mit den Nummern darauf. Den Marmorkopf hatte sie Alphonse getauft, denn ihre Mutter hatte einmal in einem Stück mitgespielt, in dem eine Figur Alphonse hieß, und der hatte keine Haare gehabt. An Alphonses Kopf hatte Cordelia die Zahlen gelernt: 1, 2 und 3 waren am Hinterkopf, 14 war am Scheitelpunkt. Alphonse war ihr Freund, manchmal schmückte sie ihn mit roten Samtblumen. Ein Marmorkopf mit Nummern war ein seltsames Spielzeug für ein kleines Mädchen gewesen, doch in der Welt des Theaters, wo man an tausend Seltsamkeiten gewöhnt war, irritierte so etwas niemanden. Hatte man es dort nicht Abend für Abend mit Wachsäpfeln und Schüsseln mit Theaterblut und oft auch mit Schädeln zu tun, außerdem mit lebenden Tauben und totem Wild und Büchern, die gar keine Seiten hatten, die alle in der Requisitenecke herumstanden?
Ihre Mutter und ihre Tante waren tot, doch zusammen mit Alphonse und den Sternen, den Spiegeln, den roten Samtblumen und all den anderen Requisiten, die ihre Mutter im Laufe der Jahre hatte mitgehen lassen, waren die starken Geister von Kitty und Hester immer noch präsent.
Schritte kamen von der Straße zu ihr herunter, ein kurzes Klopfen, und Rillie Spoons stand in der Tür. Sie war auf einen späten Schluck gekommen. Natürlich war die Uhrzeit etwas ungewöhnlich, aber schließlich waren sie Schauspielerinnen.
«Wie geht es deinen Füßen, Cordie?»
«Genau wie deinen.»
«Komm, wir gehen zu Mrs. Fortune», schlug Rillie vor, «vielleicht hören wir etwas, vielleicht ist irgendwo was los.»
«Wenigstens stehen wir nicht zusammen mit einem Elefanten auf der Bühne», meinte Cordelia verdrießlich.
«Und es hat sich doch fast gelohnt …» Sie fingen beide an zu lachen, sahen die rote Farbe noch einmal über die schockierten Gesichter der Streithähne tropfen. Cordelia kippte den Portwein hinunter, reichte ihrer Freundin die Flasche und ging ein zweites Glas suchen.
Ihr Gelächter verebbte. «Jetzt müssen wir natürlich runter Zum Lamm gehen und von Mr. Kenneth oder Mr. Turnour in Erfahrung bringen, ob sie uns freundlicherweise nochmal so ein mieses Engagement besorgen können! Ach, zum Teufel, Rillie, ich hab’s so satt, ich hab’s satt, meine Kostüme und meine Schminke einzupacken und bei Kälte, Regen oder Sonnenschein über holprige Straßen durch die Gegend zu ziehen. Das mache ich schon, seit ich auf der Welt bin, und ich hab’s satt!»
«Ich hab was Interessantes in der Zeitung gefunden», sagte Billie Spoons, ohne auf Cordelias Stimmung einzugehen. «Du erinnerst dich doch an deine Tante Hester mit ihrem Magnetismus? Also, im neuen University Hospital findet eine Vorführung statt, schau mal hier, ich hab’s aus der Zeitung rausgerissen, als der Bibliothekar nicht hingeschaut hat.» Rillie hatte immer noch eine schöne Stimme; sie las den Ausschnitt vor, den sie aus der Zeitung ausgerissen hatte und den sie jetzt ins Licht der Lampe hielt, während sie die Augen zusammenkniff und mit ihrer Stimme das Wichtige hervorhob. «MAGNETO-MANIE SPALTET DIE HAUPTSTADT! MAGNETISCHE EXPERIMENTE IM UNIVERSITY COLLEGE HOSPITAL! PROFESSOR ELLIOTSON ZEIGT AN ZWEI PATIENTINNEN AUS DEM ARMENHAUS, DEN OKEY-SCHWESTERN AUS IRLAND – Iren, siehst du, Cordie, die sind anders als wir – DEN EFFEKT UND DIE MÖGLICHEN VERDIENSTVOLLEN WIRKUNGEN DES MAGNETISMUS AUF KRANKENHAUSPATIENTEN. Lass uns morgen hingehen und uns das anschauen, Cordie, das muntert uns auf und erinnert uns an deine liebe alte Tante Hester.» Man musste vorsichtig sein, über welche Teile ihrer schwierigen Vergangenheit man mit Cordelia sprach, das Wort «Ehe» zum Beispiel erwähnte man tunlichst besser nicht, doch bei Tante Hester bestand keine Gefahr. «Wir gehen morgen früh, nachdem wir unten in der Bow Street waren.» Cordelias Miene war immer noch verzagt. «Komm schon, Cordie, wir sind fünfundvierzig Jahre alt, wir werden doch nach all den Jahren nicht aufgeben!» Endlich lächelte Cordelia, ihre Freundin oder der Portwein oder die Erwähnung von Tante Hester hatte ihre Stimmung gehoben. Wieder mussten sie lachen, als sie noch einmal über den Streit im Theater, Mr. Tryfont, das Publikum und das Blut sprachen. Und schließlich lehnten sie sich in der Kellerwohnung in Bloomsbury mit einem Glas in der Hand zurück und sangen die letzte Nummer. Sie sangen gut, und ihre Stimmen hallten durch das von der Lampe beleuchtete Fenster und trieben hinaus in die Nacht.
An Max Weltons schönen Staden,
wo früh schon fallt der Tau,
Gab Annie Laurie schluchzend mir
Ihr Wort auf Treu und Glaub.
Ihr Wort auf Treu und Glaub gab sie,
dass sie mich nie verderb,
Und für Bonnie Annie Laurie
Leg ich mich hin und sterb.
«Ich wüsste zu gerne, wer Max Welton war», sinnierten beide, und dann lachten sie wieder los, denn der Portwein wärmte ihre Kehlen und ihre Herzen. Sie zogen ihre Mäntel an, und Cordelia nahm das Bügeleisen, das sie zum Schutz stets bei sich trug, während Rillie immer einen großen Stein in der Innentasche ihres Mantels hatte. Sie machten sich auf den Weg Richtung Drury Lane zu Mrs. Fortunes Lokal in der Cock Pit Lane, wo Gerüchte und Träume die meisten arbeitslosen Schauspieler davor bewahrten, in die Themse zu springen. In Mrs. Fortunes Lokal – ein paar wacklige Holzstufen führten über ein Pfandhaus zu ihm hinauf – erzählten Schauspieler sich das Neueste oder diskutierten ihre Aussichten, hier prahlten, weinten und tranken sie. Und aßen – manchmal. Mrs. Fortune bereitete regelmäßig einen großen Schmortopf zu, dem allabendlich etwas hinzugefugt wurde. Wenn die ersten Schauspieler krank wurden, war es an der Zeit, den Rest wegzuschütten und von vorne zu beginnen.
Auch an diesem Abend war in Mrs. Fortunes Lokal wieder das ganze Theatergesindel versammelt: Mr. Eustace Honour, der Komiker, Olive, die Balletttänzerin, und James und Jollity, die tanzenden Zwerge. Und Cordelia und Rillie, Annie und Lizzie, arbeitslose alte Schauspielerinnen, der alte Mr. Jenks, ein pensionierter Souffleur, und eine Schar jüngerer Schauspielerinnen, von denen einige, obwohl Mrs. Fortune das nicht gerne sah, junge Gentlemen mitgebracht hatten, die sie auf der Straße aufgegabelt hatten. Schauspieler, die von Tourneen nach Dublin, Manchester oder Birmingham zurück waren, lehnten lässig an einer Wand, rauchten Zigarre und unterhielten sich lautstark über ihre nächsten Engagements. Unter ihnen befand sich oft die Tochter des Hauses, Miss Susan Fortune, die pfiffig eine Nische entdeckt hatte: Sie spielte alte Damen, obwohl sie noch jung war. Annie, Lizzie, Cordelia und Rillie starrten sie feindselig an. Miss Susan Fortune besaß einen äußerst ausladenden Busen: Und schon engagierten sie die Intendanten für die alten Rollen, statt der knochigen älteren Schauspielerinnen, die im entsprechenden Alter waren, Lohn und Brot zu geben.
Die Stimmen in der Cock Pit Lane vermischten sich mit dem Zigarrenrauch und dem Geruch von Mrs. Fortunes verwässertem Whisky und Eintopf, wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler von ihren Triumphen sprachen. Die tanzenden Zwillinge spendierten einer Schauspielerin, die keine Arbeit hatte, ein Glas. Hier und da waren Bruchstücke von Gesprächen aufzuschnappen: Olive, die Balletttänzerin, beschwerte sich darüber, dass sie bei ihrem letzten Engagement eine Hornpipe hatte tanzen müssen; der Komiker, Mr. Eustace Honour, ließ sich empört darüber aus, dass er mit einem Gorilla hatte auftreten müssen; das Gelächter der Gentlemen von der Straße fesselte die Emmas und die Primroses. Mrs. Fortune zählte ihre Einnahmen. Und über allem lag die ganze Zeit die Angst, keine Arbeit zu finden, die Ungewissheit, woher das nächste Geld kommen sollte, die Unwägbarkeit eines so turbulenten Lebens. In der Ecke stand eine Harfe, die von einer längst vergessenen erfolgreichen Produktion übrig geblieben war. Mr. Honour stimmte sie und begann zu spielen, und bald erscholl lauter Gesang, viele hier hatten sehr gute Stimmen. Die Musik aus Mrs. Fortunes Lokal konnte oft, durchsetzt von all den anderen Geräuschen, auf der ganzen Drury Lane gehört werden.
Magst mir für jedes Wehwehchen ein Mittel servieren,
um Tod oder Schmerz zu parieren.
Doch um die Lebensgeister zu harmonisieren,
greif ich doch lieber zur Flasche.
Und wenn einst die Liebe, die göttliche Macht,
in meinen Augen einen Strom von Tränen entfacht,
ertränk ich die Tränen, die der Venus erbracht,
doch gern mit ’nem Schluck aus der Flasche.
Spät in der Nacht verabschiedete Cordelia sich an der Ecke Long Acre von Rillie und ging durch die düsteren Straßen nach Hause, die Drury Lane hinauf in Richtung Bloomsbury. Vom Portwein gewärmt, das Bügeleisen in der Tasche, ging sie an Bettlern vorbei, wich Pissepfützen aus und sang immer noch leise:
Ertränk ich die Tränen, die der Venus erbracht,
doch gern mit ’nem Schluck aus der Flasche.
3
Cordelias Mutter und Cordelias Tante waren beide als Miss Preston bekannt gewesen.
Beide hatten sich mit Zielstrebigkeit, Plackerei, Mumm, Unverfrorenheit und Stoizismus aus den übelriechenden, miserablen Elendsquartieren um Seven Dials in der Gemeinde von St. Giles in the Fields in die achtbaren Kellerräume in Bloomsbury emporgearbeitet. Es war lange her, dass die beiden blonden Preston-Schwestern Kitty und Hester von zu Hause weggelaufen waren, wo ihr Vater ihrer Mutter mit einer Ginflasche und einem Stuhl den Kopf eingeschlagen hatte. Sie waren damals dreizehn beziehungsweise dreizehndreiviertel gewesen, und sie hatten nur einen Menschen in der Stadt gekannt und sich auf die Suche nach ihm gemacht: Mr. George Sim, der Bruder ihrer Mutter, der durch irgendein Wunder eine Stelle als Beleuchter im Drury Lane Theatre bekommen hatte. Mr. Sim musste die Hunderte von Kerzen und Öllampen, die im Theater gebraucht wurden, putzen und ihre Dochte schneiden und anzünden. Er hatte einen winzigen Raum hinter seiner Werkstatt, in dem er schlief, denn er war jeden Tag der Letzte, der das berühmte Theater verließ, und der Erste, der es wieder betrat.
Als Hester und Kitty ihn fanden, polierte er gerade die Glaszylinder der Lampen und hielt sie gegen das Fenster. Er sah ihre verzweifelten, schmutzigen Gesichter und seufzte. «Was ist denn jetzt?» Doch die Mädchen konnten nicht richtig sprechen. Sie weinten nicht, aber ihre Zähne klapperten, als wäre ihnen kalt. Nur dass es Hochsommer war, und in der Werkstatt war es heiß und stickig. Er trat hinaus auf die leere Bühne; sie folgten ihm, ohne auf die vergoldeten Logen zu achten, wo die feinen Leute sitzen würden, oder auf die verzierte hohe Decke oder die schweren, roten Vorhänge. Sie wirkten wie unter Schock, während er in den Kulissen die Öllampen anzündete. «Es muss anständiges Öl sein, wohlgemerkt», sagte er, als hätten sie ihn danach gefragt. «In der Drury Lane wird kein modriges Walöl benutzt wie bei euch daheim, schließlich geht es nicht an, dass die Damen und Herren den Geruch von Öl ins Haar und in ihre feinen Kleider kriegen, dann kämen sie nicht mehr, nicht wahr, wenn wir schlechtes Öl benutzen würden?» Er nahm an, seine Schwester wollte Geld und hatte deshalb die Mädchen geschickt. In einer Ecke der Bühne spielte ein Musiker auf seiner Klarinette, hoch und weinend trieben die Töne, wie Schmerz. «Wie geht es Mary?» Die zitternden Mädchen schauten sich an.
«Wir gehen nicht zurück.»
«Also, hier könnt ihr nicht bleiben!»
«Sie ist tot.»
Mr. Sim seufzte. Ihn überraschte gar nichts mehr. Viele seiner Geschwister waren tot. Er ging zurück in seine kleine Kammer, und die Mädchen folgten ihm.
«Weiß euer Vater Bescheid?» Der stinkende, nichtsnutzige Säufer. Er war Kanalreiniger, aber normalerweise war er zu betrunken, um in die Kanalisation zu steigen.
«Dad war’s.»
Da war er doch überrascht und stieß einen leisen Pfiff aus. Jetzt wurde die Geschichte klar. Er holte sich ein Ale, setzte sich auf einen Hocker, trank und gab ihnen einen Schluck. Sie waren hübsch, sie waren dreizehn oder so ähnlich; auch schon ohne seine Nichten hatte er genug eigene Probleme. Doch er wusste, was für ein Schicksal ihnen blühte, wenn er ihnen nicht half. Hübsche dreizehnjährige Mädchen hielten auf den Straßen nur wenige Monate durch, bevor sie in andere Umstände gerieten oder die Pocken bekamen oder Schlimmeres. Ein Wunder, dass sie überhaupt so lange durchgehalten hatten; er hatte gehört, dass sie ihrer Mutter geholfen hatten, für andere Leute die Wäsche zu besorgen. Er überlegte einen Augenblick, sah sie genau an und taxierte sie. Dann schickte er sie zu einer Waschschüssel. «Wascht euch gründlich das Gesicht», wies er sie an. «Ihr habt Glück, diese Woche steht ein Tableau vivant auf dem Programm.» Damit verschwand er.
Irgendwie gelang es ihm, Kitty und Hester als Komparsinnen im Drury Lane Theatre unterzubringen, für zwölf Shilling die Woche, und zwar für jede von ihnen. Das war mehr Geld, als sie in ihrem ganzen Leben je zu Gesicht bekommen hatten, ein Arbeiter mit Familie verdiente kaum mehr. Ihr Onkel (der, wie sie wussten, junge Männer mochte) besorgte ihnen auch die Kleider, die eine Schauspielerin persönlich für die Arbeit stellen musste: ein Kleid, einen Hut, Bänder und Schuhe. Vor Dankbarkeit lachten und tanzten sie in ihrer neuen Ausstattung um ihn herum. Sie waren genauso wenig Damen wie Mr. Sim ein Herr, doch sie waren sehr hübsch, und das zählte (besonders bei Kitty, die mehr als hübsch war, richtig schön, wie manche sagten), und sie schauten zu und lernten und taten alles, was man ihnen sagte. In einem Tableau vivant posierten sie als Soldatenbräute und in einem anderen als Nymphen; wenn es auf der Bühne nichts zu tun gab, nähten sie Hüte und Kleider und reparierten für wenig Geld Schwerter; sie versteckten Geld in ihren Schuhen; sie verbesserten ihre recht mageren Lesekünste und übten, wie man etwas auswendig lernte. Sie beschwerten sich nie. Und vor allem gingen sie niemals zurück nach St. Giles, in das dunkle Elendsviertel mit seinen stinkenden Gossen und Landstreichern und Heringshökern und den Iren und ihrem Vater, der ihre Mutter umgebracht hatte. Sie teilten sich mit fünf anderen Komparsinnen ein Zimmer in der Blackmoor Lane, einer Seitenstraße der Drury Lane, nicht weit von da, wo Prostituierte umherstreiften. Nacht für Nacht stellten sie das Bett als Sperre quer vor die Tür. Sie bedankten sich nie so richtig bei Mr. Sim, doch sie kamen oft früh und halfen ihm mit den Lampen, den Kerzen und seinem farbigen Glas und scherten sich nicht darum, dass junge Männer in seinem Zimmer schliefen. Er zeigte ihnen, wie man Schmuck zu den Kostümen und im Haar trug und wie man auf der Bühne den Kopf leicht neigte, damit das Licht sich auf dem Schmuck spiegelte, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Schwestern hörten und schauten zu und lernten und sahen, wie Schauspielerinnen ihre Stimme verändern konnten, und veränderten selbst ihre Stimmen. Sie würden sich bewegen und reden wie richtige Damen, und wenn es sie umbrachte.
Kitty war nicht nur besonders attraktiv, sie hatte auch eine hübsche Singstimme, und nach einiger Zeit wurde sie befördert und bekam kleinere Rollen; Hester machte es Spaß, auf dem Trapez gehen zu lernen, denn das Publikum verlangte jetzt mehr als das klassische Theater, und die zweite Hälfte des Programms bestand aus Musik oder Akrobatik. Manchmal wurden sie nicht bezahlt, manchmal wurde selbst die berühmte Mrs. Sarah Siddons nicht bezahlt, und oft hatten sie Hunger. Doch sie schauten zu und lernten und passten auf, sie sahen, wie junge Schauspielerinnen andere auf der Bühne aus dem Licht schubsten, sahen, wie viele von ihnen sich zur Schau stellten und zu den roten Plüschlogen hinauflächelten. Sie hofften auf einen Gunsterweis, auf einen Liebsten, darauf, dass ein Gentleman sie beachtete (je größer die Rolle, desto wahrscheinlicher war das) und ihnen ein hübsches kleines Zimmer einrichtete und ihnen Geld gab. Sie hörten, dass der Politiker Charles James Fox Mrs. Armitage sogar geheiratet hatte, und Mrs. Armitage war nicht einmal eine richtige Schauspielerin gewesen, sondern etwas sehr viel Schlimmeres.
Einige Zeit später verschwand Mr. Sim. Es wurde gelacht und gesagt, er sei mit seinen Lustknaben in die Themse geworfen worden. Die Schwestern gingen mehrmals hinunter zum Strand, um zu sehen, ob sie ihn fanden. Eines Morgens gingen sie bei Ebbe sogar von Hungerford Market flussabwärts und spazierten weit am Ufer entlang, inmitten der Kähne und Segelboote, umgeben von Abfall, Gestank und den Rufen der Fährleute. Es fing an zu regnen, und der stinkende Schlamm quatschte durch ihre dünnen Stiefel. Sie spürten, wie er ihnen zwischen die Zehen sickerte, doch sie gingen immer weiter, an der St. Pauls Kathedrale vorbei, unter der London Bridge hindurch, sie wollten nichts unversucht lassen. Sie kamen an alten Zeitungen, kaputten Kisten und dreibeinigen Stühlen, Knochen und rostigen Eisenstücken und dem hin- und herrollenden, aufgeblähten Kadaver einer Kuh, an Glasflaschen und an toten Ratten vorbei. Alte Frauen suchten Kohlestücke. Sie sahen seltsame Rinnsale glänzend metallischer Farben aus den Fabriken auf der anderen Seite des Flusses in die Themse fließen. Doch Mr. Sim, der Beleuchter, war und blieb verschwunden. Sie hörten nie wieder etwas von ihm. Bald darauf bekam Kitty ein Lied ganz für sich allein, sie stellte sich zur Schau und hoffte auf eine Gunstbezeigung, einen Liebhaber. Nach der Vorstellung kamen oft Männer aus dem Publikum in die Umkleideräume, es gab Zudringlichkeiten, Kämpfe und Tränen. Hester schlug einmal einen minderjährigen Lord nieder, worauf der Inspizient sie zu einer Strafe von fünf Shilling verdonnerte.
Und dann fiel Hester vom Trapez. Sie erlitt böse Verletzungen an Gesicht und Kopf, blutete die ganze Bühne voll, und irgendwie verletzte sie sich auch das Knie, sodass sie nie mehr richtig gehen konnte. Natürlich wurde sie fristlos entlassen, und jetzt war kein Mr. Sim mehr da, der ihnen helfen konnte. Die Schwestern waren am Boden zerstört. Kittys Gage lag bei siebzehn Shilling pro Woche, wenn sie arbeitete, doch oft arbeitete sie nicht, und jetzt musste sie für beide sorgen und auch noch ihre Bühnenkleider und die Schminke kaufen. In ihrem gemeinsamen Zimmer in der Blackmoor Lane durfte Hester nicht mehr bleiben, die anderen Komparsinnen hatten das Gefühl, sie brächte ihnen Unglück. Sie sahen ihr vernarbtes Gesicht und wussten, dass sie Schmerzen hatte. Ihr Anblick erinnerte sie daran, was passieren konnte, wenn sie einen Augenblick unachtsam waren, und als sie das Zimmer verließ, gurgelten sie wütend mit rotem Portwein und Wasser. Verzweifelt sang Kitty allabendlich ihr kurzes Lied in der zweiten Hälfte des Programms, lächelte noch charmanter und lachte mit dem Publikum, schubste andere Schauspielerinnen aus dem Licht und ließ ihre süße Stimme voller Panik in den dritten Rang hinaufsteigen. Einmal sahen Hester und Kitty in der Bow Street eine tote Frau und hörten die Leute flüstern: Sie ist verhungert. Schließlich fand Kitty so etwas wie einen Gentleman, er war ziemlich alt und nicht besonders attraktiv und vielleicht auch gar kein Gentleman (er schien viel mit Pferderennen und dem Import von Wein zu tun zu haben), doch er hatte Geld, und er bewunderte Kittys Stimme und ihr Lächeln und – dies vor allem – ihre Lebenslust so sehr, dass er ihr ein paar diskrete Kellerräume in Bloomsbury einrichtete. Die Schwestern lachten kreischend und klammerten sich ungläubig aneinander.
«In Bloomsbury?»
«Ja, Hes, genau, in der Nähe der Kirche, beim Platz, in der Nähe der Lords und Ladies …»
«… ein eigenes Zimmer? Nur für uns? Und niemand …»
«… zwei Zimmer, Hes! Zwei Zimmer im Keller eines Hauses in der Little Russell Street, direkt gegenüber der St. George’s Church, in Bloomsbury! Wir können zuschauen, wie die Damen in ihren besten Kleidern in die Kirche gehen, und dann können wir ihre Kleider kopieren und auf der Bühne tragen! Es war mal eine Küche, aber sie haben es in Mietzimmer umgewandelt, im Hinterzimmer steht ein kleiner Herd, ein richtiger Herd, wie die vornehmen Leute ihn in ihren Häusern haben, wir können selbst kochen und müssen nicht immer was kaufen!» In Seven Dials hatte es keinen Ofen gegeben, nur ein Feuer im Freien, um das sich die Leute ständig zankten.
«Und woher sollen wir wissen, wie so etwas funktioniert?»
«Das können wir lernen. Ich habe Frauen richtig kochen sehen! Wir können uns einen Topf kaufen! Und wir haben unseren eigenen Eingang!» In ihren wildesten Träumen hatten Kitty und Hester sich nicht vorgestellt, in zwei eigenen Zimmern zu wohnen. Mr . du Pont (so hieß er, wie er Kitty sagte) hatte – was die Schwestern anging – ein Wunder bewirkt. Er meinte, der italienische Vermieter sei ihm einen Gefallen schuldig gewesen. Und Mr . du Pont hatte nichts dagegen, dass Kitty weiterhin auf der Bühne stand, denn sie dort zu sehen und zu wissen, ein wenig später am Abend würde sie ganz ihm gehören (und er konnte mit ihr machen, was er wollte), hatte eine unerhört belebende Wirkung auf seine daniederliegende Manneskraft. Er verlangte nur, dass Kitty nach ihrem Auftritt sofort in die Little Russell Street zurückkehrte. Manchmal schaute sie wehmütig jungen Menschen in finanziell geordneteren Verhältnissen zu, doch nur für einen Augenblick. Ihre Dankbarkeit für die Sicherheit, die Mr . du Pont ihr bot, war größer als alles andere. «Das ist meine Schwester, die mein Dienstmädchen sein wird», sagte sie großspurig zu Mr . du Pont und kitzelte ihn unterm Kinn. Er runzelte die Stirn über den Anblick der narbengesichtigen, humpelnden jungen Frau, doch Kitty sorgte dafür, dass er Hester danach nie mehr zu sehen bekam. Wenn er zu Besuch kam, hielt sich die ältere Schwester in dem kleineren Hinterzimmer mit dem Herd auf, näher an der Jauchegrube, und verschloss die Ohren vor seinen Bemühungen. Sie war schließlich in einem Elendsviertel aufgewachsen, von daher war sie viel gewohnt. Kitty fand, dass die Dinge, die nächtens von ihr verlangt wurden, der Preis waren, den zu zahlen es sich lohnte, und bat freundlich um Geld für ein neues Kleid, das sie dann Hester gab. Die Schwestern lachten viel über Mr . du Pont, während die Kirchenglocken der großen Kirche auf der anderen Straßenseite läuteten, und dachten sich fünfzig Arten aus, wie Kitty ihn erfreuen könnte, um ihn bei Laune zu halten, damit sie ihre Sicherheit behielten. Manchmal brachte Mr . du Pont eine Flasche Stachelbeerwein mit. Kitty lächelte dankbar. Sie und Hester fanden Stachelbeerwein abscheulich, sie tranken nur roten Portwein. Mit dem Stachelbeerwein wuschen sie sich die Füße und schütteten ihn dann, wenn Mr . du Pont nicht da war, in die Senkgrube.
Wenn man weiß, wo man suchen muss, ist ein Theater eine wahre Fundgrube. Bald kam Kitty jede Nacht durch den Nebel und die dunklen Straßen mit kleinen, versteckten Errungenschaften nach Hause, mit denen sie den Kellerräumen eine ungewöhnliche, an eine Bühne erinnernde Atmosphäre gaben. Ein kleiner, mit einem Strauß Federn geschmückter Spiegel hier, ein Kelchglas mit Blumen aus rotem Samt dort, die im Kerzenschein sanft über den Tisch fielen, oder ein Vorhang aus einem Stück Stoff, das von einem Tableau vivant übrig war.
«Pass bloß auf!», sagte Hester, halb erfreut, halb ängstlich, denn sie erinnerte sich daran, wie eine junge Frau hinausgeworfen worden war, weil sie ein Paar weiße Strümpfe gestohlen hatte. «Wenn du nicht achtgibst, enden wir noch im Newgate-Gefängnis!» Doch Kitty lachte nur. Ihr größtes Beutestück war ein mit Wolken bemalter Prospekt, den sie an einem Teil der Zimmerdecke befestigten. Und als eines Nachts unter Kittys Mantel ein seltsamer, sehr großer Stiefel zum Vorschein kam, hallte der Keller von schallendem Gelächter wider. Hester bearbeitete ihn und stellte ihn neben die Tür, wo er Mr . du Ponts Spazierstock und Schirm hielt.
Manchmal waren Hester die Schmerzen in ihrem verletzten Bein ins Gesicht geschrieben, doch sie jammerte nicht; sie war ungeheuer dankbar dafür, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten. Sie besuchte die neuen Leihbüchereien und las die Zeitungen, buchstabierte langsam die schwierigen Wörter. Viele Stunden verbrachte sie in dem neuen Museum im Montagu House, und um nicht zu verhungern, kaufte sie vorsichtig von Hausierern und Straßenhändlern etwas zu essen. Überall fiel den Menschen die verunstaltete und doch irgendwie hübsche, humpelnde junge Frau mit dem eigenwilligen, offenen Gesicht und den grauen, neugierigen Augen auf. Doch Hester war keineswegs vollkommen offen, insgeheim hatte sie große Angst um ihre Zukunft. Was ist, wenn auch Kitty etwas zustößt oder Mr . du Pont ihrer müde wird? Vor dem Unfall hatten sie sich zu äußerst präsentablen jungen Damen gemausert, sie konnten jetzt anständig sprechen und hätten vielleicht sogar Arbeit in einem der neuen Läden in der Oxford Street oder auf dem Strand finden können. Doch mit ihrem vernarbten Gesicht und ihrem lahmen Bein würde niemand mehr Hester einstellen – es sei denn, sie überquerten den Fluss und gingen in die Färbereien oder die Leimfabriken. Kitty sah das abgespannte Gesicht ihrer Schwester und hörte sie manchmal in der Nacht vor Schmerz aufschreien. Auch sie hatte insgeheim große Angst um ihre Zukunft und sang umso lauter und lächelte ins Publikum.
Eines Abends erzählte jemand im Theater voller Ehrfurcht von einem Magnetiseur in Kennington, in der Nähe der Poststation Elephant and Castle. Er versetze Menschen in Trance und befreie sie von ihren Schmerzen. Die anderen Schauspieler lachten, doch Kitty dachte an Hesters schmerzverzerrtes Gesicht. «Wahrscheinlich ist das alles Humbug», sagte sie, «aber lass es uns versuchen, Hes.» Sie dachte sich für das Vorderzimmer in Bloomsbury neue Varianten aus und überzeugte den alten Mr . du Pont davon, ihr eine halbe Guinee zu geben. Sie gingen den ganzen Weg zur Kennington Road zu Fuß, auch wenn Hester manchmal die Schmerzen kaum aushalten konnte. Und so klopften die beiden eines Nachmittags schließlich ein wenig unsicher an die Tür eines Hauses in der Cleaver Street und fanden sich in einem dunklen, kahlen Raum mit farbigen Sternen und mehreren Spiegeln und einem Mann mit einem fremdländischen Akzent wieder. Unter dem Mantel trug Kitty das Bügeleisen bei sich.
«Wir wissen nicht genau, was es mit diesem Magnetismus auf sich hat, aber kommen Sie nicht auf dumme Gedanken», sagte Kitty scharf, doch der fremde Mann lächelte nur nervös und bat sie, in einer Ecke Platz zu nehmen. Er verbeugte sich und spielte auf einer kleinen Flöte eine fremde, schwermütige Melodie. Dann setzte er Hester auf einen Stuhl, nahm neben ihr Platz und fragte sie nach dem Sturz vom Trapez. Seiner Stimme nach zu schließen war er genauso nervös wie sie, und den Schwestern fielen seine abgetragenen Kleider auf. Sein Beruf war, wie es schien, finanziell nicht gerade lohnend, obwohl er ganze fünf Shilling von ihnen verlangte. Dann beugte er sich über Hester und machte sich daran, mit den Händen vorwärts und rückwärts über ihren Kopf zu streichen und ihren Körper hinunter, ohne sie jedoch zu berühren. Kitty sah ihm genau auf die Finger, falls er etwas Unschickliches tat – schließlich war er ein Fremder –, doch sie bemerkte, dass alle Nervosität jetzt von ihm abgefallen war, er wirkte sicher und ruhig. Sie sah, dass ihre aufgeweckte, starke, vernünftige Schwester sich ein wenig entspannte, und nach etwa zehn Minuten schien sie zu schlafen, doch mit offenen Augen. Sie schien im Rhythmus des Fremden zu atmen, ein und aus. Kitty beobachtete sie halb fasziniert, halb erschrocken und blinzelte, als wäre auch sie irgendwie von der seltsamen Atmosphäre gefangen. Jetzt strich der Fremde mit den Händen über Hesters Bein, doch wieder berührte er es nicht, obwohl Kitty für alle Fälle das Bügeleisen in Bereitschaft hielt. Als er mit den Händen über sein eigenes Bein fuhr, strich sich auch Hester mit den Händen über ihr Bein. Zehn Minuten vergingen, fünfzehn. Schließlich bewegte der Magnetiseur seine Hände wieder an Hesters Gesicht vorbei, und Kitty sah, dass ihre Schwester plötzlich aufwachte – obwohl sie gar nicht geschlafen hatte. Und dann stand Hester auf Anweisung des Fremden hin auf. Zuerst schwankte sie ein wenig, dann schaute sie den Mann erstaunt an. Sie ging humpelnd zu Kitty hinüber.
«Es tut nicht mehr so weh!», sagte Hester.
Sie waren viel zu vernünftig, um an Zauberei zu glauben, aber irgendetwas war passiert. Hester humpelte noch wie immer, doch so wenig Schmerzen hatte sie noch nie gehabt, seit sie vom Trapez gefallen war. Staunend erklärte sie Kitty auf dem langen Heimweg nach Bloomsbury noch einmal, sie habe das Gefühl gehabt, etwas Warmes durchströme sie.
«Es kam irgendwie von ihm, eine Art Wärme.»
«Er hat dich nicht angefasst», sagte Kitty, «ich habe ihn mit Argusaugen beobachtet.»
«Ich weiß», sagte Hester verdutzt.
«Und was ist passiert?»
«Keine Ahnung.»
«Also, ist es … war es so ähnlich wie … wie Sonnenstrahlen aus seinen Augen? Wie hat es sich angefühlt?»
«Schwer zu sagen. Ich erinnere mich daran, und gleichzeitig erinnere ich mich auch nicht. Ich wollte, dass es funktioniert. Ich weiß noch, dass ich unbedingt wollte, dass es funktioniert.»
Kitty entlockte Mr . du Pont weitere halbe Guineen, und Hester ging immer wieder zu dem Magnetiseur. Meistens ließen die Schmerzen ein wenig nach. «Vielleicht wäre es sowieso geheilt», sagte sie verwirrt zu Kitty. «Vielleicht empfinde ich die Schmerzen auch anders.» Manchmal betrachtete sie verdutzt ihr Bein. Bald konnte Hester raschen Schrittes durch Londons Straßen humpeln, drängte sich durch die überfüllten Gassen mit dem holprigen Kopfsteinpflaster, an Schornsteinfegern und Gentlemen vorbei, wich Pferden und Kutschen und Vieh auf dem Weg zum Smithfield Market und den Jungen mit weißen Tanzmäusen aus und gab einem Bettler abergläubisch stets einen Viertelpenny, als könnte das sie und Kitty vor einem ähnlichen Schicksal bewahren. Straßenhändler riefen warmes Brot und kalte Milch aus, und aus den Schänken drang Geschrei und Gelächter. Sie las in den Zeitungen, dass der animalische Magnetismus (wie er manchmal genannt wurde) ausländische Quacksalberei sei, der die Unvorsichtigen, besonders junge Frauen, in die Falle lockte; doch sie las auch andere Berichte, in denen es hieß, das magnetische Fluidum könne Gutes bewirken, von einer Person zur anderen fließen und Schmerzen lindern.
«Aber was genau ist es?», fragte sie nicht nur Kitty immer wieder, sondern auch sich selbst. «Was geschieht dabei?» Eines Tages entdeckte sie die Ankündigung, dass ein deutscher Professor in der Frith Street in Soho einen Vortrag über animalischen Magnetismus halten würde.
Hester ging zu dem Treffen. Sie stieg in einen Keller hinunter und traf dort unter der ziemlich exzentrischen Zuhörerschaft aus seltsam aussehenden Gentlemen, Ausländern und älteren Damen auch ihren eigenen Magnetiseur, Monsieur Roland. Der deutsche Professor sprach über Franz Anton Mesmer und das von ihm entdeckte magnetische Fluidum und darüber, dass durch die Harmonisierung dieses Fluidums die körperliche Gesundheit verbessert werden könne. Hester hörte fasziniert zu. Ein Mann stand auf und rief etwas dazwischen, ein anderer aus dem Publikum versetzte ihm einen Schlag. Danach verteilte der deutsche Professor Karten, doch Hester trat zu Monsieur Roland in seinem schäbigen Anzug.
«Unterrichten Sie mich», sagte sie. «Ich bezahle es irgendwie. Ich unterrichte Sie Dinge», fügte sie mutig hinzu (denn es war mutig, so offen zu sein, wenn man Narben im Gesicht und ein steifes Bein hatte) und lächelte den Gentleman mit ihren intelligenten grauen Augen an. Der Mann wurde rot bis an die Haarwurzeln, räusperte sich mehrmals, und Hester, die wusste, dass sie noch Reste ihrer einstigen Schönheit besaß, lächelte noch einmal. «Unterrichten Sie mich.»
«Mademoiselle, die Flöte und die bunten Glassterne sind nur dazu da, um die Atmosphäre vorzubereiten», sagte ihr Magnetiseur entschuldigend.
All diese Geschichten hatte Cordelia nach und nach im Laufe der Jahre von ihrer Mutter und ihrer Tante gehört, Geschichten über ihr Lachen und ihre Tränen, ihre Streitereien und ihre Versöhnungen. Mit der Muttermilch hatte sie den Geruch des Karminrot eingeatmet, mit dem die Schauspielerinnen sich das Gesicht schminkten; sie hatte in einer Ecke gesessen und zugesehen, wie ihre Tante mit den Händen über die Damen gestrichen war, die zu Besuch gekommen waren. Sie hatte das Leben der beiden Schauspielerinnen von Kindesbeinen an in sich aufgesogen. Eine ihrer Lieblingsgeschichten war die über den berühmten Politiker, der Mrs. Armitage geheiratet hatte (die Schlimmeres gewesen war als Schauspielerin), Charles James Fox, nicht wegen seiner Politik (bei Politik kannten sie sich nicht aus), sondern weil er einmal, vor Hesters Unfall, mit Freunden im Theater gewesen war und Hester und Kitty danach zum Abendessen eingeladen hatte. «Hat sich betragen wie ein Gentleman», hatten sie Cordelia immer erzählt. «Wir haben so viel gegessen, wie wir wollten, und er hat uns zum Lachen gebracht, und wir haben ihn zum Lachen gebracht, und danach hat er uns in einer Kutsche nach Hause bringen lassen!»
Es stellte sich heraus, dass Hester, äußerst diskret nur als Miss Preston aus Bloomsbury bekannt, «die Gabe» besaß. Das sagten die Damen, die vor der Kellertür vorsichtig ihre Kutschen verließen und rasch und leise die schmale Eisentreppe hinunterstiegen: Miss Preston besitzt die Gabe. «Ich mache genau dasselbe wie du», sagte Hester zu Kitty. «Wir entzücken Menschen, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise.» Als Cordelia einfiel, wie ihre Mutter und ihre Tante die billigen schimmernden Sterne poliert hatten, musste sie lachen. Schon als kleines Mädchen hatte sie genau verstanden, dass die Damen, die zu Besuch kamen, ihre Tante brauchten und ihr blind vertrauten.
Zuerst konnte Hester nur Termine am helllichten Tag machen, um Mr . du Pont nicht zu verschrecken, der schließlich die Miete zahlte, doch später, als Hesters Ruf wuchs und sie die Haupternährerin wurde, wurde Mr . du Pont nicht mehr gebraucht, und jetzt wurde Kitty ins Hinterzimmer mit dem Herd verbannt. Hester sorgte mit ihrem Geschäftssinn dafür, dass die Schwestern die Zimmer behielten. Sie ging persönlich zu dem italienischen Vermieter und fand ihn in der italienischen Kirche, wo er kleine Jungen um sich scharte, die Tauben in Käfigen verkauften.
«Von jetzt an zahle ich die Miete», sagte Hester würdevoll mit dem abgezählten Geld in der Hand. Und das tat sie, pünktlich jede Woche, selbst als die Miete stieg. Andere Mieter in der Little Russell Street trugen mitten in der Nacht ihre Stühle und Betten weg, oder der Gerichtsvollzieher kam; die beiden Miss Preston blieben. In guten wie in schlechten Zeiten behielten sie ihre zwei Zimmer in Bloomsbury – sie waren ihr Zuhause.
Mr . du Pont musste natürlich aus ihrem Leben entfernt werden, denn sie brauchten ihn nicht mehr. Kitty musste auf Tournee durch die Provinz gehen, das war die einzige Möglichkeit, ihn loszuwerden. Wochenlang noch klopfte er an die Kellertüre.
«Sie ist verschwunden, weg, für immer», erklärte Hester ihm schließlich. «Leben Sie wohl.»
Zum ersten Mal fühlte Kitty sich frei; sie war jung, sie schwelgte in ihrer Freiheit, sie juchzte buchstäblich vor Freude und Erleichterung, jemanden los zu sein, den sie körperlich so abstoßend gefunden hatte. Sie war dankbar für die Sicherheit, die er ihnen geboten hatte, doch jetzt spuckte sie ihn aus wie einen üblen Geschmack. Sie hatte ihre Pflicht getan, und jetzt war sie frei! Doch als sie feststellte, dass sie schwanger war, änderte sie ihren Namen rasch zu Mrs. Preston. Wütend trank sie Gin und sprang etliche Male vom Tisch. Mrs. Kitty Preston war Komödiantin, und die unerwünschte Schwangerschaft war ihr größter Witz, denn es gab in dem Theater in Bristol, wo sie Cordelia nach einer Vorstellung von Der Dieb zur Welt brachte, natürlich keinen Mr. Preston oder sonst einen Mr. Irgendjemand, und es gab auch keine Möglichkeit herauszufinden, ob Mr . du Pont der Vater war oder irgendeiner der vorüberziehenden Schauspieler. Ein gebildeteres Mitglied des Ensembles, das einst den König Lear gespielt hatte, verfügte, das Baby solle Cordelia getauft werden, und machte sich über Kittys prosaischeren Vorschlag Betty lustig. Die Schauspieler verließen Bristol, spielten in Scheunen und Theatern und schliefen in überfüllten, stinkenden Zimmern in Hull, Wolverhampton oder sonst wo, wo man gerade nach ihren Künsten verlangte. Baby Cordelia wurde herumgeschleppt, atmete den Geruch der Farbe ein, mit denen sie sich die Gesichter schminkten, den Talg der Kerzen und das Öl der Lampen und hörte das Knarren alter Theaterdielen und das Poltern, mit dem die Kulissen aus Pappe hin und her geschoben wurden, während es unter dem Requisitentisch oder neben den Kostümkörben lag.
«Kitty, du musst das nicht mehr machen», hatte Hester geschimpft, «nicht mit dem Baby! Ich verdiene genug Geld, du kannst meine Assistentin sein und im Hinterzimmer Flöte spielen.» Doch Kitty lebte für das Leben, das sie kannte, und nach einer kurzen Episode als Assistentin einer animalischen Magnetiseurin, bei der sie Flöte gespielt hatte, ohne das Publikum sehen zu können, wollte sie nichts mehr, als mit dem kleinen Mädchen unter dem Arm die trügerischen Bretter zu betreten, denn sie wusste nicht, wohin sie es sonst tun sollte, schließlich konnte Hester kaum magnetisieren, wenn ein Baby zugegen war. Also erschien Cordelia auf der Bühne: zuerst als Baby, wenn eines gebraucht wurde, dann als kleine Prinzessin in einem Turm. So erlernte sie den Beruf ihrer Mutter, und beim Auswendiglernen ihrer Rollen lernte sie auch gleich noch lesen.
Wenn es mal keine Rollen gab und das Geld ein wenig knapp wurde, empfing Hester im Vorderzimmer Besuch von Damen, während Kitty im Hinterzimmer Gentlemen willkommen hieß, und Cordelia wurde mit einem Penny für den Muffinverkäufer in der Hand eilig hinausgeschickt. Sie ging mit ihrem heißen Muffin zum Bloomsbury Square, wo sie mit der Zeit bald jeden Baum kannte. Manchmal musste sie auch nachts nach draußen, um nicht im Weg zu sein, und dafür hatten Kitty und Hester besondere Regeln für das achtjährige Mädchen entwickelt: Geh immer schnell, trag immer das alte Bügeleisen oder einen großen Stein in der Tasche, hab einen Korb oder einen Brief in der Hand, als wärst du auf einem Botengang. Nachts wird nicht bei den Bäumen herumgetrödelt. Schrei dir die Lunge aus dem Leib und brüll «Feuer», wenn dich jemand anfasst, und schlag ihn mit dem Bügeleisen. Cordelia schloss Freundschaft mit dem Mond. Sie war immer besonders glücklich, wenn der Mond schien, der Mond, mit dem sie und ihre Mutter so viele Nächte von Stadt zu Stadt gereist waren. «Mein Mond» nannte sie ihn und schaute nach oben, ob er hinter den Wolken oder durch den Nebel herauskam, spazierte auf ihren Mädchenbeinen um den Park und kaute stoisch ihren Muffin. An dieser Anhänglichkeit war nichts Romantisches, der Mond (wenn er überhaupt zu sehen war) änderte bedrohlich seine Gestalt (manchmal war er rund, manchmal gebogen), er war genauso wenig zuverlässig wie die meisten Dinge in ihrem Leben.
Doch wenn sie allein war und durch Nebel und Dunkelheit hindurch der Mond auftauchte, war er wie ein Freund, denn er beleuchtete ihr den Weg. Sie konnte noch nicht wissen, dass der Mond ein Symbol der Liebe war, dass die Menschen Gedichte über ihn schrieben und von Liebe sprachen (sie hatte auch noch nie etwas von Romeo und Julia gehört). Gleichmütig – er gab ihr Licht im Dunkeln – betrachtete sie ihren Mond als freundliche Kreatur, die den Platz für sie beleuchtete, mehr nicht. Manchmal hockte sie sich in die Äste einer Eiche, selbst in kalten Nächten, denn es war eine Abwechslung zum Herumlaufen, wovon ihr die Beine müde wurden. Dann saß sie da und suchte nach dem Mond, der seine Gestalt veränderte und die Dunkelheit vertrieb, und sie starrte hinauf und träumte leise, dunstige, formlose Träume, bis es Zeit war, wieder nach Hause zu gehen.
Gelegentlich erlaubte Hester ihrer jungen Nichte, dabei zu sein und leise und reglos in einer dunklen Ecke zu sitzen, wenn sie arbeitete. Bevor sie anfing, sagte Tante Hester, die in anderen Bereichen ihres Lebens so energisch und sachlich war, jedes Mal freundlich: Begeben Sie sich ganz in meine Obhut. Ihre Hände berührten die ängstlichen Frauen nicht (fast alle ihre Kunden waren Frauen), sondern hielten stets einen kleinen Abstand von ihrem Kopf und ihrem Körper. Immer wieder strich sie mit den Händen, in langen, wischenden Bewegungen vor ihnen und an der Seite auf und ab. Manchmal waren die Frauen hysterisch, und Tante Hester beruhigte sie. Manchmal hatten die Frauen schreckliche, quälende körperliche Schmerzen, und irgendwie linderte Tante Hester ihre Schmerzen entweder oder half ihnen, sie zu ertragen. Das kleine Mädchen in der Ecke hörte den Atem der Patientin und ihrer Tante, oft verbanden sie sich zu einem einzigen Rhythmus. Und nach einiger Zeit glitten die Frauen fast immer mit offenen Augen in eine ruhige Trance hinüber, in der sie – Cordelia war sich nicht sicher, was da geschah, doch sie sah es – zur Ruhe kamen.
Und dann kam ein Rollenangebot, normalerweise eine drittklassige Gastspielreise, und schon waren Kitty und Cordelia wieder unterwegs. Cordelia begriff, dass es wahrscheinlich immer so sein würde, also lachte sie, wie ihre Mutter, über die unsäglichen Bedingungen, unter denen sie oft arbeiteten: die betrügerischen Intendanten, die Rollen versprachen, die es dann nicht gab, die Kälte, den Schmutz, die Sprechchöre, mit denen das Publikum nach Löwen und Tigern verlangte, selbst wenn die Schauspieler in einem ernsten Stück auf der Bühne standen, die Reise in eine andere Stadt spät in der Nacht, wenn der Mond auf sie herabschien. All das ertrugen Mutter und Tochter, auch wenn sie manchmal schimpften und fluchten, am Ende doch stoisch. Cordelia besaß ein Temperament, das manchmal unkontrolliert aufflammte. Kitty schlug sie dann, und Cordelia war brav, bis zum nächsten Mal.
Langsam, aber sicher lernte Cordelia, was Hester und Kitty durch ihren Beruf gelernt hatten, nur lernte sie es viel früher und bekam es viel besser hin: wie eine Dame zu sprechen und sich wie eine zu bewegen.
Und dann starb Kitty irgendwo in der Nähe von Birmingham an Lungenentzündung, während sie in einem kalten Zimmer neben Cordelia schlief. Die Tochter und ihre Tante weinten, waren jedoch viel zu hart, um über die Ungerechtigkeit des Lebens zu jammern. Das gehörte zu den schrecklichen Lehrjahren einfach dazu.
Die gemalten Wolken waren längst zu Staub zerfallen, doch die bunten Glassterne an der Decke (die Kitty auf dem gewohnten Weg besorgt hatte, als Hester angefangen hatte zu arbeiten) waren noch da. Der Magnetismus war jetzt in aller Munde, die Zeitungen waren voll davon. Wenn ein Arzt neben anderen Heilkünsten nicht auch ein wenig von Magnetismus verstand, blieben manche Leute fern; besonders Frauen fanden es sehr viel anständiger und befriedigender, dass eine Krankheit von außen geheilt werden konnte statt durch etwas sehr viel Zudringlicheres. In allen Zeitungen und Zeitschriften wurde darüber debattiert, es hieß, Mr. Charles Dickens schreibe in seinem neuesten Roman, Oliver Twist, über Magnetismus, ja, es gingen sogar Gerüchte, er selbst sei Magnetiseur geworden.
Doch Miss Hester Preston, die taktvolle Pionierin, war tot und vergessen.
Cordelia war nun die einzige Miss Preston, die noch übrig war.
4
In der Gastwirtschaft Zum Lamm in einer schmalen Seitengasse der Bow Street erklärten Mr. Kenneth und Mr. Turnour («Agenten der Bühnenstars») Cordelia und Rillie in einer Ecke, die nach Ale, Pfeifentabak und Menschen roch und ihnen als Büro diente, es gebe im Moment nichts für sie, doch sie würden es im Hinterkopf behalten. Die Schauspielerinnen hörten die alten, vertrauten Worte, zogen die Augenbrauen hoch und schauten einander resigniert an.
«Komm, gehen wir uns dieses Magnetismus-Experiment im Krankenhaus angucken, von dem ich dir erzählt habe», sagte Rillie. «Immerhin haben wir unsere feinen Hüte auf.» Und so gingen sie, froh, ein Ziel und etwas zu tun zu haben, zum neuen University College Hospital, wo sie überrascht erfuhren, dass der Herr, der gerade zur Tür hineingeeilt war, womöglich Mr. Charles Dickens gewesen war. Den Flur hinunter lag ein Hörsaal, in dem sich die Menschen nur so drängten. Sie hörten aufgeregtes Stimmengewirr. Gelehrte, ernste Gentlemen, Ärzte und einige Damen in Hüten wie Cordelia und Rillie, alle drängten sich auf schmalen Sitzen. Und das war doch ganz bestimmt Mr. Dickens, der da in der Nähe der Bühne saß. Da vorne ist Mr. Dickens, hörten sie die Leute flüstern.
Professor Elliotson holte eine der jungen irischen Schwestern, von denen sie gelesen hatten, in ihrem Krankenhausnachthemd auf die Bühne. Sie setzte sich mit gesenktem Kopf, die Hände ordentlich gefaltet, sittsam auf einen Stuhl. Ihr Gesicht war nicht richtig zu erkennen. Er sprach zu der versammelten Menschenmenge von der Bedeutung der Arbeit, die er leistete. Der Magnetismus könne Krankenhauspatienten helfen, indem er sie während schmerzlicher Operationen in eine magnetische Trance versetzte. «Ich bin überzeugt, dass der Magnetismus eine körperliche Kraft ist, die auf den menschlichen Organismus einwirkt. Ich möchte meinen anwesenden gelehrten Freunden heute klarmachen, dass Magnetismus kein fauler Zauber ist, kein Spiritualismus.» Er schaute sich im Publikum um, einige Gesichter waren freundlich, einige feindselig. «Meine Damen und Herren, es hat zu viele Auseinandersetzungen zwischen Ärzten und Magnetiseuren gegeben. Ich bin beides. Ich versuche, Magnetismus und Medizin zusammenzubringen. Ich werde jetzt mit der Vorführung beginnen.» Er setzte sich der jungen Frau in dem Nachthemd gegenüber auf einen Stuhl. Als er mit den Händen immer wieder vor ihren Augen vorbei und über ihren Kopf strich, ohne sie zu berühren, spürte Cordelia ein seltsames Kribbeln der Erinnerung – dies war etwas, womit sie seit Kindertagen vertraut war, das sie jedoch nie richtig verstanden hatte. Innerhalb weniger Minuten schien die junge Frau in Trance zu fallen. Das Publikum wartete darauf, was Professor Elliotson als Nächstes tun würde. Dann geschah plötzlich etwas ganz Außerordendiches: Die junge Frau stand auf und fing an, zu ihrer eigenen Musik zu singen und zu tanzen. Die versammelte Menge hätte nicht schockierter sein können. Der Professor hatte der jungen Frau nichts dergleichen gesagt, sie tat es aus eigenem Antrieb. Mehr noch, sie sang ein Lied, das erst vor kurzem populär geworden war.
Mädchen und Jungen, eilt herbei und hört,
ich sing euch heut ein kleines Lied.
Mein Name, der ist Jim Crow.
Und ich wirbel und hops fidel im Kreis,
und wenn fidel im Kreis ich mich dreh, hops ich, Jim Crow.
«Das ist aus einer Show, die gerade im Adelphi läuft», flüsterte Rillie erstaunt. «Da ist ein Schauspieler aus Amerika, der sich als Neger schminkt. Woher kennt sie das?»
Das Publikum (denn es war wie ein Publikum) in dem kleinen, überfüllten Theater (denn es war wie im Theater) war still und aufgeregt und beunruhigt zugleich. Dichte Schwaden von Schweiß und altem Parfüm waberten durch den Raum, während die junge Frau in dem Nachthemd weiter sang und tanzte. Cordelia beobachtete sie mit höchster Konzentration. Sie hatte als Kind genug Magnetismus gesehen, um zu begreifen, was hier geschah, doch sie war sich nicht ganz sicher, ob sie einer Trance oder einer Vorstellung beiwohnte. Sie erkannte, dass Professor Elliotson ein wenig überrascht wirkte, aber auch durchaus stolz. Der Blick der jungen Frau war vollkommen leer.
Und ich wirbel und hops fidel im Kreis,
und wenn fidel im Kreis ich mich dreh, hops ich, Jim Crow.
Als das Lied zu Ende war, begannen einige in der Menge zu klatschen, wurden von anderen jedoch rasch zum Schweigen gebracht. Ein Assistent kam auf die Bühne und drückte der jungen Frau etwas Langes und Spitzes wie einen Nagel oder eine große Nadel in die Haut. Das Publikum hielt die Luft an, die junge Frau rührte sich nicht. Der Professor wandte sich, eine Hand in die Seite gestemmt, wieder der Menschenmenge zu. Die junge Frau stemmte ebenfalls die Hand in die Seite. Als er anfing, über die Bühne zu gehen, tat die junge Frau in dem Nachthemd es ihm nach. Der Professor gab ihr mit einer Geste zu verstehen, sie möge sich hinsetzen, und sie setzte sich sogleich.