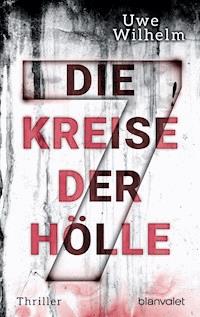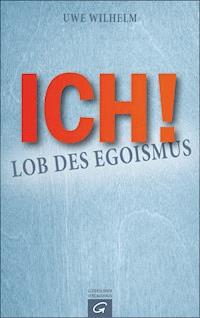9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Helena Faber
- Sprache: Deutsch
Er hasst sie, er jagt sie, er tötet sie ...
Drei Morde in drei Monaten. Drei Frauen. Drei Verkündungen, in denen der Mörder von sieben „Heilungen“ erzählt. Die Berliner Polizei steht unter Druck. Doch dann ist die Serie mit einem Mal beendet und gerät in Vergessenheit – nur nicht für Staatsanwältin Helena Faber, die davon überzeugt ist, dass dies erst der Anfang war. Als ein Jahr später eine vierte Frau brutal ermordet wird, macht Helena Jagd auf den, der sich selbst Dionysos nennt. Es ist der Beginn eines Rennens gegen die Zeit, aber auch eines Kampfes ums Überleben, denn Helena ist ins Visier des Täters geraten. Und Dionysos wird nicht aufgeben, solange sie nicht „geheilt“ wurde …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Drei Morde in drei Monaten. Drei Frauen. Drei Verkündungen, in denen der Mörder von sieben »Heilungen« erzählt. Die Berliner Polizei steht unter Druck. Doch dann ist die Serie mit einem Mal beendet und gerät in Vergessenheit – nur nicht für Staatsanwältin Helena Faber, die davon überzeugt ist, dass dies erst der Anfang war. Als ein Jahr später eine vierte Frau brutal ermordet wird, macht Helena Jagd auf den, der sich selbst Dionysos nennt. Es ist der Beginn eines Rennens gegen die Zeit, aber auch eines Kampfes ums Überleben, denn Helena ist ins Visier des Täters geraten. Und Dionysos wird nicht aufgeben, solange sie nicht »geheilt« wurde …
Autor
Uwe Wilhelm, geboren 1957 in Hanau, hat Germanistik und Schauspiel studiert. Seit 1987 arbeitet er als Autor für Drehbücher, Theaterstücke und Sachbücher. Er hat mehr als 120 Drehbücher u.a. für Bernd Eichinger, Katja von Garnier und Til Schweiger verfasst. Uwe Wilhelm ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Berlin.
Weitere Informationen unter: www.uwewilhelm.de
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Uwe Wilhelm
DIE
SIEBEN FARBEN
DES BLUTES
Thriller
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch.
Sämtliche Handlungen und Personen in diesem Buch sind frei erfunden. Die beschriebenen Begebenheiten, Gedanken und Dialoge sind fiktiv.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright ©2017 by Blanvalet,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign
ED · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-18909-9V001
www.blanvalet.de
Verkündung Nr. 1
Vor drei Tagen habe ich Tara Beria, Herausgeberin der Zeitschrift MINNA, von ihrem lächerlichen Dasein erlöst. Dass diese Tat einen Tabubruch darstellt, ist mir durchaus bewusst. Und es mag gewisse Leute erschrecken, dass ich weder Reue noch Mitleid angesichts dieses ungeheuren Aktes empfinde. Aber dafür gibt es eine Begründung. Sie liegt in dem höheren Zweck meiner Mission, die den Titel »Die sieben Farben des Blutes« trägt und die ich demnächst in weiteren Verkündungen ausführlich darstellen werde. Bis dahin kann ich nur jedem, der wie ich unter dem Niedergang unserer Kultur leidet und dennoch zögert, sich zu wehren, laut zurufen: Sei mutig! Sobald in Gedanken die Grenze, die das Gesetzbuch beschreibt, einmal überschritten ist, fällt jede noch so blutbefleckte Tat zur Wiederherstellung der natürlichen Ordnung leicht. Je weiter man sich vorwagt, umso mehr wird man von Euphorie ergriffen. Ich selbst bin dadurch zu einem modernen Alexander Humboldt geworden. Ich habe wiederentdeckt, was seit Urzeiten in den Menschen schlummert und was, erst seit Frauen ihren von Gott zugewiesenen Platz verlassen haben, Perversion genannt wird: den Krieg. Diesen Krieg werde ich durch die Heilung von sieben Huren wieder zum Leben erwecken.
(Gepostet am 12. Juli 2016 auf dem Facebook-Profil der Staatsanwältin Helena Faber von »Dionysos«)
Als der letzte Satz im stürmischen Applaus der zweihundert Studentinnen und Studenten im Hörsaal 2 der Berliner Technischen Universität untergegangen war, stand Ursula Reuben lächelnd hinter dem Rednerpult und genoss eine Weile den Beifall, bis sie schließlich die Hände hob, woraufhin ihre Zuhörer langsam verstummten.
»Und noch einen Tipp vor allem für die Studentinnen hier im Saal. Wer sagt, dass es die gläserne Decke nicht gibt, die Frauen daran hindert, genauso eine Karriere zu machen wie Männer, lügt. Es gibt diese gläserne Decke. Sie besteht aus den Seilschaften der Männer, aus den Fragen, wann eine Frau Kinder kriegt, ob sie dann zuhause bleibt und ob eine Frau in dem alltäglichen Krieg ihren ›Mann‹ stehen kann. Das ist die gläserne Decke. Unsichtbar und nur schwer durchdringbar. Aber, meine Damen, und da sollten Sie sich nichts vormachen ...«
Wieder brandete Applaus auf. Reuben, die eingeladen worden war, eine Auftaktrede vor den angehenden Wirtschaftswissenschaftlern zu halten, blickte in zwanzig Reihen leuchtender Gesichter. Junge Frauen und Männer, die sie voller Enthusiasmus ansahen, mit ihren Smartphones filmten und jubelten. Und dann war da aber auch dieser Mann in der ersten Reihe, der nicht an den Ort passte. Er kam ihr bekannt vor. War sie ihm nicht schon mal irgendwo begegnet? Auf dem Gang vor ihrem Büro beim Wirtschaftssenat? Wenn sie ihn ansah, lächelte er. Aber es war kein freundliches Lächeln. Eher ein sarkastisches, höhnisches – eines, bei dem die Augen nicht mitlächelten. Vielleicht sollte sie ihn fragen, was er in der Veranstaltung wollte. Aber wenn er nur ein Gasthörer war, wäre es ein Fehler, ihn herauszupicken und eventuell bloßzustellen. Sie wusste, dass die Presse anwesend war und nur darauf wartete, dass sie etwas tat, das ihre Qualifikation in Frage stellte. »Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ursula Reuben protegiert Frauen und stellt Männer aufs Abstellgleis«, würde sie dann wieder lesen müssen. Obwohl das nachweislich nicht stimmte. Meistens jedenfalls. Der Applaus verebbte, Ursula Reuben wandte den Blick von dem Mann ab und fuhr fort.
»Aber, meine Damen, und da sollten wir uns nichts vormachen, natürlich ist die gläserne Decke auch in unseren Köpfen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und da hilft es dann auch nichts, wenn wir die Männer beschuldigen und sie am liebsten auf die Scheiterhaufen der Chancengleichheit stellen würden. Wir sind es, Sie und ich, die das Leben, unsere Hoffnungen und Zukunft in die Hand nehmen und die gläserne Decke zerbrechen müssen. Das mag mühevoll sein und viel Kraft kosten. Aber wenn Sie es nicht versuchen, meine Damen, wenn Sie nicht Willens sind, diese Decke zu durchstoßen, mit allem Mut, mit allem Selbstbewusstsein und mit der Unterstützung von anderen, werden Sie es nie schaffen. Trauen Sie sich. Gehen Sie Ihren Weg. Bewerben Sie sich. Und glauben Sie mehr an sich, als Ihre Umwelt es tut. Ich danke Ihnen.«
Es war mehr als nur Begeisterung, als die Studentinnen nun aufsprangen und unter tosendem Applaus Ursula Reuben für die Rede dankten. Es war, als würden sie sich verstanden und ermutigt fühlen. Als hätten sie ein Vorbild gefunden, an dem sie sich festhalten und orientieren könnten.
Reuben war erst vor ein paar Wochen zur Wirtschaftssenatorin ernannt worden, hatte begonnen, den Berliner Korruptionssumpf trocken zu legen, und dabei erste Erfolge eingefahren. Sie hatte ihrem Vorgänger Bestechlichkeit nachgewiesen, seine Hintermänner ins Visier genommen und sich dabei mit Entschlossenheit und Leidenschaft viele Feinde gemacht.
Als sie eine viertel Stunde später die TU verließ und auf die Straße hinaustrat, stand die Sonne tief und rot am Horizont. Eine kühle Brise wehte sie an. Sie sah sich um. Einige Studenten hoben die Daumen in die Höhe und winkten ihr zu. Der Berufsverkehr wälzte sich durch die sechsspurige Straße des 17. Juni. Ein Taxi fuhr auf der Suche nach Fahrgästen langsam vorbei. Ursula Reuben hielt es an und ließ sich nach Hause bringen. Sie wollte unbedingt noch eine Stunde durch die Straßen in Zehlendorf joggen.
Zuhause angekommen zog sie sich rasch um, schlüpfte in die Laufschuhe und begann ihre abendliche Tour. Juttastraße, Waltraudstraße, Wilskistraße, Riemeisterstraße. Es war schon dunkel, und das fahle Licht der Straßenlaternen wirkte an diesem Abend ein wenig gespenstig. Als sie von der Argentinischen Allee in die Fischerhüttenstraße einbog, bemerkte sie den Wagen. Sie lief weiter. Wollte den Wagen ignorieren, aber er verfolgte sie, und das machte sie nervös. Wenn sie stehen blieb, blieb auch er stehen. Wenn sie langsam ging, fuhr er langsam. Wenn sie beschleunigte, beschleunigte er. Dabei bleib er die ganze Zeit konstant zehn Meter hinter ihr. Und irgendwann reichte es ihr. Sie stoppte, stemmte die Hände in die Hüften und sah herausfordernd zu dem Wagen hin. »Was willst du von mir?«, sagte sie leise. Einen Moment lang rührte sich nichts. »Was willst du von mir?«, rief sie nun lauter. Und als die Tür auf der Fahrseite geöffnet wurde und der Fahrer ausstieg, wusste sie, was er vorhatte. Und dass es ein Fehler war, stehenzubleiben und ihn anzustarren. Sie hätte stattdessen wegrennen sollen. Wegrennen, so schnell sie konnte. Um Hilfe rufen. An der nächstbesten Haustür klingeln. Doch sie hatte nicht einmal mehr Zeit zu schreien.
I
1
Bereitschaftsdienst in der Abteilung Kapitalverbrechen bei der Berliner Staatsanwaltschaft bedeutet, von Montag bis Montag, sieben Tage, vierundzwanzig Stunden pro Tag zur Verfügung zu stehen, um irgendwo in der Stadt eine Leiche in Augenschein zu nehmen und sich zu fragen, wieso ein Mensch sich selbst oder einen anderen Menschen umbringt. Vielleicht liegt es daran, dass Zivilisation nur ein dünner Firnis ist, unter dem das Grauen auf Erlösung wartet. Für Helena Faber war der Bereitschaftsdienst eine Aufgabe, die sie umging, sooft es möglich war. Vor allem wegen der Nächte. Wenn sie an einem Tatort die Leichen und das Blut sah, brauchte sie anschließend Stunden, um wieder einzuschlafen. Es waren bis jetzt zwei ruhige Nächte gewesen. Die Erfahrung sagte ihr jedoch, dass das nicht so bleiben würde. Sie hatte um 21 Uhr Katharina und Sophie ins Bett gebracht, hatte Lieferdienst und Autoversicherung bezahlt, hatte Wäsche in die Kleiderschränke einsortiert, die Spülmaschine geladen. Um Mitternacht hatte sie auf Tinder nachgesehen, ob jemand in der Nähe war, der ihr gefallen könnte. Um halb eins hatte sie Angelo aus der Schublade genommen und sich ihrem kleinen batteriebetriebenen Freund aus Silikon überlassen. Danach war sie entspannt eingeschlafen, bis das Telefon klingelte und ihre Ahnung bestätigte.
»Ja?«, fragte sie und versuchte so geschäftigt wie nur möglich zu klingen.
»Alles okay bei dir?«, fragte eine Stimme mit leicht amüsiertem Unterton zurück. Robert Faber besaß feine Antennen für atmosphärische Störungen. Vor allem was Helena betraf. Vielleicht weil er ihr Ehemann – von dem sie getrennt lebte – und der Vater ihrer beiden Mädchen war. Außerdem war er der stellvertretende Leiter der SoKo Dionysos. »Bist du alleine?«
»Was gibt’s?«
»Leiche auf der Aussichtsplattform der Siegessäule.«
»Was Besonderes?«
Er zögerte einen kurzen Moment, bevor er das Stichwort nannte, das Helena endgültig wach machte. »Sieht nach Dionysos aus.«
»Wer ist die Tote?«
»Die Wirtschaftssenatorin Ursula Reuben. Kennst du sie?«
»Nicht persönlich. Ich bin in zwanzig Minuten da.«
Helena legte auf, sprang aus dem Bett und zog sich an. Nicht schon wieder Dionysos, dachte sie. Griechischer Gott des Weins, der Ekstase oder des Wahnsinns. Je nachdem, wofür er herhalten musste. Seine irdische Ausgabe hatte im vergangenen Jahr innerhalb weniger Wochen drei Frauen auf erstaunlich bestialische Weise umgebracht. Am 7. Juli hatte er Tara Beria (Chefredakteurin der Zeitschrift MINNA), am 15. August Velda Gosen (Leiterin der Frauenrechtsorganisation NEMESIS) und am 7. September Jasmin Süskind (Vorsitzende der Gesellschaft für Sexualberatung AUX FAMILIA) verbluten lassen – während ihres Monatszyklus. Zudem hatte er Tara Beria die Finger beider Hände abgehackt, Velda Gosen die Nase abgetrennt und Jasmin Süskind die Augen herausgeschnitten. Alle drei Frauen hatten die Körperteile, in kleinen Portionen serviert, essen müssen. Die Taten sind nicht sexuell motiviert. Es geht dem Täter um Demütigung und Zerstörung, hatte die Abteilung Psychologie konstatiert. Oder um die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung durch »Heilung der Huren«, wie Dionysos es in seiner ersten Verkündung genannt hatte, die er – wie alle späteren auch – auf Helenas Facebook-Profil gepostet hatte. Warum er dazu jedem seiner Opfer ein kleines rotes Tuch in den Mund stopfte, blieb ein Rätsel. Auffällig war allerdings, dass die Tücher in unterschiedlichen Spektren der Farbe Rot gehalten waren. Bei Tara Beria Scharlachrot, bei Velda Gosen Zinnoberrot, bei Jasmin Süskind Feuerrot. Helena hatte mit Psychologen, Biologen und Chemikern gesprochen. Immer dieselbe Frage: Wieso sieben Farben des Blutes? Die Information, dass die meisten Säugetiere unfähig sind, Rot zu sehen, war ebenso interessant wie nutzlos. Rot steht für Sünde, Leidenschaft, Erotik, Liebe, Feuer, aber genauso für Gefahr, Kampf, Aggression, Wut, hatte ein Professor für Anthropologie, der an der Freien Universität Berlin lehrte, ihr in einer Mail geschrieben. Die alten Römer hätten deswegen ihren Kriegsgott Mars mit der Farbe Rot assoziiert. Später hatte er noch Sozialismus, das Rote Kreuz und Coca-Cola erwähnt. Aber wieso Dionysos von sieben Farben des Blutes sprach, konnte er sich nicht erklären. Ihr Kollege Ziffer wusste zumindest, dass Rot dabei hülfe, Dämonen zu vertreiben und Krankheiten zu heilen. Und der Priester aus der nahen Heilig-Geist-Kirche hatte Rot die Farbe ebendieses Heiligen Geistes genannt und Helena dargelegt, dass die katholischen Kardinäle rote Gewänder trugen, weil sie damit bekundeten, ihr Blut gegebenenfalls für Christus hinzugeben. Am ehesten half Helena eine Erklärung, die Barbara Heiliger, die ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft arbeitete, anbot: Für die Juden stellte Rot die Farbe des Blutopfers dar, das für eine Sünde sterben muss. Aber auch sie wusste nichts mit sieben Farben des Blutes anzufangen.
Helena schrieb eine kurze Notiz. Nur für den Fall, dass eine ihrer Töchter aufwachen sollte. Zwar hatten sie sich daran gewöhnt, dass ihre Mutter einmal pro Monat Bereitschaft hatte und dann mitten in der Nacht für ein paar Stunden weg sein konnte, aber Helena wollte sichergehen, dass sie sich keine Sorgen machten. Bin spätestens um vier wieder da, wenn was ist, ruft an. Hab euch lieb, Mama. Dazu ein lachendes Strichmännchen. Dann verließ sie das Haus und schloss die Tür so leise wie nur möglich.
Der alte Volvo sprang ausnahmsweise ohne Murren an. Helena gab Gas, fuhr den Kaiserdamm hinunter, diese große Magistrale, auf der die Truppen nach dem Deutsch-Französischen Krieg halb verhungert nach Hause getaumelt waren. Nur achtzehn Minuten nach Roberts Anruf parkte sie vor dem Großen Stern, in dessen Mitte die Siegessäule triumphierte. Sechsundzwanzig Meter hoch, der Sockel mit poliertem Granit verkleidet, setzte sich die Säule aus vier Trommeln zusammen, von denen drei mit sechzig vergoldeten Kanonenrohren verziert waren, erbeutet in drei Kriegen: 1864 Deutsch-Dänischer Krieg, 1866 Krieg gegen Österreich und 1870/71 Deutsch-Französischer Krieg. Oben thronte die goldene Viktoria, Abbild der römischen Siegesgöttin, die jetzt über das Meer aus Blaulicht hinweg in Richtung Westen schaute. Auf ihren Schultern hatte Otto Sander in dem Film Der Himmel über Berlin den Berlinern neuen Lebensmut einzuflößen versucht. Während Helena zwischen einem halben Dutzend Einsatzwagen der Polizei, ein paar Zivilen und zwei Krankenwagen hindurchging, versuchte sie einen Zusammenhang zwischen dem Ort, dem Verbrechen und dem Täter herzustellen. Warum die Siegessäule? Was will er uns damit erzählen? Von Weitem sah sie Robert am Eingang zum Turm stehen. Den Mantel offen, die Hände in den Hosentaschen, den Blick gesenkt. Je älter er wird, umso besser sieht er aus, dachte Helena. Wie ein Hafenarbeiter aus einem amerikanischen Heldenepos der fünfziger Jahre. Immer unrasiert, immer ungekämmt und mit diesem stets distanzierten Blick, der Desinteresse behauptete und doch nur eine Art Fliegenfalle war, an der eine bestimmte Sorte Frauen kleben blieb. Vor allem solche mit einer Vaterfixierung, wie zum Beispiel vor dreizehn Jahren Helena.
»Ich hoffe, du bist fit. Bis oben sind es 285 Stufen.«
»Er hat sie hoch bis auf die Aussichtsplattform gebracht?«, fragte Helena ungläubig.
»Da hat sie noch gelebt.«
Helena sah sich um. Die schwere Eingangstür war mit zwei Schlössern gesichert, eines davon ein Sicherheitsschloss.
»Wie ist er hier reingekommen?«
»Er muss Nachschlüssel gehabt haben. Hast du gewusst, dass die Siegessäule von einer Privatfirma namens Monument Tales betrieben wird?«, fragte Robert.
»Nein. Schon mit denen gesprochen?«
»Die wissen von nichts. Wir nehmen uns nachher die Kassiererin und den Hausmeister vor.«
»Die haben sie heute Nacht gefunden?«
»Jemand hat gesehen, dass die Tür offen steht, und uns angerufen.«
In dem kleinen Vorraum im Sockel der Säule befand sich rechts ein verglastes Kassenhäuschen. Daneben ein Drehkreuz und dahinter eine Glastür, die sich automatisch öffnete. Helena ging hindurch.
»Kommst du nicht mit hoch?«, fragte sie Robert.
»Ich war schon zweimal oben.«
Ein skeptischer Blick von Helena, und Robert gab sich einen Ruck und ging vorweg. Eine Wendeltreppe aus Stein, die rechts herum nach oben führte. Die Stufen waren ungefähr einen Meter breit.
»Ich frage mich, wie die Reuben ihren dicken Hintern hier hochgeschafft hat. Sie wiegt mindestens zwei Zentner. Die Jungs oben überlegen seit einer halben Stunde, wie sie sie nachher runterkriegen sollen. Wahrscheinlich bestellen sie einen Kran«, sagte Robert.
Helena antwortete nicht. Hauptsächlich weil sie nach der Hälfte der Strecke außer Atem war. Sie blieb einen Moment auf einer kleinen Plattform stehen. An einem Metallkasten klebte ein Schild mit einer Kamera drauf.
»Was ist mit der Alarmanlage?«, fragte sie.
»Wird derzeit ausgetauscht, weil vor drei Tagen ein paar Ökos nachts hier rein sind, die Kameras zerstört und ein Transparent aufgehängt haben.«
Die restlichen Stufen bis zur Plattform schaffte Helena in einem Stück und wurde mit einem Rundgang belohnt, der einen fantastischen Blick auf die Stadt ermöglichte. Ein Meer von Lichtern zeichnete eine Karte der nächtlichen Geschäftigkeit. Was sich dort zeigte, wo gen Osten das Brandenburger Tor lag, war weniger fantastisch. Polizisten und KTU standen sich gegenseitig auf den Füßen. Die Rechtsmedizinerin Dr. Claudia Becker hockte vor der Leiche. Sie war Mitte zwanzig, hatte kurze blonde Haare, die akkurat zu einem Pony geschnitten waren. Als sie Helena bemerkte, erhob sie sich. Jede ihrer Bewegungen strahlte Ehrgeiz aus. Ob damit die Ermittlungen zum Mord an der Wirtschaftssenatorin gemeint waren oder vielmehr Robert Faber, vermochte Helena nicht zu sagen. Ihr Interesse wurde ohnehin von der Toten absorbiert. Ursula Reuben trug eine weiße Tunika, darunter war sie nackt. Arme und Beine waren mit weißen Kabelbindern an einen Klappstuhl gefesselt. Zu den nackten Füßen der Toten eine Blutlache, eiförmig, ungefähr zwei Quadratmeter groß.
»Er hat sie ausbluten lassen. Todeszeitpunkt zwischen 11 Uhr und Mitternacht. Keine äußerlichen Verletzungen«, sagte Dr. Becker anstatt einer Begrüßung.
»Das gleiche Muster wie bei den drei Toten aus dem letzten Jahr«, murmelte Helena vor sich hin.
Reubens Gesicht war aschfahl, die Haut stumpf und eingefallen. Ihre Augen standen weit offen, als würde sie staunen über das, was mit ihr geschehen war. Um den Mund herum spielte ein seltsames Lächeln. Dr. Becker schien Helenas Irritation zu bemerken.
»Es handelt sich um eine sogenannte oromandibuläre Dystonie. Ursache ist die Heraustrennung der Zunge des Opfers durch den Täter.«
»Und die Zunge ist hier nirgends?«
»Er hat sie gezwungen, sie zu schlucken. Genauso wie er es mir seinen anderen Opfern gemacht hat«, sagte Dr. Becker und ließ erneut ihren Ehrgeiz von der Leine.
»Woher wissen Sie das?«
Dr. Becker zuckte einen kurzen Moment. Sie wusste es nicht. Ihr Blick huschte zu Robert hin, als wollte sie sich bei ihm entschuldigen.
»Ich weiß es nicht, aber ich vermute es«, sagte sie.
Helena ersparte sich eine Antwort. »Fingerabdrücke, Fußspuren?«
»Keine, die laut KTU verwertbar sind, nachdem der Hausmeister den Tatort gründlich kontaminiert hat«, sagte Robert. »Aber wie immer das hier.« Er hielt ihr eine kleine Plastiktüte hin, darin ein rotes Tuch.
»Karminrot«, sagte Dr. Becker.
Helena sah sie erstaunt an. »Woher wissen Sie das?«
»Ich male. Ein Hobby zum Ausgleich …«
Helena nickte und trat an die Brüstung. Der Tiergarten lag schwarz zu Füßen der Viktoria.
»Dionysos.«
Der Name schlüpfte wie ein ekelhafter Geschmack über ihre Lippen. Ein Gefühl von Übelkeit breitete sich in ihr aus. Wenn schon die Wirtschaftssenatorin, warum dann nicht eine Eifersuchtsgeschichte oder ein Idiot, der sich von ihr benachteiligt gefühlt hat?, dachte sie.
Robert schien ihre Gedanken lesen zu können. »Ja, sieht ganz nach diesem Arschloch aus. Also wieder von vorn.«
Weil nach dem 7. September letzten Jahres kein weiteres Opfer aufgetaucht war, hatten die Chefetagen von LKA und Staatsanwalt angenommen, Dionysos sei entweder verstorben oder hätte sein Werk aus anderen, profaneren Gründen beendet, wie zum Beispiel Krankheit, Geldmangel oder religiöse Erweckung. Helena hatte widersprochen. »Warum sollte er plötzlich aufhören?«, hatte sie damals gefragt. »Er ist dreimal erfolgreich gewesen, er hat sein Vorgehen mit jedem neuen Mord perfektioniert, und außerdem hat er seinen barbarischen Plan, den er nach dem ersten Mord in Form einer Verkündung in einem Video dargelegt hat und wonach er sieben Frauen umbringen will, noch nicht vollendet.«Niemand hatte auf sie gehört. Nicht der leitende Oberstaatsanwalt Paulus, nicht die Leitung des LKA. Und wie es jetzt aussah, hatte sie recht behalten. Dionysos war aus einem zwölfmonatigen Winterschlaf erwacht und hatte den Reigen seiner grausamen Morde um einen weiteren ergänzt.
»Das heißt, wir können davon ausgehen, dass innerhalb von achtundvierzig Stunden auf YouTube ein Video auftaucht, in dem er ihren Todeskampf dokumentiert«, sagte Robert.
»Mitsamt der nächsten kranken Verkündung von einer perversen Heilung.«
Es gab Hunderte anonyme Hinweise, aber keine Spur, kein Indiz, nichts, was sie auch nur einen Schritt näher an Dionysos herangebracht hatte, weshalb sie seit Monaten auf der Stelle traten. Das Einzige, was erfolgversprechend aussah, war ein anonymer Hinweis per Telefon, der vor zwei Tagen eingegangen war und behauptete, Dionysos würde aus Rashid Gibrans Werk Das Buch Dionysos zitieren.
Nachdem sie noch mit der KTU gesprochen hatte, fuhr Helena nach Hause. Gegen 4 Uhr morgens schrieb sie eine Mail an diesen Gibran, Professor für Philosophie und Ethnologie an der Humboldt-Universität, und bat um einen Termin. Dann legte sie sich schlafen und versuchte, die Fotos der toten Ursula Reuben aus dem Kopf zu kriegen. Die weiße Tunika, das bleiche Gesicht, der Mund, der eine einzige Wunde war, das schwarze Blut. Gegen halb fünf übermannte sie endlich die Müdigkeit. Die Bilder wurde sie allerdings nicht los. Als ob eine Stimme in ihr sagte: Schau sie dir an. Die Blutlache, die nackten Füße darin, das Gesicht der Toten, Augen, die dich anklagend ansehen. Und da verspürte Helena wieder den Wunsch nach einer Art moralischer Hygiene im alttestamentarischen Sinne und schlief ein.
2
Als sich zwei Stunden später der Wecker meldete, stemmte sich die Sonne tapfer gegen den unabwendbaren Herbst. Schroffe Lichtblöcke fluteten das Schlafzimmer und ließen die Bettdecke so hell leuchten, dass Helena blinzeln musste. John Lennon sang Woman is the nigger of the world, und sie hielt den Titel für einen bösartigen Kommentar. You know, woman is the nigger of the world, yeah, if you don’t believe me, take a look at the one you’re with. Sie war mit keiner Frau und mit keinem Mann zusammen. Und ich bin auch kein Nigger, dachte sie. Sie drückte auf die Schlummertaste ihres Radioweckers, brachte John Lennon zum Schweigen, sank zurück in das Kopfkissen und beschloss, noch zehn Minuten zu träumen. Wenn ich aufstehe, bin ich doch nur seit vier Jahren von Robert getrennt und alleinerziehende Mutter zweier Töchter, im Hauptberuf eine ehrgeizige Staatsanwältin unter ungeheurem Druck, nebenberuflich in eine verglimmende Affäre mit meinem Chef verstrickt, und dazu Köchin, Waschfrau, Putzfrau, Hausaufgabenhilfe, Krankenschwester, und das alles zur gleichen Zeit. Aber jetzt nicht. Nein, jetzt noch nicht. Also drehte sie sich zur Seite, nahm die weiche, an der Oberseite kühle Bettdecke zwischen die Beine und rief einen schönen Traum herbei. Am besten den, der ihr von einem Haus an der Ostsee erzählte, in dem sie, Robert, Katharina und Sophie wie früher in einer kleinen Küche selbstgefangenen Fisch aßen und die Familie glücklich war und Zeit keine Rolle spielte. Es war ihr Nummer-eins-Hit von einem Traum, auch wenn er aus der untersten Schublade der Sentimentalität kam. Aber ein bisschen Eskapismus morgens um halb sieben schadet ja wohl nicht, dachte sie.
Als sie erneut aufwachte, war es zehn nach sieben. Wieso schon zehn nach sieben? Was ist mit dem Wecker? Sie sprang aus dem Bett, musste mit einem kurzen Schwindelanfall kämpfen, weil ihr Kreislauf nicht so robust war wie ihre Disziplin. Kurz pinkeln, ein Blick in den Spiegel. Ich muss zum Friseur. Ein kurzer Besuch auf der Waage. Vierundsiebzig Kilo bei einem Meter siebzig. Und ich muss vier Kilo abnehmen. Besser fünf. Bevor sie duschte, ging sie ihre beiden Mädchen wecken.
Die Zimmer befanden sich wie das Bad im ersten Stock des Reihenhauses, das sie vor zwei Jahren mit einem günstigen Bankdarlehen gekauft hatte. Große Essküche, Badezimmer und vier weitere Räume. Hinter dem Haus ein kleiner, quadratischer Garten, rechts eine Garage, vorne eine gepflasterte Fläche mit einem Basketballkorb. Die Mauern aus roten Ziegelsteinen und ein weißer Holzzaun erzählten von einer Idylle, die nur schwer zu erreichen war. Helena hatte sich für das Berliner Westend entschieden, weil das Viertel abseits der City lag. Keine Nachtclubs und keine Dealer, kaum Jugendbanden, und tagsüber wurde die Gegend von Hausfrauen und Rentnern besetzt gehalten. Ein guter Ort für Kinder.
Als Helena die Tür zu Katharinas Zimmer öffnete, sah sie, dass Sophie nachts wieder zu ihrer großen Schwester ins Bett gekrochen war. Wahrscheinlich hatte sie schlecht geträumt. Das kam in letzter Zeit häufiger vor. Für Helena war es beruhigend, dass die Mädchen ein gutes Verhältnis zueinander hatten, abgesehen von dem gelegentlichen Zickenkrieg. Aber es schmerzte Helena, dass ihre Töchter sich manchmal aneinanderklammern mussten, um ihre Sorgen zu bewältigen, weil ihre Mutter nicht genügend Zeit für ihre Probleme und Sorgen hatte.Sie betrachtete die beiden. Es war ein großes Rätsel, wie unterschiedlich Kinder sein konnten. Katharina war muskulös, dunkelhaarig, blauäugig, einsilbig. Ein junger Panther, bei dem die Pubertät sich mit knospenden Brüsten, ersten Schamhaaren und Akne erfolgreich angemeldet hatte. Auf die Akne angesprochen, schwieg Katharina. Wie sie meistens schwieg, wenn Helena ein Problem mit ihr besprechen wollte. Sie konnte in solchen Momenten zu einem Tresor werden, mit meterdicken Türen und einer Geheimnummer so lang wie Pi. Kommenden Samstag würde Katharina dreizehn Jahre alt werden und endlich bei den Junioren von Alba Berlin spielen dürfen. Sophie dagegen, ein blonder Kanarienvogel, war offenherzig und redselig. Wenn sie irgendwo hinkam, war es, als würde ihr Selbstbewusstsein eine Zehntelsekunde vor ihr den Raum betreten. Was aus Sophie mal werden würde, wusste niemand. Nur eines stand fest: Was immer es auch sein mochte, es würde mit Sicherheit zu klein für sie sein. Sophie brauchte Raum. Nicht physisch wie Katharina, sie brauchte Raum für ihren grenzenlosen Verstand.
Als Helena Katharina mit einem Kuss auf die Wange weckte, sah Katharina kurz auf, drehte sich auf die andere Seite und murmelte etwas von ein paar Minuten. Das sagte sie jeden Morgen, egal um welche Uhrzeit sie geweckt wurde. Da war sie wie ihre Mutter. Sophie war eher wie Robert. Sie brauchte nur eine Sekunde, um hellwach zu sein und sich sofort über irgendwelche Mädchen aufzuregen, die auf Facebook Schminktipps, Flirttipps, Modetipps posteten. Sie war zwei Jahre jünger als Katharina und stand mit ihrer Schwester in einem sportiven Wettstreit um den ersten Platz in Helenas Herzen.
Eine Viertelstunde später trafen sie sich in der Küche. Katharina im Halbschlaf, Sophie im Dauermonolog und Helena in einem dunkelblauen Hosenanzug. Sie hatte die roten Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden und ihre Erschöpfung kunstvoll überschminkt.
»Ich gehe nicht mehr in den Reli«, verkündete Sophie, während sie in ihrem Müsli stocherte.
»Ich denke, du magst diese Geschichten über Jesus. Katharina, hast du Zähne geputzt?«
»Ja.«
Katharina log, Helena wusste, dass sie log, und Katharina wusste, dass ihre Mutter wusste, dass sie log.
»Putz sie nachher noch mal. Sophie?«
»Drei Minuten.« Stolz zeigte sie tadellose weiße Zähne. »Weißt du, Mama, Jesus ist okay, aber Religion ist der Schwimmreifen, den sie dir im Religionsunterricht anziehen wollen, wenn du klein bist so wie ich, damit du bloß nie schwimmen lernst. Und dann denkst du, dass es so was wie Schwimmen gar nicht gibt. Und irgendwann denkst du sogar, dass du auch an Land nicht ohne Schwimmreifen sein kannst.«
Helena sah ihre Tochter konsterniert an. Woher nahm eine Elfjährige solche Gedanken?
»Darüber reden wir heute Abend. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?«
»Keine auf.«
»Okay. Beeilt euch, wir müssen los. Kata, wo ist deine Schultasche?«
Schultasche. Katharina schlich noch langsamer als sonst die Treppe hoch in den ersten Stock. Helena sah ihr hinterher. Normalerweise war Katharinas energetischer Grundzustand Rennen, gleich gefolgt von Ungeduld. Aber heute war etwas anders. Heute schien sie den Zustand des vollkommenen Stillstandes erreichen zu wollen.
»Was ist mit ihr?«, fragte Helena.
Sophie biss sich auf die Lippen und starrte auf den Tisch. »Sie soll von der Schule fliegen.«
»Wieso das denn?«, fragte Helena.
»Sie hat auf dem Klo gekifft.«
»Du bist eine verfickte Petze«, rief Katharina, während sie mit ihrer Schultasche zurück in die Küche kam.
»Bin ich nicht, du bist eine verfickte Petze«, schrie Sophie.
»Hey! Wenn ihr glaubt, ihr kommt in diesem Haus nicht ohne Worte wie verfickt aus, gebe ich euch zur Adoption frei.« Helena sah Katharina an. »Stimmt das?«
Schweigen. Katharina gab sich Mühe, die Fassung zu wahren und nicht sofort loszuheulen. Aber es war zu spät.
»Stimmt das?«, wiederholte Helena.
»Nein!«, schrie Katharina. »Frau Holzinger lügt! Es waren welche aus der Zehnten. Ich war nur auf dem Klo, weil ich keine Lust auf Bio gehabt habe. Ich schwöre.«
Helena konnte sehen, dass die Rüstung, die sich jeder Mensch gegen emotionale Angriffe von außen wie von innen zulegte, bei Katharina noch löchrig war.
»Ich will nicht von der Schule fliegen, Mama. Alle meine Freundinnen sind da«, heulte sie so herzzerreißend, dass Sophie gleich mit ihr weinte.
»Ich will auch nicht, dass Kata auf eine andere Schule muss«, schniefte sie.
Als die ersten Tränen flossen, nahm Helena ihre Tochter in die Arme. »Du fliegst nicht von der Schule. Und jetzt zieht ihr euch fertig an, nehmt eure Schultaschen, und dann werden wir die Sache regeln. In einer Viertelstunde will ich euch am Auto sehen.«
Wenn es darauf ankam, schafften die Mädchen eine Viertelstunde in zwölf Minuten. Sophie kroch auf die Rückbank, Katharina durfte seit einem Jahr vorne sitzen. Zu dritt lauschten sie dem jämmerlichen Ächzen des Anlassers. Der alte Volvo machte wie üblich während der feuchten Jahreszeit Zicken. Helena musste aussteigen, öffnete die Motorhaube und zeigte dem Motor mit einem kleinen Hammer, wer hier der Boss war.
Der Weg zur Schule führte durch ein Spalier aus Bäumen, die mit einer ansehnlichen Verschwendung von Farben geschmückt waren. Der Herbst hatte die Blätter in alle Schattierungen des roten Spektrums getaucht, als wollte er ein letztes Fest vor ihrem nahen Tod feiern. Sie fuhren schweigend. Sophie lernte englische Vokabeln, und Katharina hatte Kopfhörer aufgesetzt. Als sie ankamen, wollte Sophie als Verstärkung zur Direktorin mitkommen, wurde aber von Helena zum Sportunterricht geschickt.
Sophie umarmte ihre Schwester. »Mach die doofe Holzinger fertig.«
Katharina nickte halbherzig, bevor sie hinter ihrer Mutter ins Vorzimmer der Schulleiterin trottete, wo eine kleine, dicke Sekretärin mit roten Wangen und einer Betonfrisur, die ein Abbild ihres Gehirns sein musste, sie entnervt ansah. Sie schien zu ahnen, worum es bei dem Besuch ging.
»Ich habe den Antrag auf Verweis von der Schule bereits gestern an das Schulamt abgeschickt.«
Ihre Herablassung gegenüber einer Schülerin, die in ihren Augen die Schule in einen Drogensumpf ziehen wollte, war unübersehbar. Sicherheitshalber sprang sie von ihrem Stuhl auf und baute sich als Zerberus vor der Tür auf, die zu ihrer Chefin führte. »Frau Holzinger hat gerade einen wichtigen Termin«, meldete sie spitz.
Aber sie hatte nicht mit der Beherztheit einer Mutter gerechnet, die es gewohnt war, Mörder und Vergewaltiger lebenslänglich hinter Gitter zu bringen.
»Ja, mit uns. Und während wir da drin sind, überlegen Sie bitte, ob es richtig ist, eine Schülerin auf der Basis von Indizien von der Schule zu verweisen. Und falls Sie unsicher sind, hilft ein Blick ins Schulgesetz. Paragraph 62, Absatz 1,2 und 4. Vielleicht können Sie dadurch Ihren Kopf noch retten«, sagte Helena. Dabei lächelte sie so freundlich, dass die Sekretärin schauderte und den Weg freigab.
Als Nächstes war die Schulleiterin an der Reihe. Von zwanzig Jahren an der pädagogischen Front ausgelaugt, hatte sie sich einen dicken Bauch, graue Haare und eine unübersehbare Abneigung gegen Kinder zugelegt. Sie erhob sich schwer von ihrem Schreibtischstuhl und reichte über den Tisch hinweg die Hand. Helena ließ sie unberührt, grüßte knapp und abweisend, was bei Frau Holzinger zu der kalkulierten Irritation führte. Es war eine von Helena häufig angewandte Strategie, um die gegnerische Seite zu zermürben. Denn wie es sich für eine anständige Juristin gehörte, ging es darum, Recht zu bekommen, und nicht darum, im Recht zu sein, und schon gar nicht ging es um das, was man landläufig Gerechtigkeit nannte. Helena ließ sich kurz die Sachlage aus Holzingers Sicht schildern, und da die Verteidigung ihrer Tochter sie in die Defensive gebracht hätte, entschied sie, statt Katharina die Schulleiterin auf die Anklagebank zu setzen.
»Haben Sie Katharina mit einem Joint in der Hand gesehen?«
»Nein, aber wie ich schon sagte, hat Herr Netzer …«
»Herr Netzer hat Katharina mit einem Joint in der Hand gesehen?«
»Er hat den typischen Geruch von Marihuana wahrgenommen und sich auf die Lauer gelegt. Katharina war, wie Herr Netzer mir versichert hat, in der entscheidenden Viertelstunde die Einzige auf der Mädchentoilette.«
»Statt meine Tochter anzuhalten, sich während des Biologieunterrichts nicht auf der Toilette zu verstecken, hat Herr Netzer es vorgezogen, eine Viertelstunde lang die Mädchentoilette zu beobachten? Wo war er da eigentlich? In der Toilette oder auf dem Flur davor?«
In diesem Moment schien Frau Holzinger zu begreifen, in welchen Morast Helena sie argumentativ führte. Sie verschränkte die Arme wie zwei Grenzbäume schützend vor der Brust, in der Hoffnung, die Angriffe auf diese Weise aufhalten zu können.
»Das weiß ich nicht. Ich vermute aber, dass er auf dem Flur gestanden hat.«
»Katharina hat mir erzählt, dass Herr Netzer einigen körperlich weit entwickelten Mädchen aus der Oberstufe unverhältnismäßig gute Noten gibt. Stimmt das?«
Mit jeder weiteren Frage fiel die gefühlte Raumtemperatur gen 0 Grad.
»Davon ist mir nichts bekannt.«
»Dass Ihnen das nicht bekannt ist, ist aber noch lange kein Grund, den Mann gewähren zu lassen, oder?«
Als der Gefrierpunkt erreicht war, wurde Frau Holzinger plötzlich sehr müde. Krachend ließ sie sich auf ihren Schreibtischstuhl fallen und schwenkte eine imaginäre weiße Fahne.
»Wir müssen das nicht ausweiten«, gab Helena sich großzügig. »Aber vielleicht wollen Sie noch einmal überlegen, ob es richtig ist, eine Zwölfjährige wegen etwas, das Sie nicht beweisen können, aus ihrem sozialen Umfeld herauszureißen. Zumal Katharina nach dieser Aufregung für die nächsten Jahre von allem, was mit Drogen zu tun hat, Abstand nehmen dürfte. So könnten wir auf unkonventionelle Weise ein beeindruckendes Erziehungsziel erreichen. Meinen Sie nicht auch?«
War da eine Hand dargeboten worden? Tat sich ein Ausweg auf? Frau Holzinger hob den Kopf, sah das Lächeln in Helenas Augen und entschied sich, genau das auch zu meinen.
Helena und Katharina verabschiedeten sich. Frau Holzinger lobte noch schnell Katharinas soziale Kompetenz in der Klasse und wünschte einen schönen Tag, doch die Tür fiel ein wenig zu hart ins Schloss.
Als sie den Flur entlanggingen, vorbei an den künstlerischen Werken der unteren Klassen, die bunt und wild durcheinander aufgereiht hingen, sah Katharina ihre Mutter erstaunt an. Es war ein Blick, der zwischen Begeisterung und Bestürzung schwankte.
»Du kennst das Schulgesetz?«, fragte sie beeindruckt.
»Ich kenne jedes Gesetz. Und vor allem kenne ich das Gesetz vom Angriff als der besten Verteidigung.«
»Ich habe dir aber nichts von Netzer und weit entwickelten Mädchen und guten Noten erzählt«, flüsterte Katharina.
»Nein? Ich dachte … Ist ja auch egal. Auf alle Fälle hat es gewirkt.«
Als sie das Schultor erreichten, hielt Katharina es nicht mehr aus.
»Ich habe übrigens doch gekifft.«
»Ich weiß«, sagte Helena lächelnd.
»Du weißt es?«
»Wir sind eine Familie«, erklärte Helena, »wir halten zusammen, egal was passiert. Aber eines machen wir nicht: Wir lügen uns nicht an. Unter keinen Umständen. Hast du verstanden? Und über die Drogen reden wir noch. Okay?«
»Okay.«
»Und jetzt gib mir dein Handy. In einer Woche kannst du es wiederhaben.«
»Eine ganze Woche? Kann ich nicht Hausarrest haben?«
»Das ist die moderne Form von Hausarrest, mein Schatz.«
Helenas Blick ließ keinen Widerspruch zu. Also rückte Katharina ihr Smartphone heraus. Helena gab ihrer Tochter einen Kuss auf die Wange, stieg in den Volvo und fuhr los. Im Rückspiegel sah sie, wie Katharina ihr verwirrt nachschaute. Sie dachte mit Wehmut daran, dass ihre Tochter an diesem Morgen etwas kennengelernt hatte, das ihr ganzes Leben lang ein treuer Begleiter sein würde: den unvermeidlichen Verlust der Unschuld.
3
»Was verbindet den Kirchenvater Paulus mit Jack the Ripper, was haben Mohammed und James Bond gemeinsam?«
Professor Rashid Gibran sah ins Auditorium. Ungefähr dreihundert Erstsemester im Hörsaal 3 der Humboldt-Universität kamen mit einem Schlag ins Schwitzen. Wie alle anderen Erstsemester vor ihnen hatten die Studenten sich unter dem Fach Philosophie etwas vorgestellt, für das man nicht viel tun musste. Ein bisschen lesen, viel diskutieren, bei Wikipedia das eine oder andere umformulieren und damit das erste Semester hinter sich bringen. Sie waren zwar von den Tutoren vor Gibran gewarnt worden, hätten also wissen können, dass er mehr verlangte als seine Kollegen, aber dass er so ein Tempo vorlegen würde, hatten sie mit Sicherheit nicht erwartet. Hoffentlich nimmt er mich nicht dran, stand deshalb in dreihundert Gesichter geschrieben. Gibran zündete sich eine Zigarette an und ging vor der ersten Reihe auf und ab. Er würde keine Anstalten machen, die Studenten aus ihrer Not zu erlösen. Seit einem Monat war das Thema bekannt, die Sekundärliteratur lag in der Bibliothek bereit, aber wie er wusste, hatte sich kaum jemand ausreichend vorbereitet.
Nach einer endlosen Weile meldete sich eine schmale, bebrillte Studentin in der dritten Reihe. Offensichtlich hielt sie seinen fordernden Blick nicht mehr aus. »Frauenhass?«, fragte sie schüchtern.
»Frauenhass!«, rief Gibran aus. »Richtig. So alt, dass wir uns nicht mehr erinnern, wann er begann. Wir begegnen ihm bei Aristoteles, in der Bibel, im Krieg, in der Cosmopolitan und hier in der Universität. Er ist universelles Kulturgut und so allgegenwärtig, dass Sie sich an ihn gewöhnt haben.« Er deutete auf die bebrillte Studentin. »Verraten Sie uns, wie Sie auf Frauenhass gekommen sind?«
»Es ist der Titel Ihrer Vorlesung.«
»Was für eine enorme intellektuelle Leistung!«
Er lächelte sie an, das schlaue Mädchen wurde rot, und der Rest der Studenten fröstelte angesichts der Hinterhältigkeit, mit der er die Studentin vorgeführt hatte. Gibran war eine beeindruckende Erscheinung. Stets gut gekleidet und stets auf Contenance bedacht, begegnete er seinem Umfeld wie auch seinem Schicksal mit größtmöglicher Distanz. Manche nannten es auch Geringschätzung. Seine Abneigung gegenüber Empathie und Nachsicht brachte ihn in Konflikt mit der politisch korrekten Universitätsetikette, machte ihn andrerseits aber auch für einige Studenten sehr attraktiv. Vor allem für die weiblichen und männlichen Studenten, sofern sie schwul waren. In einschlägigen Foren im Internet kursierten anonyme Beschreibungen, wie sie sich Sex mit ihm vorstellten, gleich neben den Enthüllungen, die eine Studentengruppe unter dem Namen Gibran-Watch Woche für Woche veröffentlichte und die seine Abweichungen von der herrschenden Lehrmeinung wie auch den Zigarettenkonsum während der Vorlesungen anprangerten. Gibran kümmerte sich nicht darum und bedachte Fans wie Feinde mit demselben Desinteresse.
»Damit sind wir auch schon bei der Methode, mit der wir uns dem Thema nähern wollen. Kombination und Deduktion. Ich habe zwei Texte und ein Foto für Sie.« Er nahm eine Fernbedienung, projizierte per Beamer einen Text von seinem Powerbook auf die Leinwand in seinem Rücken und las vor:
»Dann legte er sie auf den Rücken und schnitt ihnen die Kehle durch. Bei seinen weiteren Handlungen konzentrierte er sich immer auf den Unterleib der Frauen. Er entfernte die Gebärmutter und Teile der Vagina. Manchmal nahm er auch die Gedärme seines Opfers heraus. Mary Kelly, seinem vierten Opfer, schnitt er die Brüste ab und legte eine unter den Kopf, eine unter den rechten Fuß. Unter ihrem Kopf fand man außerdem ihre Gebärmutter sowie ihre Nieren. Das Fleisch der Bauchdecke lag auf dem Nachttisch, eine Hand des Opfers war in die leere Bauchhöhle gesteckt. Obwohl Mary Kelly im dritten Monat schwanger war, wurde der Fötus nie entdeckt.«
Während des Textes hatte Gibran langsam das Licht gedimmt. Die holzgetäfelten Wände versanken im Dunkel, die helle Decke wurde zu einem fernen Himmel. Lediglich das Licht über dem Notausgang leuchtete giftgrün.
»Kennt jemand diesen Text?« Gibran hielt das Mikrofon weit weg, sodass seine Stimme einen befremdlichen Hall bekam, als stünde er in einem riesigen Kellergewölbe. Er wartete einige Sekunden, obwohl er wusste, dass aus dem schweigenden Dunkel des Auditoriums keine Antwort kommen würde. Nach einem kurzen Augenblick projizierte er einen neuen Text auf die Leinwand und las wieder vor.
»Du, Frau, bist es, die dem Teufel Eingang verschafft hat, du hast das Siegel jenes Baumes gebrochen, du hast zuerst das göttliche Gesetz im Stich gelassen, du bist es auch, die denjenigen betört hat, dem der Teufel nicht zu nahen vermochte. So leicht hast du den Mann, das Ebenbild Gottes, zu Boden geworfen.« Als er auch den Text zu Ende gelesen hatte, war es stockfinster im Hörsaal. »Ich warte auf eine Antwort.«
Gibrans Stimme schoss wie eine Fledermaus durch den Saal, traf auf Wände, prallte an ihnen ab und füllte den Raum mit einem bedrohlichen Schwingen.
»Platon?« Der Stimme nach die bebrillte Studentin. Sie war offensichtlich mutig geworden und wollte ihren Erfolg wiederholen.
»Eifrig und fleißig, braves Mädchen. Aber ist das Platons Sprache? Tut mir leid, so einfach ist es dann doch nicht mit den guten Noten. Der Text stammt von Quintus Septimius Tertullianus, genannt Tertullian. Geboren 150 nach Christus, gestorben vermutlich 240. Tertullian gilt als der Vater des Kirchenlateins, war einer der Gründer der römisch-katholischen Kirche und ein hervorragender Frauenhasser. Kann jemand von Ihnen den ersten Text zuordnen?«
Schweigen.
»Niemand?«
Niemand. Gibran neigte den Kopf zur Seite, schloss die Augen und spazierte einen Augenblick lang am Ufer der Havel entlang, weit weg von den beschämenden intellektuellen und körperlichen Ausdünstungen seiner Studenten. Er fühlte die kühle und frische Luft, und als er die Augen nach einem kurzen Moment wieder öffnete, war er erholt.
»Na gut«, rief er heiter, »da Sie schlecht vorbereitet sind, meine Damen und Herren, will ich unsere Zeit nicht damit verschwenden, auf etwas zu warten, das doch nicht kommen wird. Der Text ist einem englischen Polizeibericht vom 28. Oktober 1888 entnommen. Es handelt sich bei den beschriebenen Morden um Verbrechen, die allgemein Jack the Ripper zugesprochen werden. Aber das hier werden Sie sicherlich kennen.«
Gibran projizierte das Foto eines Mannes auf die Leinwand. Er trug ein grünes T-Shirt über seinem fetten Bauch, auf das mit weißen Buchstaben Alles Fotzen außer Mutti geschrieben stand. Rumoren und Kichern erklang im Auditorium. Ein kurzes Knacken, und dann wurde es mit einem Schlag hell. Die Studenten scharrten mit den Füßen und flüsterten nervös. Sie sahen ihren Professor gespannt an und fragten sich wohl, mit welcher Idee er sie als Nächstes bloßstellen würde.
»Wenn Sie einen Schein haben wollen, stellen Sie eine Verbindung zwischen den beiden Texten und dem T-Shirt her. Fragen Sie sich, ob die Verurteilung der biblischen Eva, die Tertullian vorgenommen hat, zu den Verbrechen führt, die Jack the Ripper begangen hat. Und findet der Femizid, den Jack so gründlich zelebriert hat, seine Wurzeln in Tertullians philosophischer Misogynie? Oder treibt lediglich die Angst vor dem Weibe Männer in einen derartigen Wahn, dass sie keine Hemmungen haben, eine Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsorgan als Synonym größtmöglicher Verachtung zu benutzen? Das alles bis Freitag. Und kommen Sie mir nicht wieder mit Ihrem wässrigen Feminismus. Befreien Sie sich aus dem Sklavendenken. Sie wissen ja, summa cum laude bekommen Sie von mir nur für einen Mord.«
Die Studenten lachten. Vermutlich hielten sie es für einen Scherz, aber Gibran spürte, dass sie sich nicht ganz sicher waren, ob nicht ein Fünkchen Wahrheit darin steckte. Er gab die ersten Klausuren zurück, von denen keine besser als Note Drei war, und entließ seine Studenten in mehrere Nachtschichten. Dann sah er auf seinem Handy, dass eine Mail eingetroffen war. Helena Faber, Staatsanwaltschaft Berlin, stand im Absender. Normalerweise kümmerte er sich nicht um Anrufe, Mails, SMS. Auch nicht wenn sie von der Staatsanwaltschaft kamen. Doch diesmal war es anders. Auf diese E-Mail hatte er geradezu gewartet.
4
Der alte Volvo schlängelte sich durch die verstopfte Stadt. Den Kaiserdamm hinunter, durch den Kreisverkehr am Ernst-Reuter-Platz, dessen Namensgeber die Völker der Welt aufgerufen hatte, auf diese Stadt zu schauen, den 17. Juni entlang durchs Charlottenburger Tor, um die Goldelse herum, zu deren Füßen sie Ursula Reuben gefunden hatten, vorbei am Schloss Bellevue, in dem der Bundespräsident seine Staatsgäste empfing. Auf Inforadio war die Wirtschaftssenatorin das große Thema. Die Spekulationen überschlugen sich, Dionysos wurde der Reihe nach zum Psychopathen, Massenmörder, Hassprediger erklärt. Ein selbsternannter Experte vermutete ein frühkindliches Trauma als Auslöser für die bestialischen Taten, weshalb der Mörder keine Kontrolle über sich und sein Tun habe, daher eigentlich schuldunfähig sei und therapiert werden müsse. Helena schüttelte konsterniert den Kopf. »Wenn ich ihn an die Wand genagelt habe, kannst du dich ja mit ihm in eine Zweierzelle sperren lassen und versuchen, ihn zu therapieren, bevor er dich therapiert«, rief sie in Richtung Radio. Ein Kommentator wusste ein Genie am Werk, das zu klug und gerissen sei, als dass Ermittlungsbehörden ihn jemals überführen konnten. Ein anderer sah die moderne kapitalistische Warenproduktion als Schuldigen, die die Menschen entfremdete und entmenschlichte. Es war grotesk, mit welch wohligem Gruseln sich die Öffentlichkeit auf die tote Ursula Reuben stürzte, um sich dann doch ein paar Tage später mit unverhohlener Langeweile wieder ab- und dem nächsten Grauen zuzuwenden.
Helena hatte genug gehört. Sie wechselte zu einem Musiksender, bei dem John Lennon sich vorstellte, wie alle Menschen in Frieden leben würden. Allerdings nur ein paar Takte lang, dann wurde er von einem Anruf unterbrochen. Anonym, stand auf dem Display.
»Ja?«
»Rashid Gibran.«
Rashid Gibran? Sie hatte ihn in der Mail gebeten, sie im Büro zurückzurufen. Im Büro, nicht auf dem Handy. Das Handy war privat, die Nummer geheim. Manchmal wurde sie von den Kollegen im LKA angerufen, wenn es sich um einen Notfall handelte, aber sonst kannte niemand außer ihrer Familie die Nummer.
»Professor Gibran, schön, dass Sie anrufen, aber würden Sie mir bitte sagen, woher Sie diese Nummer haben?«
»Sie sind Staatsanwältin, wie ich Ihrer Mail entnehme. Finden Sie es heraus.«
Helena wunderte sich über die tiefe Stimme, die wie ein Streifen Samt aus dem Lautsprecher glitt. Sie legte ihrem Ärger Zügel an. »Auf alle Fälle ist es nett, dass Sie sich so schnell gemeldet haben. Ich würde gerne mit Ihnen über einen Fall sprechen, mit dem wir uns seit einigen Monaten beschäftigen.«
»Sie meinen Dionysos.« Er wartete ihre Antwort erst gar nicht ab. »Wie ich heute Morgen den Nachrichten entnehmen konnte, ist er wieder in den Krieg zur Heilung der unartigen Frauen gezogen, und jetzt stehen Sie natürlich blamiert da, weil Sie in den letzten Monaten versäumt haben, ihn zu schnappen, habe ich recht? Hat Ihr Chef Sie wegen dieser Blamage zur Schnecke gemacht?«
Paulus hatte sie davor gewarnt, sich mit Gibran in Verbindung zu setzen. Er wird nichts unversucht lassen, um dich zu provozieren, hatte er gesagt. Aber dieser Angriff gleich beim ersten Telefonat irritierte sie. Sie schüttelte sich kurz und zog ihre Rüstung an.
»Nein, hat er nicht. Das entspricht auch nicht der Art und Weise, wie wir bei der Staatsanwaltschaft arbeiten. Dionysos zitiert aus Ihrem Werk Das Buch Dionysos.«
»Sie meinen, ich sollte ihn wegen Verletzung des Urheberrechts belangen?«
»Ich würde Ihnen gerne eine Akte zukommen lassen. Vielleicht haben Sie eine Idee, wie wir ihm auf die Spur kommen können.«
»Warum sollte ich Ihnen helfen, Dionysos zu überführen?«
»Weil ich einen psychopathischen Mörder aus dem Verkehr ziehen will.«
»Aber es fängt doch gerade erst an, unterhaltsam zu werden.«
»Sie finden es unterhaltsam, wenn Frauen bestialisch ermordet werden?«
»Nein, da ist er einfach nur ehrlicher als die meisten seiner Geschlechtsbrüder. Unterhaltsam sind die Videos und die etwas angestrengt bedeutungsschweren Verkündungen. Er eröffnet neue Showkonzepte, finden Sie nicht auch? Jedenfalls bessere als die, die uns die Nachrichten abends bieten mit ihren verschämten Schnitten weg von den verstümmelten Gliedmaßen und abgeschlagenen Köpfen. Da sind die Werke Ihres Mörders doch von einer anderen künstlerischen Qualität. Wussten Sie, dass der Komponist Stockhausen und der Künstler Damien Hirst die Anschläge auf das World Trade Center als das größte Kunstwerk der Gegenwart bezeichnet haben? Was würden die beiden wohl zu Dionysos sagen?«
»Das interessiert mich nicht. Aber ich kann verstehen, dass man sich mit Hilfe von Zynismus vor dem Grauen in Sicherheit bringen möchte.«
»Zynismus ist etwas für Schlappschwänze. Ich spreche von der Dekadenz, die sich mitten im Sterben noch einmal in ihrer ganzen Blüte zeigt, bevor sie wie eine verfaulende Leiche explodiert. Also, warum sollte ausgerechnet ich Ihnen helfen?«
»Weil es für einen Mann von Ihrem Format zu profan ist, sich an Frauenmorden aufzugeilen.«
»Sehr schön. Ich glaube, Dionysos würde auch an Ihnen Gefallen finden!«
»Ach ja? Und wie kommen Sie darauf?«
»Wenn Sie nach der 16-Uhr-Vorlesung vor dem Hörsaal 2 auf mich warten, werde ich es Ihnen sagen. Und seien Sie pünktlich.«
Bevor Helena noch antworten konnte, hatte Gibran das Telefonat beendet. Idiot, dachte sie und ärgerte sich im selben Moment, dass sie sich nicht genauer über ihn informiert hatte. Das musste sie auf alle Fälle vor dem Treffen machen. Einfach um gewappnet zu sein. Dann atmete sie ihren Ärger aus und sah auf die Uhr. Noch zwanzig Minuten bis zum Büro. Die letzte Möglichkeit, am Telefon ein paar private Termine zu organisieren.
»Guten Morgen, Helena Faber. Ich habe am Donnerstag einen Termin mit Sophie wegen der Bioresonanz-Behandlung. Kann ich den auf Freitag verschieben? Danke.«
Sie bog in eine kleine Seitenstraße ab, um über Schleichwege der Blechlawine zu entgehen, was sich aber als vergeblich herausstellte, weil vor ihr schon andere auf diese Idee gekommen waren. Der nächste Anruf galt dem Lebensmittellieferdienst, der die zwei Tafeln Lindt Excellence 70 % Cacao vergessen hatte, weshalb sie in der vorletzten Nacht um halb zwei zum Spätkauf gelaufen war, um sich mit Nachschub zu versorgen. Dann organisierte sie ein Basketballwochenende für Katharina, besprach mit der Mutter von Sophies Freundin Paulina, dass Paulina bei Sophie übernachten würde, regelte Zahnarzttermine, verschob den Termin in der Autowerkstatt. Anschließend vereinbarte sie ein Treffen mit Robert in der Rechtsmedizin und rief dann im Büro des leitenden Oberstaatsanwalts zurück, erreichte ihn aber nicht. Er hatte ihre Bewerbung um die Leitung der Abteilung Kapitalverbrechen positiv beurteilt und wollte sie dringend sprechen. Dann steckte sie wegen eines Feuerwehreinsatzes in Moabit in einem Stau fest. Sie googelte Gibran und fand ein Foto, das schon ein paar Jahre älter war. Nicht sehr groß, schlank. Ein schmaler Mund, eine spitze Nase und volles schwarzes Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel. Seine arabischen Gesichtszüge machten es schwer, sein Alter zu schätzen. Mitte fünfzig, dachte Helena. Als hinter ihr ungeduldig gehupt wurde, schreckte sie hoch. Sie hatte sich so sehr in das Foto vertieft, dass sie nicht gemerkt hatte, wie sich vor ihr der Stau aufgelöst hatte. Ich muss mich auf diesen Gibran vorbereiten, dachte sie.
5
Helenas Arbeitsplatz bei der Staatsanwaltschaft Berlin liegt im zweiten Stock des Kriminalgerichts in der Turmstraße. Wer das Gebäude zum ersten Mal betritt, muss sich an die Metapher vom Labyrinth der Justiz erinnert fühlen. Eine riesige Treppenhalle, die sich über drei Schiffe erstreckt, über denen ein Klostergewölbe thront. Zwei Dutzend Pfeiler, eine breite Treppenanlage mit Sandsteingeländern. Sechs Figurengruppen, die Religion, Gerechtigkeit, Streitsucht, Friedfertigkeit, Lüge und Wahrheit verkörpern. Man kommt lächerlich schnell hinein, aber nur mit Geld, großer Intelligenz oder einem guten Anwalt wieder heraus, hatte Paulus Helena einst ihren Arbeitsplatz beschrieben. Sie hatte am Anfang drei Wochen gebraucht, bis sie sich nicht mehr verlaufen hatte. Zwar verfügte sie über ein phänomenales Gedächtnis in Bezug auf Daten, Namen und Ereignisse, war aber in puncto Orientierung eine Null.
Das Büro war ungefähr zwanzig Quadratmeter groß und erstrahlte in einer geradezu klinischen Aufgeräumtheit. Nur ein Zeitungsartikel, der von ihrem ersten erfolgreichen Prozess erzählte, klebte an der Rückseite der Tür. Ansonsten weiße Wände und davor Regale mit Büchern über Psychologie, Soziologie, Geschichte. Noch nicht einmal Fotos von Katharina und Sophie. Der Job bestand darin, die schlechten Menschen zu finden und das Schlechteste in den Menschen. Davon wollte sie ihre Töchter fernhalten, solange es ging. Zumindest so lange, bis sie alt genug waren, um festzustellen, dass die Spezies Mann nicht nur als Mörder, Vergewaltiger und Schläger in Erscheinung trat.
Seltsam, dachte sie, als sie den Computer hochfuhr, dass bisher nur der anonyme Anrufer die Verbindung zwischen den Verkündungen und Gibrans Buch bemerkt hatte. Auf Amazon fand sie den Grund. Es gab mehr als drei Dutzend Bücher, die sich in irgendeiner Form mit Dionysos beschäftigten. Gibrans Buch war vor drei Jahren erschienen und stand in der Liste ziemlich weit hinten. Sie kaufte das Werk als E-Book und stöberte eine Weile darin herum. Sie erwartete nicht, etwas zu finden, das sie bei der Suche nach dem Serienmörder weiterbringen würde. Doch schon wenige Seiten verblüfften sie derart und machten sie so wütend, dass sie nicht aufhören konnte zu lesen. Die provozierende Dreistigkeit, mit der er seine Thesen ausbreitete, fesselten sie. Ist es nicht herzzerreißend sentimental, wie Frauen sich mit ihren Peinigern verbünden? Das Stockholm-Syndrom, wonach Opfer von Geiselnahmen mit den Tätern sympathisieren und Dankbarkeit empfinden, funktioniert auch in den meisten Ehen.
Sie versuchte, das Klingeln des Telefons zu ignorieren, bis sie im Display den Namen Ziffer sah.
»Lukas, schon wach?«
»In fünfzehn Minuten beginnt deine Pressekonferenz. Können wir vorher kurz reden?«
»Um was geht es?«
»Kann ich dir am Telefon nicht sagen.«
»Ich treffe heute Nachmittag Professor Gibran. Soweit ich mich erinnere, gab es letztes Jahr Ermittlungen gegen ihn.«
»Aber nicht von uns aus. Das war der Staatsschutz. Eine Gruppe namens Gibran-Watch hat ihn wegen Volksverhetzung angezeigt.«
»Was soll er gemacht haben?«
»Unterstützung von terroristischen Vereinigungen, Störung der öffentlichen Ordnung und Beleidigung von Botschaftern nahezu aller arabischen Länder. Er selbst hat Anzeigen gegen den Finanzminister wegen Beihilfe zum Mord durch Export von Rüstungsgütern nach Saudi Arabien und in den Iran gestellt.«
»Was ist daraus geworden?«
»Eingestellt, soweit ich weiß. Wieso fragst du? Ist was Spezielles mit ihm?«
»Weiß ich noch nicht. Kannst du mir die Akte besorgen?«
Lukas Ziffer war der zweite Staatsanwalt in der Abteilung Kapitalverbrechen. Er war ein stiller, hartnäckiger Ermittler und ein Sinnbild preußischer Tugenden: Bescheidenheit, Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein und Disziplin. Helena mochte es, dass er von der romantischen Vorstellung erfüllt war, das Böse, wie er es nannte, irgendwann ausrotten zu können. Er war fleißig und hatte nur eine Schwäche. Er konnte nicht schwimmen. Als die Abteilung ein Jubiläum im Strandbad Wannsee gefeiert hatte, war er der Einzige gewesen, der sich trotz 34 Grad im Schatten geweigert hatte, ins Wasser zu gehen und ein paar Runden zu schwimmen. In ihrer Anfangszeit bei der Staatsanwaltschaft war er in sie verliebt gewesen, aber das hatte sich gelegt. Seitdem war er ein guter Freund und absolut loyal. Als sie ihm vor Monaten von ihren Plänen in Bezug auf die Abteilungsleitung erzählt hatte, hatte er sie sofort ermutigt, sich zu bewerben. Er hatte sie sogar gegen einige ihrer männlichen Kollegen in Schutz genommen. Denn dass sie intelligent und zielstrebig war, gut aussah und sich von kaum jemandem einschüchtern ließ, machte sie für einige Alphatiere zu einem roten Tuch. Hinter vorgehaltener Hand und »off the record« ließen sie gegenüber Journalisten fallen, was sie von Helena Faber hielten: karrieregeil, setzt ihr Aussehen ein, vögelt sich nach oben. Das hatte sie verletzt. Doch Ziffer hatte sie beruhigt. Die Liste deiner Erfolge ist zu lang und deine Auftritte vor Gericht sind zu beeindruckend, als dass Missgunst dir schaden kann, hatte er gesagt, als er sie einmal weinend in ihrem Büro angetroffen hatte. Sein Trost war nicht geheuchelt, es stimmte. Wenn sie im Gerichtssaal zu einer Beweisführung oder einem Plädoyer ausholte, schüchterte sie die gegnerische Verteidigung schon allein dadurch ein, dass sie nie in ihre Notizen schaute, die sie oftmals gar nicht mitführte. Helena stand dann vor den Zeugen und spulte aus dem Kopf Fakten mit einer solchen Lässigkeit ab, dass Zuhörern, Verteidigern und Richtern nichts anderes übrig blieb, als zu staunen. Sich an nahezu jedes Detail zu erinnern war ein automatisches Programm in ihrem Gehirn, wie ein Zwang, der sich nicht abschalten ließ. Selbst Fälle, an die absolut niemand mehr dachte, holte sie aus den Tiefen ihres Gedächtnisses hervor, konnte winzige Details memorieren und lag meistens richtig. Helena hätte der Schrecken von Shows wie »Wer wird Millionär« sein können, wenn sie dafür auch nur den Hauch einer Leidenschaft gehabt hätte.
6
Die Pressekonferenz fand aufgrund des großen Medieninteresses im Saal 206 des Kriminalgerichtes statt. Als Helena eintrat, war keine Zeit mehr, um mit Ziffer unter vier Augen zu sprechen. Sie stellte ihre Tasche auf dem Tisch an der Stirnseite des Raumes ab. Ziffer stand neben der Eingangstür und winkte ihr zu. Er war fünfundvierzig Jahre alt, nur wenig kleiner als Helena und über 90 Kilo schwer. Im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen gab er notgedrungen nur ein wenig auf modische Äußerlichkeiten. Es hieß, dass man nach zehn Jahren bei der Staatsanwaltschaft entweder Zyniker oder Alkoholiker oder beides wäre. Nicht so Ziffer. Helena fragte sich, woher er die Kraft nahm. Vielleicht lag es daran, dass er religiös war. Gerüchte erzählten, dass er sonntags in die Kirche ging und abends vor dem Einschlafen betete.
Mit einem kurzen Handzeichen gab er Helena zu verstehen, dass sie später immer noch miteinander sprechen konnten. Helena klärte anschließend die anwesenden Journalisten über den Ermittlungsstand auf. Dann rangelten mehr als dreißig Reporter um Antworten, gierig auf die Schlagzeile, die die Auflage in die Höhe treiben konnte.
»Frau Faber, können Sie uns etwas Neues über die Hintergründe des Mordes an Ursula Reuben sagen? Handelt es sich wieder um diesen Dionysos?«, fragte eine Reporterin von einem Berliner Boulevardblatt.
Helena kannte sie. Ehrgeizig und intelligent. Auf dem Weg die Karriereleiter hinauf. »Wir ermitteln noch«, beschied sie knapp.
»Es heißt, sie wäre vaginal verblutet. Damit wäre sie das vierte Opfer, das auf diese Weise ermordet worden ist. Wir haben es also bei Dionysos mit einem Serienmörder zu tun?« Die Reporterin ließ nicht locker.
Helena verschränkte die Arme vor der Brust und zog die Stirn in Falten. Zeichen größtmöglichen Widerwillens gegenüber einer Presse, die mehr an ihrer Auflage als an der Aufdeckung der Wahrheit interessiert war. Sie mochte PKs nicht. Sich vor eine gierige Meute zu stellen war nicht unbedingt ihre Sache.
»Das können wir derzeit noch nicht sagen.«
Ein Reporter aus der dritten Reihe meldete sich zu Wort.
»Die drei ersten Opfer waren Frauen, die sich für feministische Politik stark gemacht haben. Frau Reuben ist bisher nicht durch Frauenthemen aufgefallen. Denken Sie, Dionysos hat seine Auswahlkriterien geändert?«
»Ich denke vieles, unter anderem auch das.«
»Dann sind die Morde auf alle Fälle eine Warnung an Frauen, die herausragende Positionen bekleiden?«
»Ich weiß nicht, was in dem Kopf des Täters vor sich geht. Aber er hält sich nicht mit Warnungen auf.«
Die Gesellschaftsreporterin eines weiteren Boulevardblättchens hob die Hand: »Die Wirtschaftssenatorin soll angeblich Verbindungen zur lesbischen Szene gehabt haben.«
»Das Privatleben von Frau Reuben steht hier nicht zur Debatte.«
Ein weiterer Reporter: »Es sieht wie ein klassischer Ritualmord aus.«
»Wenn Sie wissen, wie klassische Ritualmorde aussehen, haben Sie bei uns eine Stelle sicher.«
Es war immer das Gleiche. Die Reporter fragten und wussten, dass sie keine Antworten erhielten. Helena antwortete und achtete darauf, dass die Antworten so wenig Informationsgehalt wie nur möglich enthielten. Das Ganze würde sich noch ein paarmal wiederholen, bis eine neue Sensation die Schlagzeilen okkupieren und Ursula Reuben aussortiert werden würde. Eigentlich hätte man sich diese Veranstaltungen schenken können.
Ein Reporter einer großen deutschen Boulevardzeitung: »Sie schließen aus, dass es ein Mord aus Eifersucht war?«
Helenas Gesichtszüge demonstrierten größtmögliche Aversion.
Eine weitere Reporterin erhob sich in der letzten Reihe, doch Helena wusste nicht, für welche Zeitung sie arbeitete. »Es gibt Gerüchte, dass die Wirtschaftssenatorin einem Grundstückskauf im Spreewald auf die Spur gekommen ist. Der Kauf hat vor zwei Jahren stattgefunden, ist aber in den Büchern ihres Vorgängers verschleiert worden.«
Alle Köpfe wandten sich der jungen Reporterin zu. Komplett in Schwarz gekleidet, das Tattoo einer Schlange am Hals, die über ihre Schulter hinaus nach unten zu kriechen schien, Fleshtunnel-Ohrringe und Piercings in Augenbrauen und Lippen.
Helena hatte von diesen Gerüchten gehört, wusste aber nicht, wie der Stand der Ermittlungen war. Ziffer kam ihr von der Tür her zu Hilfe.
»Wie Sie schon selbst sagen, sind es Gerüchte. Sollten Sie mehr darüber wissen, hören wir Ihnen gerne zu.«
»Glauben Sie, dass sie umgebracht wurde, weil ihr Mörder die Aufdeckung krimineller Machenschaften fürchten musste? Reuben soll eine Untersuchungskommission beantragt haben.«
»Es heißt Frau Reuben oder Ursula Reuben oder die Wirtschaftssenatorin«, ermahnte Ziffer die Reporterin. »Darf ich Sie bitten, der Toten so viel Ehre zu erweisen.«
»Das mache ich gerne, aber ich frage mich, ob Ihre Ermittlungen von politischen Interessen beeinträchtigt werden.«
»Wir sind eine unabhängige Behörde. Unsere Ermittlungen werden in keiner Weise durch politische Interessen oder sonstige Einflussnahme manipuliert.«
Sie hat beeinträchtigt gesagt, nicht manipuliert, dachte Helena.
»Ich habe von Beeinträchtigung gesprochen, nicht von Manipulation«, sagte die junge Reporterin.
»Auch nicht beeinträchtigt«, ergänzte Ziffer. »Darf ich noch Ihren Namen erfahren?«
»Xenia Salomé.«
»Von welcher Zeitung kommen Sie?«
»Ich habe einen Blog.«
Um sie herum hob ein kollektives Stöhnen an. Blog!
»Danke.«
Helena nahm ihre Unterlagen, packte sie in ihre Tasche und hob zu ihrer Standard-Beschwörungsrede an.
»Wir werden den Mord an der Wirtschaftssenatorin Ursula Reuben aufklären. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.«