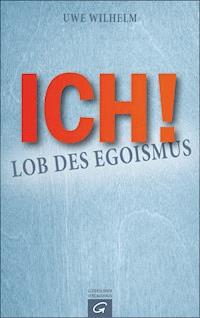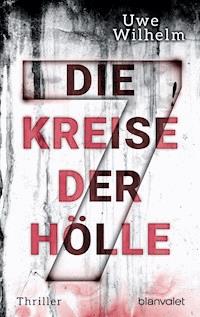
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Helena Faber
- Sprache: Deutsch
Am Ende erwartet euch nur der Tod ... Staatsanwältin Helena Faber zwischen Gesetz und Selbstjustiz.
Als sie sie das letzte Mal sah, spielten sie vor dem Haus … Seitdem erlebt die Berliner Staatsanwältin Helena Faber den Albtraum jeder Mutter: Ihre Töchter wurden entführt. Und zwar von den Männern, gegen die sie im brisanten Dionysos-Fall ermittelte. Nur einer kann ihr helfen: Rashid Gibran, der trotz seiner Verbindung zum Psychopathen Dionysos auf freiem Fuß ist. Helena kennt die Beweggründe des dubiosen Professors nicht, doch sie wird alles tun, um ihre Töchter zu retten. Es ist der Beginn einer Jagd, die Helena in die Untiefen eines grausamen und mächtigen Menschenhändlerrings führt – und bei der sie so brutal wie ihre Gegner wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Als sie sie das letzte Mal sah, spielten sie vor dem Haus … Seitdem erlebt die Berliner Staatsanwältin Helena Faber den Albtraum jeder Mutter: Ihre Töchter wurden entführt. Und zwar von den Männern, gegen die sie im brisanten Dionysos-Fall ermittelte. Nur einer kann ihr helfen: Rashid Gibran, der trotz seiner Verbindung zum Psychopathen Dionysos auf freiem Fuß ist. Helena kennt die Beweggründe des dubiosen Professors nicht, doch sie wird alles tun, um ihre Töchter zu retten. Es ist der Beginn einer Jagd, die Helena in die Untiefen eines grausamen und mächtigen Menschenhändlerrings führt – und bei der sie so brutal wie ihre Gegner wird …
Autor
Uwe Wilhelm, geboren 1957 in Hanau, hat Germanistik und Schauspiel studiert. Seit 1987 arbeitet er als Autor für Drehbücher, Theaterstücke und Sachbücher. Er hat mehr als 120 Drehbücher u. a. für Bernd Eichinger, Katja von Garnier und Til Schweiger verfasst. Uwe Wilhelm ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Berlin.
Von Uwe Wilhelm bei Blanvalet erschienen:
Die sieben Farben des Blutes
Die sieben Kreise der Hölle
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Uwe Wilhelm
DIE
SIEBEN KREISE
DER HÖLLE
Thriller
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch.
Sämtliche Handlungen und Personen in diesem Buch sind frei erfunden. Die beschriebenen Begebenheiten, Gedanken und Dialoge sind fiktiv.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Das Zitat auf der nächsten Seite stammt aus folgender Ausgabe:
Thomas Harris, Das Schweigen der Lämmer,
© Heyne Verlag, München 2006
1. Auflage
Copyright © 2018 by Blanvalet Verlag,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von
Shutterstock.com/Deviney Designs
JB Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-18918-1V001
www.blanvalet.de
Er zog sich aus und schlüpfte in seinen Morgenmantel.
Er brachte eine Ernte immer nackt und blutig wie ein Neugeborenes ein.
Thoms Harris, Das Schweigen der Lämmer
Ungeheuer ist vieles.
Doch nichts ist ungeheurer als der Mensch.
Sophokles, Antigone (Chor)
EINS
Wie in einem Winterschlaf verbringst du ein ganzes Leben in Gehorsam, Blindheit und Phlegma. Wissend, dass das Unheil kommen wird, kommen muss, schließt du wie eine blöde Kreatur die Augen und hoffst auf die Güte des Schicksals, auf Nachsicht und Erbarmen. Bis der Tag kommt, an dem die Güte des Schicksals aufgebraucht ist, und das, was du Glück nennst, dich verlässt. Heute, Helena, ist dieser Tag gekommen. Heute hebt sich der Vorhang zu dem grausamen Spektakel, das Die sieben Kreise der Hölle genannt wird. Der erste Kreis erzählt von Eros, dem Gott der Liebe, und Thanatos, dem Gott des Todes. Er handelt von dem Mann, der in das Puppenhaus einbricht. Von dem Grauen, das er über dich und deine Kinder bringt. Von der Erniedrigung und Entweihung des heiligen Körpers. Du willst wissen, wer dieser Mann ist? Ist er ein Untier, eine Bestie, gar der Teufel? Ja, das alles ist er, Helena, aber vor allem ist er Gottes erstes Geschöpf! Denn Gott schuf den Mann nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und das Weib schuf er aus dem Manne.
Rashid Gibran, Die sieben Kreise der Hölle
Samstag
1
Sie haben vergessen, was Mama zu ihnen gesagt hat. »Wenn ihr die Fahrräder in die Garage gebracht habt, kommt ihr sofort wieder ins Haus. Ich will nicht, dass ihr im Dunkeln draußen spielt.« Das hat sie gesagt. Aber dann ist der schwarze Lieferwagen aufgetaucht. Du bist Kunst, steht in großen, weißen Buchstaben auf die Seitenwände geschrieben. Hinter der Schrift sitzt die Mona Lisa und lächelt rätselhaft. Es ist der Wagen, der das Bild abliefern soll, das Sophie bestellt hat und um das sie so ein großes Geheimnis gemacht hat. Sophie winkt, aber der Wagen hält nicht an. Also müssen sie hinterherlaufen. Sie könnten die Fahrräder nehmen, dann würden sie schneller vorankommen. Aber noch mal zurücklaufen bedeutet vielleicht, den Lieferwagen aus den Augen zu verlieren. Deshalb laufen sie so schnell sie können.
Es war überraschend kühl für Mitte Juni. Die Sonne versank matt hinter den Häusern, und der feine Regen fühlte sich so angenehm feinperlig an, als käme er aus einem Zerstäuber. Wasser spritzte unter den Schuhen, Pfützen leerten und füllten sich bei jedem Schritt aufs Neue. Sophie und Katharina rannten und jauchzten, neigten sich in die Kurve, überholten einander. Die Olympische hoch in Richtung Stadion. Auf die Kreuzung zu, wo es links zum Glockenturm ging und rechts zur Charlottenburger Chaussee und Ikea. Und dann sahen sie den Lieferwagen wieder. Er stand mitten auf dem Platz. Kein weiteres Auto stand dort. Die Scheinwerfer leuchteten, der Motor lief. Die weißen Wolken aus dem Auspuffrohr wurden vom Regen zerschossen. Die Türen zur Ladefläche standen offen, zwei Flügel zur Seite gestreckt wie offene Arme zur Begrüßung.
»Lass uns umdrehen«, sagte Katharina.
Aber Sophie wollte nicht umdrehen. Sie hatte vor ein paar Tagen ein Foto von sich auf eine Website hochgeladen. Eine Jury würde unter vielen Einsendungen die schönsten auswählen, bevor sie sie per Computer in ein Gemälde verwandelten, hieß es da. Und dass ein Lieferwagen zu ihr nach Hause käme, um das Bild auszuliefern, falls sie zu den Gewinnern gehören sollte.
Sophie hatte niemandem davon erzählt. Noch nicht mal Katharina, weil sie befürchtete, dass ihre Schwester dann bestimmt auch ein Gemälde hätte machen lassen. Das wollte Sophie nicht. Es sollte ihr Geschenk für Mama sein. Und jetzt war ja vielleicht das Gemälde von ihr in dem Wagen. Oder warum sollte der sonst durch diese Gegend fahren? Bestimmt hatte der Auslieferer sich verfahren.
»Hallo?« Sophie blickte durch die offene Tür. Kein Licht. Kein Geräusch. Als wäre niemand da. Noch einmal.
»Hallo?«
»Auch Hallo.«
Die Mädchen erschraken, drehten sich herum. Ein Mann stand hinter ihnen. Er war klein, schmal und trug eine runde, hellblau getönte Brille. Sein Lächeln war freundlich.
»Ihr seid wegen den Gemälden hier?«
»Ja«, antwortete Sophie. »Ich heiße Sophie Faber. Ich hab ein Foto von mir hochgeladen.«
»Dann wollen wir doch mal schauen, ob du ausgewählt wurdest, Sophie Faber. Kommt rein.«
»Wir warten lieber hier draußen«, sagte Katharina.
»Habt ihr Angst? Vor mir? Sehe ich aus wie jemand, vor dem man Angst haben muss?«
Sophie und Katharina schauten sich an. Sah der Mann wie jemand aus, vor dem man Angst haben musste? Vielleicht schon. Und trotzdem gingen sie in den Wagen. Hinten ihnen fiel die Tür hart zu. Es hörte sich an, als würde sie sich nie wieder öffnen.
Samstag
2
Sie saßen in der Küche. Wie immer. Nicht im Wohnzimmer, wo mehr Platz war, sondern zu neunt dicht gedrängt um den Küchentisch herum, mit den leer gegessenen Tellern vor sich, den Gläsern mit Rotwein und Weißwein. Sie hörten atemlos zu, als Helena erzählte, wie sie im Elbsandsteingebirge verloren gegangen war. Wie sie den Serienmörder mit dem seltsamen Namen Dionysos gejagt hatte. Dass sie ihr Gedächtnis verloren hatte, dass sie beinahe sein Opfer geworden wäre. Sie berichtete, was in den Tagen passiert war, in denen sie wie ein Tier umhergestreift war. Das meiste davon hatten die Zeitungen berichtet. Aber nicht, was schließlich mit Dionysos passiert war. Davon erzählte Helena nur in Andeutungen. Viel wichtiger war ohnehin, dass ihr ehemaliger Vorgesetzter, der Berliner Oberstaatsanwalt Georg Paulus, als Teil eines Netzwerks von Mädchenhändlern und Vergewaltigern enttarnt worden war. Er hatte sich vor zwei Wochen aus dem Staub gemacht. Jemand musste ihn gewarnt haben, dass seine Verhaftung kurz bevorstand. Jemand, der in die Ermittlungen involviert war oder zumindest davon erfahren hatte. Jetzt wusste niemand, wo Paulus sich aufhielt. Aber auch ihn würde Helena finden. Es war nur eine Frage der Zeit.
Als sie mit ihrer Erzählung geendet hatte, saßen ihre Freunde erschüttert und fassungslos da. Männer, die einflussreiche Positionen bekleideten, hatten kleine Mädchen missbraucht. Wobei der Begriff Missbrauch seltsam und unpassend war, wie Fatima bemerkte, weil es suggerierte, dass es auch einen Gebrauch von Mädchen gäbe. Robert öffnete eine weitere Flasche Rotwein, schenkte nach und musste die Narbe zeigen, die Dionysos ihm zugefügt hatte. Das war Anlass für ein paar Späße und Erinnerungen an amerikanische Filme, in denen Helden ohne Schussverletzungen keine Helden waren. Nach einer Weile wurde sogar gelacht. Sie sprachen darüber, dass es die alten Helden nicht mehr gab. Vielleicht, weil sich nun immer häufiger zeigte, dass die Helden Frauen sexuell belästigten, nötigten und vergewaltigten. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Roman Polanski. Bill Clinton nicht zu vergessen. Einflussreiche Männer. Filmproduzenten, Politiker, Unternehmer. Männer, die mächtig waren und ihre Macht benutzten.
Helena wusste, wie das ging. Sie hatte es selbst erlebt in den ersten Wochen bei der Polizei, wenn ein Vorgesetzter in ihrem Beisein Witze riss. Wenn sie von ihrem Ausbilder Anträge für eine schnelle Nummer bekommen hatte. Sogar mit Paulus hatte es so angefangen. Er hatte ihr durch die Blume zu verstehen gegeben, dass er ihre Karriere beschleunigen könnte. Er hatte nicht gesagt, wie der Preis dafür aussehen sollte, aber es hatte zwischen ihnen gestanden wie ein rot angemalter Elefant. Damals hatte sie gedacht, sie könnte den Spieß umdrehen. Statt dass er sie benutzte, wollte sie ihn benutzen. Die Dialektik der Macht ausnutzen. Das war eine Weile gut gegangen und dann nicht mehr. Dann war die Katastrophe über sie hereingebrochen.
Helena legte die Hand auf Roberts Arm, weil sie wusste, dass ihn ihre Zeit mit Paulus tief verletzt hatte. Robert zog den Arm zurück und verkündete, dass er entgegen ihren ursprünglichen Plänen nun doch nicht wieder zu Hause einziehen würde. Die Freunde waren erstaunt. Nur Barbara nicht. Sie hatte als gelegentliche Babysitterin mitbekommen, wie sehr die Ehe der beiden in Trümmern lag. Und wie die Mädchen manchmal darunter litten. Robert schob die alleinige Schuld auf Helena. Er tat das sarkastisch, um seine Verletzung zu tarnen. Helena wehrte sich. Sie war nicht für die Trennung verantwortlich, Robert war ja vor vier Jahren ausgezogen. Erwartete er, dass sie sich für ihn aufhob, falls er zurückkommen würde? Es war ein schneller Schlagabtausch, einer, bei dem sich das Lachen über die Wunden legte. Irgendwann, als der Ton schärfer wurde, lenkte Barbara das Gespräch zurück auf Paulus, der ja auch ihr Chef gewesen war. Sie konnte sich nur schwer vorstellen, dass Paulus ein Päderast war. Er war stets freundlich gewesen, zuvorkommend. Und er sah gut aus. Doch Fatima wusste, was sich hinter Paulus’ Fassade verbarg, sie schien ein Gespür dafür zu haben. Die Frage tauchte auf, was jeder von ihnen tun würde, wenn dem eigenen Kind so etwas passieren würde. Barbara wandte sich an Robert.
»Was würdest du tun?«
»Ich würde den oder diejenigen umbringen.«
»Und du, Helena?«
Helena antwortete nicht.
»Helena?«
Helena war in Gedanken versunken, weshalb sie die Frage nicht gehört hatte. »Was?«
»Was würdest du tun, wenn deinen Kindern so etwas passiert?«
Helena dachte kurz nach, dann sah sie Barbara an, als habe die Frage einen beängstigenden Gedanken geweckt. »Wo sind die Mädchen?«
Sie stand auf und ging in den Flur. An der Garderobe links vor der Haustür lag Roberts Lederjacke. Darunter, in der obersten Schublade der Kommode, befand sich das Schulterholster mit der SIG Sauer P226 darin. Sie nahm die Waffe an sich. Später, bei der Vernehmung, würde sie nicht erklären können, warum sie das getan hatte.
3
Die Fahrräder der Mädchen lagen wie üblich auf dem gepflasterten Weg, der von der Haustür zur Straße führte. Von Katharina und Sophie keine Spur.
»Katharina? Sophie?«
Helena ging zur Garage. Barfuß. Öffnete das schwere Schwenktor.
»Katharina? Sophie?«
Sie lief hinter das Haus.
»Katharina! Sophie!«
Mit jedem Ruf nach ihren Töchtern wurde ihre Stimme lauter und um ein, zwei Töne höher. Helena kam zurück zur Haustür, wo Robert mittlerweile stand. Hinter ihm die Gäste.
»Was ist?«, fragte er.
»Katharina und Sophie sind nicht hier.«
»Vielleicht sind sie drüben bei Frau Kästner.«
»Die ist im Krankenhaus.«
Ein unvermeidlicher Gedanke blitzte auf. Sie wusste in diesem Moment, dass etwas passiert war, dass ihre Mädchen in Not waren und ihre Hilfe brauchten. Und dann der zweite Gedanke. Schuld. Sie sind entführt worden, das weißt du, Helena. Das Schlimmste ist passiert. Das Allerschlimmste. Sie werden vergewaltigt und erwürgt. Sie liegen jetzt schon irgendwo im Grunewald zwischen Laub und Moos. Die Gesichter zerschlagen, die Körper verrenkt, nackt, blutend.
»Bei Freundinnen?«
Helena trat auf die Straße. Als hätte sie ihn nicht gehört, als sei er nicht da. »Katharina! Sophie!« Sie rannte los. Ein Muttertier, das seine Jungen sucht.
»Ich fahr zur Schule!«, rief er, weil sich die Mädchen dort abends manchmal mit ihren Freundinnen auf dem Pausenhof trafen.
Sie hörte sein Rufen, aber sie konnte nicht warten. Rannte zur Olympischen Straße. Links oder rechts? Sie bog nach rechts ab in Richtung Stadion. Die breite Straße, die sie schon hundertausendmal gerannt war. An deren Ende die Fahnen wehten. Und da konnte sie sehen, wie ihre Töchter in einen schwarzen Lieferwagen einstiegen. Helena blieb auf der Brücke, die über die Bahngleise führte, stehen. Es war, als habe sie Angst, dass die kleinste Bewegung die Tragödie – von der sie wusste, dass sie kommen musste – erst in Gang setzen würde. Als gäbe es noch Hoffnung, wenn sie verharrte. Sie sah, wie die Tür geschlossen wurde, der Wagen losfuhr, wendete und auf sie zukam. Ein schwarzes Tier. Brüllend, wütend, unaufhaltsam. Als der Wagen fast auf ihrer Höhe war, hörte sie ein Geräusch. Rufen. Es kam aus dem Kasten. Der Fahrer blickte kurz zu ihr hin und dann angestrengt geradeaus, als würde sie aufhören zu existieren, wenn er sie nicht ansah.
In diesem Moment, als es schon fast zu spät war, erwachte Helena. Prägte sich das Gesicht ein. Unterbiss, Piercing in der Oberlippe, große, schmale Nase, eng stehende Augen, dunkle, halblange Haare, strähnig, vermutlich ungewaschen. Sah sein Grinsen und schoss. Auf die Fahrerkabine. Zweimal, dreimal. Der Wagen fuhr weiter, sie rannte hinterher. Die Sinne scharfgestellt und bereit, alles zu registrieren, was nützlich sein konnte. Wie auch das, was nutzlos war. Sie merkte sich das Nummernschild, ein Berliner Kennzeichen. Nützlich. Mercedes Sprinter. Nützlich. Ein Bild der Mona Lisa auf der Seite des Kastens. Daneben die Schrift Du bist Kunst in Weiß. Nützlich. Sie passierte die Westendallee, wo es aus der Küche des griechischen Restaurants nach Gyros roch. Nutzlos. Der Wagen fuhr schneller, war rasch dreißig, vierzig Meter vor ihr. Sie rannte an der Schele-Schule vorbei, wo Mütter ihre Kinder abholten und die SUVs in zweiter Reihe parkten. Nutzlos. Sie rief die Namen ihrer Töchter. Katharina und Sophie. Und dass jemand den Lieferwagen anhalten sollte. Nützlich, aber vergeblich. Sie musste wie eine Irre wirken, wie eine von den Frauen, mit denen man nichts zu tun haben will, weil sie zu viele Probleme haben. Sie kreuzte die Oldenburger auf dem Weg zum Steubenplatz. Friedrich Wilhelm von Steuben, 1730 bis 1794, preußischer Offizier und General im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Nutzlos. Das dachte sie, während der Lieferwagen hinter anderen Wagen vor der Ampel an der Kreuzung Reichsstraße halten musste. Sie kam näher. Noch zehn Meter, fünf. Als Helena den Türgriff fassen konnte, wechselte die Ampel auf Grün. Der Wagen fuhr an und zog Helena mit sich. Eine Weile lang konnte sie sich noch festhalten, aber dann stolperte sie und fiel hin. Die Damen, die in der Wiener Conditorei Caffeehaus saßen, blickten zuerst mit großzügiger Herablassung zu ihr hin, wandten sich dann aber rasch wieder dem Erdbeerkuchen mit Sahne, der Schwarzwälder- oder der Sachertorte zu. Nutzlos. Helena stand auf und lief weiter. An der Einfahrt zur Bolivar Allee hatte jahrelang der Imbisswagen der Fernsehserie Drei Damen vom Grill mit Brigitte Mira gestanden. Nutzlos.Wegen des Verkehrs und der einspurigen Verkehrsführung kam der Lieferwagen nur langsam voran. Nützlich. Helena sah Sophie am Fenster in der hinteren Tür. Sie schlug dagegen, den Mund aufgerissen zum Schrei. Helena rannte und rannte. Als junges Mädchen war sie die Schnellste in der Schule gewesen und hatte später sogar eine Medaille bei den Sächsischen Jugendmeisterschaften gewonnen. Jetzt ignorierte sie die Schmerzen in den Schenkeln, das Brennen der Lunge, das Blut an den Fußsohlen, weil sie in eine Scherbe getreten war. Ihr Blick war auf den Wagen gerichtet, starr und fest. Zwei Kilometer Wegstrecke. Weit vorne der Theodor-Heuss-Platz. Die Ampel war rot, aber der Wagen bremste nicht ab, überfuhr die rote Ampel und verlor im Kreisverkehr die Kontrolle. Krachte auf die Mittelinsel und blieb stehen. Helena beschleunigte noch einmal, erreichte den Wagen, schrie nach ihren Töchtern. Die hintere Tür des Lieferwagens wurde geöffnet.
Ein Mann mit einer Maske, die aussah wie das Gesicht aus einem Gemälde von Picasso und die seinen gesamten Kopf bedeckte, lugte heraus. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, schwarze Schuhe, Handschuhe. Er hielt Sophie fest, eine Pistole auf ihren Kopf gerichtet. Helena riss Roberts Pistole hoch. Atmete schwer. Sie zielte.
»Lassen Sie meine Tochter los. Sofort.«
Sie wusste, sie sollte abdrücken. Wann, wenn nicht jetzt? Ihr Brustkorb hob und senkte sich. Der rechte Arm unruhig. Der Lauf der Pistole war ein Zweig im Wind.
»Mama!«, schrie Sophie.
Du musst schießen. Jetzt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Sie hielt die Pistole, zielte, zitterte. Atmete ein und aus. Krümmte den Zeigefinger. Etwas hielt sie zurück. Was, wenn ich Sophie treffe? Der Hahn bewegte sich nicht. Was, wenn ich Sophie treffe? Die Patrone wurde nicht gezündet.Der Mann schloss die Tür. Der Wagen fuhr zurück auf die Straße. Nahm Fahrt auf und überquerte eine weitere rote Ampel, bevor er in die Masurenallee einbog und in den Verkehr eintauchte.
Helena stand. Sie verlor ihre Töchter aus den Augen. Bis sie bewusstlos wurde.
Samstag
4
Eine Stunde später lief die Suche nach den Mädchen an. Robert hatte seinen Vorgesetzten deBuer angerufen, und der hatte eine Fahndung nach den Mädchen und dem Lieferwagen veranlasst. Mercedes Benz, Sprinter, Koffer, schwarz, Berliner Kennzeichen. Der Schriftzug Du bist Kunst, das Bild der Mona Lisa auf der Seite. Die Mädchen tragen Jeans. Sneaker von Adidas. Katharina ein T-Shirt der Dallas Mavericks, Rückennummer 41, blau. Sophie ein rotes T-Shirt, darauf ein Porträt von Michael Jackson in der Version von Andy Warhol. Katharina hat dunkelbraune Haare, Pubertätsakne. Sophie ist blond. Fotos seiner Töchter hatte er vom Handy weitergeschickt.
Der Polizeiapparat war ein menschliches Aggregat. Tausendfache Routine. Ausfallstraßen wurden überwacht, die Überwachungskameras auf den Lieferwagen programmiert, die Hubschrauber der Verkehrsüberwachung wurden zusammengezogen und kreisten über der Stadt. Radio und Fernsehen unterbrachen ihre Sendungen, die Belohnung für sachdienliche Hinweise wurde in einem ersten Schritt auf 10.000 Euro festgesetzt. Kurz darauf gingen die ersten Anrufe bei der Hotline ein. Passanten und Fahrradfahrer hatten den Lieferwagen in der Reichsstraße und vor dem Internationalen Congress Centrum gesehen. Danach hatte sich seine Spur verloren, bis ein Wachmann auf den ausgebrannten Wagen in der Tiefgarage unter dem ICC stieß.
Man braucht Bewegung, um das Adrenalin abzubauen, das der Körper in Gefahrenlagen unermüdlich ausschüttet. Robert lief in dem Warteraum des Krankenhauses auf und ab. Von der Wand mit dem Getränkeautomaten zu der Wand mit den gerahmten Tierfotos und wieder zurück. Er hatte die Mädchen angerufen. Immer wieder. Teilnehmer antwortet nicht. Wenn Sie eine SMS schicken wollen …
Maxim suchte in seiner Hosentasche nach Münzen. Er war nicht nur Roberts Kollege und Partner bei den Einsätzen, sondern auch sein bester Freund. »Helena hat gesehen, wie Katharina und Sophie vor dem Olympiastadion in einen Lieferwagen eingestiegen sind.«
»Wieso sind sie da eingestiegen? Was war in dem Wagen drin?«, fragte deBuer.
Roberts Chef saß auf einer Bank am Fenster. Jedes Mal, wenn Windböen einen Schwarm Regentropfen gegen die Scheiben warfen, zog er die Schultern hoch. Aber das wusste er nicht. Er telefonierte ununterbrochen. Bisher keine Spur von Katharina und Sophie. Und je mehr Zeit verstrich, umso unwahrscheinlicher war es, dass sie gefunden wurden. Entweder die Hundertschaften, die mit den Hunden den nahen Grunewald durchstreiften, fanden die Mädchen unter Geäst oder in einem Graben oder einem kleinen Tümpel, oder die Entführer hielten sie an einem geheimen Ort fest und würden sie später außer Landes bringen. Oder sie würden sie jahrelang festhalten wie Joseph Fritzl oder Wolfgang Priklopil ihre Opfer. Oder sie töten. Das waren die Erfahrungen. Erfahrungen, die Robert nicht hören wollte.
»Hat jemand Kleingeld?«
Maxim suchte in dem kleinen Berg Münzen, die er in der rechten Hand hielt. DeBuer warf ihm einen Euro zu.
»Irgendwas, das sie interessiert hat«, sagte Robert.
»Was?« DeBuer konnte den Gedankensprung nicht nachvollziehen.
Maxim schlug gegen den Getränkeautomaten, als eine Münze nicht in den Schacht rutschen wollte. »Sie sind in den Wagen eingestiegen, weil etwas da drin war, das ihre Neugier geweckt hat. Kleine Katzen oder Hunde.«
»Wer von Ihnen ist Herr Faber?«
Sie sahen zur Tür hin. Eine Ärztin in tadellosem Weiß hielt eine Krankenakte in der Hand. Robert nickte deBuer zu.
Maxim hielt Robert kurz fest. »Wir finden sie«, sagte er.
Er war ein Hüne, zwei Meter groß, muskulös, und doch waren seine Bewegungen von einer fließenden Geschmeidigkeit, als wäre er Tänzer.
»Wir sehen uns nachher.« Robert folgte der Ärztin. In seinem Rücken beschwerte sich Maxim, dass der Getränkeautomat nicht funktionierte.
Sonntag
5
Als Robert das Zimmer betrat, versuchte Helena gerade, die Braunüle aus ihrer rechten Armbeuge zu ziehen.
»Ich habe was vergessen. Er hatte eine Maske auf. Wie auf einem Gemälde von Picasso. Die Augen hier unten und die Nase bei den Ohren.«
»Das hast du mir schon gesagt. Was machst du da? Helena, hör auf, du kannst nicht aufstehen.«
»Es war Paulus.«
»Woher weißt du das?«
Georg Paulus. Ehemaliger Oberstaatsanwalt, verwickelt in die Morde an sechs Frauen, Mitglied eines Rings von Kinderschändern. Von der Staatsanwältin Helena Faber überführt. Vor der Festnahme durch die Polizei geflohen und untergetaucht. Und von Interpol mit einem Red-Alert-Haftbefehl gesucht.
Helena schlug die dünne Bettdecke zurück und sah den Verband, den sie am linken Fuß trug. Ihr Blick verfinsterte sich, als würde sie sich erst jetzt wieder erinnern, dass sie am Theodor-Heuss-Platz zusammengebrochen war.
Die Tür wurde geöffnet, und die Ärztin im tadellosen weißen Anzug kam herein.
»Er hat sich wie Paulus bewegt.«
»Wie geht es Ihnen?«, fragte die Ärztin.
»Meine Töchter sind entführt worden. Sie dürfen raten, wie es mir geht.«
Die Ärztin zuckte zusammen. Sie trat einen Schritt zurück und sah Robert an, als hoffte sie, bei ihm Halt zu finden.
»Ich habe die Scherbe aus dem linken Fuß entfernt«, sagte sie zu Robert und wurde förmlich. »Sie war ziemlich tief eingedrungen. Ihre Frau muss den Fuß in den nächsten Tagen ruhigstellen. Aber das geht sowieso nicht anders, weil wir den großen Zeh richten mussten, den Ihre Frau sich bei dem Sturz gebrochen hat. Sie darf den Fuß mindestens zwei Wochen lang nicht voll belasten.«
Robert nickte, und die Ärztin ging.
Helena zog sich mit Roberts Hilfe an, ließ sich Krücken aushändigen. Dann unterschrieb sie, dass sie die Klinik auf eigene Gefahr verließ. Darin hatte sie inzwischen Übung. Sie ließ sich gemäß den Vorschriften in einem Rollstuhl bis zum Ausgang fahren und humpelte, den linken Arm über Roberts Schulter gelegt, über den Parkplatz hinter der Schlossparkklinik zu seinem Citroen DS23.
Von Weitem betrachtet, sahen sie aus wie ein verwundetes Tier, das sich durch die Nacht schleppt.
Sonntag
6
Auf dem Weg ins Präsidium starrte Helena auf ihr Handy, als könnte sie es zu dem einen Anruf zwingen, in dem deBuer oder sonst jemand sagte, dass man Katharina und Sophie gefunden hatte. Lebend und unversehrt, und dass alles nur ein dummer Scherz gewesen war.
»Warum habe ich nicht geschossen?«
»Du hast geschossen.«
»Ja. Aber nicht, als er die Tür aufgemacht hat.«
»Weil du dann vielleicht Sophie getroffen hättest.«
»Woher willst du das wissen?«
»Du hast es mir gesagt.«
Als sie im Besprechungszimmer ankamen, wollte Helena über jedes Detail der Fahndung Bescheid wissen. In der Staatsanwaltschaft kümmerte sich der neue OStA Serner höchstpersönlich, und bei der Kripo hatte deBuer die Leitung der Soko Mona Lisa inne. Mehr als dreißig Polizisten saßen in dem Einsatzraum. Es regnete immer noch. Dicke Tropfen trommelten gegen die Fensterscheiben und hinterließen Schlieren, als sie den Schmutz und Staub vom Glas wuschen. Die meisten Polizisten kannten Helena, und Helena kannte jeden Namen. In die Blicke der Polizisten waren Mitleid und Bedauern eingeschrieben. DeBuer stand an einem Whiteboard, an dem zwei Fotos der Mädchen hingen. Daneben Foto und Kennzeichen des ausgebrannten Wagens. Ein Ausschnitt des Stadtplans von Berlin. Der Westen rund um den Theodor-Heuss-Platz. Helenas Krücken lagen auf dem Boden neben ihrem Stuhl. Offiziell würden sie und Robert die Ermittlungen nur begleiten dürfen. Inoffiziell interessierte das niemanden.
»Drei Hundertschaften durchsuchen die Gegend um das ICC. Bahnhöfe und Flughäfen werden überwacht. Bis jetzt noch nichts«, sagte deBuer. »Allerdings wissen wir nicht, was auf den kleinen Flugplätzen passiert.«
»Müssen die nicht Buch führen über Starts und Landungen?«, fragte Helena.
»Gegen ein paar Hundert Euro vergisst man auch schon mal einen Eintrag. Aber wir haben die Handys der beiden Mädchen gefunden. In der Masurenallee, Höhe Haus des Rundfunks. Sie sind wahrscheinlich aus dem Lieferwagen geworfen worden.« Er hielt zwei Plastiktüten mit den Handys darin hoch. »Wir brauchen Fingerabdrücke von euren Mädchen, um zu sehen, wer die Handys angefasst hat.«
Robert nickte.
»Helena, wir brauchen eine Beschreibung von dem Kerl, der Sophie die Pistole an den Kopf gehalten hat …«
»Es war eine Sig Sauer, P 226, schwarz«, unterbrach ihn Helena.
»Die benutzen wir«, sagte deBuer überrascht. Er notierte die Bezeichnung auf dem Whiteboard. Dann deutete er auf eine Polizistin in der zweiten Reihe. »Claudia, das ist dein Job. Besorg alles, was es an Listen gibt. Auch, ob eine solche Waffe gestohlen gemeldet worden ist.«
»Er ist ungefähr eins fünfundsiebzig groß, mittelschwer, siebzig Kilo. Vielleicht mehr. Handschuhe. Schwarzes Leder«, fuhr Helena fort.
DeBuer notierte auch das. »Was haben wir über den Lieferwagen?«
Dirk Berger vom Erkennungsdienst nahm seinen Notizblock hervor. Berger war groß und so schmal, dass jeder, der mit ihm in Kontakt kam, Sorge hatte, er würde auseinanderbrechen, sobald man ihn anfasste.
»Der Wagen ist komplett ausgebrannt. Benzin. Aber wir haben das hier gefunden.« Er zeigte Fotos, die sie vom Inneren des Lieferwagens gemacht hatten. Verbrannte Holzteile, einige angekokelt.
»Was ist das?«, wollte Robert wissen.
»Reste von Bilderrahmen. Zwanzig, vielleicht mehr.«
»Was für Bilder?«
»Lässt sich noch nicht sagen.«
»Sind die beiden deswegen zum Olympiastadion gelaufen?«, fragte Maxim.
Robert sah zu Helena hin. Sie wusste seinen Blick zu deuten. Was haben die Mädchen damit zu tun?
»Berger, ich will wissen, was für Bilder das waren. Öl oder was auch immer. Wer hat sie gemalt. Was war da drauf.« Er wandte sich an Maxim. »Was hast du über den Lieferwagen?«
»Gehört Berlin-Special-Cars. Die vermieten Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch.«
»Was ist mit der Aufschrift Du bist Kunst?«, fragte Helena.
»Ist eine Aktion der Berlin Art Week. Irgend so eine Kunstmesse. Die Autovermietung hat den Wagen gestern um zehn dreißig morgens gestohlen gemeldet.«
»Wer hat ihn gemietet?«, fragte Helena.
»Bin ich noch dran.«
»Okay, du kümmerst dich weiter um den Wagen. Wer hat ihn gemietet, was ist mit diesem Kunst-Ding«, sagte deBuer.
»Frag den Mieter, warum er am Olympiastadion war«, sagte Robert.
»Habt ihr die Maske gefunden?«, fragte Helena.
»Verbrannt. Aber ich hab das hier aus dem Netz. Ist es so eine?«
Berger hielt den Computerausdruck einer Maske hoch, die an das Dora Maar-Porträt von Picasso erinnerte. Helena zuckte zusammen, als sie das Foto sah. Ein kurzes, knappes Nicken.
»Wir suchen nach dem Hersteller. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Wir haben Abdrücke von einem Sportschuh.«
»Zum Glück trägt heute kaum noch jemand Sportschuhe.«
Roberts Sarkasmus ließ Berger kurz zusammenzucken. Dann schickte er von seinem Tablet ein Foto an das elektronische Whiteboard. Der Abdruck eines Schuhs der Marke Nike. Unter der Ferse der typische Haken, dann ein wildes, spinnennetzartiges Muster.
»Claudia hat bei Nike angerufen.« Er deutete zu der Polizistin hin.
Die Angesprochene erhob sich und hielt einen Computerausdruck hoch. »Das Muster gehört zu einem Schuh, der erst in zwei Monaten auf den Markt kommt. Ein paar ausgewählte Händler haben vorab Präsentationsmodelle bekommen. Wir können davon ausgehen, dass nicht mehr als zwei Dutzend von denen im Umlauf sind.«
DeBuer sah zu Robert und Helena hin. Eine stumme Botschaft. Zwei Dutzend im Umlauf. Das war doch etwas. Helena atmete tief ein und wieder aus.
»Was ist mit den Überwachungskameras?«, fragte Robert.
»Seit das ICC geschlossen ist, sind die abgeschaltet. Es gibt Reifenspuren von einem zweiten Wagen, aber die sind nicht ausreichend«, fuhr Berger fort.
»Danke, Berger«, sagte deBuer. »Sonst noch was?« Als sich niemand mehr meldete, wendete deBuer sich wieder an Helena und Robert. »Wir finden eure Töchter. Ganz sicher.«
»Er hat sich bewegt wie Paulus.«
»Wer?«
»Der die Pistole an Sophies Kopf gehalten hat.«
Augenblicklich wurde es still in dem Raum.
»Du denkst, es war ein Racheakt?«, fragte deBuer.
»Ich denke an alles.«
Eine bleierne Stimmung legte sich über die Polizisten. Selbst die, die bislang Helena nicht besonders freundlich gesinnt waren, wollten die Mädchen heil und gesund zurück. Als Maxims Handy klingelte, erschraken sie. Er nahm das Gespräch an, hörte eine Weile dem Anrufer zu. Gebannte Blicke. Dann beendete er das Gespräch.
»Eine Galerie Diener hat den Wagen gemietet.«
Robert legte Helena die rechte Hand auf den Arm. »Ich hole unsere Mädchen zurück.«
Er wollte mit diesem Satz seine Entschlossenheit zeigen. Aber seine Stimme brach und verriet seine Sorge, dass er scheitern könnte.
Montag
7
Es war sechs Uhr morgens, als der Regen endlich aufgehört hatte. Die Fahrräder lagen wie zuvor. Vielleicht waren die Mädchen zurückgekommen. Vielleicht war alles nur ein Versehen, eine Verwechslung. Helena und Robert gingen in dem Haus umher, in dem die Stille ein Schrei war und das Fehlen der Mädchen ein Stachel, der in ihre Körper fuhr. Schultaschen lagen im Flur, die Jacken hingen an einem Haken. Schuhe standen in Reih und Glied. Barbara hatte aufgeräumt, Geschirr in die Spülmaschine gepackt, Flaschen entsorgt. Keine Spur mehr von dem gemeinsamen Essen, dem letzten Moment einer zerbrechlichen Unbeschwertheit.
Einen kurzen Moment blieben sie in der Küche stehen. Zögerten, als würde jede Bewegung die Katastrophe nur noch verschlimmern. Umarmten sich, klammerten sich aneinander. Dann holte Robert die Notebooks der Mädchen. Vermied es, zu lange in den Zimmern zu verweilen. Setzte sich in Helenas Arbeitszimmer auf das kleine Sofa, Helena saß hinter dem Schreibtisch. Das Arbeitszimmer war ein guter Ort, weil hier nur wenig an Sophie und Katharina erinnerte. Helena nahm sich Sophies Notebook vor, Robert Katharinas. Da die Computer passwortgesichert waren, dauerte es eine Weile, bis sie sich durch Mails und Websites wühlen konnten. Nichts davon war auf den ersten Blick verdächtig oder beunruhigend.
»Paulus ist seit Wochen verschwunden. Interpol hat einen Red Alert rausgegeben. Wie soll er das organisiert haben?«, fragte Robert.
»Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er Verbindungen hat, dass er Leute kennt.«
»Bei uns?«
»Vielleicht auch in der Staatsanwaltschaft.«
Es war eine beunruhigende Vorstellung, dass dieser Mann, der seine perversen Fantasien an hilflosen Kindern ausgelebt hatte, Sophie und Katharina in seiner Gewalt haben könnte. Und dass es jemanden geben sollte, der ihn informiert hatte und vielleicht immer noch mit Informationen versorgte.
»Wahrscheinlich macht er mich dafür verantwortlich, dass er gesucht wird und untertauchen musste«, sagte Helena.
»Du bist nicht verantwortlich, sondern das, was dieses Schwein getan hat, ist dafür verantwortlich.«
»Bist du da sicher?«
Wir suchen die Schuld bei uns selbst, um wenigstens einen Hauch von Sinnhaftigkeit in der Sache zu finden. Wenn das, was geschehen ist, sinnlos wäre, wäre es nicht zu ertragen.
»Du bist nicht schuld.«
Es klang gut und tröstlich.
Helena widmete sich wieder Sophies Notebook, rief die Seiten auf, die sie in den letzten Wochen besucht hatte.
Robert ging in die Küche und holte zwei Bier. Stellte eine Flasche vor Helena. Stieß mit ihr an. Und sofort war die Erinnerung wieder da. Ein Ritual, das die Mädchen unermüdlich praktizierten. Man stößt die Flaschen, egal ob Cola oder Bionade, zuerst unten an, dann oben, dann zweimal überkreuz und dann die eine Flasche auf den Hals der anderen, bis die Flüssigkeit sprudelnd herausläuft.
»Warum sind sie in den Wagen eingestiegen?«, fragte Helena, ohne eine Antwort zu erwarten. »Sie wissen doch, dass sie nicht zu Fremden einsteigen sollen. Ich habe es ihnen hundertmal gesagt. Du doch auch.«
Helena scrollte weiter durch die Liste der Websites, die Sophie in den letzten Tagen besucht hatte. Da war eine Seite über Massentierhaltung, gefolgt von vegetarischen Rezepten. Greenpeace und Amnesty. Außerdem stand sie in Verbindung mit einem Tierschutzverein. Ein Dalmatinerwelpe hatte es ihr angetan. Sie hatte ein Dutzend Fotos von dem kleinen Hund heruntergeladen.
Sie beugten sich wieder über die Notebooks.
»Hat Katharina was mit Kunst?«
»Nicht, dass ich wüsste«, sagte Helena.
»Sophie?«
Sie schüttelte den Kopf. Ihre rechte Hand huschte auf dem Trackpad hin und her. Wie ein Raubvogel auf der Suche nach der einen verräterischen Bewegung, auf die sie sich hinabstürzen konnte. Ab und zu sah sie zu Robert hin, der unbeweglich vor Katharinas Notebook saß.
Er schaute auf den Bildschirm, als brauchte er einen Ort, an dem er sich festhalten konnte. Wenn es tatsächlich Paulus war, der die Mädchen entführt hat, was wird er mit meinen Mädchen machen? Der Gedanke zerteilte ihn wie ein Messer. Mitten durch sein Gehirn hindurch. Links Wut, rechts Angst.
»Wenn er ihnen was antut, bringe ich ihn um«, murmelte er immer wieder vor sich hin. Bis Helenas Schrei ihn in das Zimmer zurückholte.
»Hier. Sophie war auf der Seite der Berlin Art Week.«
Sie deutete auf den Bildschirm. Robert beugte sich zu ihr. Mit der Wange berührte er ihre Haare, nahm den Geruch von Desinfektionsmitteln wahr, den sie aus dem Krankenhaus mitgebracht hatte. Auf der Website gab es einen Link zu einer weiteren Website mit dem Titel Du bist Kunst. Man sollte bestätigen, dass man älter als achtzehn war, dann auf der Seite ein Foto hochladen, das nach einem bestimmten Algorithmus ausgewählt werden sollte. Helena sah Robert fassungslos an.
»Du musst 100 Euro zahlen, damit daraus ein Gemälde im Stil von Picasso, van Gogh oder Warhol gemacht wird«, sagte Helena.
»Hat Sophie ein Foto von sich hochgeladen?« Robert beugte sich über Helenas Schulter.
Die Seite gehörte zur Berlin Art Week und sah seriös aus. Überall in der Stadt hingen Plakate, die Zeitungen waren voll von Artikeln, die auf die Kunstausstellungen hinwiesen.
»Sie hat offensichtlich bestätigt, dass sie älter als 18 ist. Wieso macht sie das?«, fragte Helena.
»Ein elfjähriges Mädchen weiß nicht, welche Tricks diese Drecksschweine draufhaben.«
»Da!«
Helena deutete auf eine Mail. Sie war an DubistKunst.de geschickt worden. Im Anhang drei Fotos. Porträts von Sophie, mit dem Handy in ihrem Zimmer gemacht. Helena scrollte weiter durch den Mailausgang.
»Wie ist sie überhaupt auf die Seite gekommen?«, fragte Robert.
»Ich weiß, dass sie ein Geburtstagsgeschenk für mich gesucht hat. Wir haben über Kunst gesprochen. Ich hab ihr bei einem Referat geholfen. Wahrscheinlich hat sie gedacht, dass es ein Geschenk ist, das mir gefällt.«
»Für hundert Euro?«
Helena tippte Du bist Kunst in die Suchmaske des Mailprogramms ein. Eine Sekunde später fand sie eine Nachricht, die an Sophie gerichtet war. Liebe Sophie, gratuliere, du hast einen Gutschein über hundert Euro gewonnen. Lade einfach ein Foto von dir hoch. Und vergiss nicht, den Gutschein-Code einzugeben.
»Wieso haben die Sophie einen Gutschein geschickt?«
Ein ungeheurer Gedanke keimte, trieb seine Wurzeln, hakte sich in ihren Köpfen fest.
»Was ist mit Katharina?«
Robert stöberte durch den Mailausgang.
»Nichts.«
»Vielleicht als SMS?«
»Nichts.«
»Gut.« Helena war beruhigt.
»Aber warum haben die Katharina mitgenommen?«
»Sie haben sie mitgenommen, weil sie dabei war.«
»Wenn es nur um Sophie ging, hätten sie Katharina zurücklassen können. Das haben sie aber nicht gemacht. Warum?«
Helena schloss die Augen, versuchte sich an den Moment zu erinnern, als sie auf der Brücke gestanden und gesehen hatte, wie ihre Töchter in den Lieferwagen eingestiegen waren.
»Die Typen waren zu dem Zeitpunkt nicht maskiert. Katharina hat einen oder beide gesehen. Deswegen mussten sie sie mitnehmen. Hier, die Seite gehört einer Galerie Diener. Maxim hat doch gesagt, dass diese Galerie den Wagen gemietet hat.« Helena nahm ihr Handy, wählte die Nummer, die im Impressum genannt wurde und wartete, während Robert Sophies Notebook nahm und weiter ihre Mails durchsuchte.
»Nichts. Nur die Ansage, dass die Aktion Du bist Kunst beendet ist«, sagte Helena.
Im selben Moment klappte Robert den Deckel des Notebooks hart zu.
»Was ist?«, fragte Helena.
Da Robert nicht antwortete, nahm sie das Notebook, hob den Bildschirm an. Ein Selfie von Sophie, stehend vor dem großen Spiegel in Helenas Schlafzimmer aufgenommen. Nackt. Ein weiteres, das ihre Brust, ein drittes, das den zarten Flaum zwischen ihren Beinen zeigte. Ein viertes von ihrem Hintern. Ein fünftes mit halb geöffnetem Mund.
Robert nahm das Handy und rief Maxim an. Er sagte ihm, dass es Fotos von Sophie gäbe. Nacktfotos. Maxim fragte, wie sie damit umgehen sollten. Die Fotos durften nicht an die Soko gegeben werden, so viel Vertrauen gab es dann doch nicht. Als Helena das hörte, stand sie auf und ging in die Küche. Sie öffnete die Kühlschranktür, um ein weiteres Bier zu nehmen. Dabei wehte ein leicht fauliger Geruch in ihre Nase. Sie übergab sich ins Waschbecken.
Montag
8
Ein regnerischer Tag mit mehr als 30 Grad Celsius neigte sich dem Abend entgegen. Georg Paulus betrat mit einer Plastiktüte voller Mangos und Drachenfrüchten das Hotel nahe dem Saigon-Fluss. In einer zweiten Tüte trug er Mineralwasser, eine Flasche Wein und eine Packung Breitband-Antibiotikum. Das Hundehalsband und die zusammengerollte lederne Peitsche bewahrte er in der Innentasche seiner Jacke auf. Er war wütend, weil der Aufzug immer noch defekt war und nur bis zum neunten Stockwerk fuhr, sodass er die letzten drei Stockwerke zu Fuß gehen musste. Zum dritten Mal an diesem Tag. Er hatte daran gedacht, sich ein Zimmer im neunten Stock geben zu lassen, aber vom zwölften aus konnte er bei klarem Wetter bis zum Meer sehen. Dem Ostmeer, wie die Vietnamesen es nannten, dem Meer, in dem Drachen wohnten. Außerdem war er wütend, dass er sich in diesem Touristenschuppen verstecken musste, dazu in einem Land, dessen Sprache er nicht verstand, dessen Menschen er nicht mochte, dessen Klima er hasste. Was für ein Abstieg. Vom Oberstaatsanwalt mit Ambitionen auf den Posten des Justizsenators zu einem Flüchtling, der sich vor Interpol verstecken musste. Der einzige Trost war der Gedanke, dass er das Mädchen ernten würde.
Als er die Treppen überwunden hatte und die Suite betrat, atmete er so schwer, dass sich schwarze Schleier über seinen Blick legten. Er musste sich an einem Stuhl festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Sein schweres Atmen weckte das Mädchen im angrenzenden Schlafzimmer der Executive-Suite. Sie sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Er lächelte kurz und nickte ihr zu. »Bald werde ich dich zur Frau machen«, sagte er leise, während er das Mineralwasser im Kühlschrank verstaute. Dann setzte er sich auf den Rand des Bettes. Dabei sah er, dass sie schon wieder ins Bett gepinkelt hatte. Das zweite Mal, seit sie hier bei ihm war. Aber er war deswegen nicht wütend. Obwohl er die Matratze schon wieder wenden musste, was ihn anstrengte, weil sie groß und schwer war. Aber ihr Urin roch nicht so streng wie der von Erwachsenen. Er hatte daran geschnuppert, einmal sogar davon probiert und festgestellt, dass er leicht salzig, aber ansonsten völlig geschmacklos war.
Als er ihren Fuß zu fassen bekam, konnte er kalten Schweiß fühlen. Das rührte von der Angst her, sobald er sie berührte. Oder von der Klimaanlage. Der Monsun in Saigon machte ihm dieses Jahr mehr zu schaffen, als er erwartet hatte. Wenn er allerdings nach dem Duschen nackt blieb, würde es erträglich sein. Er fuhr mit der Hand das Bein entlang. Sie sah ihn ängstlich an. Wahrscheinlich hatte sie geweint. Und gebetet, dass er nicht zurückkommen würde. Sie betete andauernd, obwohl sie doch inzwischen wissen musste, dass Gott ihr nicht helfen wollte. Gott hilft nur denen, die stark sind, hatte er ihr gesagt. Er zum Beispiel, er war stark. Und wenn sie auch stark wäre, würde Gott sie lieben, hatte er gesagt. Aber sie hatte geschrien und um sich geschlagen. Er hätte ihr sagen können, dass er ihre Mutter oder ihre kleine Schwester töten würde, wenn sie nicht gehorchte. Was er natürlich niemals tun würde. Er war ja kein Mörder, und immerhin hatte er der Mutter fünfhundert Dollar bezahlt. Aber weil sie weder Deutsch noch Englisch verstand und er nur drei Sätze auf Französisch sprach, konnten sie sich nicht verständigen.
Den wichtigsten Satz in seinem französischen Wortschatz – Voulez-vous coucher avec moi? – hatte er aus Tennessee Williams’ Theaterstück Endstation Sehnsucht, den anderen – La voiture a une panne – aus einem Deutsch-Französisch-Wörterbuch, das ihn vor vielen Jahren auf einer Reise durch die Bretagne begleitet hatte, den dritten – Arrête de pleurer – hatte er bei Google Translate gelernt. Die erste Phrase benutzte er selten, die dritte häufig, und die zweite war für seine Zwecke völlig unbrauchbar. Sie trug zwar eine Schuluniform, einen weißen Áo dài, in dem sie sehr fein, beinahe engelsgleich aussah, aber dass die vietnamesischen Kinder bereits in der ersten oder zweiten Klasse Fremdsprachen lernten, war zu bezweifeln. Obwohl es sich um ein sehr fleißiges und bis zur Selbstverachtung ehrgeiziges Volk handelte. Vor allem im Vergleich zu den saturierten Europäern. Andrerseits waren die meisten Vietnamesen in ihrem Fleiß aber auch einfach nur dumm. Flinke Ameisen, die an jeder Ecke Geschäfte machten und ihre Kinder wie Haustiere behandelten. Vermutlich hing es mit dem Konfuzianismus zusammen, in dem der Einzelne nichts zählte und die Gemeinschaft alles.
Weil sie nun wieder zu weinen begann, ließ er sie los. Er wusste ja, dass er nach der Energie, die der Einkauf ihn gekostet hatte, keine Erektion mehr zustande bringen würde, egal wie sehr der ängstliche Blick ihn erregte. Dabei war er beinahe jederzeit in der Lage, eine ordentliche Erektion zustande zu bringen. Nicht bei Frauen in seinem Alter, deren welkes, faltiges Fleisch ihn anwiderte. Auch kaum noch bei Frauen mittleren Alters wie Helena, die vom Ehrgeiz zerfressen waren und bei denen er sich endlos abmühen musste, bis sie zum Orgasmus kamen, weil sie vermutlich sogar beim Geschlechtsverkehr noch an Termine dachten. Da waren die kleinen Mädchen doch ein anderes Kaliber. Diese kleinen zerbrechlichen Spielzeuge, deren Leben in seiner Hand lag. Als er in der Dusche den kalten, harten Strahl auf dem Rücken spürte, kehrten seine Lebensgeister wieder zurück. Das war auch dringend nötig, denn wenn er in den Spiegel sah, blickte ihm ein alter Mann entgegen.
Zurück im Schlafzimmer, prüfte er die Schnüre, mit denen er sie an die Bettpfosten gefesselt hatte. An einigen Stellen war die Haut aufgescheuert, weil sie versucht hatte, sich zu befreien. Wie dumm. »Hör auf zu weinen!«, befahl er. »Stop crying!«Und dann: »Arrête de pleurer«, und als sie nicht reagierte, noch einmal lauter: »Arrête de pleurer!« Da schwieg sie und schluckte die Tränen herunter. Und während sein Schwanz sich langsam aufrichtete, dachte er daran, dass Diener Helenas Töchter entführt hatte und sie nun auch zur Ernte bereitstanden. Das erregte ihn noch mehr. Deren Mutter hatte sein Leben zerstört. Er hätte sie sonst irgendwann geheiratet und sich eben dann über die Mädchen hergemacht. Aber das konnte er bald auch ohne Heirat.
Montag
9
Die Soko Mona Lisa arbeitete unter deBuers Leitung auf Hochtouren. Inzwischen waren 40 Stunden vergangen, seit Sophie und Katharina entführt worden waren. Die Erfahrung sagte, dass mit jeder weiteren Stunde, jedem weiteren Tag die Wahrscheinlichkeit, die Mädchen zu finden, rapide gegen null tendierte. Es sei denn, die Entführer hatten sie umgebracht. Aber diese Möglichkeit hatte deBuer schon bei der ersten Besprechung vom Whiteboard gestrichen. Inzwischen hatte es sich zu einem Patchwork aus Fotos, Adressen, Namen und farbigen Pfeilen entwickelt.
Achtundzwanzig Zeugen, die den Lieferwagen gesehen hatten, waren befragt worden und hatten neun unterschiedliche Beschreibungen des Fahrers abgegeben. Deutsch, südländisch, mit Brille, ohne Brille, klein, dick, groß. Ein Zeuge schwor, dass es eine Frau gewesen sei. Die meisten Aussagen ergaben gewisse Übereinstimmungen mit Helenas Beschreibung, wichen aber in entscheidenden Punkten ab. Die Sig Sauer P 226 war exakt das Modell, das vom Berliner SEK und dem BKA benutzt wurde. Damit hätte man die Spur der Waffe vielleicht noch verfolgen können. Da aber auch das niederländische Militär und verschiedene Schweizer Polizeicorps die Pistole benutzten, wurde sie zur Stecknadel im Heuhaufen. Bei dem Schuhabdruck war Berger noch nicht viel weitergekommen. Es gab siebzehn Personen, die im Besitz der Schuhe sein konnten. Jeder Einzelne musste mit Helenas Personenbeschreibung abgeglichen, die Alibis mussten überprüft werden. Aber zumindest Maxim war fündig geworden.
Er hatte sich die Galerie angesehen. Auf den ersten Blick nichts Besonderes, ein Ladengeschäft, wie es Hunderte andere in Berlin gab. Da er den Besitzer German Diener nicht angetroffen hatte, ließ er einen der Angestellten wissen, dass Diener sich umgehend auf dem Präsidium bei Hauptkommissar deBuer melden solle. Eine Stunde später wollte Diener telefonisch erklären, dass er keine Zeit habe, der Aufforderung zu folgen. DeBuer machte ihm in gesetztem Ton klar, dass es auch noch andere Möglichkeiten gäbe, ihn vorstellig werden zu lassen. Dann knallte er den Telefonhörer auf. Er war müde und kam sich alt vor. Vielleicht lag es daran, dass er an diesem Morgen seine erste Brille in Empfang genommen hatte. »Ich werde langsam zu einem Wrack«, hatte er zu dem Optiker gesagt. »Ich sehe nicht mehr gut, ich brauche ein Hörgerät, und meine Knie kann ich auch wegschmeißen.«
Nachmittags saß German Diener in dem kahlen Vernehmungsraum und konnte nur schwer sein Missfallen verbergen. Drei Kameras, die unterhalb der Decke montiert waren, übertrugen die Vernehmung auf einen externen Monitor. DeBuer machte German Diener darauf aufmerksam, dass die Vernehmung aufgezeichnet wurde. Er wollte von dem Galeristen wissen, was es mit der Seite Du bist Kunst und den Fotos auf sich hatte, und bekam einen elend langen Monolog über die Freiheit der Kunst zu hören, der mit den Worten endete:
»Kunst ist erst Kunst im Tabubruch. In jeder Hinsicht. Kunst muss die Fassade der bürgerlichen Gesellschaft entlarven und ihr die Maske der Heuchelei vom Gesicht reißen. Kunst ist die Offenbarung der perversen, grausamen Obsessionen von Menschen wie Ihnen.«
Robert und Maxim standen im Nebenraum und sahen über den Monitor der Vernehmung zu. Roberts Finger trommelten einen ungeduldigen Takt auf den Tisch. Aber davon bekam er nichts mit. Alles, was er bemerkte, war, wie sich der Galerist mit äußerster Arroganz auf dem Stuhl spreizte. Er hatte eine Narbe über dem rechten Auge, die er ab und zu berührte.
»Von mir aus«, sagte deBuer. »Die Autovermietung hat den Wagen am Samstagmorgen um zehn Uhr dreißig gestohlen gemeldet.«
»Das war eine Katastrophe, weil wir ein Kunstwerk transportieren mussten.«
»Wann haben Sie den Diebstahl bemerkt?«
»Vermutlich bevor wir die Autovermietung angerufen haben. Danach würde es ja keinen Sinn machen, oder?«
»Uhrzeit?«
»Ich war nicht in der Galerie.«
»Wieso haben Sie nicht die Polizei angerufen?«
»Wie gesagt, ich war nicht in der Galerie. Und warum die Polizei nicht angerufen wurde, weiß nur der Mitarbeiter, der den Anruf gemacht hat.«
»Wie heißt der Mann?«
»Ich weiß nicht, wer es war.«
»Dann finden Sie es heraus.«
»Bitte.«
Bitte? DeBuer war irritiert. Er sah von seinen Unterlagen auf.
»Das Zauberwort heißt bitte.«
DeBuer zog die Stirn in Falten. Ein deutliches Zeichen, dass er genervt war. Trotzdem blieb er freundlich. Er schlug den Bericht der Kriminaltechnischen Untersuchung auf, allgemein als Spurensicherung bekannt.
»Die KTU schreibt, am Zündschloss sind keine auffälligen Spuren erkennbar.«
»Und?«
»Wenn es am Zündschloss keine auffälligen Spuren gibt, heißt das für gewöhnlich, dass der Wagen mit einem Schlüssel gestartet worden ist.«
»Und?«
»Wie ist derjenige an den Schlüssel gekommen?«
»Vielleicht hat er ihn auch gestohlen.«
»Gibt es Einbruchsspuren bei Ihnen in der Galerie?«
»Wieso?«
DeBuer atmete hörbar aus. Er musste an sich halten, um diesem arroganten Lackaffen, der in seinem dreiteiligen weißen Anzug, den blauen Wildlederschuhen und der hellblauen Sonnenbrille vor ihm saß, nicht in den Arsch zu treten.
»Gibt es Einbruchsspuren?«
»Nein.«
»Dann brauche ich eine Liste der Leute, die Zugang zu dem Schlüssel haben.«
»Das sind alle meine Mitarbeiter.«
»Dann werden die alle hier antanzen. Und zwar heute noch.«
»Ich werde meine Mitarbeiter fragen, ob sie Zeit haben.« Wieder das provozierende Grinsen.
Im Nebenraum bot Maxim Robert eine Wette an, wie lange es noch dauerte, bis deBuer ausrasten würde.
»Wer von Ihren Mitarbeitern hat Admin-Rechte bei dieser Du-bist-Kunst-Website?«
»Das werde ich Ihnen nicht sagen, weil ich dem Vordringen staatlicher Zensur nicht die Tür öffnen werde.«
DeBuer sah zum Fenster hin. Es war ein mühsamer Tag, und es wurde nicht besser. Aber er wurde nicht laut. Stattdessen sagte er mit dem Ausdruck größtmöglicher Langeweile: »Es werden hier gleich noch ganz andere Türen geöffnet, Herr Diener. Zum Beispiel, ob Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter gewusst haben, dass ein elfjähriges Mädchen Nacktfotos auf der Seite Du bist Kunst hochgeladen hat.«
»Ich bin nicht mit jedem Detail dieser Aktion betraut, aber alle, die an diesem Kunstprojekt teilnehmen, müssen bestätigen, dass sie älter als 18 Jahre sind. Wenn jemand da lügt, ist das nicht unser Problem, verstehen Sie? Trotzdem bin ich sicher, dass meine Mitarbeiter die Fotos dieses Mädchens sofort gelöscht und, wenn möglich, die Eltern informiert haben. Sonst noch was?«
Der Moment, auf den Maxim gewartet hatten, war gekommen. DeBuer sprang vom Stuhl auf, stützte die Hände auf die Tischplatte und brüllte German Diener an. Feine Speicheltropfen flogen durch die Luft und landeten in Dieners Gesicht.
»Zwei Mädchen sind entführt worden. Wie es aussieht, sind sie in einen Wagen eingestiegen, der von Ihnen angemietet worden ist und den einer Ihrer Mitarbeiter gefahren haben muss.«
Diener nahm ein Taschentuch und wischte sich deBuers Speichel ab. Er ekelte sich sichtlich. Aber er knickte nicht ein.
DeBuer sah German Diener lange an. Dann nahm er einen Hefter aus einem Schrank und schlug die erste Seite auf. »Wissen Sie, was das ist?«, fragte deBuer.
»Sie werden es mir gleich sagen.«
»Strafgesetzbuch, Paragraf 258. Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme unterworfen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.«
Dieners Gesicht glich einer Maske, die drei oder vier Mienen bereithielt. DeBuer kannte solche Masken. Er hatte schon einige davon in Aktion erlebt. Keine davon erlaubte den Blick in den Geist, der dahinter lebte und der einerseits von einem Sonnenuntergang auf Santorini schwärmen und gleichzeitig unvorstellbar grausam sein konnte.
»Schicken Sie es meinem Anwalt«, sagte Diener scheinbar unbeeindruckt. »Er wird sich dann bei Ihnen melden. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe heute Morgen die Porzellanskulptur Naked von Jeff Koons für einen Klienten gekauft. Der Mann wartet schon seit zehn Minuten in meiner Galerie.«
German Diener stand auf und ließ einen müden deBuer zurück, als er durch die Tür des Vernehmungszimmers trat. DeBuer sah zu einer der Kameras hin und nickte. Für Robert war es ein Zeichen, dass er sich um Diener kümmern sollte.
Montag
10
»Dieser Polizist hat mir mit Gefängnis gedroht, kannst du dir das vorstellen, Mama?«
Als German Diener das Polizeipräsidium verließ, lachte er so laut und exaltiert, dass ihm die Aufmerksamkeit aller Besucher des Polizeipräsidiums sicher war. Bis er den Parkplatz erreichte, wo Robert neben einem Porsche stand und telefonierte. Diener trat neben ihn, woraufhin Robert sein Handy in die Jackentasche steckte.
»Schöner Wagen. 63er Baujahr, hundertdreißig PS, zwei Liter, sechs Zylinder, Boxermotor«, sagte er.
»Der ist unverkäuflich«, sagte German Diener.
»Kommt drauf an, oder?«
»Sie müssten mich umbringen, Herr Faber.«
»Meine Frau hat mich heute Morgen gefragt, wie weit ich gehen würde.«
»Wie meinte sie das? Wegen dem Wagen? Oder sexuell?« German Diener lachte. »Und jetzt gehen Sie von der Tür weg. Husch, husch.«
Er wischte mit der Hand vor Roberts Gesicht. Dabei berührte er ihn beinahe mit dem übergroßen Smaragdring, den er am Mittelfinder der rechten Hand trug. Robert nahm es ohne sichtbare Gefühlsregung hin.
»Ich habe ihr gesagt, dass es keine Grenzen gibt. Das hat sie erschreckt. Aber so ist es nun mal. Wenn mir jemand das nimmt, was ich über alles liebe, mehr noch als mein Leben, gibt es keine Grenzen.«
»Wollen Sie mich wegen dem Porsche umbringen?«
»Nicht wegen dem Porsche.«
Jetzt schien German Diener irritiert zu sein. Er neigte den Kopf zur Seite, zog die Stirn in Falten und grinste amüsiert. »Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, halten Sie sich fern von mir, Herr Faber. Aber Sie wollten ja nicht hören. Sie wussten damals nicht, mit wem Sie sich anlegen. Jetzt wissen Sie es.«
Die Stimme bekam ein eigenartiges Vibrato. Sie war ohnehin schon hoch und jetzt noch höher. Nicht weiblich, eher von einer schneidenden Schärfe. Ein bitteres Lächeln schlich sich auf Roberts Lippen. Er hatte bei der Vernehmung erlebt, wie Diener sein Gegenüber provozieren konnte.
»Unter meiner rechten Schulter steckt eine automatische Pistole. Ich werde sie nicht herausnehmen und auf dich schießen, weil das die letzte Option ist und ich die anderen Schritte davor verschwenden würde. Zum Beispiel dir so wehzutun, dass du nach deiner Mama weinst.«
»Sie sind verrückt.«
Robert sah German Diener an.
Wer jemals, vielleicht im Zoo, in die Augen eines Löwen gesehen hat, kennt diesen Blick. Er ist weder von Erbarmen noch Freundlichkeit noch irgendeiner moralischen Prägung getrübt. Er ist ein Abgrund.
Robert griff in German Dieners Schritt, bekam die Hoden zu fassen und drückte sie zusammen. So fest, dass Diener sich unter den Schmerzen nach vorne beugte.
»Lassen Sie los«, presste er zwischen den Zähnen hervor. Die Adern an Hals und Schläfe sahen aus wie Würmer, die sich unter der Haut schlängelten. Das Gesicht wurde rot, und die Augen traten aus den Höhlen. »Ich werde Sie anzeigen.«
»Nein, das wirst du nicht. Und weißt du, warum nicht? Weil ich dir dann deine verschrumpelten Eier abreiße. Hast du das verstanden? Hast du das verstanden?« Robert drückte noch einmal fester zu, hielt German Diener am Kragen fest, damit der nicht auf die Knie ging. »Wo sind meine Kinder?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Wir fahren jetzt in deine Galerie, und du zeigst mir, wer Zugang zu der Seite hat. Und wenn er oder du nichts mit dem Verschwinden meiner Töchter zu hast, ist alles in Ordnung. Aber wenn nicht …«
Robert entließ Diener aus seinem Griff, nahm ihm den Wagenschlüssel aus der Hand und schloss die Fahrertür auf. Dann schob er German Diener auf den Fahrersitz. Er selbst stieg auf der Beifahrerseite ein. Diener fuhr den Porsche auf das große Tor zu und verließ den Hof des Polizeipräsidiums. Robert sah, dass deBuer vom Fenster im zweiten Stock aus die Szene beobachtet hatte. Ob er ahnte, dass Robert eine entsicherte Waffe war? Wahrscheinlich.
Montag
11
Eine Dunkelheit umfing sie, die nicht wich, selbst wenn es Morgen wurde und die Sonne sich alle Mühe gab, einen neuen Tag anzukündigen. Helena saß in der Küche. Sophies Computer stand auf dem Tisch. Google Earth war geöffnet. Als befände sich dort die Antwort auf die Frage, wo ihre Mädchen waren. Sie hatte schon lange nicht mehr gebetet. Das letzte Mal als sie sechs war. In der Zeit, als es passiert war. Seitdem war das Gebet kein Trost mehr. Danach hatte sie alle belächelt, die beteten und in irgendeiner Weise an Gott glaubten. Allen voran ihren Vater und ihre Mutter. Wir wissen, dass es keinen Gott gibt, hatte sie gesagt, weil er zulässt, was er zulässt. Und wie soll ich zu jemandem beten, der nicht existiert? Als sie das ihrer Mutter ins Gesicht geschrien hatte, da war sie vierzehn gewesen oder vielleicht auch schon fünfzehn, hatte sie sich keine Situation vorstellen können, in der sie wieder zu Gott beten würde. Ihre Mutter hatte ihr prophezeit, dass diese Situation irgendwann kommen würde. Und wenn nicht, könnte sie sich glücklich wähnen, hatte ihre Mutter gesagt. Helena konnte sich nicht glücklich schätzen. Vielleicht sollte sie es noch einmal probieren. Vielleicht würde sie dann noch mehr Antworten erhalten.
»Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.«
Gab es eine Antwort? Nein. Fühlte sie sich besser? Sie schloss die Augen, spürte das raue Zittern, den Atem, der sich in ihrer Brust wie Schmirgelpapier anfühlte. Ja, sie fühlte sich besser. Das Gebet gab ihr einen Halt. Es war eine Wand, die sich zwischen sie und das Grauen stellte. Auch wenn die Wand aus Pergament war. Das Gebet beschützte sie. Das Gebet und die Tavor, die Dr. Freund ihr verschrieben hatte.
Als sie das Vaterunser zum dritten Mal sprechen wollte, hörte sie Roberts Schlüssel in der Haustür. Sie brach das Gebet ab.
»Nehmen wir an, die ganze Aktion war nur dazu da, Sophie zu entführen. Warum so kompliziert?«, rief sie Robert entgegen.
Er blieb stehen, lehnte sich an den Türrahmen und zündete sich eine Zigarette an. »Wie hätten sie es sonst machen sollen?«
»Was weiß ich. Auf der Straße abgreifen, in den Wagen reinziehen und fertig.«
»Zu viel Aufmerksamkeit.«
»Okay. Dann stell dir vor, die rufen sie an. Hat Sophie nicht telefoniert, kurz bevor ich sie wegen der Fahrräder rausgeschickt habe?«
»Ich erinnere mich nicht«, sagte Robert.
»Also, die rufen sie an. Sagen Sophie, sie kann das Bild abholen. Aber nicht hier, weil die Gefahr zu groß ist, dass wir sie sehen. Also verabreden sie sich mit Sophie vor dem Olympiastadion. Von da aus gibt es drei Fluchtwege.«
Sie drehte den Bildschirm so, dass Robert sehen konnte, was sie andeutete.
»Richtung Westen über die Trakehner, nördlich über die Rominter oder über die Olympische. Das ist doch ideal. Die werden nicht gesehen. Das Einzige, womit sie nicht gerechnet haben, war ich.«
Das war Helena, wie er sie kannte. Klug, schnell. Wahrscheinlich hatte sie einen IQ jenseits der hundertfünfzig. Er war nicht so klug und nicht so schnell.
»Ich muss schlafen«, sagte er.
Sie hörte, wie er in den ersten Stock hinaufging. Sie hörte seine schweren Schritte auf der Treppe. Eine Tür wurde geöffnet. Es war die Tür zu Sophies Zimmer. Dann war es still. Sie wusste, dass er auf Sophies Bett saß und ihr Kopfkissen vor der Brust umklammert hielt. Dass er daran roch. Dass er weinte. Sie hörte, wie er schrie. »Ich werde das Schwein finden und in Stücke schneiden.«Und noch andere Dinge, die sie erschreckten. Sie konnte es nicht mehr hören, ging ins Wohnzimmer und schloss die Tür.
Sie klappte das Notebook auf. DeBuer hatte ihnen den Zugang zum Polizeicomputer gegeben, damit sie von zu Hause auf die Datenbank zugreifen konnte. In einer Datei wurden alle Anrufe transkribiert und ausgewertet. Der letzte Eintrag war drei Minuten alt. Ein Mann hatte einen anderen Mann gesehen, der mit zwei weinenden Mädchen in ein Haus in der Kantstraße gegangen war. Als die Polizei anrückte, stellte sich heraus, dass der Hund des Mädchens gestorben war. Eine Frau hatte in der Wohnung über ihrer Wohnung Schreie gehört, eine andere Frau glaubte, in ihrem Keller verdächtige Geräusche gehört zu haben, ein Wachschützer war ziemlich sicher, die Mädchen in der Herz-Jesu-Kirche gesehen zu haben. Es gab Dutzende Hinweise, denen deBuer und die Soko so schnell sie konnten nachgingen, aber nichts davon führte zu den Mädchen. Helena wechselte zu ihrem privaten Mailaccount. Kollegen aus der Staatsanwaltschaft, Lehrer der Mädchen, Katharinas Basketballtrainerin boten ihre Hilfe an. Allerdings gab es nicht nur Aufmunterungen. In den sozialen Medien beschimpften ein paar Idioten Helena und Robert, sie hätten nicht genügend auf ihre Kinder aufgepasst. Andere machten sich einen Spaß daraus, Fotos von Katharina und Sophie digital zu bearbeiten, sodass es aussah, als wären sie tot. Und immer wieder der Hinweis, dass die Mädchen einem Netzwerk von Mädchenhändlern in die Hände gefallen seien. Helena klappte das Notebook zu. Mädchenhändler. Das war die schlimmste Vermutung von allen. Mädchenhändler bedeutete, dass es Profis waren, die Katharina und Sophie entführt hatten. Dass Paulus damit zu tun hatte.
Können wir uns treffen? Außerhalb der Staatsanwaltschaft.
Eine Nachricht von dem neuen Oberstaatsanwalt Serner. Was wollte er von ihr? Und wieso wollte er sich nicht in der Staatsanwaltschaft treffen?
Haben Sie etwas von meinen Kindern gehört?
Keine Antwort. Sie nahm die Krücken und humpelte in den Flur. Griff nach dem Autoschlüssel ihres alten Volvos. Von Robert war nichts mehr zu hören. Vielleicht war er eingeschlafen.