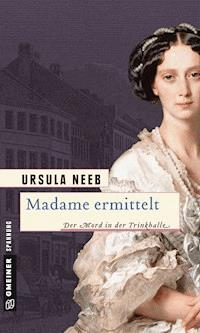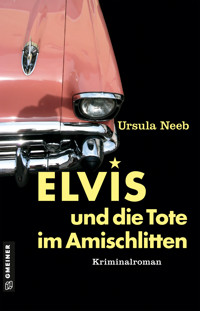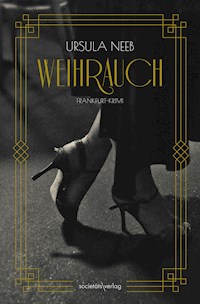Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Ursula Neebs Roman lässt das spätmittelalterliche Frankfurt in all seinen Facetten auferstehen. Mäu, die Tochter des städtischen Abdeckers, sucht in der Stadt am Main ihr Lebensglück - doch im ständisch geprägten Frankfurt bleibt für sie nur ein Platz am Rande der Gesellschaft. Als sie sich auflehnt, zerbricht sie fast an den Regeln und Gesetzen einer Welt, die für Freiheit und Liebe keinen Platz hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Neeb
Die Siechenmagd
Historischer Roman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2016
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vermeer_van_Delft_021.jpg und
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankfurt_Am_Main-Jakob_Fuerchtegott_Dielmann-FFMADIUSAAUNZ-014-Der_Roemerberg.jpg
ISBN 978-3-8392-4886-7
Widmung
Für meinen Vater Helmut Konrad Neeb
Die Kinder des Mondes
»Der Sterne Wirken geht
durch mich,
unstet bin ich und
wunderlich,
Mein Kind man kaum
bezähmen kann,
niemand sein sie gerne
untertan.«
(Aus einem mittelalterlichen Hausbuch um 1480)
I. Teil: Der Gutleuthof
Prolog
Am frühen Morgen des 22. März im Jahre des Herrn 1506 verließ der Kaufmann Ulrich Neuhaus sein Stadthaus in der Neustadt und lief die Neue Kräme hinunter in Richtung Altstadt. Bewusst hatte er darauf verzichtet, eines seiner prächtigen Reitpferde satteln zu lassen, ebenso hatte er sich gegen jegliche Begleitung verwahrt, sei es durch seine Gattin und die beiden Söhne, sei es durch einen seiner Diener. So ging er nun zu Fuß durch die engen Gassen der Frankfurter Altstadt wie ein einfacher Mann. Die pelzverbrämte Schaube und der vornehme Biberhut wiesen ihn freilich als einen Mann aus den besten Kreisen aus. Doch war sein Gang nicht stolz und aufrecht, wie man es sonst eher bei einem Dominus gewöhnt war. Mit hängenden Schultern, das Haupt gesenkt, die Schritte schwer, bewegte er sich mehr wie ein Lastenträger und weniger wie eine Standesperson. Am Steinernen Haus der Patrizierfamilie Melem vorbeikommend, zog er noch mehr als bisher schon den Kopf ein und eilte in Richtung St. Bartholomäus, wo unterhalb, eingebettet zwischen Saalgasse und Mainmauer, das Hospital zum Heiligen Geiste lag. Er war angekommen! Geblendet vom gleißenden Licht der Frühlingssonne, näherte er sich der ausladenden Hospitalpforte und betätigte nach kurzem Zögern entschlossen den schweren Türklopfer. Bald schon öffnete sich der Laden an der Seite, durch den zu bestimmten Zeiten den Stadtarmen die Suppe gereicht wurde, und der kahle Kopf des Hospitaldieners erschien in der Fensternische. »Guten Morgen, Herr Rat, ich weiß Bescheid«, sagte er devot beim Anblick des honorigen Herrn und öffnete ihm umgehend das Portal.
»Tretet ein, Herr Neuhaus, die Prüfmeister erwarten Euch schon und sind gleich bereit.«
Dienstfertig geleitete der Pförtner den Besucher zu einem kleinen Raum, der direkt an den Lichthof grenzte.
»Nehmt einstweilen hier Platz, mein Herr. Ich melde der Kommission, dass Ihr da seid.« Der Hospitaldiener entfernte sich beflissen.
Es war ein strahlender Frühlingsmorgen, genau anderthalb Stunden nach Sonnenaufgang. Die Vögel zwitscherten, und süßer Blütenduft durchdrang den lichtdurchfluteten Warteraum, dessen Fenster weit geöffnet waren. Ulrich Neuhaus, Angehöriger der altehrwürdigen Stubengesellschaft auf dem Alten-Limpurg und Mitglied des Rates der freien Reichsstadt zu Frankfurt am Main, stand am Fenster und blickte nach draußen in den kleinen Spitalgarten mit Bäumen und blühenden Blumen. Schweißperlen glitzerten auf seiner Stirn und seine Fingernägel gruben sich tief in das Fleisch seiner verschränkten Arme. Schweißgebadet entledigte er sich schließlich der schweren Schaube aus feinem englischem Tuch. Während er das Gewand über einen Stuhl warf, bemerkte er, dass er am ganzen Körper bebte, und neben den Hitzewallungen durchfuhr es ihn immer wieder eiskalt, sodass er zu schlottern anfing.
Wie der reinste Bettseicher! Ulrich, jetzt reiß dich am Riemen!, ermahnte er sich selbst, bemüht, sich zu sammeln, und begann, immer noch zitternd, still zu beten, als sich die Flügeltür öffnete und eine junge Krankenmagd mit gestärkter weißer Haube ihn bat, ihr zu folgen. Sie geleitete ihn zu einem großen hellen Raum am anderen Ende des Lichthofs und forderte ihn auf, sich vollständig zu entkleiden und sich auf dem Krankenstuhl, der in helles Sonnenlicht getaucht war, niederzulassen. Sogleich betraten die sechs Prüfmeister nacheinander den Raum, gefolgt von einem städtischen Schreiber, der das Prüfungszeugnis protokollieren sollte. Mit feierlichem Ernst begrüßte der Vorsteher den Wartenden und erklärte die Untersuchung für eröffnet. Er bat den Protokollführer, die Fenster zu schließen. Mit größter Vorsicht und Sorgfalt befühlten und betasteten die vereidigten Prüfer die Knoten im Gesicht und an den Gliedmaßen von Ulrich Neuhaus, stachen behutsam mit Nadeln in die hellen Hautflecken, befragten den Patrizier, ob er an diesen Stellen etwas fühle, ob ihn die Stiche schmerzen würden. Neuhaus verneinte wahrheitsgemäß, war gleichzeitig aber hochgradig alarmiert über diese ihm bisher unbekannte Schmerzunempfindlichkeit, die wohl nichts Gutes zu bedeuten hatte. Mit konzentrierten Mienen stellten ihm die Prüfer verschiedene Fragen in Bezug auf Beschwerden und Symptome. Knapp und etwas gereizt antwortete er, ihn störten die verstümmelten Gesichter der Prüfmeister und ihre schrillen Stimmen. Erst recht grausten ihn die Berührungen ihrer klauenartigen Hände auf seinem Körper. Die Schar war ihm regelrecht zuwider, und er nahm im Hinterkopf so etwas wie Besorgnis in ihren entstellten Zügen wahr. Nach gut einer Stunde erklärte der Vorsteher die Prüfung für beendet. Der Untersuchte konnte sich wieder ankleiden und wurde gebeten, Platz zu nehmen und auf die Verkündung der Diagnose zu warten. Die Kommission zog sich zur Beratung in einen Nebenraum zurück. Kein Laut von ihrer Unterredung drang zu Neuhaus durch, und es dauerte auch nicht lange, bis die Prüfmeister zurückkehrten. Feierlich stellten sie sich vor dem Patrizier auf, der Vorsteher räusperte sich, bevor er mit seiner merkwürdig krächzenden Stimme zu sprechen begann:
»Ulrich Neuhaus, Stadtbürger zu Frankfurt am Main, wir haben Euch ehrsam und aufrichtig untersucht und befinden Euch als einen kranken und siechen Mann. Wir würden Euch gerne sagen, dass Ihr gesund seid, aber wegen unseres Eides, den wir geleistet haben, müssen wir Euch die Wahrheit sagen. Ihr seid am Aussatz erkrankt. Habt Geduld im Herzen und Ihr werdet ein Kind des ewigen Lebens werden.«
Diese so oft ausgesprochenen Worte der Prüfungskommission wurden von den Betroffenen stets wie ein Todesurteil aufgenommen. So auch von Neuhaus, der schluchzend zusammenbrach und fassungslos beklagte, was er schon seit Langem geahnt, aber mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft verdrängt hatte:
Er litt an Lepra, war ein von Gott Gezeichneter! Genau wie die vereidigten Kranken, die die Lepraschau an ihm vollzogen hatten, würde man ihn aus der menschlichen Gemeinschaft absondern. Mit ihren grauenhaften Fratzen würde er fortan leben müssen, da draußen im Hospital der Guten Leut! Würde bei lebendigem Leib verfaulen wie sie.
Dann doch lieber tot sein!
1. Auf zum Galgenfest!
»Jetzt kommen die Stubengesellschaften! Da könnt’s gleich Groschen regnen für uns, Josef!«, flüsterte das Mädchen dem Mann im Narrenkäfig zu.
Eine Gruppe prächtig gekleideter Männer und Frauen passierte in trippelndem Schritt das Mainzertor. Die Männer trugen eng anliegende vielfarbige Beinlinge, welche das Gesäß und die Geschlechtsteile deutlich betonten, kombiniert mit kurzen, mit Goldknöpfen versehenen Hemdjacken aus edlem Tuch. Ihre Häupter waren bedeckt mit pelzverbrämten Samtbaretten in leuchtenden Farben. Den Blickfang allerdings bildete das Schuhwerk: Schuhe aus Samt und Seide oder aus feinstem Leder mit Perlen bestickt, verschiedenfarbig an jedem Fuß, wuchernde Gebilde mit schnabelartigen Schuhspitzen in kurioser Länge. So lang waren die Schnäbel, dass ihre Träger sie mit Gold- und Silberketten an die Knie hochgebunden hatten, um darin laufen zu können.
Die Damen, gehüllt in brokatene, pelzgefütterte Mäntel, die langen Schleppen wie Pfauenschwänze hinter sich hertragend, hoben graziös den Saum des Gewandes, um zierliche Füße in ›Chopinen‹ sichtbar werden zu lassen – die hohen Stelzenpantoletten waren die neueste Schuhmode aus Venedig.
Die Patrizier streiften das Mädchen und den Narren mit abschätzigen Blicken, fassten zögerlich in ihre reich mit Quasten und Seidenbändern dekorierten Almosentaschen und warfen ein paar Münzen in Richtung der beiden.
Flink sprang das zerlumpt gekleidete junge Mädchen herbei, klaubte das Geld vom Boden auf und rief den Wohltätern ihr »Gott segne Euch!« hinterher.
Das Mädchen trat an den Käfig, in dem der Mann saß, mit dem sie die ganze Zeit gesprochen hatte, und reichte ihm die Münzen. Dieser überließ ihr wortlos einige Geldstücke und steckte den Rest mit unbewegter Miene unter seine Lumpen.
Josef sagte schon seit vielen Jahren kein Wort mehr, und ebenso wenig verzog er irgendeine Miene. Die Frankfurter kannten ihn als den ›toten Josef‹. Lange Jahre schon lebte er abwechselnd im Mainzerturm nahe der Mainzerpforte oder im Brückenturm, den beiden städtischen Gefängnistürmen, in denen die Stadt auch ihre Narren unterbrachte. Von Zeit zu Zeit, wenn die Türme überfüllt waren, quartierte man einige der Verwirrten in die Narrenkäfige um, die draußen vor den Stadttoren angebracht wurden und neben der allgemeinen Volksbelustigung auch den Zweck verfolgten, den Kranken von Sinnen die Möglichkeit zu geben, milde Gaben zu erbetteln.
Das Mädchen ging gerne zu den Tollkisten an der Stadtmauer. Wenn dort etwas gespendet wurde, fiel meistens auch etwas für sie ab. Außerdem mochte sie die Kranken des Gemüts und unterhielt sich gerne mit ihnen. Das Gute an ihnen war, dass sie sie einfach so nahmen, wie sie war. Außerdem waren die Narren noch zerlumpter als sie selbst und stanken zum Gotterbarmen. Aber das störte sie nicht. Jedenfalls hatte noch nie einer von ihnen sie beschimpft oder verjagt, wie das sonst so häufig vorkam in Frankfurt.
Ihr Name war Maria Dunckel, aber alle nannten sie nur »Mäu«. Sie war die Tochter des städtischen Abdeckers, Hundshäuters und Kloakenreinigers Edu Dunckel. Mäu war 15 Jahre alt und hatte trotz vereinzelter Pockennarben an Wangen und Stirn ein hübsches Gesicht mit strahlenden grünen Augen. Ihr volles kastanienbraunes Haar, das ungebändigt nach allen Seiten abstand, wirkte sauber, aber unfrisiert und trug nicht unerheblich zu dem verwilderten Gesamteindruck bei. Auf der wohlgeformten, leicht nach unten gebogenen Nase befanden sich mehrere Sommersprossen, was dem anmutigen Mädchengesicht eine verschmitzte Note verlieh. Insgesamt von athletischem Körperbau, kündeten die muskulösen Beine mit den starken Fesseln ebenso wie die kräftigen sonnengebräunten Arme des Mädchens von harter körperlicher Arbeit.
»Kerle, es wird ja immer doller, jetzt kommen auch noch die Damen von Stalburg!«, rief sie und starrte mit offenem Mund zum Stadttor hin.
Zwei weiße Zelter, von Pagen an Zügeln geführt, kamen durch den weiten Torbogen. Auf den kraftvollen ruhigen Tieren thronten Damen, die feinen bleichen Gesichter unter kunstvollen Flügelhauben von farbigen Seidenschleiern umweht. Neben den Pagen gingen livrierte Almosengeber, die auf ein knappes Handzeichen ihrer Herrinnen hin Münzen zum Narrenkäfig warfen. Mäu verbeugte sich tief in Richtung der vornehmen Spenderinnen, bevor sie das Geld einsammelte.
»Na, verdienste dir wieder ein paar Kröten, Mäu«, sprach plötzlich eine Stimme hinter ihrem Rücken. Mäu fuhr herum und sah sich Auge in Auge mit ihrer Muhme Martha Backes.
Martha, die jüngere Schwester von Mäus Mutter, war vielleicht zehn Jahre älter als Mäu und verdiente sich ihren Lebensunterhalt als Hübscherin in einem der städtischen Frauenhäuser in der Alten Mainzergasse, unweit der Frauenpforte an der Stadtmauer. Sie war mit einer Gruppe anderer Hübscherinnen unterwegs, alle in auffallend gelber Kleidung, der von der Obrigkeit verordneten Hurentracht. Martha war eine der begehrtesten Huren in der Stadt. Ihr langes offenes Haar leuchtete rotgold und umrahmte ein blasses, ebenmäßiges Gesicht mit hoher brauenloser Stirn. Die gewölbten Lider waren mit glitzerndem Kohlestaub geschwärzt und auf den fein geschwungenen Lippen schimmerte ein duftender purpurfarbener Balsam.
»Da haste was, du kleine Grott! Vielleicht kommste ja bald zu uns an die Frauenpfort und verdienst dir’s selber«, sagte Martha lachend und steckte Mäu eine Münze zu.
»So, mir müssen weiter zum Galgenfeld. Nach einer Hinrichtung läuft des Geschäft immer wie geschmiert«, verabschiedete sich Martha. Mäu bedankte sich und blickte der Muhme bewundernd nach. »Ei, was ist die so schön, und riechen tut sie immer so gut«, murmelte Mäu versonnen und schnüffelte an ihrem schäbigen Leinenüberwurf.
»Und ich stink wieder nach Puddel! So, jetzt muss ich aber los, bald kommt die Mutter von den Siechen zurück, und ich soll ihr mit der Wäsch helfen. Aber vorher mach ich noch übers Galgenfest und hol mir was. Ich kann dir einen Weck kaufen und bring ihn dir morgen vorbei.«
Die kleine Gestalt entfernte sich vom Mainzertor mit dem Narrenkäfig in Richtung Galgengasse. Dort passierte sie die Galgenpforte, die zum Galgenviertel führte.
Hier draußen auf den westlich der Stadt vorgelagerten Feldern lag das Quartier der Ausgestoßenen. Es erschien wie ein eigener Stadtteil mit Schenken, Bettlerherbergen und Hütten, einer Badestube sogar. Kirche und Rathaus gab es hier nicht, dafür aber etwas abgelegen die alte Scharfrichterei auf dem Galgenfeld, das einzige Steinhaus im Quartier, in welchem, den Rabenstein mit dem Galgen stets im Blick, der Henker mit seiner Familie lebte. Weiter unten zum Main hin befand sich der ›Gutleuthof‹, das städtische Leprösenhospital, und in einiger Entfernung davon die Behausung des städtischen Abdeckers und seiner Familie. Die Stadtbürger nannten diesen Bezirk den ›elenden Flügel‹ oder, wegen seiner Nähe zur Hinrichtungsstätte, einfach das ›Galgenviertel‹.
Die Region der Friedlosen war verschachtelt und scheinbar undurchdringlich in ihrem engen Nebeneinander von schäbigen Hütten und Buden, zwischen denen schmale Trampelpfade und enge Trittstege verliefen, so zahlreich sich kreuzend wie die Falten im Gesicht eines Hundertjährigen. Mäu war hier aufgewachsen und kannte jeden Winkel.
Als sie aber jetzt durch die Gassen lief, wirkte alles wie ausgestorben. Genau wie die Bürger aus der Stadt und der ortsansässige Adel drängten sich alle Bewohner auf dem Galgenfeld. Heute, genau um zwölf Uhr mittags, sollte der ›Tanzstoffel‹, ein kleiner Gauner, Gelegenheitsdieb und Wilderer, aufgehängt werden. Der Mann war kein sonderlich spektakulärer bekannter Verbrecher, aber Hinrichtungen waren, ähnlich wie der Jahrmarkt oder die Messen, stets beliebte Attraktionen für alle Stände, wo man sich in einer Atmosphäre verlustierte, die gleichermaßen Spannung und Zerstreuung bot.
Mäu gehörte zu den Nachzüglern, die noch auf dem Weg zur Richtstätte und dem sie umgebenden bunten Treiben waren. Endlich hatte sie die Ausläufer erreicht, und die ersten Verkaufsstände wurden sichtbar. Es roch nach Gesottenem, Gebratenem und nach Räucherspeck, nach Zimt, Honig, gebrannten Mandeln, Anis und Ingwer, kurzum, nach allen Wohlgerüchen des fernen Orients und der heimatlichen Fleischerinnung. Sie verspürte Heißhunger, und beim Gedanken, dass sie sich etwas von den Köstlichkeiten würde kaufen können, lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Noch ganz in ihre Überlegungen versunken, was für einen Schmaus sie wählen könnte, um endlich einmal wieder das tägliche Einerlei von dünner Brotsuppe und Haferbrei zu durchbrechen, wurde sie unversehens von lautem Lärmen und Anfeuerungsrufen gleich in der Nähe aufgeschreckt. Neugierig blickte sie sich suchend um und erspähte einen Tisch, an dem sich zwei vierschrötige Männer gegenübersaßen und, umgeben von einem kleinen Schwarm von Zuschauern, die durch ihre lautstarken Kundgebungen und Rüpeleien unschwer als Sympathisanten der jeweiligen Kontrahenten auszumachen waren, ein Armdrücken veranstalteten.
Na, da sind ja die Richtigen aneinandergeraten, dachte sich Mäu beim Anblick der beiden Männer und musste grinsen. Sie kannte die beiden Kampfhähne, es waren der Bettelvogt und der Waldbüttel. Tatsächlich schien es sich bei den beiden um ebenbürtige Gegner zu handeln, kräftige, feiste Burschen ähnlicher Statur, mit denen sich nur wenige anlegen würden, so wild und furchterregend sahen sie aus.
Und beide waren auch im Alltag gefürchtet, besonders aber in der Ausübung ihrer Professionen als harte Schleifer berüchtigt.
Der eine, breitschädlig und rotgesichtig, mit strähnigen rötlichen Haaren und noch röterem Bart, war der Aufseher über das gesamte Frankfurter Waldareal. Alle Einheimischen kannten ihn unter dem Spitznamen ›Waldschrat‹. Er hatte die Aufsicht über Wald und Jägerei, Waldweide, Honig- und Holznutzung sowie die Fischbestände aus den Fischteichen. Nur der Stadt Frankfurt oblag die Nutzung dieser Erträge, darum bestand die wichtigste Aufgabe des städtischen Waldbüttels darin, Wilderern und Holzdieben das Handwerk zu legen und das unbefugte Fischen und Angeln zu verhindern. Auf solche Vergehen stand nicht selten die Todesstrafe, zumindest aber das bei Diebstahl übliche Handabhacken – vorausgesetzt, es überlebte einer die wilde Hatz des Waldschrats und seiner Gehilfen, der sogenannten ›Holzleute‹. Denn wenn sie einen Wilderer oder Fischdieb auf frischer Tat ertappt hatten und dieser die Flucht ergriff, dann verfolgten sie ihn, kreisten ihn ein und schossen mit Armbrüsten auf den Frevler.
Der Todeskandidat des heutigen Galgenfestes, der Tanzstoffel, hatte das zweifelhafte Glück, vom Waldschrat im Sachsenhäuser Forst lebendig gefangen worden zu sein, um nun seiner für Wiederholungstäter üblichen Strafe, dem Tod am Galgen, zugeführt zu werden.
»Streng dich an, Grünratt1, meinen letzten Groschen hab ich auf dich gesetzt! Den Stoffel haste an den Dullmen2 gebracht, und mich bringste hoffentlich an den Bierkrug. Das glaubt mir keiner, dass ich auf einen Büttel setzen tu!«, krächzte es heiser aus dem Publikum und wurde mit kehligem Gelächter quittiert.
Mäu blickte in die Richtung des Rufers und erkannte Leo, den Regenmacher. Die meiste Zeit reiste er von Jahrmarkt zu Jahrmarkt durchs ganze Land, kam aber immer gern zu alten Freunden ins Galgenviertel, um die Frankfurter Messe zu besuchen oder einfach, um sich für ein paar Wochen von dem rauen, anstrengenden Leben auf der Straße zu erholen.
»Drück ihn runner, Bettelmeister, des biste unsrer ehrenwerten Zunft schuldig«, kreischte eine andere Stimme aus dem Publikum. Der Kampf zwischen den etwa gleich starken Gegnern zog sich hin, beide boten ihre ganze Kraft auf, doch keinem mochte es gelingen, den Arm des anderen auf die Tischplatte zu pressen. Ihre Gesichter waren krebsrot und glänzten vor Schweiß.
Bei dem Angesprochenen handelte es sich um den städtischen Bettelvogt, dessen Aufgabe es war, das Bettlertum zu kontrollieren und zu beaufsichtigen. Wegen seines unnachsichtigen Durchgreifens hatte Meister Knut, genannt ›die Knute‹, schon lange seinen Ruf weg: Mit dem scharfen Blick seines einen Auges war er stets auf der Jagd nach ortsfremden Bettlern, um sie mit Peitschenschlägen aus der Stadt zu treiben, denn der Bettelei nachgehen durften in Frankfurt nur die einheimischen Bettler und Stadtarmen. Sie alle nahm die Knute unter ihre Kandare, um ihnen in regelmäßigen Abständen einen großen Teil ihres Erbettelten wegzunehmen. Einäugig und von Pockennarben entstellt, bot er einen Anblick von erschreckender Hässlichkeit. Einst hatte Knut sein täglich Brot selber erbettelt, und darum waren ihm auch sämtliche Tricks und Kniffe des Bettelvolkes so gut bekannt.
Der Sterzermeister hauste mit seinen Bütteln in kleinen nischenartigen Anbauten an der westlichen Stadtmauer nahe dem Stadtgefängnis an der Mainzerpforte. Im Galgenviertel munkelte man, er sei inzwischen so reich, dass er sich schon längst zur Ruhe setzen könnte, wären da nicht seine grenzenlose Habgier und die Freude am Leuteschinden.
Das Kräftemessen der beiden Kontrahenten hatte einen Punkt erreicht, an dem die Männer an ihre Grenzen gelangt waren. Die Zähne fest zusammengebissen, bebend vor Anstrengung erschienen ihre Gesichtszüge nur noch wie Grimassen. Der Bettelvogt machte überdies den Eindruck, als würde ihn jede Minute der Schlag treffen, so dick geschwollen waren die Adern an Schläfen und Hals. Da ertönte plötzlich aus seinem Mund ein wilder Schrei, und zum lauten Jubel derer, die auf ihn gesetzt hatten, drückte er mit einem festen Ruck den Arm des Waldschrats auf den Tisch. Ein Schiedsrichter verteilte die Gewinne, wobei der Löwenanteil der Knute zufiel. Während dieser die Münzen sorgsam in seiner Geldkatze verstaute, die er um den dicken Leib gebunden hatte, warf er dem Waldaufseher einen verächtlichen Blick zu. »Siehst du, Grünratt«, sagte er, »kannst zwar schön mit deiner Armbrust schießen, richtig zu kämpfen, verstehste aber net. Davon hat einer wie du, der zur Erbauung auf die Leut’ schießt wie andre auf Rehböck, keine Ahnung. Gott vergelt’s!«, verabschiedete er sich knapp und erhob sich zum Gehen.
Mäu schickte sich ebenfalls an, weiterzuziehen. Ihr knurrte inzwischen der Magen, sie würde sich eine Wurstsemmel leisten, dazu ein kühles Bier trinken und sich dann nach Hause machen.
Die Hinrichtung, die bestimmt bald stattfinden würde, wollte sie sich sowieso nicht anschauen. So viele hatte sie schon gesehen und immer war ihr schlecht geworden dabei. Nicht nur der Anblick des zitternden Delinquenten, sondern auch das johlende Beifallsgekreisch des Hinrichtungspublikums, wenn Meister Hans, der Henker, wieder mal seine Pflicht erfüllt hatte, waren ihr zutiefst zuwider.
Als sie sich durch das dichte Menschengewimmel kämpfte, um zur Wurstbraterei durchzukommen, schien auf einmal die Menge ins Stocken zu geraten und es ging überhaupt nicht mehr weiter. Ärgerlich versuchte sie, sich durchzuzwängen, was ihr ein Stück weit auch gelang. Sie konnte, umringt von der Menschentraube, einen Flugblatthändler erkennen, der mit wohltönender Stimme deklamierte.
Diese wandelnden Zeitungen erfreuten sich großer Beliebtheit seitens der Bevölkerung und waren durch die Erfindung des Buchdrucks sehr in Mode gekommen. Die Flugblätter behandelten Themen wie Liebe, Tod, Sensationen, Kuriositäten und Schauergeschichten; sie lieferten aber auch Informationen über aktuelle politische Ereignisse, die vom Flugblatthändler lautstark kommentiert wurden, wobei Spott und Kritik meistens nicht fehlten. Dem größtenteils leseunkundigen Publikum mussten sie vom Flugblattverkäufer mit viel Gestus und Pathos vorgelesen werden. Für die Bevölkerung auf dem platten Land waren sie oftmals die einzige Nachrichtenquelle und Abwechslung. Der Einfluss des Flugblatthändlers auf die Meinungsbildung war dabei nicht unbeträchtlich. Darum wurden sie auch häufig vonseiten der Obrigkeit mit Argusaugen beobachtet.
Dem jungen Flugblatthändler, der eine Brille auf der Nase trug, hinter der lustige, scharfsinnige Augen blitzten, schien es offensichtlich Vergnügen zu bereiten, dem Publikum mit dramatischen Neuigkeiten aufzuwarten.
»Hochverehrtes Publikum, ich erzähl euch jetzt die Mär vom Buntding, die sich in der nördlichen Stadt Hameln wahrlich so zugetragen hat«, begann er mit dramatischem Unterton.
»Seit langer, langer Zeit schon erzählen es sich dort die Mägde in den Spinnstuben, die Gesellen in den Schenken, die Reiberinnen im Badehaus, die Stadtbürger an ihren heimischen Öfen: die alte Mär vom Buntding, der die Seelen der Kinder entführt. Jedes Jahr um den Mittsommertag, so heißt es, kommt ein Jäger im vielfarbigen Gewand in die Stadt Hameln mit einem roten wunderlichen Hut und lockt mit seinem betörend schönen Flötenspiel die Kinder von den Gassen und Plätzen. Willenlos verzaubert folgt ihm die stille Schar, 130 an der Zahl, aus der Stadt hinaus. Er führt sie durch den Wald bis hin zur Mühle, wo sie auf Nimmerwiedersehen verschwinden, ihrer unsterblichen Seelen beraubt …«
Da setzte mit einem Mal lauter Trommelwirbel ein, der die baldige Hinrichtung verkündete. Alle Leute, die sich eben noch um den Flugblatthändler geschart hatten, drängten nun in Richtung Galgen und ließen den Vortragenden einfach stehen. Keiner wollte das Spektakel des Aufknüpfens versäumen.
Ganz verlassen stand der junge Mann da und blickte etwas irritiert um sich. Der Platz war wie leer gefegt, nur noch die Händler, Marktschreier, Garköche und Schankwirte verharrten hinter ihren Verkaufsbuden. Mäu tat der Flugblatthändler ein wenig leid, aber sie traute sich nicht, ihn anzusprechen. Gut sieht er aus und so gelehrt. Zu gelehrt für mich!, entschied sie und wandte sich zum Gehen. Von Weitem sah sie den ›Tanzstoffel‹, der, in Ketten gelegt und von den Henkersbütteln bewacht, vom Henkersverlies zum Rabenstein geführt wurde, ein kleiner, lustiger Kerl, der gut die Fiedel zu spielen verstand und gar possierlich dazu tanzte.
Auf seinem letzten Weg aber war sein Gang schleppend, die Beine wollten ihn kaum tragen. Mäu fühlte Mitleid mit ihm. »Herr Jesu, steh ihm bei«, flüsterte sie und bekreuzigte sich.
»Und du scheinst keine Hinrichtungen zu mögen?«, fragte plötzlich eine Stimme hinter ihr. Mäu zuckte zusammen und drehte sich um. Der Flugblatthändler!
»Nein, überhaupt nicht. Ich geh nur zum Galgenfest, weil hier was los ist. Wenn die Hinrichtung kommt, geh ich meistens«, stotterte sie und merkte, wie sie errötete.
»Das ist bei mir genauso. Wenn du erlaubst, begleite ich dich ein Stück.«
Gemeinsam schlugen sie den Weg aufs freie Feld ein, redeten nicht viel und schlenderten bald am Ufer des Mains entlang. Kurz vor dem Abdeckerhof trennten sie sich dann. Unmutig ging Mäu alleine weiter.
2. Da, wo der Hund begraben liegt
Ein dunkelgrau gewandeter Mann mit einem spitzen roten Hut huschte durch die menschenleeren Gassen der Stadt. Er war mit einem schweren Holzprügel bewaffnet und schien auf irgendetwas zu lauern. Zwischendurch hielt er kurz inne, spurtete plötzlich wieder los, vorbei an der Bartholomäus Pfarrkirche, am Spital zum Heiligen Geiste bog er ab und rannte im Schweinsgalopp weiter in Richtung Römer. Kurz vor St. Nikolai schlug er dann zu. Ein lautstarkes Jaulen und Wimmern war zu vernehmen, dann wurde es still.
Endlich hatte er ihn erwischt, den verdammten Köter! Edu Dunckel, seines Zeichens Schinder, Abdecker, Kloakenreiniger und Hundshäuter im Dienste der Stadt Frankfurt, wischte sich keuchend den Schweiß von der Stirn, für das Hundeschlagen wurde er langsam zu alt. Er beugte sich herunter, packte den blutverschmierten Hundekadaver und schleppte ihn zu seinem Schinderkarren, den er am Liebfrauenberg abgestellt hatte. Ganz schön groß und schwer, das Mistviech! Na, das gibt schon ein paar feine Handschuh. Der Abdecker warf den toten Hund in den Karren zu den anderen Kadavern. Erst vier Hunde hatte er heute erschlagen. Das war nicht viel, er musste also noch mal seine Runde drehen, auch wenn ihm das überhaupt nicht behagte. Und dann noch diese Hitze! Aber er konnte es sich nicht aussuchen. Gerade jetzt war eine gute Zeit zum Hundeschlagen, weil vorhin alles zum Galgenfeld gerannt war, um die Hinrichtung zu bestaunen. Danach kamen sie alle wieder zurück und liefen ihm vor den Füßen rum, behinderten ihn bei der Arbeit, die Stadtbürger. Und manch einer beklagte sich auch noch über den Krach, den das Hundeschlagen machte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!