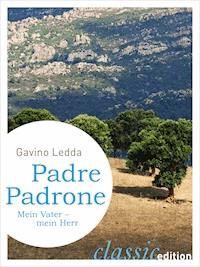Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: red.sign Medien
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Nach „Padre Padrone“ ist „Die Sprache der Sichel“ („Lingua di falce“) der zweite Teil der bewegenden Autobiografie des Sarden Gavino Ledda. Erzählte er im ersten Teil seiner Erinnerungen die erschütternde Geschichte seiner von Gewalt, Zwang und einer komplizierten Hassliebe zwischen Vater und Sohn geprägten Kindheit und Jugend in der auf Sardinien gerade erst zu Ende gehenden archaischen Zeit der Hirten und Herren, Banditen und Patriarchen, so berichtet Ledda in „Die Sprache der Sichel“ von der Zeit nach seiner Flucht vor der übermächtigen Vatergestalt. Praktisch ohne Schulbildung bleibt ihm nur der Weg zur Armee – wo er einer anderen Version von Befehl und Gehorsam ausgesetzt ist. Auch zur Befreiung von dieser Befehlsmacht findet er, getrieben von Bildungshunger und Wissensdurst, einen Weg. Den Ausbruch aus diesem Zwangssystem beschreibt er in „Die Sprache der Sichel“, und er erzählt die Geschichten, die er bei seiner Rückkehr in die immer noch archaische Heimat erlebt und hört.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Coverfoto: Shutterstock hibiscus 81
Gavino Ledda
»Die Sprache der Sichel«
Roman
Aus dem Italienischen übersetzt von Heinz Riedt. Titel der Originalausgabe: »Lingua di Falce« Für diese E-Book-Ausgabe wurde der Text neu gesetzt und gemäß den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung behutsam modernisiert.
ISBN 978-3-944561-66-0
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen
© Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei dem Erben des Nachlasses von Heinz Riedt © Gavino Ledda 1977 © Baldini & Castoldi 2011 – Milano © Deutsche E-Book-Ausgabe 2017 red.sign medien GbR, Stuttgart
www.redsign-media.de
Eine Meute hungriger Hunde steht um einen Steintrog herum. Sobald der Hirt weg ist, streiten sie sich wie immer um die Molke. Sie recken die Hälse, die von der Kette wundgescheuert sind, und drängen sich gegeneinander. Sie fressen gierig, schlappen die Brühe laut mit ihren hungrigen Zungen. Die Beine gestreckt, mit angespannten Muskeln, recken sie die Körper und sind immer bereit, die Rempeleien ihrer Gefährten abzufangen, die der Hunger zu Feinden gemacht hat. Der Trog schwappt über, die Molke rinnt auf dem kotbedeckten Boden bis zum Misthaufen des Pferchs. Keiner lässt sich stören: Alle schlingen sie die kalte Brühe hinunter. Eine ganze Weile geschieht nichts, doch das harte Aufeinanderklappen ihrer Kiefer kündigt schon etwas Unausweichliches an. Sie fressen alle weiter, versuchen einander wegzudrängen. Die Molke sinkt ab. An den Seitenwänden ist der Trog schon trockengeleckt, sauber. Nur was unten ist, wird noch vom Schaum verborgen; auch der wird weniger, schon haben die Zungen Löcher hineingeschlagen.
Schlingend und knurrend fletscht der kräftigste Hund die Zähne, um seine Vormachtstellung zu betonen, die er nur einen Moment lang aufgegeben hat, während er sich mit anderen die Molke teilt: den Trog gemeinsam mit den anderen! Ihm sträubt sich das Fell. Er rempelt seine Nachbarn mit seinen struppigen Flanken, stößt sie mit dem zottigen Hals. Nun steckt er seine Schnauze genau in die Mitte des Troges, schnaubt, bewegt den Inhalt noch heftiger als zuvor: Das ist eine Aufforderung an die anderen zu verschwinden. Das Alarmsignal. Doch zu seiner Verblüffung geschieht etwas Unerhörtes. Nicht alle Hunde kommen seiner Aufforderung nach, wie er es gewohnt ist. Es war zu wenig Molke, sie haben noch Hunger. Nur zwei Hündinnen und zwei junge Rüden lassen sich von dem gesträubten Fell des Leithundes beeindrucken und weichen bei der ersten Drohung zurück. Die anderen aber, die etwas stärker sind, das Muttertier, dessen kräftige Schwester und ein flinker, schlauer Rüde, sie rühren sich nicht von der Stelle: Sie bleiben, trotzen dem Knurren des Stärkeren, als hätten sie sich entschlossen, gemeinsam den Kampf aufzunehmen, der nicht ihrem Wesen entspricht.
Und doch haben bei dem Leithund die gewohnten Verhaltensnormen rechtzeitig und auf die richtige Weise funktioniert. Auch die majestätische Stille ist eingetreten, die er den anderen stets zugesteht, um seine Macht noch größer erscheinen zu lassen (aber auch, um seinem anhaltenden Knurren mehr Autorität zu geben), wenn sich das Rudel zurückzieht. Doch diesmal wurden die Verhaltensnormen ja nicht von allen respektiert. Er ist verwirrt. Einen Augenblick lang scheint er der Schwächste zu sein: ein Hündchen am Trog! In der Stille, die auf das Knurren folgt, verharrt er regungslos vor den drei tollkühnen Hunden. Die stellen sich taub und fressen weiter, als hätten sie nicht begriffen oder wüssten nicht, was ihre Zungen tun. Der Leithund wartet immer noch, aber es ändert sich nichts. Das ganze Ritual zu wiederholen, das passt nicht in seine Logik: Das wäre geradeso, als würde er sich selber richten, als würde er die geschichtliche Verhaltensnorm zerstören, deren Hüter er gewesen war und für die er sich verantwortlich fühlt.
Als er es vor Ungeduld nicht aushalten kann, sucht er in seiner Erinnerung. Er hofft auf das Unmögliche: dass er selbst einen Teil des Rituals unterlassen hat. Wieder majestätisches Schweigen, aber kein Knurren mehr, denn er weiß mit Sicherheit, dass er hier nichts falsch gemacht hat; er gibt diesem Schweigen einen anderen Ausdruck, er benutzt seinen ganzen Körper für dieses Ritual und übertreibt noch mehr; er legt die Ohren noch fester an, streckt die Schnauze noch steifer vor, sträubt das Fell noch mehr, stemmt die Beine noch fester gegen den Boden und hofft, auf diese Weise sein angestrengtes Schweigen noch gebieterischer zu machen. Aber auch diese letzten Verstärkungen des Befehlskodexes bewirken nichts.
Da wird er noch starrer als der Stein, aus dem der Trog gemacht ist. Die anderen drei fressen, er nicht. Er ist blockiert in dieser Situation, in die seines Wissens noch nie ein Leithund gekommen ist. Es ist der Zusammenbruch einer Moral, die ihm von den Alten überliefert wurde. Er krümmt sich am ganzen Leib, als sei er von einer Macht beherrscht, die ihm keine Regung erlaubt. Und in seiner Regungslosigkeit erkennt er das innerste Wesen seiner Spezies, sieht die dunkelsten Winkel, die unzulänglichsten Schluchten, die steilsten Abgründe, und dort findet er plötzlich die Energie, die er braucht, um zu reagieren. Spürt in sich eine andere Kraft als diejenige, die er früher gehabt hat: als auch er noch im Rudel war, als er ganz andere Wertbegriffe hatte als jetzt. So fühlt er sich imstande, unerbittlich vorzugehen, und das nicht mehr aufgrund seines Instinkts, sondern der erworbenen Gewohnheit, die ihm schließlich erlaubt, das ganze Ritual mit Knurren und Bellen zu wiederholen, ohne dass die Normen dadurch verletzt würden.
Er versetzt den Rebellen die üblichen Rempler und begleitet diese mit einem rauen, geifernden, langgezogenen Bellen. Wieder steckt er seine Schnauze mitten in den Trog, sein Körper ist so steif und angespannt wie noch nie. Das kehlig-raue, zähnefletschende Knurren hält an, und das instinktive Bündnis der drei fällt auseinander. Zwei ziehen sich zurück: die Mutterhündin und ihre kräftige Schwester. Der Rüde aber, beharrlicher und gewitzter als alle anderen, macht weiter. Doch der Anführer kennt nun keine Gnade: Er weiß, dass er nicht an die Logik des Rudels gebunden ist. Sein Knurren wird noch erbitterter, klingt jetzt so, als wäre das, was ihm mit solcher Gewalt aus dem Maul dringt, das gemeinsame Knurren aller Leithunde, und mit einer Art Urwut lässt er den hartnäckigen Gegner seine Zähne spüren.
Der vorwitzige Rebell, der nun von allen verlassen ist, weicht instinktiv zurück. Er liefert ein kurzes Verteidigungsgefecht, beißt seinerseits den Anführer, um seine Hundewürde zu retten, unterwirft sich dann aber wieder. Auch er hat zu seinem Wesen zurückgefunden und wird von den Verhaltensnormen, denen er seit eh und je unterworfen war, niedergehalten und wieder an die Kette gelegt. So entfernt er sich mit eingezogenem Schwanz vom Trog, senkt den Kopf unter der Last einer nicht näher bezeichneten Schuld und gesellt sich zu den Unterlegenen, denen er durch seine Haltung die größte Verachtung ausdrückt. Endlich kann der Leithund die Mahlzeit allein beenden, nach einem Kodex, den ihm die Anpassung der Spezies schon stets suggeriert hatte: unabhängig vom ursprünglichen Rudel, wo, anders als jetzt, der Anführer seine Stärke wirklich nach dem Prinzip der natürlichen Auslese eingesetzt hatte, wonach nur so weit gegen die anderen vorgegangen werden darf, wie es das Überleben der Spezies erlaubt.
Wieder und wieder leckt er den Trog, als folge er damit einem zwingenden Ritual, als wolle er die anderen daran erinnern, dass nur er dieses Vorrecht habe, seitdem der Hund im Dienst des Menschen steht. Erregt reibt er seine Zunge an dem inzwischen trockenen Steintrog. Stets von Neuem fährt er über die graue, poröse, raue Oberfläche, obwohl der Trog schon längst leer ist. Ja, gerade das ist der ausdrucksstärkste Teil des Rituals. Seine Überlegenheit entsteht immer wieder neu gerade aus diesem Lecken über der Leere, über den Poren und Löchern, die kein Fett und nicht einmal mehr Speichel enthalten: Seine Zunge löscht jegliche Spur eines Besitzanspruchs, den seine Untergebenen da hinterlassen haben.
Und in seiner Leckwut packt er den Trog mit den Zähnen. Hebt ihn hoch, kommt knurrend auf mich zu. Ich trete zurück, doch er kommt mir nach. Nun hat er mich erreicht. Er setzt den Napf ab und knurrt mich laut an, ein Knurren, das nach menschlicher Verbitterung klingt. Ich bleibe stehen, und zu meiner Verblüffung streift er seine Backenhaare, die noch voller Molke sind, an meinen Wangen ab. Ich rühre mich nicht von der Stelle, er aber reckt seinen Hals, der vor Wut angeschwollen ist, und spuckt mir Molke und Geifer ins Gesicht und auf die Kleider, macht damit ein Kreuz über meinen Körper, aus der Zwangsvorstellung heraus, den Gegner beschwören zu müssen. Er lässt mich stehen, läuft zum Trog zurück, beschreibt noch ein Kreuz über dessen ganze Oberfläche und packt ihn noch einmal. Er fletscht die Zähne. Zieht die Augenwülste zusammen, hebt den Trog wieder gegen mich, beschreibt damit noch einmal ein Kreuz, spuckt seinen Geifer hinein, knurrt mich wieder an. Bei dieser letzten Geste aber läuft es mir kalt über den Rücken; ich schüttle mich, und es ist wie ein Erwachen, bestürzende Gedanken überfallen mich.
In dem Knurren, das den jungen Hund vom Trog vertreibt, erkenne ich das Knurren meines Vaters, der mich aus dem Haus jagt. Und wieder bin ich weit weg von meiner natürlichen Umgebung und gehe einem Ziel entgegen, das mir ebenso unbekannt ist, wie mir damals Baddevrústana unbekannt war, als mich mein Vater eines Tages auf den warmen, felligen Rücken unseres Esels Pacifico setzte und dorthin brachte.
Jetzt aber beförderte mich ein kalter Eisenbahnzug, dessen metallisches Rumpeln dem Aufschlag riesiger Hufe glich und mich an einen großen Dampf-Esel denken ließ. Und beim Rattern der Wagen erkannte ich mich in dem rebellischen jungen Hund wieder, der die Logik des Pferchs nicht mehr akzeptieren wollte; und wie er, nachdem er den Anführer gebissen hatte, den Schwanz einzog, überkam auch mich bei diesem qualvollen Erwachen das Gefühl einer Schuld, die ich nicht definieren konnte. Irgendetwas bewegte sich schmerzhaft in mir, stach wie der dornige Zweig eines wilden Birnbaums und riss mir überall Wunden.
Meine Angst, meine krampfhafte Suche nach einer plausiblen Erklärung, führte schließlich dazu, dass ich begann, über die Natur, über die Moral der Hirten und Bauern nachzudenken. Ich sah beispielsweise den Weinbauern, wie er seine Rebstöcke mit einer primitiven Technik heranzieht, die ihm als die beste und natürlichste erscheint und die ihm von den Alten überliefert worden ist. Er stutzt die Reben kräftig, und wenn nötig, lässt er den längsten und stärksten Trieb stehen; und streift das Laub in der ganzen Länge ab. Er nimmt die Hacke, zieht damit einen Graben und bettet den Trieb hinein. Dann deckt er ihn mit der ausgehobenen Erde zu und biegt ihn wieder zur Reihe hinauf: Das ist der Ausläufer, der ihm gleich vom ersten Jahr an Trauben geben wird, ohne dass er gepfropft werden müsste. Doch nach einer angemessenen Zeit geht er die Reihen wieder durch und trennt wie ein unerbittlicher Richter mit Baumschere oder Säge den Ausläufer vom Mutterstock ab: Er muss entwöhnt werden. Wurzeln sind ihm schon genug gewachsen, also hat er kein Recht mehr, den Saft aus dem Stock zu ziehen, der sein Heim, sein Trog gewesen war. Jetzt ist es an der Zeit, dass er sich selbst versorgt.
Mit diesen Bildern vor Augen hielt ich nun das Vorgehen des Weinbauern auch für moralisch gerechtfertigt: Ich hatte es ja selbst schon so gemacht. Doch ich erinnerte mich auch, dass es oft ein am alten Stock gewachsener Schössling gewesen war, der den Vater ernährt und verjüngt hatte. Und ebendies wollte mein Vater von mir. Doch ich, ein sozialer Schössling, der nicht allein biologisch bestimmt war, hatte eine große Sehnsucht und war nicht gewillt, meinen Lebenssaft ausschließlich demjenigen zu opfern, der ihn schon fast verzehrt hatte; von meinem sechsten Lebensjahr an mit Arbeit bis zur Erschöpfung. Ich fühlte mich als undankbarer, egoistischer Schössling. Also schien es mir nach der natürlichen Ordnung der Dinge nur richtig, dass mein Vater diesen Schössling mit der schärfsten aller Baumscheren abgetrennt hatte: mit derjenigen der Überzeugung, die, wenn sie sich erst einmal festgesetzt hat, oft ganz unabhängig von dem historischen Bedürfnis, aus dem sie entstanden ist, Tatsachen und Dinge blindlings auf eine Hierarchie zurechtschneidet; diese erstreckt sich vom Vater auf den Sohn, vom Ehemann auf die Ehefrau, vom Offizier auf den Soldaten, vom erwachsenen Hund auf den jungen Hund in einer Reihe von Beziehungen, die nur dem Anschein nach natürlich sind.
Aber auch das Leben eines Hirten, der seine Schafe gut weidet, sie sorgfältig melkt und dabei die Zitzen mit dem richtigen Fingerdruck presst, damit das Schaf an dieser Stelle keinen Schaden nimmt, wo er seiner Arbeit Lohn erhält, dies Leben schien mir, wenn ich es mir genau überlegte, doch mehr eine egoistische Ausbeutung als ein Sicheinfügen in den Zyklus der Natur zu sein. Ich sehe ihn als Geburtshelfer der Schafe bei schwierigen Geburten, und er macht das mit größerer Kompetenz und größerem, egoistischerem Interesse, als er es bei seiner eigenen Frau tun würde. Beharrlich und beflissen steht er nachts in kurzen Abständen auf, um nachzusehen, ob da nicht im Stall oder im Pferch ein Neugeborenes ist, das wegen der Nachtkälte trotz aller Bemühungen der Mutter nicht saugt. Ist dies der Fall, legt er das Mutterschaf der Länge nach auf den Boden und hält es wie in einem Schraubstock mit Schienbeinen und Schenkeln fest; dann steckt er dem Lämmchen seinen rechten Zeigefinger ins Mäulchen und füllt dieses mit der Milch, die er schon vorher aus der Zitze gedrückt hat. Noch verbissener und am Rande der Verzweiflung ist er, wenn er aus der Hütte kommt und ein totes Lämmchen findet.
Er fängt die Mutter ein, die nun unwiderbringlich ihr Kleines verloren hat, pfercht sie ein, bindet sie an. Und stürzt sich wie ein Wahnsinniger in die Herde und greift sich unu anzone perríncu, ein Zwillingslamm, nimmt es der Mutter weg. Und als sei dieses einzig und allein ein Objekt seiner Gewinnsucht, beschmiert er es mit den Geburtsresten jenes Mutterschafs, das er zwingen wird, ihm künftig Mutter zu sein; und reibt es wiederholt an dem toten Lämmchen, das in dem Zwillingslamm »wiedererstehen« wird. Solcherart mit dem Wasser und der Plazenta behandelt, zwingt er ihm die neue Mutter auf. Funktioniert es, freut sich der Hirte. Nimmt das kinderlose Mutterschaf das Lamm nicht an, holt er sa leppa, sein Klappmesser, schärft es, fährt damit dem toten Lämmchen über das Fleisch und zieht ihm das Fell ab. Dieses bringt er über dem Feuer auf »Lebendtemperatur« und zieht es dem Zwillingslamm über, passt es ihm mit irgendwelchen Verschnürungen so gut wie möglich an. Dann nimmt er das blökende Kleine und gibt es noch einmal der unglücklichen Mutter. Endlich ist ihr Kind wieder auferstanden. Sie leckt ihm das Fell und nimmt es als das ihre an, schiebt es sich unter das Euter.
Ich aber fragte mich, wie solche Gewalttätigkeiten, die für den selbstständigen Hirten typisch sind, mit dem Naturgesetz in Einklang zu bringen sind, mit jenem Gesetz also, das in der Natur das Recht auf Überleben und Vermehrung regelt, das jene biologische Harmonie schafft, die wir in den Gesetzmäßigkeiten von Tier- und Pflanzenwelt und sogar in den Sternenbahnen erkennen. Auf derartige Fragen wusste ich wahrhaftig keine Antwort.
Erinnerst du dich noch an die Schafe, fragte ich mich weiter, wenn sie merken, dass sie niederkommen? Du siehst sie zwischen den Brombeer und Mastixsträuchern herumlaufen oder auch im hohen Gras, um ein sicheres Versteck für das Kleine zu finden. Hat das werdende Mutterschaf dann einen geeigneten Platz gefunden, legt es sich dorthin und wimmert, denn auch Tiere haben ja bisweilen Geburtswehen; und es liegt auf der rechten oder linken Seite, je nach Windrichtung und Bodenbeschaffenheit. Und dann wirft es sich herum, verdreht den Hals, bewegt Kopf und Zunge und rollt vor Anstrengung und Schmerzen die Augen, sodass man nur das Weiße sieht. Doch beim ersten Blöken des Lämmchens erhebt es sich wieder, steht recht und schlecht auf den Beinen und leckt, nichts als Lebensseufzer, das Kleine; und leckt immer wieder, leckt das Fruchtwasser auf, einerseits, um sich zum Säugen zu stimulieren, und andererseits, um dem Fuchs, vor dem es sich fürchtet, keine Witterung zu hinterlassen. Und mit seiner Schnauze, ganz Liebe, hilft es dem Lämmchen stets, sich auf die noch weichen Beinchen zu stellen, drängt es ans Euter, um es der Natur zuzuführen.
Jedes Mal, wenn ich dieses Lebensphänomen erlebt hatte, wunderte ich mich. »Wer lehrt es, so etwas zu tun?« fragte ich mich.
»Die Natur«, gab ich mir immer, ganz allgemein, zur Antwort.
Für die Schafe und die nicht vom Menschen aufgezogenen Tiere stimmt das auch, wie ich jetzt begriff. Aber in der Beziehung zwischen dem Herrn und dem Knecht, dem Bauern und den Feldern, dem selbstständigen Hirten und der Herde, dem Leithund und seinen Untergebenen schienen mir nun plötzlich die Dinge anders zu liegen. Der Grund- und Viehbesitzer betreibt seine Landwirtschaft niemals ausschließlich im Sinne des Naturgesetzes, im Sinne eines Gleichgewichts von Leben und Fortpflanzung bei den verschiedenen Tier- und Pflanzengattungen. Sein Hauptanliegen ist es, den größten Nutzen aus seinem Eigentum zu erwirtschaften. Das Naturgesetz braucht keine Herren und Besitzer, um sich zu behaupten. Der Besitzer unterwirft seinem Egoismus nicht nur Wald, Flur und Vieh, sondern zuallererst seine eigenen Kinder, seine Frau und, wenn er sich welche leisten kann, seine Knechte.
Je mehr Ordnung ich in diese Überlegungen brachte, umso mehr schienen sie mir endlich jene Rechtfertigung zu liefern, nach der ich so angestrengt suchte, und der wilde Birnbaumzweig in meinem Innern stach nicht mehr gar so heftig. Zum ersten Mal wurde mir klar, dass der wie der Haushund aus einem Rudel hervorgegangene Mensch die Logik der Natur schließlich ebenso wie jener vergessen hatte, als er in den Besitz des Menschen übergegangen war. Solcherart sah ich alle mir bekannten Gesellschaftsordnungen (ob ländlich oder städtisch) aus der Auflösung der ursprünglichen Horden entstehen, in denen die Menschheit wohl einmal vor der Entstehung des Privateigentums in Harmonie gelebt hatte, das sie dann einer winzigen Minderheit unterordnete: den Besitzern. Diese aber ersetzten die Logik der Horde durch den Egoismus des Besitzes. Und was ich mir nach dieser Beantwortung meiner Gewissensfrage sagte, war befreiend und für mich eine wirkliche Hilfe.
Ich sagte mir nämlich: »Den Trog verlasse ich gerade deshalb, weil ich kein Hund bin. Ich konnte dort nicht mehr bleiben und meinen Vater, den Herrn, noch länger ertragen. Ich fühlte mich als Mensch und besaß außer meinem Instinkt noch andere Kampfmittel: den Willen, kein Knecht zu sein; die grimmige Absicht, in meinem Körper mein Ich heranwachsen zu lassen, das kein Fuß in einem allzu kleinen Schuh sein darf, der schmerzt, bis es irgendwann einmal neue und größere Schuhe geben wird. Nein! Der Mensch darf nicht Biologisches und Existenzielles erdulden, sondern muss tätiges Denken im Einklang mit der Natur sein, die ihn geformt hat. Jetzt will ich bewusst wachsen, will fühlen, wie ich wachse. Ich will endlich die Früchte meines Ichs kosten! Es war ganz richtig, dass ich mich aufgelehnt habe, und es macht auch nichts, dass ich jetzt allein bin. Aber wenn ich's mir recht überlege, meine ich doch, in dieser Auflehnung nicht ganz so allein zu sein. Schon jahrzehntelang vor mir haben sich Hirten und Bauern aufgelehnt. Sind nicht die Banditen von früher und die Emigranten auch Rebellen? Eigentlich befinde ich mich in einer großen Gesellschaft. Und schließlich gibt es ja nicht nur sardische, baskische, griechische und spanische Rebellen: Es gibt sie in aller Welt! Schon lange lehnen sie sich gegen die Unterdrückung auf und gehen dabei zwei verschiedene Wege.«
Der balente, der Bandit einerseits, der in der Gegend und bei seinen Leuten blieb, suchte das ehemalige, an eine uralte Lebensauffassung gebundene Gleichgewicht wiederherzustellen: gebunden nämlich an Tugend-, Anständigkeits- und überhaupt Wertbegriffe, die nur solange Bestand haben, wie die Möglichkeit eines echten Wettbewerbs zwischen den Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft besteht (er will eine ehrbare Herausforderung: als Knecht oder auch als Herr, falls er es jemals fertigbringt, ein solcher zu werden). Natürlich träumt der Bandit nicht von einer neuen Welt. Ihm würde es genügen, das harmonische Gleichgewicht der alten Werte wiederzufinden, wonach die Herren gute Herren sind und die Knechte geachtete Knechte sein können: Er begnügt sich mit der vagen Hoffnung, Herr zu werden, wie es ihm seine auf Herausforderung aufgebaute Lebensauffassung eingibt, innerhalb derer die Spielregeln zu beachten sind. Sonst ist er eben bereit, sein Leben in der Illegalität zu verbringen. Er weiß, dass er bei einem Feuergefecht von den Carabinieri, den Streitkräften, den Blaumützen erschossen werden kann. In den letzten hundert Jahren hatten die Banditen auf Sardinien mehr oder weniger diese Einstellung. Banditen wie Juanne Tolu aus Florinas, Cicciu Rosa aus Usine, Perra Juanne aus Bonorva; und in gewisser Weise auch Tandeddu aus Orgosolo.
Auf der anderen Seite gibt es den Emigranten, der nicht Bandit sein will. Was bringt es schon ein, wenn man in den Bergen wie ein Fuchs tötet? Mit Schläue allein kommt man gegen das Heer der Besitzer nicht an! In Australien, Amerika, Deutschland gibt es Herren, die besser sind als die sardischen. Die entlassen nicht einen Teil ihrer Knechte, um die restlichen noch mehr ausbeuten zu können. Um also nicht stets härteren Arbeitsbedingungen ausgesetzt zu sein, gehe ich lieber. Ich wechsle Land und Herren, gehe dorthin, wo die Herren viele Knechte brauchen und demnach auch bereit sind, sie besser zu behandeln.
So entscheidet sich der Emigrant für eine andere Form des Protests. Er nimmt eine Art von Flucht auf sich, die bezahlt und mehr geachtet ist; und alles in allem ist er einen Schritt weiter gekommen als der Bandit, der, obwohl er auf eigenem Boden rebellierte, ganz bestimmt ein Reaktionär war, weil er niemals andere Lebensmodelle angeboten hat als diejenigen, die er kennengelernt hatte. Gewiss, auch der Auswanderer ist kein echter Revolutionär, doch seine Aussichten sind weit besser. In ihm festigt sich die Hoffnung, als »reicher Mann« zurückzukehren im Vergleich zu denjenigen, die er in seinem Dorf zurückgelassen hat und die noch Knechte sind, weil sie nicht rebelliert haben. Sein Trachten geht dahin, sich ein eigenes Haus zu bauen, das er nie gehabt hat (um wenigstens unter seinem eigenen Dach zu sterben), und seine Ersparnisse so in seinem Heimatdorf anzulegen, wie es ihm seine jetzt relativ guten Verhältnisse erlauben. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass er seinen Kindern nun eine Ausbildung verschaffen, ihnen also die Möglichkeit bieten kann, nicht auswandern zu müssen. Bandit und Emigrant sind also zwei verschiedene Aspekte ein und derselben Rebellion der unterdrückten Sarden und bergen im Keim (vor allem die Emigration) die geschichtliche Antithese zur These der herrschenden Macht: zwei einander ergänzende Formen von Auflehnung gegen die Unterdrückung, wie sie sich in den unterentwickelten Ländern nach den verschiedenen Formen von kapitalistischer Ausbeutung zeigen. Nur dass diese beiden Wege keine Alternative zur ursprünglichen sozialen Misere darstellen. Es gibt leider noch keine Möglichkeit, das Bewusstsein, dass man ausgebeutet ist, in einer kollektiven Anstrengung zu wecken.
Immerhin bin ich stolz, mit diesem Zug zu fahren, der schon seit langem einen Großteil dieser Rebellen Sardiniens nach Olbia befördert, sie in das dort wartende Schiff hineinfährt, das sie seinerseits nach einer unbequemen und oft stürmischen Überfahrt im Hafen von Civitavecchia mit Zielrichtung in alle Welt auslädt.
Bald wird dieser Dampf-Esel auch mich in das Schiff, mitten in die Rebellion so vieler Sarden hineinbringen. Was für ein Teil von dieser ganzen Rebellion bin ich denn? Ich bin auch ein wenig balente, also wie die Banditen von einst, denn ich habe auch einen Herrn abgelehnt und mich für ein Leben außerhalb der Gemeinschaft entschieden. Natürlich bin ich ebenso ein Emigrant, denn ich habe schon fremde Herren gehabt und werde sie auch weiterhin haben, Herren, von denen ich ein angemesseneres Entgelt als von meinem Vater erhielt und vielleicht auch weiterhin erhalten werde. Aber meine Flucht ist eine andere als diejenige der Banditen und Emigranten. Sie ist nicht wie eine Feuerwaffe, die gegen die Vertreter von Recht und Ordnung eingesetzt wird, sondern wie eine Waffe im Kampf um eine auf den Menschen bezogene Gerechtigkeit: Wenn ich Sprache und Bildung erringe, wird mir das vielleicht erlauben, nicht minder gefährliche Gefechte zu bestehen. Im übrigen habe ich keinerlei Ehrgeiz, nach Siligo zurückzukehren, um mir dort Haus und Grund zu erwerben oder zu heiraten und meine Kinder wie Herrensöhne aufzuziehen! Freilich weiß ich nicht, was ich bin und was ich tun werde, doch ich fühle mich wie ein Stück Kork, das man ausgesondert hat, das die ganze Nacht auf einem unbekannten Meer getrieben ist und im Morgengrauen irgendwo strandet, wo vielleicht durch eine bessere Behandlung ein wertvolleres Stück Kork aus ihm wird, mit dem man Einlegearbeiten macht.
Wie ich auf dem Schiff so allein zwischen Soldaten, Hirten, Mönchen, Dienstmädchen und ein paar Touristen auf der Heimreise herumging, traf ich auf ein mir bekanntes altes Ehepaar, das ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Sie wollten nach Bussoleno, um ihre dorthin ausgewanderten Söhne zu besuchen.
»Sie arbeiten in einer Fabrik«, sagte Thiu Juànne, »das ist die übliche Geschichte. Wir Sarden müssen eben immer auswandern.
Ach, seit Jahrhunderten schaffen wir es auf unserer Insel einfach nicht, uns durchzusetzen und ein Verhältnis von Gleichberechtigung mit dem Festland und der ganzen Welt herzustellen.«
»Und wo fährst du hin?», fragte mich Thia Maria.
»Nach Salerno.«
»Was willst du dort?«
»Ich habe mit meinem Vater Streit gehabt. Seiner Meinung nach hätte ich bei der Armee bleiben oder mich wieder seinen Befehlen unterwerfen müssen. Er ist dagegen, dass ich studierte: ich soll auswandern, wie eure Söhne und die anderen alle.«
»Das ist es ja gerade, Grund für die Auswanderung sind das Elend und die Niederträchtigkeit der Herren und oft auch der Väter. Hör zu, Gavino. Thia Maria ist siebzig Jahre alt und hat viel mehr Erfahrung als du. Um meine Kinder wiederzusehen, wandere auch ich heute aus. Thia Maria versteht dich. Du hast recht, mit bösen Herren geht's immer so aus.
Da hat's mal im Dorf einen Richter gegeben. Er hieß Don Barore, und er hat das Richteramt in Macomer, in Oristano undsoweiter ausgeübt. Dabei hat er alles mögliche getrieben, zu Pferd und zu Fuß: ein ganzes langes Leben wäre nötig, um alles zu erzählen. Stell dir vor, da hatte doch der Don Piras, sein Freund und Mandant, in der Nähe Schafe gestohlen und sie wie immer, bevor er sie zum Schlachthof bringen konnte, auf seine Knechte in den verschiedenen Pferchen verteilt, wo aus Angst und Respekt kein Mensch jemals kontrolliert hat. Die Eigentümer der Schafe hatten aber den Diebstahl bei den barracelli, den Flurwächtern, gemeldet; die hatten nämlich das Recht, ihre Schritte überall hinzulenken. Die Zeit verging, und es kamen keine Käufer. Aber seine Knechte haben das Vieh gemolken, und da gab's viel Milch. Die Flurwächter, die immer dort vorbeikamen, hatten vielleicht etwas vermutet, jedenfalls entdecken sie die Sache und zeigen Don Piras an. Er, dem das gleich gemeldet wird, verliert keine Zeit, lässt sich sein Pferd satteln und reitet in aller Eile zu Don Barore, um seinen guten Ruf zu wahren, wie er das ja immer gemacht hat.
›Don Baro, Don Baro! Ich bin wieder in der Klemme.‹
›Ach was, keine Angst, das werden wir schon einrenken. Also, nur keine Sorgen, Gevatter, die Sorgen verschaffen wir jemand anderem. Schließlich bestimmen wir ja, wer schuldig ist, und einen Schuldigen finden wir schon irgendwie. Nein, es gibt überhaupt keinen Grund zur Aufregung. Ihr wisst doch noch, als … hm. Und wie wir das gedreht haben! Die Anzeige gegen Euch ist schon hier. Ich habe mir gerade überlegt, wie wir das in Ordnung bringen …‹
›Wie denn?‹
›Wie denn? Wie immer, natürlich! Gibt's denn nicht auch unter Euern Knechten den üblichen Trottel?‹
›Doch.‹
›Und die üblichen Schlaumeier?‹
›Doch, die gibt's auch.‹
›Dann ist doch schon alles geregelt! Dem Trottel geben wir die Schuld, und die Schlaumeier müssen's bezeugen.‹
Es gibt einen Prozess. Der Trottel wird rechtskräftig verurteilt und kommt ins Gefängnis. Unser Freund, der Don, wird freigesprochen und bekommt sogar noch eine Entschuldigung der Flurwächter. Und Don Piras wird so selbstbewusst, dass er nicht nur den dreckigen Schlaumeiern das Geld nicht zahlt, das er ihnen für die falsche Beschuldigung des Trottels versprochen hat; er verschiebt das nicht nur von einem Tag auf den anderen, sondern heuert sogar durchziehende Viehdiebe dafür an, dass sie sie verprügeln, sodass sie dann wie herrenlose Hunde davongegangen sind und ihre Dienste einem anderen Herrn für einen Bauch voll Kleiebrot angeboten haben. Auf so eine Art hat sich also der Don Barore bereichert und ist einer der wohlhabendsten Männer im Dorf geworden. Ländereien und Ländereien, Täler, Berge, Flachland, Olivenhaine, Gärten wo auch immer. Als gehörte alles nur ihm! Hätte ihn doch die Justiz erwischt! Ja, da hätte die Justiz mit der Justiz abrechnen müssen. Und weißt du, um seinen Grund und Boden zu vermehren, hat er sich mit Druck und Versprechungen, mit Erpressungen und Drohungen Land verpachten und dann verkaufen lassen … Und wenn ich dir noch erzähle, wie er seine Knechte behandelt hat, dann sträubt sich dir das Fell. Wie Tiere hat er sie arbeiten lassen, aber versorgt hat er sie nicht, wie er schließlich hätte tun müssen und können: sie waren gezwungen zu stehlen, um satt zu werden.
Was also Don Barore im Dorf bedeutete, das wussten die Menschen. Und um sich an seinem Besitz zu erfreuen, musste er ja ins Dorf zurück, also nach Siligo. Aber der Weg war lang und voller Feinde (Banditen, befreundet mit denen, die er ins Gefängnis gebracht hatte); und so hat er Angst, man konnte ihn unterwegs umbringen. Doch ein paar Freunde, die gerade bei ihm sind, sagen ihm, wie er ungeschoren zurück zu seinem Besitz kommen kann.
›Don Baro', Don Baro'! Draußen steht schon ein Ochsenkarren: mit einem Fass …‹
›Ich, und in ein Fass? Ich, der Richter? Das ist doch …‹
›Die einzige Möglichkeit. Übers Fass tun wir dann Stroh, Heu und alles mögliche andere. Und genug Platz haben Sie da auch.‹
›Machen Sie's, Don Baro'! Es ist schon spät. Was zweifeln Sie denn noch? Wir sind doch alle daran interessiert, dass Ihnen kein Haar gekrümmt wird. Und in Siligo können Sie uns immer helfen, auf Ihr Wort wird man immer hören.‹
›Wir wissen ja, dass es eine Demütigung für einen Richter, für eine Persönlichkeit wie Sie ist, auf so eine Art in sein Heimatdorf zurückzukehren, Don Baro'. Aber sterben wollen Sie doch auch nicht, oder?‹
›Nein, nein!‹
›Dann steigen Sie ein, steigen Sie nur ein!‹
Don Barore blickt um sich und muss sich überzeugen, dass es für ihn keine andere Möglichkeit als dieses Faß gibt. Seine Freunde deuten mit dem Finger darauf, und er kriecht hinein. Die Freunde fahren los, und der Karren sieht genauso aus wie einer von denen, die Garben in die Tennen oder auch Heu in die Pferche bringen. So geht's also dahin, und schließlich erreichen sie auch das Dorf.
Die Alten haben ihn gefürchtet, und die jungen Leute und die Kinder haben ihn nur stumm gehaßt. Einmal hat sich folgendes begeben. Ein paar Jungen gehen nach Bisonza Bassa, um sich wie gewohnt dort Holz zu holen. Sie gehen alle ans Werk, graben Zistrosen, Mastix und so weiter aus. Sie binden sich ihre Bündel mit Ruten zusammen und machen sich wieder auf den Heimweg und unterhalten sich unterwegs. Bei der Funtana Altu werfen sie ihre Bündel ab und trinken. Wie immer ruhen sie sich dort aus. Sie verbringen die Zeit mit Spielen und mit Wettkämpfen, aber dann müssen sie schon bald an Don Barore denken. Und einer meint: ›Verwünschen wir den Don Baroro Und alle gemeinsam: Verwünschen wir den Don Barore, ja verwünschen wir ihn! Er hat so viele Unschuldige verurteilt.‹
Sie stürzen sich auf die Pfütze und den Schlamm dort bei der Quelle und formen eine liegende Puppe. Dann reißen sie vom Weißdorn und den anderen Dornenbüschen die größten Dornen ab. Sie haben die Hände voller Dornen, und jeder schändet Don Barores Abbild auf eine Art, wie sie es in Wirklichkeit mit ihren Händen nie hätten tun können. Sie machen Kreuze und auch andere Zeichen über ihn, die ihnen als magisch bekannt sind, stellen sich im Kreis um diesen Don Barore aus Schlamm herum und sagen:
›Den stoß' ich Don Barore ins Auge.‹
›Den stoß' ich Don Barore in den Bauch.‹
›Den stoß' ich Don Barore ins Ohr.‹
›Den stoß' ich Don Barore in den Fuß.‹
›Den stoß' ich Don Barore in den Hals.‹
Und der eine dies und der andere das, und so haben sie ihn verhext! Aber was geschieht jetzt? Noch bevor die Jungen nach Hause kommen, wird dem Don Barore übel. Ja, wirklich ganz übel wird ihm! Und im Dorf helle Aufregung:
›Dem Don Barore geht's schlecht.›
›Don Barore kommt nicht über den Winter.‹
›Don Barore ist krank.‹
›Don Barore stirbt.‹
Ihm geht's wirklich schlecht. Was ihm eigentlich fehlt, weiß keiner: er selbst noch weniger als die anderen.
Sie geben ihm die bekannten Mittel gegen Zauberei, aber sie helfen nicht: das Mittel gegen den bösen Blick, die verschiedenen Aufgüsse; sein Bett ist voller Amulette. Die Hexen geben ihr Urteil: ›Hexerei‹.
Dagegen hilft nichts. Weder die Alten noch die Pfarrer können etwas dagegen tun. Aber was passiert ein paar Tage später? Es passiert, dass Peppe Sanna, einer der Jungen, die ihn besprochen haben, einer ist, die sich nachts ›mitteilen‹, die also im Schlaf reden. Und da hört ihn seine Mutter:
›Den stoß' ich Don Barore ins Auge.‹
›Den stoß' ich Don Barore in den Bauch.‹
Der armen Frau laufen Schauer über den Rücken. Sie hat Angst, dass die Sache herauskommen könnte. Ach, der Don Barore kann sie ja auch als Kranker ruinieren und Schlimmeres noch! Da ist es schon besser, sie spricht selber davon. Also vertraut sie sich den Gevatterinnen und Freundinnen an (deren Männer alle Don Barores Pächter waren, dessen Tod ihnen natürlich durch die Erbfolge andere Landbesitzer beschert hätte), und man beschließt, im Dorf zu verbreiten: ›Jungen haben den Zauber über Don Barore gesprochen, sie haben's in Funtanaltu gemacht…‹
Die Geschichte spricht sich herum. Peppe Sanna hat im Schlaf auch genau gesagt, wo sie die Puppe versteckt haben. Und das ganze Dorf ist in Aufruhr wie ein Wespenschwarm:
›Gehen wir hin!‹
›Suchen wir den Don Barore.‹
›Jesus Maria, ich will doch mein Weideland nicht verHeren! Mit den Erben bin ich zerstritten, und wenn er stirbt, nehmen sie's mir sofort weg. Solang er am Leben ist …‹
›Gehen wir! Gehen wir! Mein Weideland ist in Gefahr, meine Herde …‹
Das ganze Dorf steigt also hinauf zur Quelle, um den Don Barore aus Lehm zu suchen. So haben sie bestimmt nicht einmal Jesus Christus gesucht. Das ganze Gestrüpp ist in Bewegung: Man schüttelt es, biegt es in die Höhe, kriecht hinein. Bis man ihn schließlich unter einem großen Brombeerbusch findet. Einer ruft:
›Da ist er! Ganz von Dornen durchbohrt!‹
Die Ruhe kehrt wieder ein. Ihr Herz ist ihnen aus den Hosen wieder in den Leib gefahren: Sie sind gerettet!
›Seid vorsichtig! Zieht einen nach dem anderen raus. Sonst bricht die Puppe auseinander, und er stirbt.‹
Sie nehmen also die Puppe und ziehen einen Dorn nach dem anderen aus ihr heraus, und während sie das tun, lassen Don Barores Schmerzen nach. Don Barore wird wieder gesund. Dass ihn der Judas hänge!‹«
»Als ob der nicht den Tod verdient hätte!« meinteThiu Juanne.
»Ach ja, böse Herren wie den gibt's jetzt immer mehr. Auch aus dem Grund sind unsere Söhne ausgewandert, sind fort: sie wurden zu sehr ausgebeutet, und ihr Lohn hat ihnen nicht gereicht«, sagte Thia Maria.
»Wären sie wenigstens alle so gewesen, wie Thiu Pedru Tolu, dann wären die Leute immer noch auf dem Land bei den Tieren.«
»Wieso, was war denn mit diesem Thiu Tolu?« fragte ich neugierig- »Der war auch ein selbstständiger Hirt. Mit viel Weideland, Schafen, Kühen, Knechten und Häusern im Dorf. Und ganz allein hat der sich hochgebracht! Angefangen hat er nur mit der Erbschaft seines Vaters: ein Weidegrund und vielleicht hundert Schafe.
Aber fleißig ist er gewesen und schnell wie Schießpulver. Der hat keine Zeit verschwendet. Natürlich, seinen Spaß hat er sich auch gegönnt, aber wann und wie lange hat er immer gewusst. Sein Leben bestand eigentlich immer nur aus Trappeln von Schafshufen und Blöken von Schafen, und ihre prallen Euter haben es ihm schön gemacht.
Geheiratet hat er nie. Er wollte nicht heiraten. Er sagte immer: ›Ich will keine Münder zum Sattmachen. Warum soll ich mir selbst und den anderen gegenüber heucheln? Eine Frau im Haus ist oft nur eine bessere Magd und sonst nichts.‹ Auch eine Ansicht. Es ging ihm also gut, doch er hat sich geweigert, das Leben als eine mathematische Abwicklung von Riten aufzufassen: Geburt, Heirat, Tod. Aber seinen Knechten gegenüber hat er sich doch wie ein Vater benommen und hat es selber kaum gemerkt, fast als hätten ihn die Lebensumstände ganz unwillkürlich dazu gebracht. Seine Knechte hatten es damals viel besser als alle anderen im Dorf, die sie darum beneideten. Alle haben sie sich darum gerissen, in seine Dienste zu treten. Er hatte es schon auf zehn gebracht, und die liebten ihn wirklich wie einen Vater, weil er sie nicht unterdrückte und bestrafte wie ein Thiu Elia und die anderen Herren. Er hat sich anders verhalten, und bei ihm war ein Knecht nicht solchen Demütigungen ausgesetzt. In ihren freien Stunden hat er ihnen sogar immer wieder von den Methoden und Straf maßnahmen jener Herren erzählt, die er verachtete.
Er setzte sich mit dem Bauch vors Feuer, ringsum seine ›Söhne‹; rauchte seinen Toscano wie die Alten mit der Glut im Mund und schimpfte über diese Leute, wobei er fast immer seine eigenen Erziehungsmethoden herausstrich, fast als wollte er auf diplomatische Weise zu verstehen geben, dass er zwar auch ein Landbesitzer, aber ein guter, war.
Und so hat er sich benommen: unter seinen Knechten war einer, der hieß Sistu. Thiu Pedru betrieb nämlich auch Landwirtschaft, und so hat er den Sistu tagsüber auch dafür eingesetzt. Die Schafe ließ er in einem gut umzäunten Pferch. Und nach seiner Tagesarbeit als Landwirt kam Sistu in der Dämmerung zu seinen Schafen zurück, die ja nicht seine eigenen waren. Sie mussten gemolken und auf die Weide gelassen werden. Oft aber schaffte er es nicht mehr und schlief schon in den Hohlwegen ein. Nach dem Melken, wenn er die Schafe zu dieser zusätzlichen Mahlzeit brachte, warf ihn die Müdigkeit fast immer um, und so lag er wie eine Erdscholle auf dem Boden. Eines Sommerabends ist doch Sistu wie üblich in s'istula, auf dem Dürrgras, eingeschlafen, aber Thiu Pedru, dieser Hurensohn, ist auf der Hut. Sowie er auf der Tenne seinen ersten guten Schlaf hinter sich gebracht hat, besteigt er schon lange vor Morgengrauen sein Pferd und findet Sistu ausgestreckt auf dem Boden liegen: wie tot auf dem Dürrgras; neben ihm liegt die stumme Herde, satt und wiederkäuend, was sie nachts gefressen hat. Was macht nun Thiu Pedru? Er tritt ihn nicht in die Seiten, in die Lenden oder vor die Brust, wie das andere zu tun pflegten, wusste er doch, dass dies gar keine Wirkung haben würde. Und warum auch unmenschlich sein? Er rennt zu einem Flechten mit Dürrgras in der Nähe, reißt eine Menge aus, legt es wie einen Kranz um Sistu herum, von Kopf bis Fuß, und steckt es an. Thiu Pedru geht aber beileibe nicht weg, sondern genießt das Schauspiel von irgendeinem Versteck aus und hat auch schon einen dichtbelaubten Mastixzweig in der Hand, damit er das Feuer ausschlagen kann, falls es auf sein Dürrgras übergreifen würde, weil es ja so war, als würde er es selber hungrig mit den Mäulern seiner Schafe fressen und mit ihren Ärschen wieder ausscheißen müssen. Das Dürrgras knistert und leuchtet auf; Sistu aber schläft immer noch unter dem Gebirge seiner Müdigkeit. Das Feuer erhellt ihn, dringt aber nicht unter seine Lider, die der Schlaf versiegelt hat. Das Dürrgras brennt, redet mit seinen Feuerzungen in der windstillen Dunkelheit, als wollte es ihn auf den vorgeschriebenen Weg aufmerksam machen, dem es ja unweigerlich folgen musste. Es sind so viele Zungen, die eine nach der anderen entstehen, immer wieder neue, doch alle mit demselben Ziel:
Tricktrack, tricktrack.
Ta! Tata! Trickitracka.
Tratrickitra.
Puffpaffpoff.
Sistu aber schläft immer noch auf seinem Bett aus Dürrgras, das, auch schon zutiefst erschrocken, drauf und dran ist, mit seinen Schuhen, seiner Hose, seiner zerlumpten Jacke ein und dieselbe Sprache zu reden. Die Flammen rücken vor. Die Zungen multiplizieren sich mehr, als sie das selber wollen, und reden immer wieder, während sie vordringen, nehmen mitleidigen Anteil an dieser Szene, deren unfreiwillige Protagonisten sie sein könnten.
Jeder Halm teilt sich in mehrere Zungen, wie um zu sagen: ›Sistu! Sistu! Wach auf!‹ Das Band Trockengras hat sich schon beinahe verbraucht, die Zungen lecken an Sistus Füßen, an den Stiefeln, an der Hose, flackern umher. Zum Glück schlägt er jetzt um sich, schiebt sich in seiner instinktiven Angst wie eine Schlange vorwärts, hustet in dem Rauch und stöhnt: oh! oooh!
Noch ehe der magische Augenblick herum ist, stürzt sich Thiu Pedru auf ihn. Er geht mit einer sedina, einem dicken Strick aus Rosshaar, auf ihn los, doch er schlägt ihn nicht.
›So lässt du dich also auch zum Narren halten, Kerl! Auch noch anzünden lässt du dich! Wäre ich nicht gekommen, wärst du verbrannt, du Vieh! Und ich hab' mich auf dich verlassen!‹
Thiu Pedru war für seine Knechte eigentlich wie ein Medizinmann, obwohl er gar nicht Medizin studiert hatte und nahezu ein Analphabet war. Seine Durchtriebenheit, seine bissigen Worte, sein spöttisches Lachen über die Ignoranz von damals waren der wirksamste Zauber, den man auf einen Menschen ausüben konnte. Das wusste er und hat es ausgenutzt. Und ab und zu, wenn er's für notwendig hielt, machte er mit seinen Knechten eine Zauberei: sagte ihnen sos reppossorios, Orakelsprüche. Er hatte ein Gedächtnis, das sich wie ein Schwamm vollsaugte, war in seinen Anweisungen unfehlbar, hatte ein würdevolles, stolzes und gebieterisches Aussehen.
›Anto', morgen gehst du zum Kanal von Bestía und fängst an, die Binsen zu schneiden. Wir müssen das Hüttendach für den Winter neu decken. Drei Jahre haben wir jetzt nichts mehr daran getan, und den First haben Wind und Wetter, Wasser und alle Teufel schon ziemlich strapaziert. Jua', du gehst morgen, wenn du die Schafe gut getränkt hast, auf den Berg und holst ein großes Bündel Steinlinde. Wir brauchen Besen für den Drusch der Puffbohnen. Baízu, du gehst nach Pubúlos und holst noch vor der Mittagshitze so viele Binsen, wie du nur kannst; und in der Hitze, wenn die Grillen zirpen, gehst du in den Schatten und köpfst sie und ›melkst‹ sie (machst sie weich und biegsam), wie ich es dir beigebracht habe. Wenn es genug sind, bringst du sie her und hängst sie auf den Laden vor die Hütte. Und du, Sistu, bleibst auf alle Fälle hier: Du passt auf. Du behältst die Hütte im Auge und bündelst Reisig von den Eichen, die wir für den Winter geschlagen haben. Ich muss morgen nach Sassari: Ich habe dort zu tun. Und dass mir jeder von euch seinen Auftrag gut ausführt.‹
Thiu Pedru war noch durchtriebener als Hannibal, und sagte er den Knechten seine Orakelsprüche, gab er ihnen zu verstehen, dass er tagsüber weit weg vom Weideland sein würde. Aber er tat nur so, als würde er mit seinem schnellsten Pferd wegreiten; er versteckte sich in den Senken seines Landes, hatte den Quersack mit dem Proviant für den ganzen Tag prall gefüllt und beobachtete wie ein Adler. Und nicht, wie er vorgab, vom Himmel, sondern vom Rücken seines Pferdes verfolgte er die Wege seiner Knechte, um eine leichtsinnige Beute zu erspähen. So kreiste er den ganzen Tag sozusagen in den Lüften, kam aber nie im Sturzflug herunter, um seine Knechte mit Schnabel oder Krallen zu greifen. Er schrieb sich alles in sein Gedächtnis, in seinen Kopf (der mehr aufnehmen konnte als irgendjemand wusste). Noch am selben Abend oder auch tags darauf nach dem Mittagessen oder nach dem Abendessen (die immer gut waren: Er war einer der wenigen Herren im Nurraggine, der mit seinen Knechten gemeinsam und dasselbe aß, ob's nun Feiertag war oder nicht) erhob er sich dann in der Hütte und meinte:
›Heute sage ich euch das Orakel: Ich will wissen, ob gestern jeder seine Pflicht getan hat. Sitzengeblieben! Jeder auf seinem Hocker!‹
Er nahm eine angemessene Haltung ein und sah aus wie ein Zauberer im Zirkus. Alles schwieg, und es trat eine geheimnisvolle Stimmung ein. Er nahm seine Mütze ab und machte ein paar Zeichen. Gab unverständliche Laute von sich. Steckte die Hand in seine geöffnete grobe schwarze Wollmütze. Und er sprach Worte, die er von seiner Handfläche ablas, sobald die Hand aus der Mütze auftauchte.
›Anto', du bist gestern nicht gleich nach Bestía gegangen, wie ich dir aufgetragen hatte! Du bist bei Pittanu gewesen, über eine Stunde lang, hast ass'istrumpa mit ihm gespielt und sogar gewonnen. Und leugne es ja nicht ab, sonst sag' ich dir was anderes … Nachher bist du in den Kanal gestiegen und hast zwanzig Bündel Binsen geschnitten, wo du doch gute fünfundzwanzig hättest schneiden können.‹
Er steckte wieder seine Rechte in die Mütze, und wieder kam ein Wahrspruch.