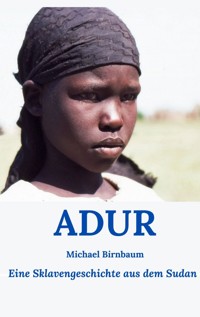Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein bitterer Duft von Kaffee und Korruption zieht durch Afrika: Der deutsche Journalist Michael Baumann deckt ein gefährliches Netzwerk aus Geldwäsche und Korruption auf. Was als Marktliberalisierung der Weltbank begann, entpuppt sich als perfides Spiel der kolumbianischen Kokain-Mafia, das von Afrika bis Deutschland reicht. Baumann und der Weltbank-Mitarbeiter Jens Stratmann folgen den Spuren schmutzigen Geldes von den Kaffeeplantagen im Ostkongo bis zu der Kaffeebörse in London. Dabei gerät Baumann tief in die Machenschaften eines skrupellosen belgischen Geschäftsmanns, gedeckt von einer Londoner Anwaltskanzlei. Zwischen Intrigen, Verrat und lebensgefährlichen Verstrickungen beginnt die Jagd. Ein explosiver Thriller über Macht, Gier und den wahren Preis unseres Kaffees.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Über dieses Buch
Der umgekehrte Strom
Verdacht in Bujumbura
Umweg über London
Illegale Pfade
Die Spur der Geldwäsche
Die Schatten des Handels
Verstrickungen
Duft der Weltpolitik
Ein Netz aus List und Lügen
Ungeplanter Showdown
ÜBER DIESES BUCH
Ein bitterer Duft von Kaffee und Korruption zieht durch Afrika: Der deutsche Journalist Michael Baumann deckt ein gefährliches Netzwerk aus Geldwäsche und Korruption auf. Was als Marktliberalisierung der Weltbank begann, entpuppt sich als perfides Spiel der kolumbianischen Kokain-Mafia, das von Afrika bis Deutschland reicht. Baumann und der Weltbank-Mitarbeiter Jens Stratmann folgen den Spuren schmutzigen Geldes von den Kaffeeplantagen im Ostkongo bis zu der Kaffeebörse in London. Dabei gerät Baumann tief in die Machenschaften eines skrupellosen belgischen Geschäftsmanns, gedeckt von einer Londoner Anwaltskanzlei.
Zwischen Intrigen, Verrat und lebensgefährlichen Verstrickungen beginnt die Jagd. Ein explosiver Thriller über Macht, Gier und den wahren Preis unseres Kaffees.
Dies ist der Band 3 der Baumann-Reihe
Michael Birnbaum war jahrelang Afrika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Seine Erlebnisse und Erfahrungen in dieser Zeit inspirierten ihn zu seinen Afrikaromanen der Baumann-Reihe – von denen er immer behaupten wird, sie seien ganz und gar erfunden.
COPYRIGHT
Alle Menschen sind gleich
Für meine Frau und meine drei Töchter
Impressum
Texte: © 2025 Copyright by Michael Birnbaum
Umschlag:© 2025 Copyright by Michael Birnbaum
Verantwortlich
für den Inhalt:Michael Birnbaum
Höslstr.10
81927 München
PROLOG
Moses erhob sich von der dünnen Matte. Sie diente ihm und seiner Frau Grace seit Jahren als Bett. Die kühle Morgenluft drang durch die Ritzen der Wände, die aus groben Lehmziegeln und alten Holzplanken zusammengefügt waren.
Die ersten Strahlen der Morgensonne drangen durch die dichten Wolken über den Ruwenzori-Bergen und tauchten die Landschaft in ein sanftes, goldenes Licht. Der Nebel zog sich nur widerwillig von den Hügeln zurück. Das war die Jahreszeit, in der das undurchdringliche Weiß die Welt in ein sanftes Schweigen hüllte, bis der Tag langsam erwachte.
In der Ferne krähte ein Hahn. Das Echo verhallte zwischen den Hängen, auf denen sich das satte Grün der Kaffeeplantagen wie ein Teppich ausbreitete.
Fort Portal, die kleine Stadt, in der Moses Mugisha und Grace Namara ihr Zuhause hatten, lag unter der schützenden Hand des mächtigen Mount Ruwenzori. In dieser Region Ugandas war das Leben für viele einfach und beständig.
Für Moses aber hatte es sich in den vergangenen Monaten grundlegend verändert. Denn er hatte erfahren, dass man jenseits der Grenze, drüben im Kongo, fast zwei US-Dollar mehr pro Sack Rohkaffee zahlte. Seitdem waren seine Besuche dort häufiger geworden. Er wusste nicht, warum die Preise dort so viel höher waren.
Das war ihm auch egal. Was zählte, war das zusätzliche Geld, das er mit jedem Trip verdiente – Geld, das seine vier Kinder zur Schule schickte und ihnen eine Zukunft ermöglichte, die er selbst nie gehabt hatte.
Moses Mugisha war ein Mann in seinen späten Vierzigern. Er trug die Spuren eines harten Lebens in seinem von der Sonne gegerbten Gesicht. Dass Moses von schwerer Arbeit lebte, verrieten auch die schmale, muskulöse Statur und die Schwielen an seinen kräftigen Händen. Die dunklen Augen lagen tief in seinem Gesicht.
Die Hütte, in der er lebte, war bescheiden, kaum mehr als eine einfache Behausung, die dem Wetter und dem Wind gerade so standhielt. Das Dach war aus Wellblech, auf dem der Regen in lautem Trommeln niederprasselte, wenn die Stürme über das Land zogen.
Innen gab es zwei kleine Räume: einen zum Schlafen und einen, der als Wohn- und Kochbereich diente. Das Mobiliar war spärlich – ein paar einfache Holzstühle, ein Tisch, der schon bessere Tage gesehen hatte, und ein paar Regale, auf denen sich Geschirr aus Ton und Metall stapelte.
In einer Ecke hing ein kleines Kruzifix, das sie vor Jahren von einem reisenden Prediger geschenkt bekommen hatten.
Moses zog sich die geflickten Hosen und das ausgeblichene Hemd an, das er gestern Abend zum Trocknen aufgehängt hatte. Es roch noch nach dem Rauch des Kochfeuers, das Grace immer mit Bedacht schürte, um das wenige Brennholz zu sparen, das sie sammeln konnten.
Er hörte, wie sie sich in der kleinen Kochstelle bewegte. Die lag hinter der Hütte, geschützt unter einem aus Palmblättern geflochtenen Dach. Der Geruch von frisch gebackenen Fladenbroten und reifen Bananen erfüllte die Luft, und Moses’ Magen knurrte vor Erwartung.
Die Hütte lag am Rande einer Lichtung, umgeben von den Kaffeebäumen, die Moses mit viel Liebe und harter Arbeit über die Jahre gepflegt hatte. Die Pflanzen waren sein Leben, das Land, auf dem sie wuchsen, war alles, was er besaß.
Zusammen mit Grace hatte er jedes Stück Erde umgegraben, die Setzlinge gepflanzt und die ersten Jahre mit Bangen den Ertrag abgewartet. Die Bäume waren ihr Vermächtnis, die Wurzeln, die sie in dieser rauen, doch wunderschönen Gegend geschlagen hatten.
Moses trat hinaus in den Morgen. Die dünnen Riemen seiner abgenutzten Sandalen knirschten bei jedem Schritt. Grace kam zu ihm. Sie reichte ihm den kleinen Stoffbeutel, den sie mit frischen Fladenbroten gefüllt hatte. Sie lächelte schwach, als ihre Blicke sich trafen.
In ihrer einfachen Kleidung – einem farblosen Baumwollkleid und einem Tuch um den Kopf – sah sie müde, aber zufrieden aus. Die Jahre auf dem Land hatten auch bei ihr Spuren hinterlassen, in den Falten ihres Gesichts, aber auch in der Ruhe und Beständigkeit, die sie ausstrahlte.
»Hier, Moses. Ich habe dir auch ein paar Bananen eingepackt. Sie werden dir auf dem Weg guttun«, flüsterte sie, um die Kinder nicht zu wecken. »Und sei vorsichtig. Die Zeiten sind unsicher geworden.«
Moses nickte. Er nahm den Beutel und warf einen schnellen Blick auf die beiden Esel, die unweit der Hütte standen. Die Tiere schnaubten leise und traten ungeduldig von einem Bein auf das andere. Auf ihren Rücken lagen die schweren Säcke mit Rohkaffee, sorgfältig verschnürt und bereit für den langen Weg. Er trat zu den Eseln und überprüfte die Ladung, bevor er die Zügel in die Hand nahm.
»Ich werde vorsichtig sein, Grace«, versprach er und versuchte sie zu beruhigen. »Es sind nur zwei Tage. Ich kenne den Weg.« Er sah ihr in die Augen, die voller Sorge waren, und küsste sie auf die Stirn. »Pass du auf die Kinder auf, und sorge dafür, dass sie in die Schule gehen.«
Die Schule, die einige Kilometer entfernt im nächsten Dorf lag, war ein Segen. Aber auch eine Last. Denn das Schulgeld war hoch, und jede Reise wie diese bedeutete, dass Moses etwas mehr verdienen konnte, um die Ausbildung der Kinder zu sichern. Ihre vier Kinder – zwei Jungen und zwei Mädchen – waren das größte Geschenk, das ihnen das Leben gemacht hatte.
»Ich werde auf sie achten«, erwiderte Grace und streichelte seine Wange. Ihre Finger fühlten sich rau an, die Haut trocken und spröd von der harten Arbeit auf dem Feld und in der Hütte. »Aber Moses, höre nicht auf die Geschichten, die man erzählt. Die Leute reden viel. Wir sollten uns nur auf das Wesentliche konzentrieren.«
»Und das ist, dass ich bald zurückkomme«, ergänzte Moses und versuchte zu lächeln. Er wusste, dass sie recht hatte. Dennoch spürte er eine gewisse Unruhe, die er nicht abschütteln konnte. Wie immer verdrängte er diese Gefühle. Er konnte es sich nicht leisten, ängstlich zu sein.
Mit einem letzten Blick auf sein kleines Zuhause, das sie sich aufgebaut hatten, lenkte Moses die Esel auf den schmalen Pfad, der von der Hütte weg hinunter ins Tal führte. Der Pfad schlängelte sich durch die Felder, die noch feucht vom Tau waren, bevor er in die Hauptstraße mündete. Die führte weiter nach Westen zur Grenze.
Der Weg war ihm vertraut. Er kannte jeden Stein, jede Biegung und jede Mulde. Der Himmel war klar, die Luft frisch, und Moses folgte den Eseln Schritt für Schritt. In der Ferne begann die Sonne langsam, sich über den Horizont zu schieben. Ihre Strahlen durchdrangen den Nebel und tauchten die Landschaft in goldenes Licht.
Moses wusste, dass er vor dem Einbruch der Dunkelheit die Grenze erreichen musste. Die Nacht gehörte den Unbekannten, den Unsichtbaren, die sich im Schutz der Dunkelheit bewegten.
Der Tag schritt voran. Als Moses die Grenze erreichte, stand die Sonne bereits tief. Der schmale Fluss, der Uganda vom Kongo trennte, glitzerte im letzten Licht des Tages. Die Überquerung war riskant, aber Moses hatte es schon oft getan wie all die anderen Schmuggler.
Moses band seine Esel an einen Baum, packte den Proviant aus und setzte sich auf einen Felsen, um zu essen. Die Nacht schlich sich langsam heran, nur das Rascheln der Blätter und das gelegentliche Schnauben der Esel waren zu hören.
Die Fladenbrote schmeckten nach Heimat, nach den Händen von Grace, die sie mit Sorgfalt zubereitet hatte. Er beschloss, nicht länger als nötig hier zu verbringen. Ein leises Flüstern im Wind, ein entferntes Geräusch, das er nicht zuordnen konnte, ließen ihn frösteln.
Er richtete sich auf und machte sich bereit für die letzte Etappe der Reise, die ihn endgültig in den Kongo führen würde. Der Gedanke an das zusätzliche Geld, das er für den Kaffee bekommen würde, trieb ihn an, die Esel erneut zu beladen und weiterzuziehen.
Moses spürte die Kälte, die vom Fluss aufstieg, und zog seine dünne Jacke fester um sich. Die Esel trotteten geduldig voran, ihre Schritte auf dem steinigen Pfad machten ein leises Geräusch, das im Nichts zu verhallen schien.
Es war ein fast unmerkliches Rascheln im Gebüsch, das Moses innehalten ließ. Er blieb stehen, nahm die Tiere fest in die Hand und lauschte in die Dunkelheit. Die Esel spitzten die Ohren, rissen ihre Augen weit auf. Für einen Moment dachte Moses daran, umzukehren, bevor es zu spät war. Aber der Gedanke an das Schulgeld und die Zukunft seiner Kinder, trieben ihn an.
Er griff nach den Zügeln der Esel und setzte seinen Weg fort. Kein Vogelruf, kein Rascheln in den Bäumen, nur die schweren Schritte der Esel und das gleichmäßige Klicken ihrer Hufeisen auf den Steinen.
Der umgekehrte Strom
EIN UNGEWÖHNLICHES GESPRÄCH
Die Sitzung des Schulvorstandes der Deutschen Schule in Nairobi zog sich hin. Michael Baumann lehnte sich in seinem unbequemen Holzstuhl zurück, nahm die Brille ab und rieb sich die Schläfen. Als Vater dreier Kinder war er mehr oder minder zwangsverpflichtet worden, sich bei der Vorstandswahl aufstellen zu lassen. Und er war gewählt worden.
Die Themen schienen an diesem Abend endlos, von Budgetfragen bis zu neuen Sicherheitsvorkehrungen. Heinrich Petersen, der Kaffeehändler, der neben ihm saß, nickte zustimmend, als der Vorstandsvorsitzende, der Stationschef der Lufthansa, sprach. Aber Michael merkte, dass auch Heinrich mit seinen Gedanken woanders war.
Endlich wurde die Sitzung vom Schuldirektor beendet. Die Vorstandsmitglieder erhoben sich langsam von ihren Stühlen. Heinrich beugte sich zu Michael herüber.
»Lust auf einen Drink?«, fragte er mit einem verschwörerischen Lächeln. »Ich habe da etwas, das du sehen musst.«
Michael nickte. »Klingt gut. Was hast du vor?«
»Ich habe einen alten Jaguar E-Typ fast fertig restauriert. Du musst ihn dir anschauen.«
Die Fahrt zu Heinrichs Haus in Muthaiga, dem Beverly Hills von Nairobi, war kurz.
Als sie ankamen, führte Heinrich ihn direkt in die Garage. Die massive Holztür schwang auf und gab den Blick frei auf den makellos rot glänzenden Jaguar.
»Beeindruckend«, sagte Michael und trat näher an das Auto heran. »Du hast wirklich ein Talent dafür. Wo hast du den Wagen her?«
Heinrich strich liebevoll über die überlange Motorhaube des Wagens. »Die Reste dieses einmaligen Autos standen in der Garage eines Kaffeeplantagenbesitzers in Arusha, drüben in Tansania. Er hat mir die Rostlaube für weniger Dollar überlassen, als ein Sack Kaffee kostet.«
»Wirst du jetzt Oldtimer-Händler?«, neckte Michael den eher schüchternen Hamburger, der für mehrere renommierte deutsche Kaffeefirmen arbeitete, die auf seine Expertise in Ostafrika vertrauten.
»Ja, das ist meine Leidenschaft neben dem Kaffeehandel. Leider fehlen bei dem Auto noch die beiden Tanks, deshalb habe ich hinten die beiden Benzinkanister auf den Rücksitzen festgeschnallt. Nicht ganz TÜV-gerecht, ich weiß. Aber die Originalteile aus England sind schon unterwegs. Es kann also nur noch Wochen dauern«, konterte Heinrich.
Michael sah Heinrich an und bemerkte, wie sich der Ausdruck seines Gesichtes veränderte. »Was beschäftigt dich?«
Heinrich zögerte einen Moment, bevor er antwortete. »Es gibt da seltsame Entwicklungen im Kaffeegeschäft in Zentralafrika.«
Michael hob eine Augenbraue. »Seltsame Entwicklungen?«
»Ja«, fuhr Heinrich fort und verschränkte die Arme vor der Brust. »Mir ist aufgefallen: Die Kaffeebauern aus Uganda, Ruanda und Burundi verkaufen ihren Rohkaffee plötzlich in den Kongo. Früher lief das immer andersherum.«
»Interessant«, sagte Michael nachdenklich. »Kannst du dir erklären, warum?«
Heinrich schüttelte den Kopf. »Ökonomisch ergibt das eigentlich keinen Sinn. Ich vermute, dass da was anderes dahintersteckt.«
Michael konnte seine Augen nicht von dem glänzenden Jaguar lassen und sagte. »Du meinst, es könnte politische Gründe haben?«
»Vielleicht«, antwortete Heinrich. »Es wäre sicherlich einen Blick wert für jemanden wie dich.«
Michael, Afrika-Korrespondent einer führenden deutschen Tageszeitung, lächelte und spürte, wie seine Neugier wuchs. »Das klingt spannend. Ich fliege morgen nach Ruanda und fahre dann weiter nach Burundi – eigentlich für eine Geschichte über Tutsi und Hutu nach dem Völkermord vor einigen Jahren. Da werde ich auch mal nach dem Kaffee fragen.«
Heinrich klopfte ihm auf die Schulter. »Ich wusste, dass es dich interessieren würde.«
Petersen und Baumann gingen in das Haus, das von einem üppigen tropischen Garten umgeben war. Kaum hatten sie die Schwelle überschritten, wurden sie von Carla Petersen begrüßt, der charmanten und attraktiven Frau des Kaffeehändlers. Ihre offene und freundliche Art sorgte sofort für eine angenehme Atmosphäre. Ihre karibischen Wurzeln waren unverkennbar und machten sie inmitten der Ausländergemeinde Nairobis einzigartig.
»Was wollt ihr trinken?«, fragte sie mit einem einladenden Lächeln, während sie die beiden Männer musterte.
Heinrich lebte mit seiner Familie in diesem gemütlichen Haus, das in einem sicheren, grünen Viertel von Nairobi lag. Die Wände waren geschmackvoll dekoriert, und die Einrichtung spiegelte die multikulturelle Verbindung der Familie wider – von afrikanischen Kunstwerken bis zu karibischen Elementen, die die Räume lebendig machten.
»Welchen Malt für dich, Michael?«, erkundigte sich Carla und wandte sich ihm zu, während sie eine Hand selbstbewusst an ihre Hüfte legte. Baumann überlegte kurz, bevor er mit einem Lächeln antwortete: »Mortlach.« Der Name des Whiskeys fiel ihm leicht, denn es war sein absoluter Favorit, ein Genuss, den er sich nur zu besonderen Anlässen gönnte.
Im Wohnzimmer traf Baumann unerwartet auf einen weiteren Besucher, den Deutschen Jens Stratmann. Baumann bemerkte, dass der Mann erst Mitte 30 war. Der junge Mann stand sofort artig auf. »Noch ein Deutscher?«, neckte Baumann den jungen Mann. »Stratmann, Jens Stratmann.«
Sie begrüßten sich herzlich, und Baumann konnte die Aufregung in Stratmanns Stimme spüren. Der Abteilungsleiter der Weltbank hatte gerade einen neuen Posten in Abidjan übernommen und war nun in Nairobi, um Petersen als alten Fachmann für Kaffee zu besuchen. Die Informationen sprudelten aus ihm heraus. In seinem neuen Job würde er sich vorwiegend mit der Marktliberalisierung der Rohstoffe in Zentralafrika beschäftigen, meinte er.
Kaffee war dabei ein wichtiges Thema, und Baumann ahnte bereits, wie leidenschaftlich Jens für die Herausforderungen der Branche brannte. »Deshalb ein Besuch bei dem Alt-Profi Petersen, verstehe«, meinte Baumann. Die Diskussion über die neuesten Entwicklungen war bereits in vollem Gange, und Baumann zeigte sich erfreut darüber.
Nicht nur wegen seines jungen Alters strahlte Jens eine bemerkenswerte Frische aus. Bei jedem Wort, bei jeder Geste machte er deutlich, dass er glaubte, durch seine Arbeit die angestaubte Weltbank mit neuen Ideen und dynamischer Energie wiederzubeleben.
Michael konnte die Begeisterung auch bei Petersen hören, als dieser über Jens sprach. Der Kaffeehändler sagte, sein rascher Aufstieg in der Weltbank beweise nicht nur seine Kompetenz, sondern auch sein unermüdliches Engagement für die anstehenden Aufgaben.
Baumann erinnerte sich an die zahlreichen Gespräche, in denen Petersen mit Stolz von talentierten jungen Leuten gesprochen hatte, die den alten Strukturen frischen Wind einhauchen würden. Jens Stratmann war ganz offensichtlich so einer.
Stratmann verstand sich sofort mit Baumann. Sie teilten eine gemeinsame Herkunft, beide waren in München aufgewachsen, was eine erste Verbindung schuf. Jens erzählte, dass seine Mutter Lehrerin aus Augsburg war, während sein Vater als Compliance-Chef eines großen Unternehmens in der bayerischen Landeshauptstadt tätig war. Während sie sich zunächst mit Erinnerungen an ihre Heimatstadt übertrafen, tauschten sie sich schnell über die offenkundigen Herausforderungen auf ihrem Wahlkontinent aus.
Mit leuchtenden Augen berichtete Jens über ein Projekt, das ihm besonders am Herzen lag: die Liberalisierung des Kaffeehandels im Kongo. »Es gibt dieses Projekt schon seit der Endzeit Mobutus«, erklärte er voller Überzeugung. »Jetzt, unter dem neuen Präsidenten Kabila, wird es endlich fortgeführt.«
Während er sprach, spürte Michael die Leidenschaft von Jens für seine Aufgabe. Jens nannte Zahlen, die das Thema noch greifbarer machten: »Und siehe da, der Aufkaufpreis für Rohkaffee ist deutlich gestiegen. Es gibt also Hoffnung!«
Baumann hörte aufmerksam zu, während Jens Stratmann die Möglichkeiten aufzeigte, die sich daraus ergeben könnten. Die Vision eines besseren Handels und die Aussicht auf positive Veränderungen im Kongo führten zu einer ziemlich intensiven Diskussion, bei der Baumann den Skeptiker gab, Jens Stratmann dagegen den Zukunftsgläubigen.
Jens Stratmann freute sich, Michael Baumann kennenzulernen, »einen erfahrenen Afrika-Korrespondenten, den ich aus der Zeitungslektüre kenne«. Er zeigte seine Begeisterung mit einem bewundernden Lächeln.
Stratmann schätzte nicht nur Baumanns jahrelanges Engagement und sein Wissen, »sondern auch die tiefen Einblicke, die du aus deinen zahlreichen Erlebnissen in Afrika gewinnen konntest«. Er wollte von Baumann lernen. Und stellte deshalb endlos viele Fragen, vorwiegend über die schwierige politische Situation in der zentralafrikanischen Region.
Während sie sich unterhielten, bemerkte Michael die ehrliche Neugier und den Wunsch des jungen Abteilungsleiters, den Kontinent besser kennenzulernen und zu verstehen.
Schon bald spürten beide, dass es bei ihrem ersten Treffen nicht nur um einen Austausch von Daten, Fakten und natürlich auch um historische Fakten über Afrika ging. Zeitgleich bildete sich zwischen den beiden eine menschliche Verbindung und erste Sympathien.
Beim Abschied versprach Heinrich Petersen, Baumann noch einige weitere Kontaktadressen und Telefonnummern für seine Kaffee-Recherche zukommen zu lassen.
Mit einem nachdenklichen Blick und einem leichten Schmunzeln fügte er hinzu: »Wo die Weltbank ihre Finger hineinsteckt, kommt selten etwas Gutes raus. Nimm das dem jungen Kerl nicht übel.«
Michael konnte hören, dass Petersen skeptisch war.
RECHERCHEN IN KIGALI
Michael Baumann stand in der Empfangshalle des Mille Collines in Ruandas Hauptstadt Kigali. Er war müde und verkatert. Der Whiskey vom Abend zuvor bei Petersen hatte Spuren hinterlassen.
Er nahm den Zimmerschlüssel, bedankte sich mit einem flüchtigen Nicken und verschwand in sein Zimmer, um sich frisch zu machen. Die vertrauten Gerüche des Hotels, die Mischung aus alten Holzmöbeln und polierten Böden, weckten Erinnerungen an frühere Besuche.
Nachdem er sich notdürftig erfrischt hatte, machte er sich auf den Weg zum »La Baguette«. Er musste an die Geschichten über dieses Café denken, kurz nach dem grässlichen Bürgerkrieg gegründet von Mike Nowak, einem Kölner mit dem Gespür für Geschäftliches.
Als Michael durch die Straßen Kigalis ging, bemerkte er die Veränderungen seit seinem letzten Besuch: neue Gebäude, gepflegte Parks und belebte Straßencafés. Doch die Erinnerung an das düstere Kapitel der Geschichte Ruandas, den Völkermord an den Tutsi, blieb stets präsent.
Vor dem La Baguette angekommen, schob er die Glastür auf und trat ein. Das Café war voller Leben. An den Tischen saßen Menschen aus aller Welt, Helfer und Berater, die für verschiedene Organisationen arbeiteten. Michael bemerkte sofort das rege Treiben der internationalen Gemeinschaft.
»Baumann«, rief eine bekannte Stimme aus einer Ecke des Raumes. Es war Mike Nowak selbst, der ihn herzlich begrüßte. Mike hatte sich kaum verändert: charismatisch und energiegeladen wie immer. Er trug ein leicht zerknittertes Hawaiihemd und grinste breit.
»Mike«, antwortete Michael und schlug seinem alten Freund auf die Schulter. »Lange nicht gesehen.«
»Setz dich, ich habe gerade frischen Kaffee aufgebrüht«, sagte Mike und deutete auf einen freien Platz an seinem Tisch.
Michael setzte sich und nahm dankbar die Tasse entgegen. Der Duft des Cappuccinos vertrieb die letzten Reste des Katers.
»Wie läuft das Geschäft?«, fragte Michael, während er einen Schluck nahm.
Mike lehnte sich zurück und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Gut genug. Die Helfer strömen immer noch nach Kigali, auch wenn es inzwischen weniger geworden sind.«
Michael nickte nachdenklich. »Ich bin hier wegen einer Geschichte über den Kaffeehandel im Kongo. Hast du davon gehört?«
Mike grinste breit und seine Augen funkelten vor Interesse. »Klar doch. Kaffee ist das neue Gold hier in der Region.«
Während sie weiter sprachen, fiel Michaels Blick auf ein paar alte Fotografien an der Wand: Bilder von der Eröffnung des La Baguette, von Mike mit internationalen Gästen wie dem UN-Sonderbeauftragten oder dem deutschen Außenminister und von den Anfängen nach dem Völkermord.
»Du hast wirklich etwas aufgebaut hier«, bemerkte Michael anerkennend.
Mike zuckte mit den Schultern. »Man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.«
Recht hatte er gehabt. Das La Baguette war ein wirklicher Erfolg. Und hier wollte sich Michael Baumann auch mit seinem ruandischen Kollegen Emmanuel Nkusi treffen, der ihm bei der Recherche zu seiner Reportage über Ruanda nur ein paar Jahre nach dem Bürgerkrieg helfen wollte.
Mike hatte zu tun. »Wir sehen uns? Hier oder die Tage in Bujumbura, muss da heute noch runter.« Michael Baumann hatte die Hauptstadt Burundis auch auf seinem Reiseplan. »Spätestens in Bujumbura. Ich melde mich bei dir.«
Endlich tauchte Emmanuel Nkusi im Café auf. Michael erhob sich, um ihn zu begrüßen, sie drückten sich fest die Hände.
Emmanuel Nkusi war für Michael Baumann nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund. In den schlimmen Tagen Ruandas waren sie durch dick und dünn gegangen. Michael hatte den Ruander an der Grenze zwischen Ruanda und Uganda kennengelernt – und schließlich in seinem Wagen mitgenommen in das vom Bürgerkrieg und den Massenmorden verwüstete Land. Seit dem ersten Treffen mochte Michael Emmanuel aufrichtig.
Emmanuel war ein schlanker Tutsi mit einem markanten Erscheinungsbild; seine ausdrucksstarken, braunen Augen strahlten leidenschaftlich und sein Engagement für seine Heimat war aufrichtig. Das hatte Michael in diesen schlimmen Tagen gelernt.
In seinen praktischen kakifarbenen Hosen und lockeren Hemden verkörperte Emmanuel den Alltag eines Journalisten in Ruanda, der trotz seiner finanziellen Schwierigkeiten nie seine Überzeugungen verlor. Sein Drang, die Komplexität der gesellschaftlichen Konflikte Ruandas zu verstehen und diese dann authentisch, aber verständlich darzustellen, war ansteckend.
Für Michael war es wichtig, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgten: die Realitäten Ruandas zu dokumentieren und den betroffenen Menschen Gehör zu verschaffen.
Emmanuel hatte oft wertvolle Insiderinformationen, die Michael halfen, die Hintergründe in Ruanda besser zu verstehen. Dies machte ihn zu einem idealen Partner für die journalistische Arbeit.
Michael empfand es als eine besondere Erleichterung, dass Emmanuel nie ein Blatt vor den Mund nahm. Er sprach offen über seine Gedanken und Sorgen, und in den schwierigen Momenten der Berichterstattung hatte Michael immer das Gefühl, auf Emmanuels Unterstützung zählen zu können.
Kaum hatte sich Emmanuel gesetzt, als er schon mit lebhaften Gesten konkrete Vorschläge machte, wo sie hinfahren sollten und mit wem sie sprechen müssten.
»Lass uns mit den Gedenkstätten in Kigali beginnen, um das Ausmaß der Tragödie zu verstehen und zu spüren. Dann sollten wir mit Überlebenden und ehemaligen Rebellen sprechen, um persönliche Geschichten zu sammeln«, sagte Emmanuel. Er betonte, dass sie unbedingt auch in die ländlichen Gebiete reisen müssten. »Nur dort können wir wirklich Eindrücke sammeln, wie der Bürgerkrieg sich auf die Bevölkerung auch der Hutu auswirkt.«
Schnell bemerkte Emmanuel, dass Michael nur höflich zuhörte. Baumanns Gedanken streiften ab. Er konnte den Geruch von frischem Kaffee und den leichten Duft von Zimt in der Luft wahrnehmen. Das Summen der Gespräche um ihn herum vermischte sich mit dem Klappern von Geschirr. Er nickte zwar an den richtigen Stellen, aber seine Gedanken waren ganz woanders. Sein Blick war abwesend und leer.
Emmanuel hielt inne und schaute ihn skeptisch an.
»Was ist los mit dir, Michael, du scheinst nicht bei der Sache zu sein?«
Michael Baumann spielte verlegen mit dem Schaum in seinem dritten Cappuccino herum, beobachtete, wie die Bläschen langsam zerplatzten und einen cremigen Wirbel hinterließen. Schließlich hob er den Blick und sagte in überraschender Offenheit: »Ich bin seit ein paar Tagen regelrecht angefixt von einer Geschichte über Kaffee und illegale Ausfuhren, auch aus Ruanda in den Kongo. Weißt du etwas darüber?«
Er nahm einen tiefen Atemzug und wartete gespannt auf Emmanuels Antwort.
Emmanuel, der inzwischen für die New Times Ruanda arbeitete, berichtete, dass er Gerüchte gehört habe, wonach neue, private Käufer im Kongo aufgetaucht seien. Diese Käufer seien bereit, deutlich mehr für Rohkaffee zu zahlen als hier in Ruanda. Niemand wüsste genau, wer oder was dahintersteckte, doch die Situation schien sich rapide zu entwickeln. Im Kongo habe die Weltbank offenbar durchgesetzt, dass neben den staatlichen Sammelstellen auch private Geschäftsleute Rohkaffee aufkaufen dürften, erklärte Emmanuel.
»Die zahlen besser. Ist doch klar, dass viele ruandische Kaffeebauern ihre Ernten deshalb über die Grenze schmuggeln«, fügte er hinzu. »Die privaten Käufer bieten nicht nur bessere Preise als die staatlichen Aufkäufer bei uns in Ruanda, sondern sie zahlen auch schneller und in harter Währung.«
Michael schien es, als ob der ruandische Kollege dies alles für selbstverständlich hielt. Das war für ihn keine Geschichte, sondern schlicht und einfach Realität. Wenn du jenseits der Grenze mehr für deine Kaffeebohnen bekommst und das auch noch in harten Dollar, ist es doch selbstverständlich, dass du dort verkaufst und nicht in Ruanda.
Für Emmanuel war das kein Schmuggel, sondern nur logisch.
Michael lehnte sich zurück, nahm einen Schluck von seinem inzwischen kalt gewordenen Cappuccino und dachte über die möglichen Implikationen nach. Kaffeebauern, die ihre Ernten über die Grenze schmuggelten, bedeuteten für sie mehr Gewinn.
Aber für ihr Land waren das wirtschaftliche Verluste. Und letztlich könnten sich auch die politischen Spannungen in der Region verschärfen. Denn die Demokratische Republik Kongo und das neue Ruanda waren sich alles andere als gute Nachbarn.
»Kennst du vielleicht Kaffeebauern, die so etwas machen?«, fragte Michael nach.
Emmanuel kramte seinen Block und Stift zusammen und steckte alles in seine Tasche. Dann sah er Michael direkt an: »Klar. Wenn du willst, können wir im Grenzgebiet zu ein paar Kaffeebauern fahren und mit ihnen auch darüber sprechen. Ich bin mir sicher, sie reden offen darüber.«
EIN BESUCH AUF DEM MARKTPLATZ
Michael Baumann saß schon wieder in einem Hotelzimmer, dieses Mal in Bujumbura, der Hauptstadt Burundis, und tippte das Gehörte, Gesehene und Erlebte seiner Recherchereise im Nachbarland Ruanda in seinen Laptop. Es waren anstrengende und intensive Tage gewesen, mit Emmanuel einmal quer durch Ruanda zu fahren, und das nur fünf Jahre nach dem Völkermord.
Nur das Erlebte musste gleich festgehalten werden. Sonst verblassten die Details, verlor er die Erinnerung an die Gerüche, die Ausstrahlung der Menschen, die Assoziationen, die Landschaften bei ihm auslösten.
Das machte er immer so, Notizen ausformulieren, ganze Sätze schreiben, Thesen wagen. So entstanden seine Geschichten, erst im Kopf und dann Stück für Stück im Computer.
Er tippte los: Von der Hauptstadt Kigali führte eine Straße durch den Akagera-Nationalpark nach Ngarama. Auf dem holprigen Weg wurde deutlich, wer auf dem Schlachtfeld gesiegt hatte und bis heute in Ruanda das Sagen hatte: Wohin das Auge reichte, nur tausende Ankole-Rinder, Kühe und Bullen mit ihren schier endlosen Hörnern.
Die Tutsi hatten sie aus ihrem Hauptrefugium Uganda in ihre neue, alte Heimat zurückgetrieben. Von hier waren sie als herrschende Minderheit nach dem großen Hutu-Aufstand 1959 zum Ende der belgischen Kolonialzeit vertrieben worden. »Ruanda ist heute der sicherste Ort für Tutsi«, hatte ein Diplomat in Kigali in seinen Block diktiert.
Michael Baumann fiel es besonders schwer, dieses Mal diese Erinnerungsarbeit, diese Fleißarbeit zu machen. Wohl, weil es Ruanda und diese traumatischen Erfahrungen waren, die Baumann manchmal nachts schwitzend aufwachen ließen. Aber er wollte seine Leser zum 5. Jahrestag mit einer Reportage daran erinnern, was geschehen und bis heute nicht überwunden war. Wie auch?
Mindestens 800.000 Menschen waren im Genozid 1994 in nur 100 Tagen umgebracht worden. Die ethnische Karte war Trumpf in der totalen Ideologie der Diktatur gewesen, die Hutu oder Tutsi sogar in den Pass stempeln ließ.
Baumann verdrängte die Bilder und Gerüche, die er seither nicht mehr vergessen hatte. Er war da gewesen, freilich nur am Rande, nur als Beobachter, als weißer Mann klar erkennbar und deshalb wohl auch sicher. Aber dennoch ließ es einen nicht mehr los. Die Welt hatte tatenlos zugesehen.
Zurück zum Schreiben: Mit seinem Journalistenkollegen Emmanuel waren sie vor zwei Tagen nach Ngarama gefahren. Dort war immer noch ein Camp, ein Auffanglager für Waisen aus diesen Tagen, obwohl das Morden schon Jahre her war. Emmanuel hatte ihm unmissverständlich gesagt, sie müssten dahin. »Das ist wichtig, dass du die Kinder besuchst. Kinder sind Zukunft.«
Also schrieb Baumann weiter.
Ruakari ist Ruandese. Der kleine Junge mit den großen, viel zu alten Augen, der mit 210 anderen Waisen im SOS-Notaufnahmedorf in Ngarama im Norden Ruandas lebte, ist Tutsi. Sein Alter konnte er mir nicht sagen, ein Arzt bestimmte es am Kariesbefall seiner Zähne: etwa neun Jahre.
»Der Junge ist stark traumatisiert«, sagte mir der Arzt, »aber fragen Sie ihn, das hilft«.
Einmal gefragt, erzählte Ruakari in gleichbleibendem Flüsterton jedes Detail der grausamsten Geschichte seines Lebens: wie der Nachbar seine Familie warnte, dass die Interahamwe-Miliz des Hutu-Regimes käme.
Als Erstes schmissen diese Leute eine alte Frau auf den Boden und ermordeten sie. Dann war sein Vater dran; dem schnitten sie die Kehle durch. Kaum zu glauben, fünf Jahre war das her. Jeder Name schien dem Jungen noch präsent zu sein, als wäre es gestern geschehen.
Er hatte nichts vergessen, nichts verdrängte er. Kein Detail konnte er auslassen. Er redete sich unaufhaltsam den Schmerz von der Seele, berichtete, wie seine Mutter versuchte, den Männern Geld zu geben, auch sie wurde misshandelt, zerschnitten, zerhackt.
Am Ende saß Ruakari alleine da. Außer ihm war nur noch die Lehrerin des Dorfes am Leben. Die kannten einige der Milizionäre gut, deshalb verschonten sie sie. Die Lehrerin, sagte Ruakari nach fast 20 Minuten ununterbrochener Rede, hat ihn dann mitgenommen und den siegreichen Tutsi-Rebellen übergeben. So war er hierhergekommen. Sagte es, und dann schwieg er, kein Wort mehr, er blieb stumm.
Die Szene mit dem Jungen war das Eindringlichste, was er in diesen Tagen mit Emmanuel erlebt hatte. Alles andere war wichtig und gut zu beschreiben gewesen. Aber die Erzählung, die nicht enden wollenden Details, die der Junge beschrieben hatte, ließen einen daran zweifeln, ob so etwas jemals vergeben und vergessen werden könnte.
Baumann konnte nicht weiterschreiben. Er fühlte sich leer und kraftlos. Er beschloss, sich an der Hotelbar einen Cappuccino zu gönnen.
Dies war die richtige Entscheidung, dachte er, als er auf einem der Barhocker Platz genommen hatte.
Er atmete tief durch und schloss für einen Moment die Augen. Der süße Duft von frisch gebrühtem Kaffee umhüllte ihn, vermischte sich mit der feuchten Luft des Pools und dem starken Geruch derbunten Bougainvillea-Blüten auf dem Dach.
Baumann öffnete die Augen und beobachtete, wie das Licht auf der Wasseroberfläche tanzte. Ein Gast entspannte am Poolrand, während andere in bequemen Liegen in ausgedruckten Powerpoint-Präsentationen oder einige Tage alten Zeitungen blätterten. In dem Sabena-Hotel stiegen meist Entwicklungshelfer und ihre Zuarbeiter ab.
»Brauchst du wieder meinen Neffen mit Auto für deine Recherchen?« Claude stellte die Zuckerdose neben die Tasse und lächelte. Seine weißen Bartspitzen erinnerten Baumann an schneeweiße Wolken am klaren Himmel.
»Danke, ich nehme keinen Zucker. Aber wenn dein Neffe ein paar Tage Zeit hat, gerne.« Baumann lächelte und spürte, wie sich seine Schultern allmählich entspannten.
Claude nickte, während er den Cappuccino vor Michael mit einer eleganten Handbewegung abstellte. »Er hat immer Zeit für einen Freund.«
»Immer gut, Transport zu haben«, murmelte Baumann mehr zu sich selbst.
»Die Stadt ist klein, jeder kennt jeden«, sagte der Barkeeper und wischte mit einem Tuch über die Theke.
Michael nippte an seinem Cappuccino und ließ den warmen Schaum über seine Lippen gleiten. Der bittere Geschmack des Kaffees war ein willkommener Kontrast zu seinen Gedanken.
Ruanda hatte ihn ausgelaugt; jetzt wollte er etwas anderes erleben. Die Gerüchte über den Kaffeehandel im Kongo beschäftigten ihn – neue Käufer tauchten auf? Wer waren diese Leute?
»Wer kann mir in Bujumbura etwas über das Kaffeegeschäft erzählen?«, fragte er schließlich direkt.
Claude überlegte kurz und kratzte sich am Kinn. »Da gibt es ein paar Namen … in der Nähe des Marché de Kamenge ist ein Mann namens Dadi, ein alter Kaffeebauer. Er kennt sich aus.«
»Dadi?« Michael schrieb sich den Namen hastig auf eine Serviette.
»Ja, Dadi ist gut vernetzt«, antwortete Claude und hob vielsagend eine Augenbraue. »Aber sei vorsichtig mit ihm.«
»Warum?«
»Er hat seinen eigenen Kopf«, murmelte Claude und stellte ein Glas Wasser neben Michaels Tasse. »Kaffee bringt Geld, aber auch Ärger.«
Baumann nickte.
»Kann ich deinen Namen nennen?« Michael trank den letzten Schluck Cappuccino aus seiner Tasse.
Claude grinste zufrieden. »Ja, klar, wir kennen uns.«
Er bezahlte schnell an der Bar und machte sich auf den Weg zur Hotelrezeption, um auf Claudes Neffen mit dem Taxi zu warten.
Wie hieß er noch? Richtig, Jeanmarie, jetzt fiel es ihm wieder ein. Er war schon vor Jahren mit ihm durch Bujumbura gefahren, als nach dem Mord am ersten gewählten Hutu-Präsidenten abends eine Ausgangssperre verhängt worden war. Jeanmarie war gut gewesen – und kannte wirklich jeden, auch die meisten Polizisten. Das hatte geholfen.
Unterwegs ließ Michael seinen Blick durch die Hotelhalle schweifen. Alles schien friedlich, ruhig, entspannt – ganz anders als in Ruanda.
Am Empfang wartete schon Jeanmarie. »Ich muss nach Kamenge zum Markt«, sagte Michael. Jeanmarie wusste schon alles: »Du möchtest Dadi treffen, Claude hat mir bereits Bescheid gegeben.«
Michael atmete tief durch und trat hinaus in die drückende Hitze Bujumbura und setzte sich in das hellblaue Taxi, einen alten Renault.
Die Straßen waren schon belebt; Händler boten frisches Obst an, andere laute Stimmen versammelten sich an Spieltischen. Hier fühlte man das geschäftige Treiben einer Stadt im Herzen Afrikas.
Die Fahrt zum Markt von Kamenge dauerte nur Minuten. Farbenfrohe Stände reihen sich dicht gedrängt entlang des Gehwegs. Das Geschrei von der Verkäufer mischte sich mit dem Geruch von gebratenem Fisch und Gewürzen in der Luft.
Baumann sah sich um; hinter einem großen Baum an einer Straßenkreuzung saß vor einem schäbigen Eckhaus ein kräftiger Mann mit einem breiten Hut und grinste ihn an – das musste Dadi sein.
Jeanmarie, der Fahrer, deutete mit seinem Kopf genau auf ihn.
Michael näherte sich langsam, bemühte sich um einen freundlichen Ausdruck auf seinem Gesicht.
„Dadi?“
Der Mann schaute auf, sein Grinsen wurde breiter. »Ja! Und du bist …«
»Michael Baumann.« Er streckte seine Hand aus; Dadi schüttelte sie kräftig.
»Ein Journalist! Hier wegen des Kaffees?«
Baumann nickte leicht und deutete auf eine leere Bank neben dem Kaffeebauer.
»Darf ich mich setzen?«
Dadi wischte mit einer Handbewegung Staub von der Bank ab: »Setz dich!«
Michael Baumann nahm Platz, den Notizblock aufgeschlagen auf seinen Knien.
»Claude hat mir im Hotel von deiner Leidenschaft für Kaffee erzählt. Er meinte, du könntest mir einiges über die Situation der Kaffeebauern hier in Burundi sagen. Vor allem, ob sie ihren Rohkaffee seit einiger Zeit in den Kongo verkaufen.«
Dadi schüttelte den Kopf, und er schaute skeptisch: »In Burundi haben wir vorwiegend die ausgezeichneten Arabica-Bohnen. Die gedeihen in unseren Bergen ab 1800 Metern Höhe ausgezeichnet.«
Dabei hob er seine Hand und zeigte nach oben über die Gipfel hinter Bujumbura, als wollte er die konkreten Berge zeigen. »Das haben die in Ruanda nicht.«
Michael schrieb mit. »Aber ich habe gehört, dass Robusta-Kaffee auch hier in Burundi über die Grenze geschmuggelt wird. Ist das wahr?«
Dadi nickte zustimmend, dabei verfinsterte sich sein Gesicht. »Ja, das stimmt. Der Robusta wird auch in den Kongo geschmuggelt.« Dabei legte er die Hände in seinen Schoß und schaute Michael direkt an. »Die zahlen mehr, seitdem es private Aufkäufer dort drüben gibt.«
Michael wurde neugierig. »Wer sind diese neuen Käufer? Wer kauft den Kaffee?«
Dadi antwortete einsilbig, fast frustriert, aber mit einer großen Geste, als wolle er die Käufer wegwischen. »Dumme Leute mit viel Geld.«
MRS. WONG IN LONDON
Der Morgen dämmerte kühl über den grauen Fassaden Londons. Postbote Evan Connolly machte sich auf den Weg, wie er es jeden Morgen tat.
Es war kurz vor neun Uhr, und die Straßen rund um Moorgate begannen sich zu füllen. Anzugträger, die mit ernsten Mienen an ihren Krawatten zupften, eilten durch die Gassen. Frauen in eleganten Kostümen, manche mit einer Aktentasche in der Hand, andere mit einem Coffee-to-go-Becher, bewegten sich zielstrebig auf die glänzenden Bürotürme zu.
Evan kannte diese Szenerie. Seit über zehn Jahren brachte er die Post in die Büros der Finanzwelt, und nichts, nicht einmal die zunehmende Digitalisierung, hatte ihn von seinem Job abhalten können. Die großen Gebäude hatten sich verändert, waren immer moderner und imposanter geworden, aber Evan war geblieben.
Er schob den kleinen Wagen vor sich her, der mit Briefen, Paketen und der typischen morgendlichen Hektik beladen war. Das Gebäude, in das er nun eintrat, war einer dieser neuen Glastürme, die sich im Herzen des Finanzviertels erhoben. Hoch, modern, blitzsauber. In der Lobby glänzte der Boden, als wäre er nie betreten worden, die hohe Decke ließ selbst Evan, der wahrlich kein kleiner Mann war, sich winzig fühlen.
Mit einem Grinsen auf den Lippen drückte er den Knopf des Aufzugs, und die Türen glitten lautlos auf. Er stieg ein. Als der Aufzug sanft in Bewegung kam, lehnte er sich gegen die Wand und betrachtete sein Spiegelbild. Sein grau meliertes Haar war ordentlich zurückgekämmt, und seine blaue Uniform war wie immer makellos.
Er mochte seinen Job, und er mochte die Menschen, die er tagein und tagaus traf. Jeder in Moorgate kannte Evan, und er kannte sie. Es war ein Spiel, das er beherrschte: in die Büros huschen, einen kleinen Witz machen, die Post abliefern und wieder verschwinden. Die Menschen schätzten ihn, auch wenn sie in diesen Büros oft kaum Zeit für ein Gespräch hatten.
Als der Aufzug zum Stillstand kam und die Türen sich öffneten, trat Evan hinaus auf den hell erleuchteten Korridor. Die Büros hier waren modern, mit Glaswänden und mit Blick auf die dahinter arbeitenden Menschen. Er sah einige bekannte Gesichter, nickte höflich und machte sich an seine übliche Runde.
Im ersten Büro, das er betrat, saß bereits eine Frau hinter ihrem Schreibtisch. Sie trug ein schlichtes, elegantes Kleid, das perfekt zu den neutralen Farbtönen des Raumes passte. »Morgen, Miss Jones«, grüßte Evan und stellte ein paar Briefe auf ihren Tisch. Sie blickte kurz auf, lächelte höflich und sagte: »Guten Morgen, Evan. Wie immer pünktlich.« Er lachte und winkte ab. »Ach, wenn ich mal nicht pünktlich bin, fällt es ja sofort auf.« Mit einem Zwinkern verließ er das Büro, bevor die Frau wieder in ihre Arbeit vertieft war.
Der nächste Stopp war ein kleiner Konferenzraum, wo er ein Päckchen für den Abteilungsleiter hinterließ. Er hatte es eilig, denn sein letzter und größter Stopp würde bei Liane Wong sein. Und dort gab es immer ein wenig mehr zu tun.
Liane Wong. Ein Name, der in diesen Kreisen mit Ehrfurcht genannt wurde. Sie war bekannt als eine der besten Börsenhändlerinnen in ganz London, spezialisiert auf den Kaffeemarkt. Liane hatte einen Ruf, der ihr vorauseilte, und Evan hatte von den Leuten, die in den Büros rund um ihres arbeiteten, schon oft gehört, dass sie eine unerschütterliche Arbeitsmoral hatte. Diszipliniert, klug und absolut zielstrebig – so beschrieben die meisten die junge Vietnamesin. Doch trotz ihres Erfolgs war sie stets freundlich zu ihm gewesen, was Evan an ihr besonders schätzte.
Als er an ihrem Büro ankam, durch die Glastür schaute und sie, wie erwartet, bereits an ihrem Schreibtisch sah, grinste er. Die Frau war wie ein Uhrwerk, immer präzise, immer schon tief in die Arbeit versunken, wenn er kam. Drei Bildschirme waren vor ihr aufgebaut, jeder zeigte verschiedene Charts und Kurven. Liane tippte mit einer raschen Präzision auf ihrer Tastatur, die Geschwindigkeit beeindruckte Evan immer wieder.
Er öffnete die Tür und trat leise ein. Sie telefonierte gerade. Ihre Stimme war ruhig und sachlich, aber der Inhalt des Gesprächs verriet, dass es um bedeutende Geschäfte ging.
»Nein, die Lieferung aus dem Kongo muss nächste Woche erfolgen. Wir haben einen Rückstand bei den Verträgen, und die Preise steigen. Das Fenster schließt sich.«
Liane machte eine kurze Pause, während sie offensichtlich den Ausführungen ihres Gesprächspartners lauschte.
In der Zwischenzeit setzte Evan die Post auf ihren Schreibtisch, arrangierte sie ordentlich und wartete einen Moment, bis sie ihn bemerkte. Es dauerte nicht lange, und als sie kurz aufblickte, begegnete ihm ein Lächeln.
»Morgen, Evan«, sagte sie freundlich, wobei ihre Stimme ihre volle Konzentration auf das Telefonat nicht verbergen konnte. »Danke.«