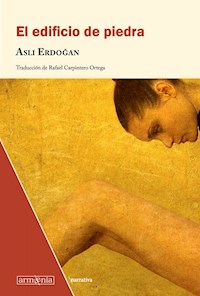11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rio de Janeiro: Stadt des Karnevals, Meisterin im Spiel der Täuschungsmanöver, der Zufälle und der Maskerade. Özgür, eine introvertierte junge türkische Akademikerin, kann sich von der ebenso faszinierenden wie bedrohlichen Stadt nicht lösen. Weit entfernt hat sich dabei die junge Frau von der traditionellen Frauenrolle, wie sie die türkische Gesellschaft vorsieht. Nicht wie eine Touristin führt Özgür den Leser durch die Labyrinthe dieser Metropole, sondern wie eine Migrantin, die das zunächst Fremde als Vertrautes und Eigenes akzeptiert. Gleichzeitig ist die Stadt Impuls für ihr Schreiben und für die Schöpfung ihrer fiktiven Doppelgängerin Ö. – die beiden Erzählebenen, auf mannigfache Weise miteinander verflochten, spiegeln sich ineinander. Atemberaubend ist die nuancierte Feinzeichnung der Menschen, die in Liebe und Leid auf oftmals tödliche Weise miteinander verschmelzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Rio de Janeiro: Stadt des Karnevals, Meisterin der Zufälle und der Maskerade. Özgür, eine introvertierte junge türkische Akademikerin, kann sich von der ebenso faszinierenden wie bedrohlichen Stadt nicht lösen. Sie führt den Leser durch die Labyrinthe dieser Metropole, in der die Menschen in Liebe und Leid auf oftmals tödliche Weise miteinander verschmelzen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Aslı Erdoğan (*1967) studierte Informatik und Physik. In ihren Werken erkundet sie stets das Fremde, das andere vor dem Hintergrund der türkischen Gesellschaft und der globalen Entwicklungen. 2010 wurde sie mit dem bedeutendsten Literaturpreis der Türkei ausgezeichnet. Als Kolumnistin und Beiratsmitglied der kurdischen Tageszeitung Özgür Gündem wurde sie im August 2016 verhaftet, seit 2017 lebt sie in Deutschland im Exil.
Zur Webseite von Aslı Erdoğan.
Angelika Gillitz-Acar (*1958) studierte erst Sozialpädagogik, dann Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie und Pädagogik. Sie arbeitet als Übersetzerin und in Projekten zur Integration junger Ausländer.
Zur Webseite von Angelika Gillitz-Acar.
Angelika Hoch (*1969) studierte zunächst Kunstgeschichte und ließ darauf ein Turkologie-Studium folgen, das sie im Jahr 2002 abschloss. Seitdem ist sie u. a. als freie Übersetzerin aus dem Türkischen tätig.
Zur Webseite von Angelika Hoch.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Aslı Erdoğan
Die Stadt mit der roten Pelerine
Mit einem Nachwort von Karin Schweißgut
Roman
Aus dem Türkischen von Angelika Gillitz-Acar und Angelika Hoch
Türkische Bibliothek
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel Kırmızı Pelerinli Kent beim Verlag Adam Yayınları.
Originaltitel: Kirmizi Pelerinli Kent (2001)
© by Aslı Erdoğan 1998
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Elvan Alpay, Dolch (1998)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30207-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 01:19h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE STADT MIT DER ROTEN PELERINE
Tag des FeuerwerksDer Verrückte von Santa TeresaEntfernungenAbwärtsDie Neue WeltDer NullpunktUnd das Feuerwerk beginnt!NachwortUmschlagmotivMehr über dieses Buch
Über Aslı Erdoğan
Über Angelika Gillitz-Acar
Über Angelika Hoch
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Aslı Erdoğan
Zum Thema Türkei
Zum Thema Brasilien
Zum Thema Frau
Du warst mein Tod:
Dich konnte ich halten,
während mir alles entfiel.
Paul Celan
Eine Reisende in den Straßen von Rio – I
»Rio ist der schönste Ort der Welt!«, sagen die Einwohner über ihre Stadt. Wie im Chor tönt es einstimmig: »Der schönste Ort der Welt!« Reisehandbücher und exotisch angehauchte Filme verbreiten diese Ansicht, ebenso Entdeckungsreisende längst vergangener Tage und heute Pauschaltouristen im Karneval. Von so unterschiedlicher Seite war dieses Urteil schon zu vernehmen. Ich schließe mich ihm an; auch wenn ich nicht genau weiß, was hier mit »Welt« gemeint ist, glaube ich dennoch, genug von ihr gesehen zu haben.
So sieht sie aus, die typische, allseits bekannte, atemberaubende Fotografie von Rio: unendlich weite, silbrig glänzende Sandstrände unter wolkenlosem Himmel; die bis ins Herz der Stadt reichende, verschlungene Küste der Guanabarabucht; Berge, wie in die Erde gestoßene Dolche, die die Linie des Horizonts zerteilen; schwindelerregende Abgründe; mächtige, wilde, schroffe Felsen; der nur aus einem einzigen Granit bestehende, wie herausgemeißelte Pão de Açúcar, der Zuckerhut, der mir manchmal wie ein Daumen, manchmal wie ein Grabstein vorkommt; der Dschungel, der über Jahrtausende seine Geheimnisse bewahrte, der trotz all der Plünderungen noch immer unberührt ist und im Feuer der Jugend knackt und knistert. Eine Stadt, die sich unter dem gleißenden Licht der Tropen und dem rötlichen Dunst, der sich um die Berghänge legt, in ein Märchenreich verwandelt.
Und dennoch werde ich keine Loblieder auf die so oft beschriebene, überirdische Schönheit Rios anstimmen. Mich verbindet ohnehin seit Langem nichts mehr mit dieser Stadt. Nur so viel: Das früheste Bild, das mir von Rio im Gedächtnis geblieben ist, zeigt genau diese Ansicht, die ich zum ersten Mal auf einer billigen Postkarte sah. Ich war wie verzaubert. Am stärksten beeindruckten mich die Felsen. Diese aschgrauen, bronze- und kupferfarbenen, violetten und ziegelroten Felsen, so alt wie die Erde, die verharren, als seien sie Skulpturen einer erstarrten Bewegung. Wäre ich sentimentaler gewesen, hätte ich diese Postkarte über einer Kerze verbrannt und ihre Asche ins Tal von Santa Teresa verstreut, aus dem die Schüsse zu hören waren. Ich habe sie jedoch lediglich verloren.
Nun bleibt mir nichts weiter, als denjenigen, die an diesen »schönsten Ort der Welt« reisen, eine gesunde und wohlbehaltene Heimkehr zu wünschen. Aber ich erinnere daran: Sämtliche Abenteuer in Brasilien endeten bisher blutig, und seit dem 16. Jahrhundert hat dieses wilde Land noch jeden Weltenbummler, Herumtreiber, Goldgräber und tollkühnen Draufgänger bezwungen. Deshalb warne ich davor, jemals Rios gewaltige Aids- und Kriminalitätsraten zu vergessen, und sei es nur für einen Augenblick; ich warne davor, alleine herumzulaufen, eine Uhr, echten oder falschen Goldschmuck zu tragen. Man sollte alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um nicht vom Blut der Stadt bespritzt zu werden. Außerdem empfehle ich, vom Gipfel des Corcovado aus, dem Berg mit der berühmten, monumentalen Christusstatue, den Sonnenuntergang zu verfolgen – ein in den Tropen eindrucksvolles, aber nur flüchtiges Schauspiel. Und man sollte unbedingt den frischen Papayasaft probieren.
Dann gibt es da noch das Rio der Journalisten, der internationalen Hilfsorganisationen, der Menschenrechtler und der diversen »Ohne-Grenzen-Institutionen«. Rio, das ist die Stadt, in der jeder Dritte Hunger leidet, die in Kriminalität zu versinken droht und die durch den Handel mit billigem Mischlingsfleisch, mit Kokain und Waffen groß geworden ist. Ihre sechshundert Hügel werden allesamt von unzähligen Favelas in Beschlag genommen. Hunderttausende von Obdachlosen verrotten in diesen Straßen wie verrostete Nägel, die man weggeworfen hat. Es ist die Stadt der Massaker, der öffentlichen Hinrichtungen, der Meningitis- und Aidsepidemien. Die Stadt, wo im Garten der Candelária-Kathedrale Straßenkinder erschossen wurden, wo räuberische Banden mit Maschinenpistolen die Strände heimsuchen. Rio ist die Heimat der Justiceiros, dieser selbsternannten Gerechtigkeitsfanatiker, die nicht einmal so viel vom Rechnen verstehen, um die Zahl ihrer Mordopfer auf ihrem Kerbholz einzuritzen. Rio ist der Ort, wo naive, wohlmeinende und großzügige Organisationen versuchen, ein ausgebeutetes, schlecht ernährtes und geknechtetes Volk – vor wem? – zu schützen. Rio zwinkert nur teuflisch mit den Augen und belächelt sie. Die Stadt weiß, dass sie schnell aufgeben und, nachdem sie sich ein, zwei Punkte auf ihrem Gewissenskonto gutgeschrieben haben, wieder zurückkehren werden in ihre wie ein Uhrwerk funktionierende, langweilige, mit Freud und Leid geizende Erste Welt; übersät mit Moskitostichen, voll von Darmparasiten und Erinnerungen an gelungene, bequeme und hygienisch einwandfreie Abenteuer. Und denjenigen, die Rio immer noch nicht satthaben, sieht die Stadt amüsiert hinterher, wie sie sich verdrossen nach Nicaragua aufmachen oder sich auf die Seite der Zapatisten schlagen. Rio, diese launische, verführerische Gaunerin, die man nie zu fassen bekommt.
Ein prächtiges Foto von Rio und sein Negativ, zwei Masken, mehr nicht. Das sind nur zwei der vielen verschiedenen Kostüme, die sich diese Stadt überstreift, die seit Jahrhunderten ihre Karnevalstradition pflegt. Das Rio jedoch, von dem ich erzählen werde, ist ein Labyrinth, das aus mehr als zwei Dimensionen besteht. Genauer gesagt, es ist eine Reihe sowohl zeitlich als auch räumlich ineinander verschlungener Labyrinthe, voller Sackgassen, toter Winkel, geheimer Kammern, schaudererregender Echos, krampfhafter Befreiungsschläge, vager Prophezeiungen.
Bald werden Sie die Straßen Rios betreten. Es wird eine Reise in die gefährliche Nähe eines Wesens sein, das uns seine Schrecklichkeit ständig spüren lässt; dauernd wird Ihnen der stechende Atem des Todes ins Gesicht wehen, und ununterbrochen werden Ihnen finstere, verderbte Blicke im Nacken sitzen. Es wird sein, als würden Sie sich über einen Brunnen beugen und hineinsehen und plötzlich feststellen, dass eigentlich er es ist, der Sie belauert. Sie werden dem menschlichen Körper begegnen, der im Reich der Begierde auf einen kläglichen Thron gesetzt wurde und den man jetzt billig verschleudert. Das nie erlöschende Feuer des Fleisches, seine Torheit und seine einzigartige Schönheit; ein leichtes, schnell vergängliches, unstetes Leben, und an jeder Ecke ein Tod.
Es war vor zwei Jahren. Auf einem Fest in einer Favela sah ich eine Frau. Sie war in Lumpen gehüllt, Beine und Hintern waren nackt. Es dauerte Minuten, bis ich wusste, zu welchem Geschlecht sie gehörte. Die Frau sah aus, als hätte man sie zu spät aus einem Konzentrationslager befreit und als wäre es ihr Schicksal, innerhalb von wenigen Tagen zu sterben. Vielleicht war sie zwanzig, sie hätte aber auch siebzig sein können. Sie hatte fast alle Zähne verloren, und ihre Ellenbogen hatten die Haut durchbohrt und ragten spitz heraus. Eine Sambatänzerin, sie war im Freudentaumel, lachte schallend. Ihr Gesicht strahlte diese naive, reine Freude aus, wie man sie sonst nur bei Kindern sieht. Wenn Sie je in die trüben, matten und leeren Augen einer Frau gesehen haben, die gerade am Verhungern ist, und dem Glück, dem wahren Glück begegnet sind, dann werden Sie ins Innere der Labyrinthe Rios eingedrungen sein. Alles, was Sie danach sehen, bezahlen Sie mit Ihrem Leben. Genauso wie ich.
Nun brauchen Sie – und ich – nur noch die nötige Portion Mut. Vielleicht so viel, wie man bräuchte, bevor man von einem Boot aus in tiefes, dunkles Wasser springt oder bevor man beim Pokern seine Karten aufdeckt. Vergessen Sie eines nicht! Es ist Rio de Janeiro, das Sie vor sich haben. (Wussten Sie eigentlich, dass Rio de Janeiro »Januar-Fluss« bedeutet?) Diese Stadt hat es im endlosen Spiel der Zufälle zu einer solchen Meisterschaft gebracht, dass im Vergleich zu ihr selbst der Teufel als Amateur gilt. In dem Moment, in dem sie einen glauben macht, sie würde bluffen, zieht sie das Karo-Ass.
Schließen Sie jetzt Ihre Augen. Ich zähle leise bis zehn. Bei zehn sind Sie in Rio. Aber sagen werde ich Ihnen nicht, wann Sie die Augen wieder aufmachen müssen.
Tag des Feuerwerks
Wanderer, wer bist du?
Ich sehe dich deines Weges gehn …
feucht und traurig wie ein Senkblei,
das ungesättigt aus jeder Tiefe wieder anʼs Licht
gekommen – was suchte es da unten?
Friedrich Nietzsche
Schließlich hatte sie es geschafft, eine echte Vagabundin zu werden. Sie war verloren gegangen in dieser südamerikanischen Stadt, die für Morde an Straßenkindern und für ihren Karneval berühmt ist. Sie war eine von Millionen Heimatlosen geworden, die auf diesem Planeten hin und her geschleudert werden, zu einer dieser verlorenen Seelen, die ganz der Gnade eines ungerechten und grausamen Schicksals ausgeliefert sind. Dieses abenteuerlustige Mädchen aus gutem Hause, dieses kleine, zerbrechliche, scheue Mädchen ist nun eine wirkliche Vagabundin. Jetzt glaubt sie nicht mehr an Märchen, sie kann allein durch dunkle Straßen gehen, und sie prahlt nicht mehr mit den Ohrfeigen, die sie einstecken musste. In dieser Stadt, die mit niemandem Erbarmen hat, windet sie sich auf dem Boden, als hätte man ihr die Gedärme herausgerissen, und findet nicht einmal Trost beim Gedanken an den Tod.
Sie hatte den Ozean durchquert, den Äquator überschritten und einen Kontinent betreten, über den sie zuvor nicht das Geringste gewusst hatte. Alles, was sie zurückließ, hatte sie den Flammen übergeben. Vor ihr tauchte ein vollkommen geschändetes Universum auf. Die Gesetze der Alten Welt hatten hier keine Gültigkeit. Ihre Wertvorstellungen glichen nunmehr dem schweren, unhandlichen Koffer, den sie aus der Türkei mitgebracht hatte: unten abgewetzt, der Griff beinahe schon ausgerissen, in der Feuchtigkeit der Tropen der Fäulnis überlassen, abgeschrieben bis zur Rückkehr, die sie immer wieder aufschob.
Dieses kleine Mädchen, das dem Leben so mutig trotzte, hatte sich »die gefährlichste Stadt der Welt« ausgesucht, um sich ganz allein die dunklen Seiten der Menschheit anzusehen, sie aus sicherer Entfernung zu betrachten. Doch in der Hölle, der sie sich zuwandte, fingen ihre Haare Feuer. Rio de Janeiro hetzte die schwindelerregende Unbezähmbarkeit des Leibes auf sie, seine weißglühenden Tage, seine mit Verheißungen, Drohungen und Zärtlichkeiten erfüllten Nächte, seine Morde. Ihr Wille war nun erschlafft, ihre Persönlichkeit in Fetzen. Ein vernichtetes Heer, das seine Verletzten liegen lässt und sich davonmacht.
Plötzlich waren wieder Schüsse zu hören. Özgür fuhr vor Schreck zusammen, das Glas in ihrer linken Hand fiel zu Boden. Ihr ganzer Körper zuckte, als würde man ihm Stromschläge verpassen. Aus jeder Pore drang Schweiß, dennoch war ihr eiskalt. In ihren Augen standen Tränen, die brannten wie Säure, aber sie konnte nicht weinen. »Aufhören! Genug! Ich halts nicht mehr aus! Mein Gott, mach dieser Folter endlich ein Ende! Siehst du denn nicht, dass ich nicht mehr kann?«
Der Nervenzusammenbruch dauerte nur ein paar Minuten, dann hatte sie sich wieder gefasst. Mit der Gewissenhaftigkeit eines Offiziers lauschte sie dem Monolog einer halb automatischen Schnellfeuerwaffe. Als ihr klar geworden war, dass die Schüsse nicht aus den auf der Anhöhe gelegenen Favelas, wie die Elendsviertel in Brasilien heißen, sondern aus dem benachbarten Tal kamen, ging sie wieder ins Haus zurück. Es tröstete sie zu sehen, dass ihr einziges Glas nicht zerbrochen und kein einziger Tropfen Tee auf ihr Heft gefallen war. Sie lächelte sogar, als sie merkte, dass die verschwitzten Finger ihrer rechten Hand den Stift während des ganzen Anfalls krampfhaft festgehalten hatten.
Die beiden riesigen Favelas, die sich von den Flanken der Anhöhe von Santa Teresa bis zum Dschungel erstrecken, bekämpften sich nun schon seit acht Tagen. Die etwa sechshundert Favelas, die das sonst so überwältigend schöne Gesicht Rios wie Pockennarben entstellen, werden seit der Zeit der Militärjunta von einer der mächtigsten Organisationen Lateinamerikas kontrolliert, dem Comando Vermelho. In den Favelas verging kein Tag ohne Kämpfe: Entweder gerieten konkurrierende Banden beim Verteilen von Kokain aneinander, oder die Polizei unternahm Razzien mit fünfzig Mann starken, bis an die Zähne bewaffneten Einheiten, wenn ihnen das Schmiergeld zu gering erschien.
Aber nun waren in Santa Teresa die schrecklichsten Kämpfe ausgebrochen, die Özgür während ihrer zwei Jahre in Rio erlebt hatte. Seit letztem Samstag setzte schon morgens mit den ersten Sonnenstrahlen ein Getöse ein, entfacht von Infanteriegewehren, Uzi-Maschinenpistolen und Handgranaten, das, abgesehen von wenigen Unterbrechungen, den ganzen Tag andauerte. Özgür, die noch vor zwei Nächten in den jetzt dunklen und totenstillen Straßen von Santa Teresa mit seinen berühmten Bars herumspaziert war, sah, wie ein halbes Dutzend Busse, die vollgestopft waren mit Soldaten und aus deren Fenstern lange Gewehrläufe ragten, lautlos und ohne Licht den Berg erklommen. Mit dem Eingreifen des Militärs waren die Kämpfe keineswegs beendet, im Gegenteil, sie gerieten völlig außer Kontrolle.
Noch bis gestern hatte sie diese Schüsse bloß als eine weitere Lärmquelle in diesem unablässig dröhnenden Rio empfunden, als eine weitere Störung, die sie daran hinderte, sich auf ihren Roman zu konzentrieren, zumindest hatte sie sich das zunächst eingebildet. Bis es mit ihren Nervenzusammenbrüchen losging.
Sie versuchte zu ergründen, wie dieser unumkehrbare Prozess eigentlich genau begonnen hatte. Wenn sie ihn eingrenzen, ihn ausloten könnte, dann wäre es ihr vielleicht möglich, ihn zu kontrollieren. Hätte sie einen Nullpunkt bestimmen müssen, wäre es der Tag gewesen, an dem sie dieser Mulattin an der Copacabana begegnet war, der letzte Osterfeiertag, an dem in Rio alle Uhren stillstanden, die Hitze plötzlich auf über vierzig Grad stieg und die Stadt zitterte, als wäre sie von Malaria befallen.
Es war irgendein Sonntag. Ein ganz normaler Sonntag. Wieder so ein trister, trostloser Tag, der, wie schon die Tage zuvor, ohne irgendeine Hoffnung, Erwartung oder Bedeutung verstrich. Der Tag des Feuerwerks.
Obwohl es erst Anfang Dezember war, breitete sich eine Hitzewelle über der Stadt aus, die immer mehr anschwoll. Die Temperatur sollte nun wochen- und monatelang nicht mehr unter vierzig Grad sinken. Die überall in den Straßen der Stadt angebrachten Thermometer sollten jetzt wie unter der Achsel eines Gelbfieberkranken Werte um die zweiundvierzig Grad anzeigen. In Rio, das von zahlreichen Buchten und steil aufragenden Bergen umgeben ist und das von Meeresstürmen gepeitscht wird, regt sich während der Monate der sogenannten Trockenzeit kein Blatt mehr, und der strahlende, indigoblaue Himmel wird von keiner Wolke getrübt. Wie im Wahn stürzt sich die Hitze auf die Menschen, drückt ihnen die Kehle zu und raubt ihnen den Atem. Die Stadt verwandelt sich dann in einen riesigen Ofen, in dem die Menschen bei lebendigem Leib langsam schmoren. Die Sonne reißt sich die Maske der freigiebigen Königin, die sie das ganze Jahr getragen hat, herunter und gebärdet sich wie eine mordlüsterne Tyrannin. Die Luft saugt so viel Feuchtigkeit wie möglich auf und kondensiert sie zu Wasser. Die legendäre Feuchtigkeit der Tropen.
Die Straßenkinder bettelten jetzt nicht mehr um Salgadinhos – gefüllte Teigtaschen –, sondern wollten eine Cola. Nun würden sie an Ruhr, Cholera oder schlichtweg an Wassermangel sterben. Sämtliche Brunnen und Fontänen der Stadt waren ausgetrocknet, die Obdachlosen rochen jetzt noch strenger. Weil ihre »Freiluft-Toiletten« auf den Bürgersteigen nicht mehr vom Regen gespült wurden, zog der Gestank von Fäkalien und Verfaultem durch die Straßen. Die Verkäufer nahmen die Bonbons, die mit Schokolade überzogenen Cashewnüsse und die frittierten Bananen vom Ladentisch und tauschten sie gegen kalte Getränke und frische Kokosmilch aus. »Gelada, gelada – kalt und erfrischend«, riefen sie. Die Bewohner der Stadt hatten keine Kraft mehr. Das Gehen, das Sprechen, ja sogar das Atmen verlangsamte sich. Das Leben erlahmte und stockte wie ein Fluss, der auszutrocknen droht. In Aufzügen, Wartezimmern und Bussen begann jedes flüchtige Gespräch mit dem gleichen Satz: »Que calor! Was für eine Hitze!« Auf den Werbeplakaten, mit denen Rio von oben bis unten zugepflastert ist, standen skandinavisch aussehende Mädchen knietief im Schnee und versprühten ihr strahlend blondes Lächeln. So wie sich die Beduinen nach allem Grünen sehnen, so lechzen die Bewohner von Rio nach Schnee.
An diesem ersten Sonntag im Dezember belagerte die Stadtbevölkerung die Strände, oder sie flüchtete sich in die Bergdörfer. Die Zeit schien fast stillzustehen. Die Stunden verrannen langsam und zäh wie Schweißtropfen. Im Tal von Santa Teresa, das in eine tiefe Siesta versunken war, bekämpften sich die Banden unbarmherzig.
Özgürs Unterkunft bestand aus einem Wohnraum, so schmal und lang wie ein Trog, einer Küche, die sie »Gruft« nannte, und einem Bad voller Blutegel, die sie nicht umbringen konnte, weil sie sich so vor ihnen ekelte. Die Wohnung war eines von sechs Appartements einer schneeweißen, mit Säulen und ähnlichem Schnickschnack verzierten Villa, die den hochtrabenden Namen Villa Branca trug. Der Abhang ins Tal von Santa Teresa war derart steil, dass sich der Balkon auf der Vorderseite mindestens drei Meter über dem Boden befand, die hinteren Fenster sich jedoch ebenerdig zu einem Dschungel aus wilden Gräsern und dornigen Sträuchern öffneten. Durch die Fenster, die wegen der Hitze Tag und Nacht geöffnet waren, drangen Termiten, Eidechsen, Heuschrecken, handtellergroße fliegende Kakerlaken und manchmal sogar herrenlose, vom Hunger geschwächte Katzen ein. Auch Özgür war einmal hinausgeklettert und hatte versucht, sich durch diesen Dschungel zu kämpfen, aber sie hatte noch keine zwei Schritte getan, da waren ihre Hände und ihr Gesicht schon völlig zerkratzt. Obwohl sie wusste, dass kein Tier, das größer war als eine Katze, das Dornendickicht durchdringen konnte, erschreckten sie die nächtlichen Geräusche aus dem Garten zu Tode. Sie hatte kein Geld für einen Ventilator. Und der ausgesprochen geizige und halsabschneiderische Hausbesitzer Professor Botelho verweigerte seinen Mietern, obwohl er widerwärtig reich war, eine Klimaanlage, die hier ebenso lebenswichtig ist wie in Stockholm die Heizung. Er war der maßgebliche Berater des rechtsgerichteten Bürgermeisters, spielte sich wegen seines akademischen Titels und seiner rein europäischen Abstammung auf und war sehr darauf bedacht, vornehm und bedeutend zu erscheinen, wie es seinem eigenen und dem Rang seiner Vorfahren angemessen war. Obendrein war er auch noch Sauberkeitsfanatiker; er vergötterte Regeln, Ordnung und Formalien. Den der Straße zugewandten Teil des Gartens schmückte er mit griechischen Götterstatuen aus feinstem Marmor, mit Lampen, die aufdringlich an Paris erinnern sollten, und mit eleganten Treppen, die zwischen Bananenstauden und Mangobäumen zu schweben schienen. Doch die Art, wie er die Appartements eingerichtet hatte, offenbarte, dass seine goldglänzende Persönlichkeit nur Fassade war. In Özgürs Wohnzimmer hatte er ein riesiges, hässliches, steinhartes Bett, Aluminiumregale und ein kunstledernes Klappsofa gestellt, das aussah, als hätte man es aus dem Rathaus entwendet; zwischen all dem Gerümpel stand ein schwerer, wuchtiger Mahagonitisch mit acht Stühlen, die viel zu viel Platz wegnahmen. Auf dem Balkon hatte er außerdem die für Rios Häuser obligatorische Hängematte angebracht; an der Tür hingen auf Schnüre gefädelte Muscheln, die beim leisesten Windhauch ohrenbetäubend rasselten, denn nach einer brasilianischen Glaubensvorstellung, die ursprünglich aus Afrika stammt, bringen Muscheln Glück. An einer der grauen Wände, die unangenehme Assoziationen an die Korridore von Krankenhäusern oder Gerichtsgebäuden wachriefen, hing ein Schwarz-Weiß-Poster, das Professor Botelho im New Yorker Metropolitan Museum gekauft und aufwendig hatte rahmen lassen: die Nahaufnahme eines Paares, das sich küsst und dessen geöffnete Lippen leicht ölig schimmern. Früher einmal hatte Özgür die steife, verhaltene, fast förmliche Sinnlichkeit der Fotografie erregend gefunden. Sie sehnte sich danach, ihre Lippen auf die Lippen dieses krawattetragenden Mannes auf dem Bild zu pressen. Vor allem nachts, wenn sie ihre Einsamkeit in dieser so bedrückenden, erstickenden Atmosphäre des Hauses als ein von ihr unabhängiges, schwer zu zähmendes, überschäumendes, unkontrollierbares, fast zerberstendes Wesen wahrnahm. Nicht um ihn zu küssen, sondern wie ein hungriger kleiner Vogel, der sich nach dem Schnabel seiner Mutter reckt.
Ich bin allein in diesen halbwilden Gegenden, bin alleine und habe dieses ganz neue Gefühl von Freiheit und Isolation. (Einsam, allein, herrenlos, frei, verwaist … Im Türkischen kann ich nacheinander mehrere Adjektive dafür aufzählen, aber ich kann keine Brücke schlagen zwischen diesen Ausdrücken und der Wirklichkeit.) Es ist eine absolute, eine infernalische Freiheit, niemanden zu haben, der meine Bedürfnisse erahnt, ja nicht einmal einen Aufpasser zu haben. Ich kann irgendwelche Lügen in die Welt setzen, ich kann mir die Vergangenheit so zurechtbiegen, wie sie mir passt, und ich kann den sündigsten Fantasien nachhängen. In dem Moment, in dem ich merke, dass ich mir sicher bin, dass ich durch die Hintertür entwischen kann, bin ich fähig, die entsetzlichsten Verbrechen zu begehen. In einem Buch habe ich einmal gelesen, dass ein Kanarienvogel, dem man den Käfig öffnet, sofort herausflattert und zum Fenster fliegt. Wenn man ihm aber auch noch das Fenster aufmacht, tut er das einzig Richtige und fliegt – so der Autor – in seinen Käfig zurück, was ihn vor dem Tod bewahrt.
Manchmal jage ich einigen bruchstückhaften Erinnerungen bis an die andere Seite des Atlantiks hinterher. Im grellen Licht der Tropen verwischen oder, besser, verschwinden die Umrisse der Vergangenheit. Der Ozean, dieser tosende, stürmische, unsterbliche Ozean begrub all meine Meere unter sich. Das schrille Krächzen von Papageien löst jetzt mehr Assoziationen in mir aus als das Schreien der Möwen.
Filterkaffee zu trinken statt starken Tee, mit den Wellen des Atlantiks zu ringen statt im stillen, zurückhaltenden Binnenmeer so weit wie möglich hinauszuschwimmen, in einer romanischen Sprache zu träumen … Das sind Veränderungen, über die ich hinwegkommen konnte, aber es gibt auch solche, an die man sich niemals gewöhnt. Ich spreche nicht von launischen Gelüsten nach Schafskäse, Salbeitee und dem Bosporus. Ich sehne mich nach schlichteren Dingen, Kirschen zum Beispiel. Manchmal lege ich mich aufs Bett und träume von einer Schale voll dunkelroter Kirschen mit winzigen Eisstückchen darauf, fast ein erotischer Traum. So einfach, so unkompliziert, so schlicht. Ich sehne mich nach dem Wechsel der Jahreszeiten, danach, wie die Blätter, die sich erst Ader für Ader mit roten Linien schmücken, in Flammen aufgehen und mit dem Verglühen des Feuers vertrocknen und vergilben …Wie sie plötzlich eines Morgens keine Kraft mehr haben und majestätisch zu Boden sinken. Ich sehne mich nach ziellosen Spaziergängen mit blau gefrorenen Lippen, wenn mir der Nordostwind ins Gesicht peitscht, nach dem unvergleichlichen ersten Schluck eines verdammt guten und starken Tees, den man trinkt, wenn man die Kälte nicht mehr aushalten kann. Ich sehne mich sogar nach diesem schrecklichen Februarschnee, der mich früher immer angewidert hat, nach den verschneiten Buchenwäldern, Tundren und Steppen, die ich noch nie gesehen habe. Hier ist das Thermometer ganze sechs Wochen nicht unter vierzig Grad gefallen, und der Geruch von Lederjacken steigt mir in die Nase. Außerdem sehne ich mich danach, spazieren zu gehen, wann immer ich Lust habe, ohne meine Uhr in der Tasche verstecken zu müssen, ohne mich ständig umsehen und die Handtasche krampfhaft festhalten zu müssen, ohne mich vor einer Pistole zu fürchten, die mir irgendwer jeden Moment an den Kopf halten könnte. Ich sehne mich nach Schlaf, der nicht von Schüssen unterbrochen wird. Ich reiße meine Augen sperrangelweit auf, bin ständig auf der Hut, zünde immer wieder eine Zigarette an der anderen an, aber was ich auch mache, es gelingt mir nicht, das ständige Zittern meiner Lippen zu unterdrücken.
Trotz allem gibt es auch etwas, was ich gewonnen habe. Zum Beispiel muss ich keinen Ausweis mit mir herumtragen. In meinen Stammkneipen, die die ganze Nacht geöffnet haben, erregt es kein Aufsehen, wenn ich keinen Büstenhalter trage. An Tagen, an denen es über vierzig Grad heiß ist, trage ich sogar überhaupt keine Unterwäsche. Ich habe Faltenröcke, die knapp unterm Po enden, knallenge Shorts und Tangas, und ich liebe es, meinen eigenen Körper zu betrachten, der erst spät seine Weiblichkeit entwickelt hat. Es gefällt mir zu spüren, wenn meine Haare, die seit einem Jahr keine Schere mehr gesehen haben, wie bei wilden Fohlen auf dem Rücken hin und her schwingen. Wenn diese Stadt nicht so windstill wäre und ich meiner Wahrheitsliebe einen Augenblick entwischen könnte, hätte ich geschrieben: »Sie wehten im Wind.« Aber Rio ist völlig windstill, die Stadt hat keinen Atem, oder, besser gesagt, sie hat keine Seele. Ich kann in Restaurants, Bars oder auf Gehsteigen tanzen, in Bussen rauchen oder mit jedem beliebigen Mann schlafen. Hier habe ich den Freibrief, meine niedrigsten Triebe voll und ganz auszuleben. Wenn ich vierhundert Dollar übrig hätte, könnte ich einen Killer engagieren. Sehne ich mich etwa nach den Zwängen der Alten Welt, die ein Teil meiner Persönlichkeit, vielleicht auch ihre Stütze sind?
Flieg zurück in deinen Käfig, kleiner Kanarienvogel, flieg in deinen Käfig! Solange noch Zeit ist. Dieses offene Fenster ist dein Verderben!
Diesen Text fand sie beim Durchblättern ihrer alten Hefte zwischen Notizen zur Geografie und zur Beugung portugiesischer Verben. Sie musste ihn während ihrer ersten Trockenzeit in den Tropen geschrieben haben. Sie mochte diese Unschuld, diese kindliche Naivität, die sich hinter ihren Klagen verbargen. »Ich konnte meine Einsamkeit keineswegs besiegen«, dachte sie. »Aber ich bin anscheinend über sie hinausgewachsen – indem ich sie ganz fest umschlang, bin ich gereift. Wie einen Embryo trage ich sie nun in mir, sie liegt an meiner Brust wie ein Medaillon.«
Mit einem Bierglas voll strohgelben brasilianischen Tees, der nicht dunkler wird, egal wie lange man ihn ziehen lässt, saß sie vor ihrem Heft; sie kaute auf ihrem Stift, der zu einer Verlängerung ihres Körpers geworden war und ihr wie eine Prothese als dritte Hand diente, und hing dabei ihren Gedanken nach. Sie spürte, wie sich die Hitze des stickigen Zimmers auf ihren Körper legte, wie diese Hitze ihr Gewebe allmählich schmelzen ließ und es auflöste. Mal atmete sie schneller, mal langsamer; die Gedanken flogen wie blinde Fledermäuse wirr durch ihren Kopf, und nach jedem Schluck brach ihr der Schweiß aus allen Poren. Sie nahm den säuerlichen Geruch unter ihren Achselhöhlen wahr, den Geschmack billigen Tabaks in ihrem Mund und die Träger, die das Hauskleid, das an ihr klebte, so unbequem machten. Noch vor Einbruch der Nacht musste sie diesen »Nullpunkt«, komme, was wolle, beschrieben haben. Plötzlich fiel ihr auf, dass die Schießerei im Tal vorbei war und nun laut dröhnend der populärste Rap der Favelas gespielt wurde, Elle foi um bandido. (Er war zwar ein Bandit, aber ein guter Mensch.) Verwundert stellte sie fest, wie dieses Meisterwerk an Oberflächlichkeit sie berührte, und vor allem, wie es sie schmerzte, dass der Text von Vergangenem sprach. Der Song ließ sie den Tod dieses Banditen betrauern, den sie gar nicht kannte. Der Sänger hatte die kräftige, schwermütige Stimme eines Schwarzen, eine Stimme, die nach Schießpulver roch. Sie kam aus der Welt der Schnellfeuerwaffen und der zahllosen Tode, und Özgür wusste so sicher, wie sie ihren Namen wusste, dass auch dieser Sänger, genau wie sein Freund, einer dieser Banditen war, die nicht mehr lange zu leben hatten, dass auch er einer dieser guten Menschen war. Eine Erinnerung aus den vielen Gräbern ihres Gedächtnisses. Ein weiteres Lied, noch ein Lied, das tief berührte. Sie begann in den Seiten von Die Stadt mit der roten Pelerine zu blättern.
Der erste Tag in Rio
Rio empfing sie mit hoher Luftfeuchtigkeit und bleigrauem Himmel. Schon vom ersten Moment an lockte die Stadt die Reisende, die voller tropischer Träume war, auf die falsche Fährte. Nach achtzehn Stunden Flug sank sie in ein Taxi und hörte, vollkommen übermüdet und erschöpft, apathisch dem Fahrer zu. In seinem wirren Englisch wiederholte er ununterbrochen wie ein Papagei: »Rio schönster Ort der Welt, schönster Ort der Welt.« Kaum hatte sie sich eine Zigarette angezündet, da tauchten auch schon die Favelas auf. Tausende und Abertausende ineinander verschachtelter, verfallener, heruntergekommener Behausungen zogen sich Kilometer um Kilometer bis in Rios Zentrum hin. Hütten ohne Dächer, Baracken aus ungebrannten Lehmziegeln, Karton oder Wellblech; Labyrinthe, die knietief in einem Meer aus Schlamm versanken.
Es hatte nicht einmal eine Zigarette lang gedauert, da erteilte ihr Rio schon die erste Lektion. Das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen war, hatte sie vor einem der Abgründe des Lebens, vor dem schrecklichsten und tiefsten Elend, in das ein Mensch stürzen kann, bewahrt. Ein solches Elend hätte sie sich nie träumen lassen. Eine starke Vorahnung warnte sie leise, dass sie in einen entgleisenden Hochgeschwindigkeitszug gestiegen war und dass sie in dieser Stadt, die sich vom Leid der Menschen ernährt, zugrunde gehen würde. Aber dann hatten sie schnell das Zentrum und die Copacabana, den »schönsten Ort der Welt«, erreicht, und Rio de Janeiro fesselte sie mit all den betörenden Buchten, den wilden Abgründen und der tropischen Lebenslust. Die Favelas vergaß sie sofort wieder, genau wie es die Einwohner aus der Mittelschicht Rios auch tun.
Sie fuhr zur einzigen Adresse, die sie in Rio kannte, zur Wohnung des Professors. Man ließ sie spüren, dass sie nicht willkommen war, und wies ihr auch kein Zimmer zu. Stunden später hatte man dann doch Mitleid mit dieser blassen Fremden, die in einem Sessel eingeschlafen war, und bot ihr an, dass sie erst einmal im dunklen Dienstbotenzimmer auf der Hofseite schlafen könne.
Als sie vom Lärm der Trommeln wach wurde, war es bereits dunkel. Sie wusste nicht gleich, wo sie war – in Istanbul oder im Flugzeug? Rhythmen von etwa einem Dutzend gut harmonierender Trommeln, die so enthusiastisch, einzigartig und außergewöhnlich klangen, dass sie einen zu Tränen hätten rühren können. Eine eindringliche, schwermütige Männerstimme setzte ein. Sie konnte nur einem Schwarzen gehören, und sie konnte nur aus den Slums kommen. Diese Stimme schien alle Abgründe, alle Sümpfe und Peitschenhiebe des Lebens zu kennen. In diesem Moment fing Ö. an zu verstehen. Sie befand sich in den Tropen, an der Küste des Ozeans, an der Schwelle eines vollkommen anderen Lebens. Sie war in Rio de Janeiro. Am liebsten wäre sie ins nächste Flugzeug gestiegen und zurückgeflogen. Doch da war diese Stimme! Sie fühlte den tiefen inneren Drang, barfuß der Zukunft entgegenzurennen. Sie wollte ihr Schwert ziehen und mit ihrem Pferd an die grausame Front des Lebens galoppieren. Wahrscheinlich war dies das Gefühl, das man »Lebenslust« nennt.