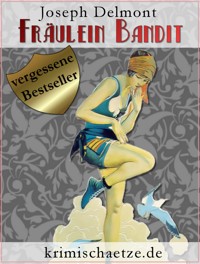Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Geheimer U-Boot-Stützpunkt. Der Kaiser ist geflohen. Das Deutsche Reich liegt in Scherben. Revolution im Reich. So beschließen, einige deutsche Offiziere und Mannschaften unter Führung ihres Kapitäns, ihre Visionen fern der Heimat umzusetzen. Abgeschottet von der Welt gelingen den Männern bahnbrechende Erfindungen. Als zum ersten Mal die neue Erfindung zum Einsatz kommt, beginnt die Jagd auf die Pioniere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Stadt
unter dem Meere
von
Joseph Delmont
_______
Erstmals erschienen im:
Verlag Fr. Wilhelm Grunow,
Leipzig, 1925
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung
© 2018 Klarwelt-Verlag, Leipzig
ISBN: 978-3-96559-185-1
www.klarweltverlag.de
εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης
Homer, Ilias XII. 243
Ein Wahrzeichen nur gibt es:
Das Vaterland zu erretten!
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
1
ichter blitzten überall auf. Laternen geisterten im Dunkel. Schreie hier und dort vermischten sich mit dem Rauschen der Brandung. Weit draußen auf der See irrlichterten Fackeln und Laternen in Booten, und am Horizont funkelten zitternde Lichter durch die Bullaugen eines Ozeanriesen, der westwärts zog.
„Emilia!“ „Emiiiliaa!“
Der Ruf erschallte aus allen Richtungen. Tiefe Männerbässe und schrille Frauenorgane trugen den Namen.
„Emilia!!“ Hell und laut erscholl eine Männerstimme. Der Ton war stark und doch in Angst gehüllt.
Ein kräftiger, hoch gewachsener junger Mann von etwa 25 bis 27 Jahren schwang zwei Fackeln in den Händen. Er stieß den Ruf mit voller Lunge ins Dunkel der Nacht.
Auf dem Inselchen zwischen Spotorno und Bergeggi flammte der Scheinwerfer auf. Milchig huschte der Lichtstrahl über die schwarzen Wellen.
Von Noli kamen die Fischerboote herüber. Die Aufregung wuchs.
„Die fünfte ist es. Die fünfte hat man gemordet!“
Alle schrien durcheinander.
Die Mutter Emilias warf sich kreischend auf den Felsen und schlug heftig mit dem Kopf auf den Stein:
„Mia carissima Emilia! Mia carissima Emilia! Mia povera ragazza!”
Der Strahl des Scheinwerfers rastete auf dem erhöhten Felsplateau. Fahl sahen die braunen Gesichter ans. Mit weit geöffneten Augen blickten alle ins dunkle Meer hinab.
Fischer mit Fackeln kletterten die Felsen herauf.
Die Mutter springt auf, stürzt den Männern entgegen. Bittend, mit gefalteten Händen, steht sie vor ihnen. Ihre Lippen zittern.
Die Männer senken die Köpfe, zucken die Achseln. Einer bekreuzigt sich, die anderen folgen seinem Beispiel.
„Die fünfte ist’s! Fünf sind in kurzer Zeit verschwunden!“ Einer stößt es scharf hervor. Andere fallen mit Entsetzen in den Ruf ein.
„Fünf! Fünf unserer besten und schönsten Mädchen!“
Ein großer bartloser Fischer reißt seine Tochter herum. Mit Grauen im Blick und halb offenem Munde hört sie zu und bekreuzigt sich unbewusst, ununterbrochen. „Nach Hause mit dir. Ins Bett und den Riegel vorschieben. Morgen lasse ich das Fenster deiner Kammer vergittern!“ Er stößt das Mädchen vor sich her und verschwindet mit ihr im Dunkel. Das Lichtfünkchen in der Laterne tanzt wie wahnsinnig in der Hand des furchtsamen Vaters.
“Mia povera ragazza! Mia Emilia!“ Schrill klingt die Stimme der Mutter. Schauerlich hallt das Echo von den Felsen zurück.
Der junge Mann mit den zwei Fackeln tritt auf die Schreiende zu und versucht, sie zu beruhigen. Sie stößt ihn zurück, läuft zum Felsrand, will sich hinabstürzen. Die Fischer packen die Rasende und halten sie fest.
Das langgezogene Heulen einer Sirene durchschneidet das Dunkel der Nacht. Alle wenden den Kopf dem Meere zu.
Lichter und Scheinwerfer schaukeln auf dem Wasser.
Das Zoll- und Polizeiboot von Savona durchschneidet in rascher Fahrt die schwarzen Wellen. Von der kleinen Insel hat man herübergefunkt und das Verschwinden Emilia Rossis gemeldet.
Alles klettert zum Strand hinab.
Der junge Mann hält die Mutter Rossi umschlungen. Sie schluchzt: „Francesco, warum bist du heute Abend so lange weggeblieben? Warum? Emilia hatte keine Ruhe und wollte dich am Felsen erwarten!“
„Ich habe meine Fische nach dem großen Hotel in Spotorno gebracht und habe auf dem Rückweg schlechten Wind gehabt.“ Er holte tief Atem. „Oh, meine Emilia, meine Emilia.“
2
as ganze Land war in Aufregung. Innerhalb dreier Monate waren vier Mädchen und eine junge Kriegerwitwe aus der Gegend plötzlich und spurlos verschwunden.
Eine aus einem kleinen Dorf bei Cimola, zwei aus der Nähe von Bergeggi, eine aus Pia und heute Emilia Rossi.
Alles ganz arme Mädchen. Auch die Kriegerwitwe war als sehr arm bekannt.
Anfangs beschäftigten sich nur die Lokalbehörden mit dem Verschwinden der ersten Zwei. Später nahm die Polizei von Savona die Sache in die Hand und jetzt wurde bereits Rom alarmiert.
Alle möglichen Vermutungen wurden laut. Man sprach von einem geheimnisvollen Mörder à la „Jack the ripper“. Einzelne wollten ein Ungeheuer aus dem Meere haben kommen sehen, das mit 30 bis 50 Meter langen Fangarmen wie ein Oktopus seine Opfer ins Meer gezogen.
Diesen Aussagen wurde von den Behörden keine Beachtung geschenkt, alle Hypothesen dieser Art kamen nicht in Frage. War doch das Mädchen aus Cimola gar nicht in die Nähe des Meeres gekommen. Cimola lag weit über fünf Wegstunden vom Meere entfernt.
Seit Wochen waren Streifen zu Wasser und zu Lande unterwegs. Nichts, auch nicht die geringste Spur von Räubern ward entdeckt.
Selbstmorde der Verschwundenen kamen nicht in Betracht. Alle fünf waren als lebenslustig bekannt.
Die Regierung in Rom sandte gepfefferte Noten an die Polizeichefs von Genua und Savona.
In allen Orten entlang der ligurischen Küste, von Genua bis Ospedaletti westwärts und bis Livorno südöstlich, wurden Spezialwachen und Streifen eingerichtet. Hohe Preise wurden für die Ergreifung der Täter ausgesetzt.
Die ersten vier Opfer waren an ein und demselben Tage verschwunden. Zunächst wusste man nur von den zweien aus Bergeggi; erst nach einigen Tagen stellte es sich heraus, dass auch die beiden anderen am gleichen Tage verschwunden waren.
Die Zeitungen und Plakatsäulen in den Städten, die Aushängetafeln auf dem Lande brachten Bilder mit genauen Beschreibungen; die Lichtbildtheater stellten sich in den Dienst der Sache. Alles blieb vergebens.
Wohl liefen hier und da Anzeigen ein, dass man die Vermissten gesehen; aber in allen Fällen erwiesen sie sich als falsch.
Nach dem Verschwinden Emilias wurden Torpedoboote von Spezia und Genua in die Zone beordert. Ebenso wurde Militär zur Verstärkung der Gendarmerie abkommandiert.
Zu Wasser wurden Tag und Nacht Streifen veranstaltet.
Scheinwerfer spielten ununterbrochen an den Felsen und auf den Wellen. Berittene Karabinieri und Bersaglieri1 suchten die ganze Gegend ab.
Viel lichtscheues Gesindel wurde festgenommen und musste wieder freigelassen werden. Alle Verbrecher verschwanden aus der Gegend.
Die Pascher , die es jetzt unmöglich fanden, auf dem Wasserwege von und nach Frankreich ihre lohnende Schmugglertätigkeit auszuüben, fluchten.
Alles war und blieb vergebens.
Von den Verschwundenen wurde weder eine Spur noch ein Lebenszeichen erlangt.
Auch ihre Leichen konnten nicht gefunden werden.
1 Infanterietruppe des italienischen Heeres
3
„ände hoch! Wer einen Schritt tut oder Miene macht, die Hände zu bewegen, den knalle ich nieder wie einen tollen Hund.“
Die Matrosen blieben in der Mitte des Felsendomes mit erhobenen Händen stehen.
Kapitän Mader stand mit schussbereiter Parabellumpistole an einem großen Steintisch. Hinter ihm und an beiden Seiten waren einige Marineoffiziere, Unteroffiziere und Mannschaften aufgestellt. „Schröder! Sind Sie des Teufels?! Haben Sie Ihren Schwur vergessen? Hindert Sie irgendjemand, in die Welt zurückzukehren?! Treten Sie vor! Nehmen Sie die Hände herab!“
Ludwig Schröder tritt vor. In seinem Gesicht kämpfen Trotz und Verlegenheit. Er blickt scheu auf den Offizier und senkt gleich darauf die Augen.
„Ich dachte, Herr Kapitän, weil doch die vier anderen Mädchen — — — !“
„Haben Sie nicht gedacht, was Sie anrichten, Schröder? Ist nicht schon genug Geschrei wegen der anderen Vier? Sind wir denn Menschenräuber?!“
Schröder bewegt nervös die Finger an seinen Hosenbeinen hin und her.
„Doktor! Bitte sehen Sie zu, ob das Mädchen schon bei Bewusstsein ist.“
Doktor Katzberg begab sich eiligst nach rückwärts in den Dom. Kapitän Mader gab das Kommando zum Wegtreten.
Langsam ließen die Leute die Arme sinken und verteilten sich in dem Raum.
Mader winkte Schröder zu sich und ging mit ihm nach der Seite hin ab.
4
er Raum, in dem sich die vorher geschilderte Szene abspielte, war ein mächtiger, hoher Felsdom. Durch einige Bogenlampen erleuchtet.
Die Wände glitzerten von Katzengold und Glimmerschiefer. Vieltausendjähriges Porphyrgestein bildete die Felswände. Mächtige Tropfsteingebilde, Stalaktiten und Stalagmiten, Jahrtausende alt, standen am Boden oder hingen von der Decke herab.
5
m August 1916 kreuzte Kapitänleutnant Mader mit seinem U-Boot im Mittelländischen Meere.
U. 10 war kein Kampfboot, sondern eine schwimmende Werkstätte. U. 10 hatte Schienenvorrichtungen an Steuer- und Backbord für invalide U-Boote, die an seiner Seite festgemacht werden konnten, um an ihnen entweder die Reparatur an Ort und Stelle vorzunehmen, oder mit dem kranken Kameraden an gesicherter Stelle zu landen. Auch mussten U-Boote geschleppt werden.
Am 9. August, morgens gegen 5 Uhr, bei unsichtigem, diesigem Wetter schlüpfte U. 10 unter dem Minenkranz des Golfs von Genua durch, wo an der riffigen Küste zwischen Spotorno und Bergeggi, in der Tiefe von zehn Metern ein flacher Felsen lag, an dem vor einiger Zeit durch die zwei geschicktesten Taucher der U-Bootflottille, Schröder und Maxstadt, eine Verankerungsvorrichtung für U-Boote nach monatelanger schwerer Arbeit fertiggestellt worden war. Die Boote wurden dort festgemacht und repariert, soweit dies unter den gegebenen Umständen möglich war.
Als das Boot die kleine Insel unweit Spotorno passierte, konnte man durch die neue, sinnreiche Wasserradio-Vorrichtung die Kommandos der ablösenden Wachen auf der Insel ganz deutlich vernehmen.
Kapitänleutnant Mader stand am Steuer und sichtete mit dem Unterwasserperiskop, dem ein Scheinwerfer den Weg auf fünfzig Meter vorleuchtete.
Der Ankerfelsen kam in Sicht und sachte legte sich U. 10 auf dem glatten Felsen fest.
Die Maschine stoppte. Die Mannschaften machten sich an ihr Frühstück und verteilten sich rings auf ihren Plätzen.
Kapitänleutnant Mader stellte Periskop und Steuer fest, gab dem jungen Leutnant Gerber einige Befehle, als er plötzlich stockte und taumelte. Auch einige Matrosen rollten nach achtern aus. Mader sprang zum Steuerapparat. Im gleichen Augenblick legte sich U. 10 ganz backbord und ging kielhoch, so dass alle losen Gegenstände herumkollerten, dann trieb das Boot ab. Es hatte sich von seiner Verankerung losgerissen.
Plötzlich wurde das Boot hin und her geschleudert. Wer sich nicht festzuhalten vermochte, schlug der Länge nach hin.
Alle glaubten, eine Mine wäre an das U-Boot herangetrieben und explodiert.
Mader hielt sich am Steuerapparat fest. Das Unterseeperiskop gab keine Auskunft. Der Scheinwerfer warf trotz Umschaltens kein Licht. „Kurzschluss oder kaputt“ schrie der den Apparat bedienende Maschinist.
Plötzlich beruhigte sich das Boot wieder. Die Magnetnadel drehte sich im Kreise.
Mader blickte auf seine Uhr. Sie stand still. Der Zeitmesser rückwärts über dem Pumpgehäuse ging auch nicht mehr.
Leutnant Gerber zog seine Uhr, — sie war ebenfalls stehengeblieben.
„Auch meine Uhr geht nicht,“ schrie Obermaschinenmaat Möller.
„Seebeben”, sagte kurz Kapitänleutnant Mader und gab Befehl, die Maschinen anzulassen.
Der Tiefenmesser zeigte 18 Meter.
Das Boot trieb an, schwankte aber immer noch ein wenig.
Die Magnetnadel im Kompass begann sich wieder wie rasend im Kreise zu drehen.
An ein Dirigieren des Bootes war nicht zu denken. Mader befürchtete, dass das Schiff gegen die Riffe getrieben werde und dort starke Havarie erleiden könne.
Die Magnetnadel stand abermals still.
Die Mannschaften blickten ängstlich aus allen Ecken aus ihren Kommandanten.
Mader, sich seiner Verantwortung voll bewusst, beschloss, nach oben zu gehen.
Plötzlich spürte man, wie das Boot steuerbord an dem Felsen entlangstrich. Es gab ein klirrendes Geräusch, das bald wieder verstummte.
Mader gab Befehl, die Wasserventile zu öffnen.
Langsam hob sich das Boot.
Aufmerksam beobachtete der Kapitänleutnant den Periskopspiegel.
Alles schwarz. Sollte das Rohr oben abgebrochen sein?
Es musste doch längst über dem Wasser sein.
Die Tiefenmesser zeigten nur mehr zwei Meter Tiefe an.
Langsam hob sich das Boot weiter.
Nach kurzem Schwanken lag es still.
Der Periskopspiegel blieb schwarz.
Jetzt hieß es, achtgeben. Ist das Wetter noch unsichtig, dann sind Möglichkeiten vorhanden, unbeobachtet vom Feinde, über Wasser zu bleiben. Hätte die Insel- oder Landwache das Boot entdeckt, so würde man schon zu feuern begonnen haben.
Auch das Radio-Horchperiskop gibt nur ein plätscherndes leises Wellengeräusch wieder.
Als nach weiteren fünf Minuten alles ruhig bleibt, gibt Mader den Befehl, die Einsteigluke zu öffnen.
Die dazu kommandierten Matrosen klettern in den Tubus.
Leise und langsam öffnet sich der Deckel des Turmes.
Der eine Matrose kreischt auf: „Die Welt ist untergegangen. Alles ist schwarz und eiskalt!“
Mader befiehlt ihm, nicht so zu schreien und herabzusteigen.
Schreckensbleich kommen die beiden Leute die Steigleiter herunter.
Mader klettert selbst nach oben, er fühlt den Rand des Turmes, doch sehen kann er nichts! Es ist stockdunkel.
„Möller, schalten Sie die Decklichter ein!“
Nichts brennt.
Möller wechselt die Sicherungen. Das Decklicht brennt, doch durchdringt es nicht die Finsternis.
„Den kleinen Handscheinwerfer herauf!“
Die Steckdose knackt, als Möller die Stifte hineinschiebt. Neben Mader steht ein Matrose mit dem kleinen Handscheinwerfer und schraubt die Kohlen auseinander. Der Lichtkegel fällt über den schwarzen Wasserspiegel und beleuchtet weit hinten feuchte, glitzernde Felswände.
Mader dirigiert den Lichtkegel nach oben.
Auch dort, vielleicht in vierzig Meter Höhe funkelt eine große Felsenkuppe.
Jetzt wusste Mader Bescheid.
Sie waren durch einen Unterwasserkanal in eine Riesenfelsenhöhle getrieben.
Mader gab Befehl, den großen Scheinwerfer spielen zu lassen.
Der grelle große Lichtkegel zeigte die Riesenausdehnungen des Höhlensees. Weit über fünfhundert Meter zog er sich der Länge nach hin, während die Breite mindestens dreihundert Meter maß. Die Tieflotung ergab fünfzig Meter und darüber.
Die ganze Mannschaft stand an Deck und starrte offenen Mundes dieses unterirdische Wunder an.
Mader kommandierte jetzt, dass das Boot in Betrieb gesetzt werde.
Langsam wurde die Rundfahrt begonnen. Überall waren Nebenhöhlen; auch ein Platz wurde gefunden, wo man an „Land“ gehen konnte. Stets blieb dieselbe Tiefe.
Mader, gefolgt von zwei Leuten mit Strichen, Werkzeugen und Taschenlampen, sprang auf ein Felsplateau.
Hier war, nur durch geringe Unebenheiten unterbrochen, eine Fläche von dreißig bis fünfunddreißig Meter Breite. Seitlich davon drang Mader mit seinen Leuten in einen riesigen Dom ein. Mächtige Tropfsteingebilde hingen von der Decke herab oder standen am Boden. Schneeweiß.
Stalaktiten- und Stalagmitengebilde bizarrster Säulen, hunderttausende von Jahren alt. Alabasterweiß.
Tropfen, in unregelmäßigen Intervallen durch mehr als hunderttausend Jahre herniederfallend, brachten diese Säulen von zwei bis drei Meter Umfang zustande.
Kleine Stalagmiten kauerten wie Gnome und tückische Zwerge am Boden.
Dort sprang eine weiße Hexe mit krummer Hakennase und fliegenden Haarsträhnen aus der Mauer. Nur der Besen fehlte.
Ein wunderbares, vorhangartiges Gebilde mit Spitzen am Rande, wie von einem großen Künstler erzeugt, hing hier an der Felsenmauer.
Jetzt sah man ein Meer von kurzen Stalagmiten, wie ein Kinderkirchhof.
Weiß. Wie mit Schnee überzuckert.
Dort lagert eine Riesensäule, die umgekippt, gestürzt, einen Durchgang bildet.
Sie ruht auf zwei mächtigen Stalagmitenstümpfen und neue Gebilde haben sich an der gebrochenen Größe geformt, die den wunderbarsten italienischen Alabasterarbeiten gleichen.
Und jetzt, o Wunder!
Ein klarer, zwei Meter breiter Bach stürzt über eine Silberwand in einen kleinen See hinab.
Blinde Molche, rosig gefärbt, schwimmen träge in dem eisig kalten Wasser.
Warm, fast zu warm, ist es in dieser Höhle, die zweihundert Meter tief unter dem Monte Alti liegt.
Mader richtet seinen Weg nach der Bussole1 und findet sich damit zurecht.
1 Kompass
6
ls Mader auf U. 10 zurückgekehrt ist, sind die Reparaturen beendet.
Manches konnte nur notdürftig geflickt werden.
Die Mannschaften harren am Plateau und betrachten forschend ihren Kommandanten.
Alle Arbeit wird auf Befehl Maders eingestellt.
Im Halbkreis umstehen ihn die Leute.
„Wir sind durch ein Elementarereignis in ein vielleicht zwei bis drei Jahrhunderttausende altes Wunder der Mutter Natur geraten. Ohne dieses Seebeben hätte vielleicht nie eines Menschen Fuß diese Stelle betreten.“
Schweigend und gespannt horchen die Leute.
„Die Strömung hat uns hier hineingetrieben. Wir müssen jetzt versuchen, zurückzufinden!“
Alter Augen haften an Maders Mund. Von den Wänden des Domes hallen die letzten Worte lauter wieder, als sie gesprochen wurden.
Obwohl unerschrocken, tapfer und sorgfältig ausgesucht, sind die Leute sich der gefährlichen Lage bewusst und in manches Auge kommt Angst. Auch das mutigste Herz schlägt schneller.
„Können wir auf dem Unterseewege unseren Ausweg nicht finden, so müssen wir versuchen, durch den Berg hindurch zu kommen. Ob dies möglich sein wird, kann ich jetzt nicht sagen. Versuchen müssen wir beides.“
Die Leute hören atemlos zu.
„Wenn uns diese Wege verschlossen sind, — — — dann müssen wir uns in das Schicksal ergeben. — — Noch ist es nicht so weit. — — — Die Luft ist klar und nicht ungesund. Verpflegung ist für sechs Wochen und noch länger vorhanden, wenn wir die Vorräte einteilen. Betriebsstoff für Licht haben wir genug, um auf Wochen die Akkumulatorenbatterien zu laden. — — — Und jetzt, alle Mann an Bord!“
In geordneter Ruhe ging der Einstieg vonstatten.
Als Letzter hantelte sich Mader die Steigleiter herunter.
Er blieb im Kommandoturm und begab sich zur Steuerungsanlage des Hauptruders.
Der Befehl zum Klarmachen erging.
Der Deckel zur Einsteigluke schloss sich. Die Positionslaternen außen am Boot erloschen.
Der Rohölmotor begann auf langsame Fahrt zu arbeiten.
Der angeschlossene Elektromotor fing an zu brummen und zu surren, und der mittlerweile wieder in Stand gesetzte Unterseescheinwerfer warf knallend seinen Strahl ins schwarzgrüne Wasser, den Weg auf dreißig Fuß erhellend.
Im Kampf zwischen Licht und Finsternis siegte diese.
Mader starrte auf das durch die Sehschlitze geworfene Bild. Fast nichts war zu erkennen.
Langsam schob sich U. 10 durch die Flut.
Mader ließ das Boot auf 12 Meter Tiefe herab.
Langsam, mit äußerster Vorsicht wurde gefahren.
Kein Mensch wagte, ein Wort zu sprechen.
Überall standen die Leute auf ihren Posten. Es ging ums Leben. Der Antriebsvorrichtung für das Tiefenruder ward besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
In den Herzen und Hirnen der Besatzung arbeitet es fieberhaft.
Zurück wandern die Gedanken zur Kindheit, zum Elternhaus, zu Weib und Kind, zur Geliebten. Manch ein Schwur und Gelübde ward da im gepressten Herzen laut, manche Bitte um Vergebung für ein erkanntes Unrecht rang sich aus dem Inneren.
Der Antriebsmotor singt jedem ein anderes Lied. Die erhitzte Phantasie lässt Rufe Angehöriger vernehmen. Man will Glocken, Straßenbahnen, Autohupen und alles Mögliche gehört haben.
Einer, der sich nie im Leben um Kinder gekümmert hat, Gustav Bender aus Altona, hört plötzlich Kinderlachen und Kinderstimmen.
Langsam schiebt sich U. 10 durch die nachtdunklen Wassermassen.
Maders Augen brennen. Sein Kopf fängt an zu schmerzen.
Am Maschinentelegraph steht Marinefähnrich Ulitz.
Ulitz ist ein Jüngling von 21 Jahren. Immer lustig und zu allen möglichen Streichen aufgelegt. Er ist der Sohn einer unermesslich reichen rheinländischen Großindustriellenwitwe.
Mit heller Stimme gibt er die Kommandos Maders nach dem Maschinenraum weiter.
Endlos scheint die Fahrt zu sein.
Der Maschinentelegraph arbeitet.
Mader befürchtet, dass er die Felswände anrennt. Sein Gehirn arbeitet krampfhaft.
Das Kommando „zurück“ erschallt immer häufiger.
Das Schlimmste ist bis jetzt vermieden.
Auf allen Posten herrscht große Nervosität.
Obermaschinenmaat Möller ist ruhig und gibt die ihm zugerufenen Befehle mit klarer Stimme weiter.
Sein Häuschen in Stade fällt ihm plötzlich ein. Er sieht seine alte Mutter, die besorgt in dem kleinen Gemüsegarten umhergeht. Bei jeder Staude, jedem Beet, jedem Baum denkt sie an ihren Jung’. Nie hat gemerkt, wie lieb er seine Mutter hat. Unwillkürlich werden seine Augen nass.
Zornig und unwillig fährt er sich mit dem Handrücken darüber. Die Gedanken Maders sind ganz von dem Suchen nach dem Ausweg gefangen. Er kämpft gegen andere Ideen an, die unwillkürlich in seinem Hirn aufsteigen. Fort damit! Menschenleben sind in Gefahr. Keine Sekunde darf er sein Sinnen Hertha von Zöbing weihen.
Immer noch sucht U. 10 den Kanal, den Tunnel, durch den es in diese finstere Unterwelk getrieben worden ist.
Tastend fühlt sich das Boot vorwärts.
Man muss mindestens schon zwei- bis dreimal im See gekreist haben. Die Mannschaften geben Signal um Signal, das vom Kommandantenturm kommt, weiter.
Bei den Motoren, in den Mannschaftslogis, bei den Reguliertanks und den Oeltanks, überall horcht man auf die Befehle. Möller beginnt einen alten Gassenhauer vor sich hinzusummen.
„Up de Reeperbahn
Dor is’n Ding passiert,
Dor hett ne olle Zeech
Mit ne Gans poussiert.“
Mader ruft Ulitz mit überlauter Stimme plötzlich ein Kommando zu.
Ulitz hat sich eben in Gedanken vorgestellt, wie er als erstickter Leichnam aussehen würde. Nein, ersticken möchte er nicht. Lieber vorher eine Kugel, solange noch die Kraft dazu vorhanden ist.
Steuerbord! Back! Back!
Schrill gehen die Klingelsignale.
Erschrocken hat Ulitz das Kommando gegeben.
Ein Knirschen und Reiben wird von Backbord außen hörbar.
Mader dreht langsam nach links. Das Knirschen hört auf.
Alles lauscht beklommen.
Die Mannschaften stecken ihre Köpfe zum Tiefensteuerraum hinein. Von hier aus bekommt man alle Nachrichten zuerst. —
Kommando folgt auf Kommando. Mader hat jetzt den Ausweg entdeckt, einen breiten Tunnel mit langen Windungen, die Wände vom Wasser zerfressen.
Der Kompass zeigt W.S.W.
Die Spannung im Boote ist aufs Höchste gestiegen.
Mader will noch keine Auskunft geben.
Vielleicht ist es ein anderer Weg.
Sein Auge leuchtet plötzlich auf.
Der Scheinwerferkegel ist länger geworden, das Wasser durchsichtiger.
Das Licht kommt von oben.
Das ist der Tag.
„Wir sind heraus!“ schreit Mader Ulitz zu.
Im nächsten Augenblick geht der Ruf von Mund zu Mund. Die Spannung löst sich von den Gesichtern.
Willy Reimer, ein alter aktiver Diener, dem das Land nur auf acht bis zehn Tage, von Zeit zu Zeit, Vergnügen bieten kann, nimmt einen Schluck Wasser und vergisst vor Freude, das Achtelpfund Priem aus der rechten Backe zu nehmen.
Die Kommandos erfolgen seltener.
Bis auf zehn Meter Tiefe ist U. 10 hochgegangen.
Mader will den Platz nicht verlassen. Ein großer Plan ist in seinem Kopfe gereift.
Er kennt jetzt den Weg und will ihn nochmals befahren.
Der alte Neptun wird helfen, und nun ist der Weg leichter zu finden.
Wieder taucht U. 10 auf achtzehn Meter hinab.
Die Leute können es nicht glauben, dass ihr Kommandant nochmals in die Höhle zurück will.
„Wat sall datt?“ fragt sich Möller.
Gewohnt, zu gehorchen, und im Vertrauen zu dem geliebten Führer, werden die Befehle ausgeführt.
Ganz langsam geht die Fahrt.
Zwölf Meter Tiefe.
Langsam tastend.
Die Einfahrt ist gefunden.
Die Positionslichter werden eingeschaltet.
Der große Scheinwerfer lässt seine Strahlenbündel durch die dunkle Flut gleiten.
Viel kürzer ist der Weg jetzt.
Periskop und die obere Positionslampe davor gehen hoch.
Beide brechen wie Streichhölzer plötzlich ab.
Die Ventile werden geschlossen.
Die Tauchtanks entleeren sich.
Das Boot steigt. Steht.
„Schröder!“
„Befehl — Herr Kapitänleutnant?“
„Schröder! Sie und Reimer bereiten Aluminium- und Weißphosphorfarbe. Dort, wo wir den Wasserspiegel wieder erreichen, über dem Ausgange des Unterseehohlkanals Zeichen machen! Groß! Mit Pfeil! Mehr Phosphor als Aluminium! Verstanden?!“
„Befehl, Herr Kapitänleutnant!“
Die Einsteigluken fallen zurück.
Die Positionslaternen bezeichnen den Platz, wo das Boot aus der Tiefe kam.
Schröder und Reimer ziehen das Faltboot hoch.
Der kleine Scheinwerfer spielt an der Rückwand des Felsens.
Mader behält einen senkrechten Spalt, der sich wie ein Hochgebirgskamm hinzieht, im Auge. Darunter ist der Tunnel.
Maxstadt wird in Taucherkleidung kommandiert. Schröder zurückbeordert.
Willy Reimer fährt mit einem anderen Matrosen auf den Spalt zu, auf dem der Scheinwerfer spielt.
Breite, weißleuchtende Pinselstriche ziehen sich an der feuchten Felswand herab.
Das große Beiboot ist flott. Schröder und Maxstadt in Taucherausrüstung, besteigen es mit der Taucherbegleitmannschaft. Das U-Boot dreht langsam bei. Die Luftpumpe beginnt zu arbeiten, der Sauger wird neben der Steuerungsanlage auf der Kommandobrücke klargelegt.
Reimer hat sein Malwerk vollendet. Die Farbe trocknet nur langsam auf der feuchten Wand. Der Strahl des Scheinwerfers wärmt die Stellen.
Das Beiboot hält an dem Spalt im Felsen. Das Wasser ist ruhig, und man zwängt den Bug des Bootes in den Spalt.
Die Luftpumpe für die Taucher arbeitet mit voller Kraft.
Schröder geht als erster in die Tiefe.
Alle Mann sind auf Deck und gespannt wartet man auf Schröders Signal zum Hochziehen.
Mader befiehlt, eine große leere Eisentonne auszupumpen und zu verlöten.
Schröder hat Signal gegeben und kommt hoch.
Nachdem ihm der Helm abgenommen, berichtet er:
„Zuerst fällt die Wand steil ab, dann folgen Einbuchtungen, und in vier Meter Tiefe kommt ein breites Plateau, ganz mit besonderer Muschelart bekrustet.“ Schröder zeigt eine Muschel, die er losgebrochen.
„Unter dem Plateau beginnt der Tunnel. Messungen konnte ich nicht machen, da ein längeres Verweilen unten unmöglich war.“ Die Muschel hatte eine besondere Form. Sie sah wie eine ovale Frucht aus, war faustgroß und besaß in ihrem Innern zwei Kammern, jede von einem anders geformten Muscheltier bewohnt. Während in der kleineren Kammer die schleimigdicke Masse gelblich war, hatte die in der größeren eine grellrote Farbe.
Die aus der Eisentonne verfertigte provisorische Boje wurde mittels Ankerketten und Klemmen an der Felsspalte unter der bemalten Fläche fest verankert.
Jetzt kommt Maxstadt, der mittlerweile getaucht hatte, einen riesenhaften Seestern, der in allen Farben schillert und im Dunkeln am ganzen Körper phosphoresziert, in der Hand haltend, nach oben.
Kapitänleutnant Mader hat inzwischen Messungen veranstaltet und den Kompass überprüft. Alles wird genau zu Papier gebracht.
U. 10 taucht und findet diesmal seinen Weg leichter in die Außenwelt.
7
m Marineministerium wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt.
Mader stand vor dem Marineminister und Obersten Chef der Flotte.
Der Plan des Kapitänleutnants war gigantisch. Seit dreiviertel Jahren schon zogen sich die Verhandlungen ergebnislos hin.
Endlich hatte Mader es durchgesetzt, selbst gehört zu werden.
Man war über das persönlich Berichtete höchst erstaunt. Bis jetzt hatte es eine Kamarilla zu verhindern gewusst, dass der Kapitänleutnant persönlich seine Pläne darlegte.
8
in Konteradmiral mit einem großen technischen Stab begleitete U. 10 und U. 79 zum Golf von Genua.
Nachts auf hoher See, bei stürmischem Wetter, nahm Kapitänleutnant Mader den hohen Vorgesetzten nebst den Technikern an Bord von U. 10.
Am folgenden Morgen erreichte U. 10 den Golf von Genua und schlüpfte wie immer unter der Minenkette durch, schwamm den Wassertunnel entlang und hob sich im großen Dom an die Oberfläche.
Der Konteradmiral kam aus dem Staunen nicht heraus.
Mader halte im verflossenen Halbjahr eine Lichtleitung in dem großen Dom und den anschließenden Räumen legen lassen. Die Kabel wurden an die Dynamos im U. 10 angeschlossen.
Neun große Höhlen lagen in einer halbkreisförmigen Strecke von zwölf Kilometern Länge.
Auf dem Plateau hatte Mader eine kleine Reparaturwerkstätte eingerichtet.
Die Höhlen waren Wunder, wie nur die Natur sie zu schaffen vermag.
Alle hatten Namen oder Zahlen erhalten.
In Nummer 4 fiel ein großer Wasserfall zwanzig Meter in die Tiefe.
Durch die Höhlen 5, 6 und 7 ging ein reißender Bach von 7 bis 10 Meter Breite. Das Wasser war an manchen Stellen tief. Trinkbares, eisiges, keimfreies Quellwasser.
In Höhle 8 gab es drei heiße Springquellen, die in Zeitabständen von genau sechs Minuten dicke, heiße Wasserstrahlen bis zu neun Metern hochschleuderten.
9
echs U-Boote folgten Mader, zwei Monate nach der Besichtigung durch den Konteradmiral, nach dem Mittelmeer.
Mit jedem U-Boot fuhr Mader in die Höhle, die Kommandanten genau in der Fahrtrinne unterweisend.
Jedes der U-Boote barg große Mengen von Maschinenteilen und Baumaterialien und war mit einer Anzahl von Arbeitern bemannt.
Ungeheure Vorräte an Lebensmitteln wurden mitgeführt.
Die Arbeiter entluden im Verein mit der Mannschaft die Boote. Alle Boote kehrten den Weg ins Freie zurück, und als letztes fuhr Kapitänleutnant Mader sein U. 10 in die Höhle, nachdem er das sechste Boot sicher ins Freie gelotst hatte.
U. 10 brachte einzelne Möbelstücke und sogar drei Lebewesen. Maders Foxterrierhündin „Nelly“, Möllers Kanarienvogel und — — — — eine Milchziege.
10
och vor seiner letzten Ausreise hatte Mader Hertha von Zöbing, seine Verlobte, ausgesucht und ihr erklärt, dass er vor Kriegsende nicht mehr auf Urlaub käme. Hoffentlich werde das Völkerringen bald ein Ende nehmen.
Hertha saß ihm gegenüber und sprach nichts. Ihre Augen blickten weit geöffnet mit fragendem Ausdruck auf ihren Verlobten. Sie wollte keine neue Auseinandersetzung. Fast ein Jahr hatte sie ihn nicht mehr gesehen und in Furcht gelebt, wenn die Nachrichten länger als gewöhnlich ausblieben.
Sie konnte und wollte nicht begreifen, dass Millionen von Menschen aufeinandergehetzt wurden, sich mit den schrecklichsten Mordinstrumenten töteten oder zu Krüppeln machten.
Sie hatte weder jetzt Umgang mit den sogenannten Volksbeglückern, die seit Jahren von einer Weltverbrüderung schrieben, noch hatte sie je mit diesen Leuten zu tun gehabt.
Ihr gesunder Sinn sagte ihr, dass es doch einen menschlicheren Weg geben müsse, um internationale Gegensätze oder Konflikte zu regeln.
Niemals dachte sie weiter, oder besser gesagt, tiefer, und immer sah sie nur die zeitlichen Folgen des Völkerringens. Sie beteiligte sich auch nicht an den Siegesfeiern, da ihr die unendlichen Qualen der Verwundeten und Vermissten vor Augen waren. Sie sah die Lazarettzüge von ihrem Fenster aus, wie sie vom Westen kommend, in den Bahnhof einfuhren.
Die besonders gekennzeichneten Feldpostwaggons hatten etwas Grauenhaftes für sie. Wie viele Unglücksnachrichten bargen diese schwarzen Riesenbriefkästen aus Rädern. In ein, zwei, drei Tagen haben Mütter, Bräute, Kinder die Nachricht von der Verwundung, Verkrüppelung oder vom Tode ihrer Nächsten. „Gefangen“ steht in manchem dieser Unglücksschreiben, oder was noch tausendmal schlimmer ist: „Vermisst!“ Diese peinigende Ungewissheit. Dieses Krebsgeschwür der Hoffnung, das tausendmal täglich das Herz zerreißt.
„Hertha! Hertha! — warum siehst du mich so starr an? Wo sind deine Gedanken wieder?“ Zärtlich strich Mader die Hand seiner Braut.
„Wie lange soll das noch dauern, Eugen? Wann hört dieser entsetzliche Krieg auf?“
„Hertha, warum grübelst du über diese Dinge nach? Uns gilt es, das Vaterland zu verteidigen.“
„Das sagen die anderen auch. — Auch sie haben ihr Vaterland zu verteidigen. Wo bleibt die Kultur?“
„Hertha, nur kurze Stunden sind mir an deiner Seite gegönnt. Denk’ zurück an die glücklichen Stunden von früher.“
„Ich kann meine Gedanken nicht so leicht meistern.“ Sie sieht ihn lange an. „Wie glücklich bin ich, dass du nur ein Werkboot befehligst, dass du keine Mordkommandos geben kannst!“
Er strich ihr leise über die Hand.
„Weißt du, Eugen, ich könnte dich nicht mehr lieben, wenn ich wüsste, dass du Boote mit unschuldigen Menschen versenkst.“
„Hertha, lass uns von anderen Dingen sprechen.“
„Ich kann nicht dagegen an, solange dieser furchtbare Krieg noch dauert.“
11
ie große Turbine abstellen. — Es ist Ostersonnabend. Der Nachmittag soll dienst- und arbeitsfrei sein.“
Der kleine Fähnrich Ulitz ist inzwischen zum Marineleutnant befördert worden. Er lacht übers ganze Gesicht und gibt am Telefon den Befehl weiter.
Nach einigen Minuten hört das Surren der Maschinen auf.
Die Arbeiter haben die Riemen auf die Leerscheiben gestoßen und die Transmission dreht sich langsamer und langsamer. Die Treibriemen werden von den Drehscheiben gestoßen und hängen schwingend und schlapp. Aus den Schmierlöchern tropft langsam das schwarze Öl.
Immer ruhiger wird es.
Spiralförmig hängen zitternd die Späne von den Egalisierdrehbänken.
Ein allgemeines Reinigen der Maschinen beginnt. Die Fräs- und Drehmesser werden losgeschraubt. Die Spiralbohrer aus den amerikanischen Backenköpfen genommen und aufgehoben.
*
Neun Monate sind seit der Einfahrt von U. 10 in die Höhle vergangen. Im Dom 1, der Madersee genannt, waren weit über zwanzig Exzellobogenlampen an der Decke angebracht. Wandarme mit großen 5000 Kerzen starken Glühlampen erhellten das Plateau im Hintergrund. Das Licht der Bogenlampen spiegelte sich im Madersee und beleuchtete zehn U-Boote, die teils zur Reparatur, teils zur Aufnahme von Munition und Ladung eingefahren waren.
Neben dem Plateau rückwärts war ein Trockendock. Ein Boot lag im Dock, während daneben auf Hellingen Spanten und Kiel zu einem Miniatur-Unterseeboot in Arbeit waren.
Zwei Riesenscheinwerfer mit zweizolldicken Kohlen warfen taghelle Strahlen von der Decke auf den Wasserspiegel zur Tunnelausfahrt. Direkt über der Wasserfläche war ein dritter Scheinwerfer, der das Wasser bis auf dreißig Fuß Tiefe erleuchtete.
Unten an dem Muschelplateau waren von den Tauchern biegungsfähige Gleitvorrichtungen angebracht, die eine Beschädigung der ausfahrenden U-Boote verhinderten.
Längs den Wänden am Plateau im Maderseedom befanden sich die Bureaus und Lagerräume für Ersatzteile der auszubessernden U-Boote.
Im Dom 2 hatte sich wenig verändert. Die wunderbaren Tropfsteingebilde sollten erhalten bleiben. Nur Wege waren geschlagen und zwei Schmalspurmaschinengleise liefen quer durch diesen Dom. —
Dom 3 hatte sich in eine große Maschinenhalle verwandelt.
Drehbänke, Fräsmaschinen, Schneide-, Bolzen-, Riefen- und Stiftenmaschinen standen in regelmäßigen Reihen. Pendellampen hingen über jeder Maschine, außer den in reichlicher Zahl an der Decke angebrachten Bogenlampen.
Rückwärts, beim Ausgang zum Dom 3 standen zwei große Elektromotoren, die die Transmissionen links und rechts vom Dom durch breite Treibriemen in Bewegung setzten.
Dom 4 war auch zum Teil eine Schlosser- und Schmiedewerkstatt. In einem gesonderten Teile war eine Gießerei errichtet, sowie die Abteilung für Schweißmaschinen und Sauerstoffgebläse. Auch hier liefen die Schienenstränge entlang.
Holzbearbeitungsmaschinen, wie Gatter-, Kreis- und Bandsägen, Fräs-, Hobel- und Falzmaschinen standen rechter Hand von dem Fluss in Dom 5, während links davon am großen Wasserfall die Turbinenanlage angebracht war, die sämtlichen Maschinen in der Felsenhöhlenstadt als Antriebskraft diente.
Weiter rückwärts speisten Motoren große Dynamos, die zur Herstellung der elektrischen Kraft und für die Beleuchtungsanlage dienten.
Dom 6 war in zwei Teile geteilt. Hier waren die Speisesäle und der allgemeine Aufenthaltsraum errichtet. Eine Abteilung diente als Magazin und Lagerraum. Abteil 2 enthielt die große elektrische Küche.
Nummer 7 umfasste die Schlafräume für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften.
Im Mannschaftsschlafraum standen Holzbetten in Reih und Glied. Die Riesenhalle besaß im Mannschaftslogis zwei Reihen zu 45 Doppelbetten, wie in den Schiffskabinen, also Raum für 180 Mann. Außerdem waren 100 Hängematten an den Felswänden entlang aufgespannt.
Jeder Mann hatte seinen eigenen, verschließbaren Schrank mit einem Ausziehbrett unten wie oben, um Bücher, Wassergläser und sonstige Dinge dort abzulegen. Über jedem Bett befand sich eine Glühlampe.
Die Offiziere besaßen jeder ein Abteil für sich. Darin waren Waschvorrichtungen mit kaltem und (von den heißen Quellen) heißem Wasser angebracht.
Die Unteroffiziere bewohnten zu viert ein eigenes Abteil.
Ganz im Hintergrund war ein großer Raum, den Schustern, Schneidern und dem Friseur eingeräumt.
Dom 8 diente als Badeanstalt mit Wannen-, Schwimm-, sowie Dampf- und Heißluftbädern.
Die heißen Quellen waren zum Teil in Röhrenleitungen abgefangen und den Offiziersschlafräumen und der Küche zugeleitet worden.
Im rückwärtigen Teile von Dom 8 war ein Lazarett mit zwanzig Betten hergerichtet worden. Auch Ordinationszimmer und Operationssaal befanden sich dort.
Die letzte und allergrößte Höhle, die ungefähr 650 Meter lang und gegen 400 Meter breit war, diente als Sportplatz. Für Fußballspiele waren zwei regelrechte Tore vorhanden. Auch einen Tennisplatz gab es in dieser Höhle und einige Kegelbahnen.
Interessant war, dass das vom Wasserfall und der Quelle gespeiste Flüsschen durch fünf Höhlen lief und dann unter einer Felswand verschwand.
12
ader stand nackt in seiner Badekoje und ließ die kalte Dusche über seinen Kopf brausen.
In feinen Strahlen strömte das erfrischende Nass über den Körper.
In der Nebenkoje plätscherte Ulitz, stöhnte und prustete.
Mader rieb seinen Körper rot und machte Gelenkübungen.
Ulitz pfiff jetzt ein Liedchen und rief Mader an:
„Das erfrischt! Aber Donnerwetter, ein bisschen Sonne wäre jetzt ganz angenehm! Möchte gerne einmal wissen, wie die liebe Sonne aussieht. Sechs Monate und kein Tageslicht! Wir werden noch eine Haut über die Pupille bekommen, — wie die Molche.“
Mader musste über den ewigen Brummhumor des kleinen Ulitz lachen. Er wurde aber gleich wieder nachdenklich.
Was ist in den letzten Monaten alles hier unter der Erde geschaffen worden! Draußen ging das blutige Ringen weiter. Die Menschen zerfleischten sich, und ein Ende. war nicht abzusehen.
Wie schwierig war es doch gewesen, hier tief unter der Erde all dies erstehen zu lassen. Die Kunst der Marineingenieure hatte hier ein Wunderwerk vollendet.
Die Wasserkraft des reißenden Falles trieb alle Turbinen. Noch ein zwanzigmal größeres Werk könnte mit der überschüssigen Kraft bewältigt werden.
Aber die Menschen? Werden sie es noch lange aushalten? Wird ein Verräter einmal das Geheimnis preisgeben?
Wie schwer war das Finden der richtigen Leute gewesen. Immer und immer wieder war es nötig, Umschau nach einwandfreien Leuten zu halten. Jeder Einzelne musste ein Vollkommener in seinem Fache sein.
Die Leute hatten sich für die Zeit des Krieges zu verpflichten. Es wurde keinem gesagt, wohin es ging. Jeder Einzelne erfuhr nur, dass er nach einer Werkstätte käme, die versteckt im Lande des Feindes läge, dass ein Umgang mit der Außenwelt ausgeschlossen wäre, und dass es keinen Urlaub gäbe.
Jedem Manne wurden zwei Tage Bedenkzeit gelassen. Erklärte er sich dann einverstanden, so wurden ihm ein bis zwei Wochen Urlaub bewilligt und strengste Verschwiegenheit aufgetragen, auch den allernächsten Anverwandten gegenüber. Da nur ganz einwandfreies, ausgesuchtes Menschenmaterial in Frage kam, so war ein Verrat kaum zu erwarten. Er hätte dem Feinde auch wenig geholfen. Die Leute wurden auf Umwegen zu ihrem Transport-U-Boot gebracht. Die Einschiffung geschah jedes Mal an einem anderen Platz. Es wurde in einem Einschiffungshafen immer nur ein Transport an Bord gebracht. Die Leute trafen sich zuerst im Boot, das sie in See oder in die Bucht hinaus brachte. Dort wurden sie in die Mannschaftsquartiere verteilt und kamen erst zusammen, wenn das U-Boot in See stach. Die Begleitoffiziere achteten genau darauf, dass keine Botschaft ungesehen und ungesichtet in die Heimat zurückging. Die „letzten“ Briefe gelangten in einem Postbeutel nach der Heimat, und niemand erfuhr, wo sie aufgegeben waren. Den Angehörigen ward eine Adresse im Marineministerium aufgegeben. Dorthin musste alle Post gesendet werden, und von dieser Stelle ging sie erst wieder auf Umwegen zur
„Stadt unter dem Meere.“
Mader erhielt mit jeder Post einen langen Brief von Hertha. Sie konnte nicht verstehen, warum er nicht auf Urlaub kam. Stets wurde in ihren Briefen die Klage über den Krieg laut. Sie teilte ihm mit, dass sie mit ihrem Vater, ja, mit der ganzen Verwandtschaft, ihrer Abneigung gegen den Krieg halber, in Streit geraten wäre.
„Tante Hermine,“ schrieb sie einmal voll Empörung, „denke Dir, Tante Hermine ist stolz darauf, dass Richard gefallen ist! — Bedenke, eine Mutter ist stolz, dass ihr Kind ermordet wurde.“
Dann sagte sie in einem anderen Brief, dass sie sich nicht im Betriebe ihres Vaters blicken ließe, da er jetzt „Munition“, ja sogar „Granaten“ fabriziere. Sie fände es entsetzlich und hätte Papa aufmerksam gemacht, dass fünf von den Vettern in der englischen Armee dienten! Alle fünf, Söhne der Tante Bessie die doch eine Schwester der verstorbenen Mama sei.
Wie gut, dass Mama dies nicht mehr zu erleben brauchte!
„Bedenke, Papa, wenn eine Granate, wenn eine Kugel, die du fabrizierst, Schuld an dem Tode eines unserer Vettern trüge!“
„Papa war sehr ungehalten über diese Einwendungen meinerseits,“ schrieb sie weiter, „das erste Mal in meinem Leben fuhr er mich hart an und gebot mir, zu schweigen. Ich verstände das alles nicht. Ich solle endlich mit dem Gefasel, dass alle Menschen Brüder seien, aufhören.“
Mader seufzte still, als ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen. Wie wird das mit Hertha noch werden? Wer hat ihr diese krausen Gedanken in den Kopf gesetzt? Sie hatte doch niemals Umgang mit Politikern gehabt und hatte auch niemals in Kreisen verkehrt, wo derartige Gedanken ausgetauscht wurden. Sie schrieb: „Die ganze Welt ist unser Vaterland; nur der Scholle, auf der wir geboren, hängen wir mit mehr Zärtlichkeit an, als anderen Gegenden. Gibt es doch Menschen, die sich nicht mehr heimisch im nächsten Dorfe fühlen. Ja, Jungens einer Stadt, aus zwei verschiedenen Straßen bekriegen sich. Man müsste den Gedanken an die engere Heimat aus den Lehrplänen und den Schulbüchern ausmerzen. Man sollte die Menschen von Kindheit an lehren, dass es keine engere Heimat gibt, dass die ganze Welt der Menschen Heimat ist und dass alle Brüder und Schwestern seien!“
Im Gedanken an diese Sätze schüttelte Mader den Kopf. Er seufzte schwer.
„Nun, hoher Vorgesetzter,“ rief Ulitz von seinem Abteil herüber, „wohl den Moralischen heute!? Die Gedanken weilen wohl auch bei den Osterhasen zu Hause?“
Mader musste über den ewig lustigen Ulitz lachen. Er warf die trüben Gedanken über Bord.
„Apropos, Osterhasen, lieber Ulitz; wir wollen noch vor unserer Tennispartie den Marstall besichtigen. Möller berichtete mir, dass zwei Karnickelstuten 17 Kinderchen das Leben geschenkt haben.“
13
m Dome Nummer 9 ging es lebhaft zu.
Die zwei Fußballmannschaften in ihrem Sportdress bereiteten sich auf ihren Match vor.
Auf den Kegelbahnen herrschte ebenfalls großes Treiben.
Die Ingenieure und Maschinisten machten starken Lärm.
Ganz im Hintergrunde des Domes befand sich ein hohes Drahtgitter mit vielen Abteilen.
Im größten, rechtsliegenden Raume scharrten viele Hühner im kalkigen Sande. Sie bevölkerten zwei Volieren. Einige ausgewachsene Hähne suchten sich im Krähen zu überbieten. Ein junger Hahn machte einen lächerlichen Stimmversuch.
Neben dem Hühnerhofe stand eine lange Reihe von Kaninchenställen in drei Etagen.
Auch diese Tiere hatten ihren Auslauf.
Möller hantierte mit Reimer und Schröder an den Käfigen herum.
„Es gibt wieder 22 gute Kaninchen für die Kombüse morgen, Herr Kapitänleutnant!“ rief Möller den herankommenden Offizieren zu.
Mader und Ulitz, denen sich noch einige Herren angeschlossen hatten, traten näher.
Die im Laufe der letzten Nacht und heute Vormittag mit ihren U-Booten eingelaufenen Offiziere interessierten sich sehr für den ganzen Betrieb. Insbesondere die Herren, die zum ersten Male die „Stadt unter dem Meere“ besuchten. „Döbel, lieber Junge,“ rief Ulitz einem baumlangen Leutnant zu, „wenn du wieder mal unser infernalisches Paradies besuchst, das heißt, wenn du zuvor nach der Heimat kommst, dann lasse dir von meiner Mama ein Kälblein schenken. Wir müssen uns eine Kuh hier anschaffen. Ich habe die ewige Ziegen- und Kondensmilch schon mehr als satt.“
„Erst muss ich dazu die Erlaubnis von unserem Herrn Kommandanten haben,“ gab Döbel zurück.
„Ist gegeben, meine Herren,“ gab Kapitän v. Görbitz, ein untersetzter Herr mit rotem Haar, jovial zurück. „Natürlich, wenn wir den Vogel, das heißt das Milchtier, von Ihrer Frau Mama erhalten können. Sie scheinen vergessen zu haben, dass alle irdischen Güter dieser Art in unserer Heimat unter besonderer Aufsicht stehen.“
„Herr Kapitän, so wie ich meinen Freund Döbel kenne, wird er das Tierchen in einem unbewachten Augenblick in seiner Handtasche verschwinden lassen. Also, lieber Freund, ohne Kalb das nächste Mal keine Einfahrt . . .“
Nebenan hörte man jetzt ein klägliches Meckern.
Schröder öffnete die Stalltüre und zehn Ziegen mit drei Zicklein drängten ins Freie.
Mader trat in den eingezäunten Raum und streichelte die Tiere.
Eigentümlicherweise gediehen auch alle Vierfüßler in der Höhlenstadt vortrefflich.
Mit Ausnahme von Dom 1 herrschte in den Höhlen eine angenehme, stets gleichmäßige Wärme. Die Luft war weder zu trocken, noch zu feucht. Dass alle Höhlen tagsüber gleichmäßig sehr hell erleuchtet waren, kam am meisten dem Hühnervolk zugute. Die meisten· dieser noch jetzt lebenden Tiere, mit Ausnahme einiger Veteranen, hatten den Begriff „Tageslicht“ vollkommen verloren. Wenn abends um 7 oder 8 Uhr die Lichter nach und nach in Dom 9 erloschen, gingen die Hühner zur Ruhe, und wenn morgens die Köche das Licht einschalteten, das auch Dom 9 versorgte, dann kamen die Hühner aus ihren Verschlägen. Die Hähne krähten „nachts“ in den seltensten Fällen.
Durch die stete Sommerwärme und die Einwirkung des starken Lichts legten die Hühner mit kurzen Unterbrechungen das ganze Jahr.
Möller hatte Brutkästen mit elektrischen Heizkörpern angefertigt, so dass die Hennen nicht durch Brüten vom Legen abgelenkt wurden. .
Den jeweiligen Verpflegungssendungen für die Höhlenbewohner gab man immer eine genügende Menge frisches Gemüse, sowie Fleisch und Futterstoffe mit.
Es hatte große Mühe gekostet, dies zu erreichen; doch die Eingabe Maders wurde durch die ärztlichen Gutachten Katzbergs und seiner zwei Assistenten bekräftigt, da bei steter Konservenkost der Ausbruch von Krankheiten, insbesondere Skorbut, befürchtet werden musste.
Im allgemeinen ließ der Gesundheitszustand wenig zu wünschen übrig. Anfangs, das heißt, in den ersten vier Wochen, spürte man überhaupt nichts; nachher erst wurden manche Leute von einer seltsamen Krankheit befallen. Sie bekamen plötzlich Atemnot, verfärbten sich und verrenkten die Arme stark nach rückwärts. Dann trat Ohrenbluten ein. Die Krankheit erinnerte in manchem an die „Bent“, die Caissonkrankheit, von der die in Caissons unter Wasser arbeitenden Männer befallen werden, wenn man sie zu rasch ausschleust. Viele sterben daran. Die Wissenschaft steht noch heute bei der „Bent“ einem Rätsel gegenüber.
Von den in der Höhle unter diesen Erscheinungen Erkrankten war zwar noch niemand gestorben; doch mussten schon mehrere Mann nach Hause geschickt werden, da sie immer mehr von Kräften kamen. In der Sonne erholten sich die Leute in kurzer Frist.
Viel schlimmer war es mit denen bestellt, die infolge des gänzlichen Abschlusses von der Oberwelt und vom Tageslicht, sowie durch die sexuelle Enthaltsamkeit in Melancholie verfielen.
Es waren schon vier Fälle dieser Art vorgekommen, von denen einer mit Tobsucht geendet. Der Unglückliche hatte im See von Dom 1 Selbstmord begangen.
Sonst herrschte unter der ganzen Besatzung Zufriedenheit und ein den Lebensbedingungen nach guter Stand des Wohlbefindens.
Blass und weiß waren die Gesichter alle durch den Mangel an Tageslicht.
Die Verpflegung war ausgezeichnet.
Die einlaufenden U-Boote brachten von den versenkten Schiffen alle möglichen Dinge mit. Niemals herrschte Mangel.
Die Mannschaften arbeiteten täglich zehn Stunden.
Zwei Stunden, und zwar mittags von ein bis zwei Uhr und abends von acht bis neun Uhr, war „Korso“, das heißt, in diesen zwei Stunden durfte niemand sitzen, sondern jeder musste sich im Dom 9 Bewegung machen. Es wurde geturnt und Fußball gespielt, damit der Körper nicht die ihm nötige Bewegung entbehre.
Zweimal wöchentlich konzertierte eine Kapelle, die sich aus zwölf Mann der Besatzung gebildet hatte. Außerdem krähten und krächzten abwechselnd Grammophone. Ein Maurerklavier, oder, wie der schnoddrige Berliner Koch, der Stübbecke, sagte, eine Quetschkommode, gab den zwei Gigerln der Besatzung, Lehmann I und Hansen, Gelegenheit, ihre neuesten Schieber zu tanzen.
Der Schrittenbacher Max, ein Feinmechaniker ersten Ranges aus Feldafing in Bayern, hatte einen Gesangverein gegründet und in Stimmung gebracht. Dieser Max plattelte, wenn Stübbecke ihm den „Holtauer Doppelschlag“ auf der Ziehharmonika vorspielte.
Überhaupt der Schrittenbacher Maxl! Er war ein kreuzfideles Haus und hatte stets die Lacher auf seiner Seite. Jeden Sonnabend gab es Bier. Da war der Maxl schon drei bis vier Tage beim Korso äußerst beschäftigt, einigen Nichtbiertrinkern ihr „Quantum“ abzuschachern. Maxl versprach, zu singen, zu tanzen und die schönsten Dinge aus seinen Liebesgabenpaketen. Obwohl es verboten war, mehr als einen Liter Bier pro Kopf zu erhalten, hatte der Maxl immer sechs bis sieben Liter für sich versteckt. Betrunken wurde er nie, nur äußerst lustig.
Er brachte Stimmung in die ganze Besatzung.
Mader musste immer wieder schmunzeln, wenn er an eine unfreiwillig belauschte Unterhaltung zurückdachte.
Maxl saß mit einigen Kameraden „Am Wasserfallhügel“ bei der „Hexe“ und hielt einem der Melancholie verfallenen Metalldreher eine Standpauke:
„Hanswurst, damischer, du Mordsrindviech! Ja, den schaug an. Ja, was war denn dös? Oh Bluatsau! Tat der Hanswurscht woana, weil er nöt bei seiner Alten kunnt sei. Ja, Hergottsakra! Bluatiger Heanadreck! Wart, i nim zerscht an Schmalzler, damit’s mar net de Red verschlagt. Ja fei, grad fei g’schluchzt hab i, wie i g’hört hab, dass a Kommandierung gibt, wo ma koan Urlaub nit kriagt. Woaßt, i mag s‘ scho, mei Alte, — aber manchmal muss i ihr scho oane in d’Letschen eini hau’n, damit s’ a Ruah gibt. A guts Wei is, aber sie gibt eahnder koan Fried, bal i ihr nöt oani einihau. Ja moanst, dass sie sich dös g’fallen lasset? Oh mei, gar koa Idee von oaner Gspur. Was s’halt grad derwischt hat, hat s’ ma am Schädel g’haut. Sie is halt a bisserl gach, aber a guats Wei is. Wie i z’letzt furt ganga bin, hat’s gwoant; i hab’s tröst und do hat’s ma, wie i scho in der Tür g’standen bin, was nachg’schrian. I hab mi umdraht, hab zurückg’schrian: „Du mi a!“ dann bin i mit schwerem Herzen furtganga. — Juchhuuuuuu! Du Mordshammel du, jetzt hörst fei glei auf z’groana oder i stirr dir oane ins Gletsche.“
Mader vermochte sich schwer in die Psyche dieses Menschen hineinzufinden. Er konnte niemals an Maxl vorbeikommen, ohne an das belauschte Gespräch zu denken.
Einmal war der Schrittenbacher zum Rapport befohlen und Mader war gezwungen, ihn abzukanzeln.
Der Maxl stand mit todernstem Gesicht dabei Als er abtreten sollte und schon an der Türe war, rief ihn Mader zurück.
„Schrittenbacher — ich weiß, was Sie sich jetzt an der Türe gedacht haben!“
„Kunnt scho sei, Herr Kapitänleutnant.“
„Abtreten.“
14
ast alle Fahrzeuge, die das Mittelländische Meer befuhren, hatten ihre Not mit den deutschen U-Booten
Man war nirgends mehr sicher. Sogar in dem Kriegshafen von Spezia sollten sie gesehen worden sein.
In der ganzen Welt wurde von einer geheimen U-Boot-Basis im Mittelmeer gesprochen.
Kein Mensch der Entente glaubte mehr, dass Pola oder ein anderer feindlicher Hafen die ganze Strecke versorgen könne.
Ganze Geschwader der Gegner suchten die Küsten immer und immer wieder ab.
Man vermutete die geheime Station zuerst an der Küste von Korsika, dann wurden die afrikanischen und die asiatischen Gestade genauest beobachtet.
Nichts! Nichts!
Italien ließ nichts unversucht. Sardinien, Sizilien, ja sogar die Küsten im Ligurischen Meer standen monatelang unter schärfster Bewachung.
Alles blieb vergebens. Nichts wurde entdeckt.
Niemand in Italien hatte eine Ahnung, dass sich im eigenen Lande eine unterirdische deutsche Werkstätte befinde, die Granaten und Torpedos herstellte. Kein Mensch vermutete, dass sogar ein kleiner Typ feindlicher U-Boote sich unter heimischer Erde im Bau befand und dass eine kleine Schar von Menschen in treuester Pflichterfüllung seit Jahren nicht mehr die Sonne sah und fern von ihren Liebsten weilte, die nicht wussten, wo sich Vater, Sohn, Bruder, Gatte oder Bräutigam aufhielten.
Eine Gemeinde von Männern lebte mitten im Feindesland und darbte nach dem Licht des Tages.
In der Heimat wurde allerlei von der geheimen U-Boot-Basis gemunkelt.
Kein Mensch, mit Ausnahme der U-Boot-Besatzung und einiger Eingeweihter im Hauptquartier wie im Marine- und Kriegsministerium, wusste darum, und auch von diesen kannten nur die Kommandanten der U-Boote die Lage der Höhlen genau.
15
er Sommer 1918 war vergangen. Mit Riesenschritten eilte der Herbst ins Land.
Hertha von Zöbing stand vor einem Briefkasten an der Ecke von Graf-Adolf-Straße und Königsallee und schob nach kurzem Überlegen ihren Brief in die Öffnung. Langsam ließ sie den Deckel über den Schlitz fallen. Sie strich mechanisch mit der Hand über den Briefkasten und entfernte sich dann eiligen Schrittes.
Nun nahm das Schicksal seinen Weg.
Seit zwei Jahren hatte sie ihren Verlobten nicht gesehen. Lange Briefe hatte sie Woche für Woche abgesandt und doch niemals Antworten auf die Fragen erhalten, die ihr Innerstes aufwühlten.
Mader schrieb stets von Pflichtbewusstsein, von der Liebe zum Vaterlande, immer wieder von der Heimat, und dass er — — — erst nach Kriegsende zur Braut zurückkehren könne.
Es waren, nach Herthas Ansicht, ausweichende Antworten.
Sie verbiss sich in ihre Gedanken, und als Mader auf ihr letztes Schreiben offen mitteilte, dass er ihren Wunsch, der Offizierskarriere zu entsagen, nicht erfüllen könne, reifte in ihr der Gedanke, dem Verlobten sein Wort zurückzugeben.
Der Entschluss wurde ihr nicht leicht. Acht Tage kämpfte sie einen schweren Kampf. Sie liebte Mader. Liebte ihn wie eine Frau, die zum ersten Male im Leben liebt. Aber nie könnte sie mit einem Manne zusammen sein, der sie stündlich an den grausamen Krieg erinnerte und dessen äußere Gewandung ihn als Krieger kennzeichnete.
Sie lebte in dem Wahn, dass die Feinde keine Feinde wären, dass man „drüben“ längst Frieden wünschte und dass nur die Häupter der Heimat den Krieg weiter führen wollten.
Obwohl sie wenige Zeitungen las, konnte sie es nicht verhindern, bei Tisch, von dem Dienstpersonal und anderen manches zu hören.
Nun lag der „Feldpostbrief“ im Kasten. Die Würfel waren gefallen.
Vielleicht war es besser so. Sie würde nie einem anderen Manne angehören.
Krüppel begegneten ihr. Ketten von Menschen, vor Bäcker-, Fleischer- und Gemüseläden in Geduld stundenlang harrend, sahen vielfach der elegant gekleideten jungen Dame hasserfüllt nach und riefen ihr hässliche Worte zu.
Hertha ging rascher.
Wer helfen könnte! Sie senkte den Kopf, als ob die Schuld am Kriege auf ihrem Haupte laste.
16
as Volk hatte die Macht in seine Hände genommen und die Gewalt an sich gerissen.
Jahrelange Entbehrungen waren die besten Helfer und Hetzer gewesen.
Nur heraus aus der Misere. Nur wieder die Möglichkeit haben, ein bisschen menschlich zu leben.
Die Macht in der Hand des Volkes ist ein gefährliches Spielzeug.
Die Bestie Mob lauert jahrzehntelang auf solche Gelegenheiten. Die Führer wussten nicht, mit wem sie die Macht teilen mussten. Sie ahnten nicht, dass es die niedrigsten Instinkte waren, die mit ans Ruder wollten, die ein großes Wort mitzusprechen hatten und die sich das Heft nicht so schnell wieder aus den Händen winden ließen.
Die ihr rieft, die Geister!!
Sie waren nicht zu bannen.
Auf einen derartigen Hexensabbat waren die Treiber nicht gefasst gewesen. Nun hieß es mit der Horde Wölfe heulen, um nicht ganz verdrängt zu werden und um der Blutgier und dem grausamsten Elend, noch größer als es schon gewesen, nicht freie Bahn zu lassen.
17
ader inzwischen zum Kapitän befördert worden war, befand sich seit Tagen in größter Unruhe. Die einfahrenden Kameraden brachten scheußliche Nachrichten. Unverbürgt. Aber etwas bereitete sich vor. Seit zwei Tagen war kein Boot eingelaufen. Eine Seltenheit.
Fast jeden Tag waren sonst Boote in der „Stadt unter dem Meere“ ein- und ausgefahren.
Auch die Besatzung war beunruhigt. Hässliche Briefe waren seit Monaten aus der Heimat eingetroffen.
Mader stand mit Ulitz am Kuhstall. Der Doktor war beschäftigt, der kranken Kuh ein Klistier zu geben.
Ulitz machte allerhand schnoddrige Bemerkungen.
Möller, der das leidende Tier festhielt, warf dem jungen Offizier einen strafenden Blick zu.
Plötzlich klingelte die Signalleitung.
Mader ging ans Telefon neben den Ankleideräumen am Sportplatz. Von Dom I wurde das Einfahren von U. 174 gemeldet. Mader und Ulitz setzten sich auf die elektrische Dräsine und fuhren eiligst ab. —
Kapitän Zirbental zog sich mit Mader sofort zurück.
Ulitz blieb am Rande des Plateaus und unterhielt sich flüsternd mit einem Offizier von U. 174.
Mader stand mit. weit offenen Augen vor dem Kameraden. Er konnte es nicht fassen.
„Revolution?! Waffenstillstand?! „Rückzug?!“
Stoßweise kamen die Worte aus seinem Munde. Man musste leise sprechen. Damit, um Gotteswillen, die Besatzung nichts höre.
Das schrille Signal eines einfahrenden Bootes ertönte.
Innerhalb der nächsten sechs Stunden liefen weitere vier U-Boote ein.
Immer unglaublicher lauteten die Hiobsposten.
Die Arbeit ruhte. Nur die Lichtanlage und die Küchen arbeiteten.
Die Offiziere berieten.
Manche wollten wieder ausfahren; dies war angesichts der Gefahr, dass andere Boote sich auf der Einfahrt befinden konnten, nicht möglich.
Die Besatzung der Höhle war treu und zuverlässig.
Möller hatte am Fußballplatz die gesamte Besatzung zusammen gerufen und in kurzen Worten einige Erklärungen abgegeben. Noch wüsste man nichts Gewisses; aber jetzt hieße es: Kopf hoch halten. Keiner sollte murren, innerhalb von ein oder zwei Tagen würde sich alles entscheiden.
Der Schrittenbacher Maxl fühlte sich auch veranlasst, einiges zu sagen:
A“ Haxen reiß’ i an jedem aus der wo sie a nur trauet und dö Goschen aufmacht. Weißwürscht mach I aus eahm. Kimmt’s her, wenn’s eich traut’s!“
Viele lachten. Maxl hatte wieder einmal Stimmung gemacht.
Wie oft wohl im Leben ein Witzwort eine Situation der Gefahrzone auf ruhiges Gleis gerettet hat. Wenn hier auch der Witz Maxls unfreiwillig war, so hatte er doch seinen Zweck erfüllt.
Bis zum folgenden Mittag waren im ganzen elf U-Boote im Domsee eingefahren. Die Mannschaften blieben eingeschlossen.
Möller hatte seine Getreuen bewaffnet, um auf alle Fälle gerüstet zu sein.
Mader hielt mit den Offizieren eine Versammlung ab.
Man hatte U. 174 wieder hinausgeschickt und wartete auf Nachricht. Endlich ertönte das Signal.
U. 174 fuhr ein, gleich hinterher noch ein U-Boot.
Die Funker von U. 174 und dem letzten U-Boot — es war dies eines der Proviant-U-Boote für die Höhlenbewohner — brachten die letzten Neuigkeiten.
Zusammenbruch. Rückzug. Revolution im Reich — und was das Schlimmste von allem für die Offiziere war — die Flucht des Kaisers.
Tiefe Stille herrschte im Kreise, als diese Botschaft kund ward.
Flucht! Flucht des obersten Kriegsherrn.
Die Herren von der Marine waren im Grunde niemals so außerordentlich „kaiserlich“ wie die Landarmee. Dies lag wohl daran, dass das Landheer viel eher Berührungspunkte mit dem Herrscher hatte, und dass die Herren von der Kriegsmarine durch ihre Auslands- oder Überseereisen einen weiteren Gesichtskreis bekamen und überdies auch gebildeter waren. Insbesondere die U-Boot-Offiziere waren ausgesuchtes Material. Diesen Herren war durch ihre Sprachkenntnisse schon in der Friedenszeit Gelegenheit geboten, die Zeitungen englischer Zunge zu lesen, um sich ein Bild über manche Dinge zu machen.
Es gibt und gab wohl keine Truppe, die mehr Vaterlandsliebe und Treue zur Heimat besaß, als die deutsche Kriegsmarine. .
Was die revolutionären „Matrosen“ betrifft, so wird einst die Geschichte darüber Aufschluss geben, wer diese „Matrosen“ und ihre „Führer“ waren.
*
„Wer von den Herren in die Heimat will, der möge sich entscheiden. Ich muss dies nachher auch meinen Mannschaften anheimstellen!“
Mader blickte im Kreise der Offiziere umher.
„Ich bleibe hier und wer mit mir bleiben will, der soll sich bald entscheiden. Um unvorhergesehenen Dingen vorzubeugen, muss ich darauf dringen, dass bis morgen Mittag alle Boote, die zurück wollen, diesen Platz verlassen haben.“
Die Herren schwiegen und warteten auf weitere Erklärungen.
„Ich bleibe hier, bis weitere Nachrichten aus der Heimat eintreffen. Unter den gegebenen Umständen ist für mich zurzeit in der Heimat kein Platz. Ich kann und darf auch diesen Posten nicht verlassen!“
„Ich schlage vor, wir fahren alle aus, schießen die befestigten Hafenstädte in Grund und Boden sterben einfach mit unseren Booten,“ rief ein exaltierter junger Leutnant.
„Das wäre eine böse Geschichte. Die Oberste Heeresleitung hat einen Waffenstillstand geschlossen. Wir täten unserer armen Heimat keinen Gefallen mit einem solchen Streich.“
18
echzehn Offiziere und Unteroffiziere, einschließlich der Techniker hatten sich entschlossen, in der „Stadt unter dem Meere“ zu bleiben.
Von den Mannschaften hatten siebenunddreißig gebeten, bleiben zu dürfen.
Es waren dies meist alte, aktive Leute, die kapituliert hatten, schon viele Jahre dienten, die niemanden in der Welt besaßen und froh waren, nicht in die Revolution hineingestoßen zu werden.
Der Schrittenbacher Maxl hatte sich zur Heimfahrt gemeldet.
„Wissen S‘, Herr Kapitän, i muaß ja do’ hoam zu meiner Alten. Dö werd scho’ Sehnsucht nach oan Krawall ham. I kumm amal auf B’such her, wann i an Urlaub von der Fabrik krieg!“ Mader schüttelte kräftig die Hand des biederen Bayern. Es war schade, dass gerade dieser Mann ihn und seine Kameraden verließ. Er hatte es immer verstanden, den Leuten auf launige Art die Zeit zu vertreiben.
„Leben Sie wohl, Schrittenbacher. Grüßen Sie die Heimat und vergessen Sie uns nicht. Sie waren ein braver und treuer Kamerad, wie man ihn besser nicht. finden kann! Versuchen Sie es ohne Schläge, wenn Sie nach Hause zurückkehren. Die in der Heimat haben genug gelitten, und Ihre Frau wird sich auch geändert haben!“
Maxl trat ganz unmilitärisch von einem Fuß auf den anderen und nickte nur. Sprechen konnte er nicht. Er schluckte und spürte ein Würgen in der Kehle. Er drückte nochmals und viel fester die Hand seines Kapitäns und lief weg.
Heulen, brüllen hätte er mögen. Er schämte sich und versteckte sich an seinem Lieblingsplatz bei der „Hexe.“
19
ags darauf verließen am frühen Morgen fünf Boote, die „Stadt unter dem Meere.“ Alle U-Boote hatten ihre überflüssigen Lebensmittel, Uniformstücke, Öle, Betriebsstoffe und alles sonst Entbehrliche für die Kameraden in der Höhle zurückgelassen.
*
Im Dom 9 standen die Höhlenbewohner, die sich entschlossen hatten, in die Heimat zurückzukehren, in Reih und Glied auf einer Seite, während die anderen, die bleiben wollten, zwanglos auf dem rechten Flügelende hielten.