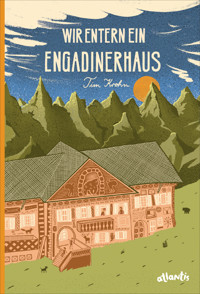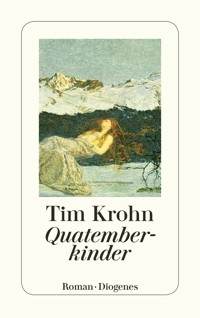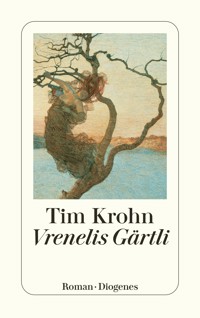18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Michael und Marta nehmen wegen eines Fondue-Sets an einer Tombola teil und gewinnen den Hauptpreis: ein verlängertes Wochenende im Bergell, das Michael am Albignasee eine einsame Nacht unter Sternen beschert. Lorenz und Sibylle werden im August auf dem Gotthardpass in leichtem Hemd und Sandalen vom Schnee überrascht. Margrith fährt jeden Winter nach Vals, wo sie auch dieses Jahr im Mondlicht hinaufsteigt nach Leis, im Gepäck Stifters Novelle Bergkristall. Edith und Hubert wandern zur Trauerbewältigung: sie barfuß, er mit einer Tuba im Gepäck. Tim Krohns Figuren fahren mit dem Postauto nach Maloja, mit dem Deux-Chevaux über den Gotthard, mit dem Zug ins Glarnerland und mit dem Bähnli auf den Bärenboden. Sie erzählen von Auf- und Abstiegen, von zerklüfteten Landschaften und der Einsamkeit in den Alpen, vom Naturerleben und der ewigen Suche nach etwas, das die Leere füllt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tim Krohn
Die Stille der Höhe
Erzählungen aus den Bergen
Atlantis
Michael Panda am Lägh da l’Albigna
Einer der Preise bei der Tombola der diesjährigenAbschlussklasse war ein komplettes Käsefondue-Set mit Caquelon, Rechaud und Gabeln, und da Michael Panda nur ein Rechaud besaß (das Caquelon war ihm beim letzten Umzug zerbrochen, und geeignete Gabeln hatte er sich nie gegönnt), seiner Kollegin, der Handarbeitslehrerin Marta Meister, dagegen just ein Rechaud fehlte, beschlossen sie zu fortgeschrittener Stunde, angeheitert von Punsch und Polonaise, sozusagen eine Losgemeinschaft zu bilden und derart ihre Chance auf das Käsefondue-Set zu verdoppeln.
Stattdessen gewannen sie den Hauptpreis, ein verlängertes Wochenende für zwei im Bergell, Einkaufsgutschein der Kosmetikfirma Soglio inklusive. Michael Panda freute sich darüber fast ebenso sehr, das Bergell kannte er noch nicht, dazu ließ sich die Reise mit einem Abstecher nach Chiavenna verbinden. Aus Chiavenna nämlich hütete er seit Jahren eine Ansichtskarte, ergattert auf dem Bürkliplatz-Flohmarkt, die ihn unerklärlich berührte. Sie zeigte einen reißenden Bach, über den sich die Erker einer Reihe trutziger Häuser neigten, die geheimnisvolle Bildlegende war: Piazzetta Dr. Ernesto Ploncher, Posteriore.
Leider sagte Marta ab, obwohl er angeboten hatte, auf geteilte Kosten das Doppelzimmer in zwei Einzel umzubuchen, und sie tat dies in buchstäblich letzter Minute, telefonisch, als er bereits auf dem Bahnsteig stand. Ihre Begründung verstand er nicht, denn inzwischen fuhr der Zug ein, und er war zu scheu nachzufragen. Aber er konnte sich zahlreiche gute Gründe für eine solche Absage denken. Immerhin versicherte ihm Marta, sie habe sich auf den Ausflug gefreut, »ganz besonders auf den Stausee, du musst unbedingt hochfahren und ihn von mir grüßen. An diesem See habe ich …«. Was darauf folgte, ging abermals unter, diesmal im Lärm einer Schulklasse, die den für sie reservierten Wagen suchte, und weil generell Gedränge herrschte und er einen Platz auf der linken Wagenseite ergattern wollte (auf dieser Strecke fuhr er stets links, der Aussicht auf Zürichsee und Walensee wegen), hängten sie auf.
Als noch bezaubernder entpuppte sich die Fahrt danach auf der Albulastrecke (obwohl er dort besser rechts gesessen hätte), er schrieb Marta zwei SMS, weil er mit sonst keinem seine Begeisterung teilen konnte. Im Postauto, auf den Serpentinen hinter Maloja, wurde ihm zwar übel, doch nicht so sehr, dass er den Plastikbeutel hätte bemühen müssen, den er bereithielt. Und als er in Vicosoprano ausstieg, war er vor Rührung den Tränen nahe: Das Dorf, in dem fast jeder Stein noch von Hand gehauen und geschichtet schien, hatte eine Lieblichkeit, die ihn fast schmerzte – in doppeltem Sinn schmerzte, denn gleich darauf las er auf einer Informationstafel über Hexenprozesse, Folter und Hinrichtungen, die hier stattgefunden hatten.
An einem über viele Jahrzehnte hinweg ausgewaschenen, hübsch mit Blumengestecken geschmückten Brunnen vorbei erreichte er das Hotel: Albergo Piz Cam. Dort hielt es ihn nur kurz, als Erstes nämlich wollte er seine »Schuld« abtragen und den Stausee besuchen (nicht zuletzt, damit er nochmals guten Grund bekam, Marta zu schreiben und sein von all den Eindrücken volles Herz zu erleichtern). Dazu musste er erst die Seilbahnstation finden. Da sein Italienisch allein durch die Lateinischkenntnisse genährt wurde, der Anstand es ihm wiederum verbot, Deutsch zu sprechen, wurde er in die Irre geführt: Das Wort für »Seilbahn« kannte er nicht, er glaubte sich nur zu erinnern, dass »Tiramisù« wörtlich »Aufzug« bedeutete, und landete mehrmals vor einem Gasthaus. Erst nachdem er am Dorfrand eine Landkarte entdeckt und den irisch anmutenden Namen des Sees, Lägh da l’Albigna, auswendig gelernt hatte, wies man ihm den rechten Weg.
Der Pfad zur Seilbahnstation führte durch den Wald, auch diese Erfahrung genoss er in vollen Zügen – zumindest bis er sich zwei fast mannshohen Ameisenhaufen gegenübersah. Auch der Pfad war bedeckt mit Ameisen, und es gelang ihm nicht, sich gegen die Fantasie zu wehren, er könnte stolpern und, wehrlos am Boden liegend, bei vollem Bewusstsein von dieser wimmelnden Armee erobert und zerlegt werden. Deshalb ging er schneller, als es seiner Lunge bekam – erst der Schmerz erinnerte ihn daran, dass er sich auf gut tausend Metern über Meer befinden musste.
Die Seile der Bahn bemerkte er als Erstes, sie wiesen bedenklich steil in die Höhe und waren flankiert von schroffen, ja jähen Felsflanken. Er war nie ein Freund zerklüfteter Landschaft gewesen, er mochte es weich und lind, zudem schmerzte immer noch die Lunge. Nur Marta zuliebe bestieg er die Gondel, nachdem er bei einem finster blickenden Wärter die sehr teure Karte gekauft und sich hatte darauf hinweisen lassen, dass die letzte Talfahrt bald bevorstand. Doch er hatte ja nicht vor, sich lange zu vertun.
Er war der einzige Fahrgast, und die Gondel bot unangenehm viel Aussicht, allein die Bodenplatte war nicht transparent. Um seine Nervosität zu dämpfen, identifizierte er nach der Abfahrt alle Pflanzen, die unter ihm vorbeistrichen – er erkannte Tannen, Lärchen, Blaubeerbüsche, Farn und Alpenrosen. Gegen die Angst half auch, dass er sich immer wieder in Erinnerung rief, dass die Bahn, wie wohl auch der Stausee, dem Zürcher Elektrizitätswerk zugehörte, ewz stand unübersehbar auf der Gondel. Das weckte Vertrauen.
Schneller als erwartet kreuzte er zudem die Gegengondel, und wenn ihm auch erst durch den Kopf schoss, dass es da jemand aber eilig habe, wieder heim ins Tal zu kommen, freute er sich doch daran, dass bereits mehr als die halbe Strecke überstanden war. Schon kam auch der Boden näher, das Gelände wurde flacher, und das Finstere, Massige der Staumauer, die ihm während der ersten Fahrtminuten als unüberwindlicher Wall erschienen war, der den Menschen von allem Lichten, Himmlischen abschottete, verlor sich, von Nahem betrachtet hatte sie eine fast gemütliche Neigung.
Die Bergstation kam sehr schnell näher, und vergnügt begann er schon, an einem SMS für Marta zu feilen, als urplötzlich der Boden unter ihm aufriss, wie eine Wunde klaffte eine nackte, scheinbar bodenlose Schlucht im Fels. Sofort fielen ihm die Hexen wieder ein, es konnte nicht anders sein, als dass sie hier zu Tode gestürzt worden waren, in den Höllenschlund, und kurz schrie er vor Entsetzen. Dann machte die Bahn fest, vollautomatisch, mit einem komplizierten Mechanismus, der ihm einen Film von Tarkowskij in Erinnerung rief. Er konnte aussteigen, doch die Leere an der Bergstation machte ihn nicht fröhlicher. Keine Menschenseele war zu sehen, keine Tafel, keinerlei Hinweis darauf, dass Gäste hier willkommen wären. Hinauf zum Damm führte auch kein Wanderweg, nur eine Art Baupiste, und ein spinnenhafter Menzi Muck stand quer, wie in Eile zurückgelassen, am Fahrbahnrand. Die kalte Zugluft verstärkte noch das Gefühl des Ausgestoßenseins.
»Quarantäne« war das Wort, das ihm in den Sinn kam, doch solches wollte er Marta keinesfalls schreiben. Er bemühte sich, die verschiedenen Blumen zu benennen, die staubbedeckt im Wind zitterten, über Margeriten, Löwenzahn, Vergissmeinnicht kam er jedoch nicht hinaus, das gab für ein SMS zu wenig her. »Kletterlieschen«, »Hirtentäschlein« wären schöne Worte gewesen, doch er wusste nicht einmal bestimmt, ob es sich dabei um Pflanzen handelte.
So erreichte er die Dammkrone und genoss endlich einen vergnügten Moment, als er nämlich, vor dem steilen, kalten Berghang deponiert, einen Ruderkahn entdeckte, metallisch glänzend, der so gar nicht in die Landschaft passen wollte. Ja, davon ließ sich köstlich schreiben! Doch sein Triumph währte nur gerade eine Sekunde, dann hatte er den See erblickt und schämte sich für seine Kurzsicht.
Irgendwie hatte er erwartet, am See ein Eis essen zu können, doch das vermeintliche Restaurant entpuppte sich als Wärterhäuschen, als verlassenes wohlgemerkt. Auch die zwei Dächer, die er auf der anderen Seeseite entdeckte, in einiger Höhe am Hang, wirkten nicht, als würden sie Leben bergen. Leben schien hier generell mehr in niederen Formen zu existieren: Der See hatte kaum Wasser, und das wenige war milchig graugrün verfärbt. Das Seebecken war ein nackter Krater, auch oberhalb der Grenze, die den Höchststand anzeigte. Pflanzen waren rar, der blasse Schimmer Grün an den Felshängen stammte, wie er beim Nähertreten erkannte, von Flechten. Die einzige Bewegung stammte von den Fallwinden, die das Wasser entlang des Ufers in kleine, quirlige Muster warfen, und dünne Rinnsale von Regen- oder Schmelzwasser ergossen sich hier und da am Berg.
Dabei machten sie erstaunlichen Lärm. Um dem auszuweichen, rannte er in einem Anflug von Schamlosigkeit mit ausgebreiteten Armen über die Staumauer, schrie, wie ein Adler oder Falke schreien mochte, fühlte noch während des Rennens einzelne, schwere Regentropfen und lachte erst. Er sah hoch, der Himmel schien mehr diesig als bewölkt. Hinter, vielleicht auch über einem der Berggrate ballten sich allerdings die Wolken, und in jener Ballung flackerte ein Blitz auf. Er begriff, dass seine kleine, übermütige Gestalt der höchste Punkt auf dem Damm und sein Leben in Gefahr war, und rannte wie der Teufel. Dabei stolperte er über eine Erhebung, konnte sich aber aufraffen – wobei er sich ausmalte, wie er unter der Brüstung hindurch rutschte und talwärts stürzte –, dann erreichte er das Ende der Mauer und fand Schutz unter einem Felsen.
Jetzt wusste er, was es wirklich heißt, die Lunge zu spüren. Auch sein Herz jagte, und als er das Knie untersuchte, fand er unter der zerrissenen Hose eine Schürfung. Er verarztete sich – auf Reisen trug er stets denselben Anorak, in dessen Innentaschen er neben Besteck, einem Kompass und kleinen Noten in verschiedenen Währungen eine Notfallapotheke mit sich führte –, dann rief er Marta an. »Du glaubst es nicht«, wollte er ihr sagen, »da sitze ich an deinem Lägh da l’Albigna respektive unter einem Felsdach, ein Gewitter hält mich gefangen, und gleich fährt die letzte Bahn zurück ins Tal.« Leider war die Verbindung gestört, er wusste bis zuletzt nicht, ob sie ihn verstanden hatte, und nachdem er sie gefragt hatte, was sie hier so Aufregendes oder Erinnernswertes erlebt habe, erhaschte er von ihrer Antwort auch nur Stückwerk. Offenbar hatte sie in der SAC-Hütte oberhalb des Sees ein Fest gefeiert, womöglich eine Kindstaufe, außerdem erzählte sie von Feuern, die überall geflackert hätten. »Elmsfeuer? Sprichst du von Elmsfeuern?«, fragte er nach (er schrie gegen den Wind an, der, wie sie beklagt hatte, ins Mikrofon seines Handys blies): Danach hörte er von ihrer Seite her noch zwei, drei explosive Laute, Knaller oder Lacher, dann brach die Verbindung ab.
Er sah auf die Zeitangabe und entdeckte, dass ihm zehn Minuten bis zur letzten Talfahrt blieben. Der Regen war versiegt (es war bei jenen paar Tropfen geblieben), auch Blitze oder Wetterleuchten hatte er nicht mehr gesehen. Dennoch traute er sich nicht über den Damm, sondern stieg entlang der Mauer ab und stapfte an ihrem Fuß zurück zur Bergstation. Wäre nicht die Eile gewesen und eine gewisse Sorge seines Schuhwerks wegen, das wenig Profil hatte, so hätte er jene Minuten genossen, denn im Tal läuteten mehrere Kirchenglocken zugleich, und die Mauer fasste und verstärkte den Klang in einer Weise, dass ihm war, er schreite mitten hindurch, und er stellte sich vor, die ganze Welt sei Klang geworden.
Aller Eile zum Trotz verpasste er die letzte Bahn – das gestand er sich ein, nachdem er eine Viertelstunde lang vergeblich das Servicetelefon betätigt hatte. Um sich zu trösten, kehrte er zurück unter die Mauer und hoffte auf eine weitere Klangsensation (so wollte er den Eindruck nennen, wenn er Marta davon berichtete). Doch die Glocken waren verstummt, und der Straßenlärm, den die Mauer nun zurückwarf, klang nicht halb so magisch. Als er eben entschieden hatte, den Abstieg anzutreten, setzte wieder Regen ein, von der vielleicht hundert Meter hohen Stauwand rann er gleich in Bächen, und es dauerte keine Minute, bis er ausglitt und rücklings hinschlug, zu seinem Glück an einer flachen Stelle. Dennoch war ihm sofort klar, dass er bei solchem Wetter nicht unversehrt ins Tal käme.
Auf allen vieren kletterte er aufwärts, zurück zu jener Stelle, von der aus er mit Marta telefoniert hatte. Er schrieb ihr eine Nachricht: Stecke fest, melde ich mich nicht bis morgen früh, Rettung alarmieren, löschte sie aber gleich wieder, aß zwei Cracker, die er ebenfalls stets mit sich trug, dann hörte er dem Regen zu und formulierte in Gedanken, wie er Marta nach der Heimkehr sein Abenteuer schildern wollte.
Darüber war er wohl eingenickt, plötzlich war es dunkel. Die Wolken hatten aufgerissen, und als er sich erhob und auf den Damm hinaustrat, sah er, dass der Vollmond sich im See spiegelte – so plastisch, dass man denken mochte, er sei hineingestürzt. Nun war er dankbar für all die Missgeschicke, die ihn droben festgehalten hatten, hielt sich gar für einen Glückspilz und beschloss in plötzlicher Euphorie, nun auch den Berg in Angriff zu nehmen, um in der Hütte zu logieren, nach einer feinen Suppe, serviert vielleicht von einer hübschen Kellnerin, und Geplauder mit gewiss hochinteressanten Gebirgskundigen. Sein Mut zur Geselligkeit hielt jedoch nur vor, bis sich wieder Wolken vor den Mond schoben. Den Weg – einen steilen Weg durch allerlei Geröll – musste er ertasten, mehrmals schürfte er sich die Haut auf, und als er der Hütte nahe kam, fühlte er sich derart dürftig, dass er sich nicht unter Menschen wagte. Auch wurde dort offenbar wieder gefeiert, die Hütte war bunt geschmückt, er hörte Musik und laute Stimmen. Also schlich er vorbei, zu jenem zweiten, kleineren Dach, dort brannten keine Lichter. Inzwischen schmerzten alle Glieder, er zog sich mehr von Fels zu Fels, als dass er stieg, und seitdem ihm eingefallen war, dass sich angeblich die Kontinentalplatten noch immer verschoben und die Alpen deshalb weiterwuchsen, wenn auch nur gering, fühlte er bei jedem Schritt buchstäblich, wie gerade jene zwei, drei Millimeter fehlten.
Das zweite Dach deckte einen kleinen Schuppen mit mehreren, allesamt von außen begehbaren Abteilen. Eines davon war nicht verriegelt, weil die Tür verzogen war und sich sperrte. In jenem Räumchen kauerte er nieder – zum Liegen war zu wenig Platz –, die Tür zog er mit einiger Kraft zu sich (mittels einer geteerten Zweimeterschnur, die ebenfalls zu seiner Reiseausrüstung gehörte). Er konnte die Enden der Schnur nur nirgends verankern, behielt sie um die Hand geschlungen und schlief so natürlich nicht, denn das Blut staute sich, und alle paar Minuten musste er die Wicklung lösen und die Hand wechseln. Immerhin döste er ein bisschen, verfolgt von unanständigen Gedanken, in denen Marta die Hauptrolle spielte. Diese Fantasien waren, mehr noch als die Schmerzen in den Händen, sein Grund, bald wieder aufzubrechen.
Dabei beging er den Fehler, auf dem Handy nachzusehen, wie spät es war, danach war er geblendet und stieg versehentlich in einen Teich. Doch er belachte sein Missgeschick, und wieder malte er sich aus, wie er Marta davon erzählte: »Stell dir vor, bei tiefschwarzer Nacht wollte ich dir eine Seerose pflücken – als Souvenir quasi.« Daraufhin würde sie ihn küssen, gerührt ob so viel Leidenschaft. Wobei: Viel eher würde sie wissen wollen, ob er denn davor welche gesehen hatte, bei so schwarzer Nacht, und ihm bliebe nur etwas zu sagen wie: »Gesehen nicht, da war allein die Hoffnung – oder sagen wir, ich habe einen See geträumt, auf dem Seerosen wuchsen.« Doch das kam ihm gleich so lächerlich vor, und schlimmer noch, der Gedanke setzte sich so hartnäckig fest, dass er ihn nur verdrängen konnte, indem er beschloss, Marta – und zwar jetzt, auf der Stelle – einen Zweig Alpenrosen zu pflücken. Nur derart konnte er vor sich selbst seine nassen Füße rechtfertigen, ach, überhaupt seine Dummheit.
Während er sich weitertastete, kamen ihm die grellen Straßenlampen vor dem Schlafzimmerfenster seiner kleinen Leimbacher Wohnung in den Sinn, erstmals fühlte er nach ihnen Sehnsucht. Und endlich, als er eben die Alpenrose gebrochen hatte, öffnete sich das Wolkendach, er sah eine Flut von Sternen, und bald schien auch der Mond durch einen Wolkenspalt, erleuchtete die Felswand neben ihm, und er entdeckte eine Höhle, nein, mehr als das. Eine ins Leere ragende Felsplatte hatte jemand solcherart mit geschichteten Steinen unterfüttert, dass eine regelrechte Hütte entstanden war, komplett mit Fenster- und Türöffnungen. Er glaubte, einige Zeilen darüber in einem Prospekt gelesen zu haben, der in seinem Hotelzimmer lag, etwas über einen Schafe hütenden Bürgermeister. Danach gefiel ihm sein Fund noch besser, und nachdem er sich vergewissert hatte, dass kein Bär in der Höhle war, stieg er aus den Schuhen, hüllte sich in eine Notfallfolie, die er ebenfalls stets bei sich trug – da er einen empfindlichen Schlaf hatte, breitete er auf Reisen stets eine unter dem Bett aus, das half gegen Wasseradern –, und während er sich vorstellte, wie jener Bürgermeister, eng bedrängt von seinen Schafen, hier ganze Sommer verbracht hatte, schlief er ein.
Gelegentlich drang das Gellen eines Murmeltiers an sein Ohr, doch wirklich wach wurde er erst, als die Sonne über den Grat stieg. Er faltete die Decke, aß die kleine Packung Cracker leer und stieg, nachdem er die klammen Füße massiert hatte, zurück in die noch immer triefend nassen Schuhe.
Dennoch rannte er beim Abstieg fast, so glücklich war er – nicht nur der Sonne und der überstandenen Gefahr wegen. Vor allem hatte er in jener Nacht geträumt, was er Marta sagen müsste, wenn er ihr die Alpenrose überreichte, um damit seinem ganzen Leben eine Wende zu geben, es war ein Satz von großer Kraft und unbedingter Wirkung. Leider entdeckte er an der Talstation, dass er die Fahrkarte verloren hatte, er sollte ein zweites Mal bezahlen, überdies wollte der Wärter nicht glauben, dass er nur die Alpenrose geplündert hatte, verlangte, dass er alle Taschen öffnete, und beschimpfte ihn, obwohl – oder vielleicht eben weil – er nicht fündig wurde. Darüber vergaß Michael Panda jenen einen erlösenden Satz, konnte ihn in den kommenden Tagen nicht wieder in Erinnerung bringen und wusste zwar, die Chance, dass er ihm wieder einfiel, war oben am See, in jener Höhle am größten, doch er getraute sich kein zweites Mal hinauf.
Wellen
Zu seinem vierzigjährigen Jubiläum bei der Rhätischen Bahn erhielt Streckenwärter Bartholomäus Klaus eine einwöchige Reise nach Venedig geschenkt. Das geschah sehr unkompliziert, der Umschlag mit den Fahrkarten und dem Hotelgutschein lag eines Tages einfach in seinem Dienstfach. Im Umschlag steckte zudem eine vorgedruckte Glückwunschkarte: Mit Dank zum Vierzigjährigen. Direktion RhB.
Da Bartholomäus in seiner gesamten Dienstzeit von niemandem gehört hatte, der zu seinem Vierzigjährigen ein so großzügiges Geschenk erhalten hätte, war er versucht, den Umschlag am Schalter abzugeben und darauf hinzuweisen, dass ein Versehen passiert sein mochte.
Nachdem er allerdings einen Nachmittag lang bei seinen Kaninchen darüber nachgedacht hatte, entschied er, still abzuwarten, ob sich jemand meldete. Stattdessen fand er auf seinem nächsten Dienstplan die betreffende Woche rot markiert und mit der Aufschrift Jubiläumsreise versehen. Das beseitigte seine Zweifel, und an einem diesig bewölkten Samstagmorgen im Juli, nachdem er die Kaninchen in die Obhut seiner Nachbarin gegeben hatte (die sie despektierlich »Eisenbahnerkühe« nannte) bestieg er den R1909 nach St. Moritz.
Die Reise klappte problemlos, obschon die Kollegen ihm eine ungewöhnliche Strecke gebucht hatten, via Chiavenna und Colico. Im Bus auf dem Malojapass und durchs Bergell hinab wurde ihm übel, aber sobald er wieder Schienen unter sich hatte, erholte er sich.
Mit bemerkenswert wenig Verspätung erreichte er Venedig. Und wurde unverhofft von einer heftigen Krise gepackt. Die Farbumstellung der RhB anlässlich ihres hundertsten Geburtstags von dezentem Feldgrün auf Signalrot 1989 war ein Schock gewesen, der ihn einige Wochen lang um den Schlaf gebracht hatte, doch er war noch jung gewesen und hatte sich wieder aufgerafft. Auch der Tod der Mutter, mit der er bis dahin, bis zu seinem dreiundvierzigsten Lebensjahr zusammengelebt hatte, hatte einen tiefen Einschnitt hinterlassen.
Die Erfahrung dieser Stadt war weder Schock noch Einschnitt, sie war viel grundlegender, ein Beben, das alles bis anhin Feste in Frage stellte, ein Felsrutsch. Bartholomäus’ Welt geriet ins Wanken. Fast die ganzen vierzig Jahre bei der RhB nämlich war er auf Gleisen unterwegs gewesen, die letzten achtundzwanzig immer auf der Albulastrecke. Jeden Tag hatte er fünf Kilometer abgeschritten, im exakt bemessenen Sechzig-Zentimeter-Gang von Schwelle zu Schwelle, um Schraubenmuttern, Gleisweichen, Tunnelwände kontrolliert. Selbst in seinen Träumen ging er jene Strecke ab (manchmal hielt er auch Zwiesprache mit seinen Kaninchen oder stritt mit seiner toten Mutter).
Und ob er nun schlief oder wachte: Jede dieser Streckenwanderungen war für Bartholomäus ein Abenteuer. Weil alles sich permanent verschob, veränderte, weil alles lebte. Die Gleistrasse, die Böschungen und Felswände links und rechts, die in den Berg geschlagenen Tunnelwölbungen und Spritzbetonbefestigungen, Leitungsrohre, Notportale, der Himmel, die Wolken, Schnee und Wind waren für ihn so beredt, dass ihm selbst in der Einsamkeit der Val Bever oft die Ohren dröhnten. Aus jeder Kleinigkeit las er ganz wesentliche, ja existenzielle Botschaften, aus dem Kondenswasser entlang der Leitungen, der Farbe der Rinnsale im Tunnel und draussen, der Elastizität von Gräsern und Ästen, aus Hirsch- und Fledermauslosung, Flugrostbildungen oder der Mürbheit des Gesteins. Er wusste, bei welchem Mondstand das Eis an der Tunneldecke wuchs und drohte, das Zugdach zu verletzen (dann schlug er es ab), er wusste, wann es schrumpfte. Bei Regenfällen wusste er den Tag voraus, an welchem die eichenen Bahnschwellen sich dehnten, verwarfen und zu Spannungen im Gleisbereich führten, die eine Weiche blockierten. Selbst oberhalb der Böschung die Steinstrukturen, die Schichtungen, Verwerfungen, Risse und Auswaschungen im Fels sah er nicht als starre Gebilde, sondern als hochsensible Systeme, die in der Weise, wie sich darin die Luft verfing, das Licht, der Nebel, ihm Auskunft über Dinge gaben, die so feinstofflich waren, dass er dafür keine Worte kannte.
Venedig war demgegenüber brachial. Die Fülle, der Lärm, die Hitze und das Stickige. Dazu kam, dass die Wege und Brücken sich Bartholomäus’ Sechzig-Zentimeter-Gang völlig widersetzten und er sich die Zehen wund schlug. Er wagte sich nicht aufs Schiff, zu Fuß verlief er sich andauernd und fand erst in der Abenddämmerung sein Hotel – von dröhnenden Kopfschmerzen geplagt, da er aus Sparsamkeit unterwegs nichts zu essen und zu trinken gekauft hatte, nur aus seinem Proviantrucksack gelebt, wie er es auch auf den Kontrollmärschen tat, aus einer verbeulten blechernen Lunchbox und einem seit Jahr und Tag neu mit Leitungswasser aufgefüllten Rhäzünser-Fläschlein.
Am kommenden Tag traute er sich gar nicht erst aus dem Zimmer, so erschlagend fand er die Stadt. Erst gegen Abend zwang ihn der Hunger hinaus (seit dem Frühstück hatte er nichts gegessen, und das hatte aus einer abgepackten Brioche und einer Tasse Anrührkaffee bestanden). Wieder irrte er lange umher, bis er einen winzigen Supermarkt entdeckte, der sieben Tage die Woche und bis in die Nacht geöffnet hatte. Dort kaufte er ein, was er kannte: Zwieback, Dosengemüse und Thunfisch in Öl.
Es war Nacht, als er aus dem Laden auf den Platz trat. Die Gassen, Pfade und Brücken waren kaum noch bevölkert. Endlich herrschte genügend Leere, dass Bartholomäus sich nicht mehr nur retten wollte, sondern auch wieder schauen konnte und kleine Dinge sah, die ihn erfreuten: zwei Fische im Kanal, weiße Blumen auf einem Fenstersims, die der Sommerhitze trotzten, Dellen in den ausgetretenen Marmorplatten, die so weich und so geschmeidig schienen, dass er nicht anders konnte, als niederzuknien und sie zu berühren.
Anderntags wagte Bartholomäus sich in aller Frühe auf einen Spaziergang und gelangte dabei an den großzügigen Canale della Giudecca, der Quai war breit und leer und bot gut Platz für Sechzig-Zentimeter-Schritte. Er spazierte etwas auf und ab, dann setzte er sich auf einen der salzzerfressenen Poller an der Quaikante und beobachtete so lange die Nachen, Bötchen, Vaporetti und Lastschiffe, bis er glaubte, das unsichtbare Netz von Fahrrinnen und Kurslinien durchschaut zu haben. Dann kehrte er zurück in sein Zimmer, aß auf der Bettkante sitzend zu Abend und träumte, nachdem er zu Bett gegangen war, seine Kaninchen hätten Möwenköpfe. Sie waren ihnen nicht am Hals festgewachsen, sondern steckten an Stäbchen, wie er Touristen sie für ihre Handykameras hatte benützen sehen.
Am Dienstag kehrte er an den Canale della Giudecca zurück und wagte sich bis an sein westliches Ende: Dort lag, streng abgeriegelt, eine Zoll- oder Quarantänestation. Das zwang ihn zur Umkehr, gleich darauf entdeckte er einen zweiten, sehr viel hübscheren Supermarkt. In einem Anflug von Leichtsinn kaufte er nicht mehr nur, was er sonst aß, nämlich Bohnen, Mais und Karotten, sondern Artischockenböden im Glas, dazu Südtiroler Joghurt.
Als er den klimatisierten Laden verließ, war es drei Minuten vor zehn. Das Licht war noch morgendlich blass und wollte nicht zur schwülen Hitze passen, die sich nie verlor. Auf der anderen Seite des Kanals erhob sich ein massiges Backsteingebäude mit der Aufschrift Stucky, vermutlich eine stillgelegte Fabrik. Einen Stucky hatte Bartholomäus in seiner Dienstzeit im Verkehrs- und Transportbataillon 1 der Schweizer Armee kennengelernt, einen gar nicht üblen Berner Kommandanten. Die Erinnerung färbte ab, plötzlich schien ihm dieses Venedig gar nicht mehr so übel. Er setzte sich abermals auf einen Poller und wärmte sich eine Weile am freundlichen Anblick der alten Fassade.
Dann bemerkte er eine Möwe, die auf einem von zwei eng nebeneinander aus dem Kanal aufragenden Holzpfählen saß, an denen wohl Schiffe vertäut wurden, und die wie er die Gegend musterte. Er nickte ihr höflich zu. Zu gern hätte er gewusst, was sie sah, auf was ihr einheimischer Vogelblick gerichtet war, und er versuchte, mit ihren Augen zu schauen. Zuerst sah er empor in den blassblauen Himmel, dann zu Boden, auf einen Einschnitt in der Quaikante, in dem eine Steintreppe über vielleicht vier, fünf Stufen direkt ins Wasser führte. Gerade musste Ebbe herrschen, denn die unteren Stufen waren dicht mit Algen oder Schlamm überwachsen und ragten dennoch über den Wasserspiegel, die eine deutlich, die andere knapp. Die untere wurde alle paar Sekunden von einer Welle überspült, dazu brauchte nicht einmal ein Boot vorbeizufahren, die obere nur alle naslang, wenn sich auf den nächstgelegenen Fahrrinnen der Verkehr ballte. Dann wogten die Algen, doch nur halbherzig, denn gleichzeitig bremste sie das eigene Gewicht, da sie noch immer zur Hälfte aus dem Wasser ragten oder allenfalls mit dem ersten Wellenkamm zur Gänze überflutet wurden, danach sackte der Wasserstand schon wieder ab und riss nur an den Pflanzenfüßen. Daraus entstand eine schleppende, fast wollüstige Bewegung, die Bartholomäus so gut gefiel, dass er sich nicht überwinden konnte, aufzustehen und weiterzugehen.
Mit den Stunden stieg der Wasserspiegel, die Pflanzen der unteren Stufe wehten aus der Tiefe empor wie die Locken einer Meerjungfrau, darüber kräuselte sich die Gischt. Bis zum Abend erkannte Bartholomäus zahlreiche Wellenarten, in enger Folge und in weiter, ungeordnet als Kabbelwasser und rollende, von denen oft mehrere aus verschiedenen Himmelsrichtungen kamen und scheinbar widerstandslos durcheinander hindurchzogen – etwa so, wie man zwei Fotonegative aufeinanderlegen und gegeneinander verschieben kann, ohne dass sich die einzelnen Bilder verändern. Andere lappten, schaukelten sich gegenseitig auf, oder eine brach sich an der anderen.
An dieser Stelle am Canale della Giudecca, vor dem Haus, in dem ein gewisser Luigi Nono einige Jahre verbracht hatte, ließ Bartholomäus die ganzen übrigen Ferien verstreichen. Nur zum Schlafen kehrte er in sein Hotel zurück.
Dort träumte er in der letzten Nacht, wie die Brandung des offenen Meers sich an rohen, wilden Steinen brach. Am anderen Morgen, als er den Zug nach Mailand bestieg, freute er sich zwar unbändig wie ein Hündchen darauf, bald die altgeliebten Felsverwerfungen und Klüfte des Albulamassivs wiederzusehen. Doch der Traum hatte Spuren hinterlassen, und so fühlte er zugleich – auch diese zwei Gefühle rollten quasi durcheinander hindurch, ohne sich zu beeinträchtigen – eine regelrechte Not, dachte er daran, wie jene Felsverwerfungen und diese Meeresflut in ihrem Ursprung ein und dieselbe Welt geteilt hatten, und nun waren sie so unüberbrückbar voneinander getrennt.