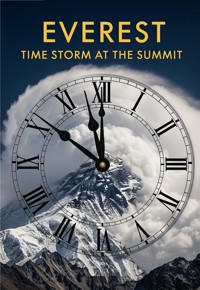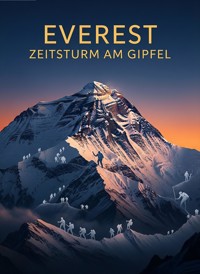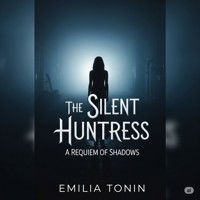Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Hauptgenre: Psychologischer Thriller Das ist definitiv die passendste Bezeichnung. Der Fokus liegt stark auf der Psyche der Täterin Marie, ihren Motivationen, ihrer Vergangenheit und ihrem Doppelleben. Auch die psychologischen Auswirkungen der schockierenden Enthüllungen auf Charaktere wie Maximilian sind zentral. Die Spannung entspringt hier weniger der äußeren Action, sondern vielmehr der inneren Zerrissenheit der Figuren, der Manipulation und den verborgenen dunklen Geheimnissen. Zusätzliche Kategorisierung: Kriminalroman / Thriller Das Buch passt auch sehr gut in diese breitere Kategorie. Es beinhaltet ungelöste Morde, die Suche nach der Wahrheit und die Aufklärung von Verbrechen. Der Thriller-Aspekt manifestiert sich durch die konstante Spannung, die schockierenden Entdeckungen und die andauernde Bedrohung, die selbst nach Maries Tod von ihren Enthüllungen ausgeht. "Gewalt" als thematisches Element, nicht als Genre Du hast völlig Recht, dass "Gewalt" keine eigenständige Genre-Bezeichnung im Buchhandel ist. Es ist ein zentrales Thema und ein entscheidender Bestandteil der Geschichte, der jedoch innerhalb der Genre-Grenzen des Thrillers oder Kriminalromans verhandelt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass "Die Stille Jägerin: Ein Requiem der Schatten" primär ein Psychologischer Thriller ist, der sich nahtlos in die Welt der Kriminalromane und Thriller einfügt und Gewalt als starkes thematisches Element nutzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Version 1.0 Die Stille Jägerin –
Ein Requiem der Schatten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
©2025 Emilia Tonin
Herstellung und Verlag:
Vorwort: Die Stille Jägerin –
Ein Requiem der Schatten
Dieses Buch, das Sie in Händen halten, ist das Ergebnis einer jahrelangen, zermürbenden Suche nach der Wahrheit. Es ist die Chronik eines Lebens, das nach außen hin so unscheinbar, so bieder wirkte, und doch einen Abgrund an Grausamkeit und Berechnung verbarg. Marie Korn, die Protagonistin dieser Seiten, war keine Figur aus einem Schauerroman – sie war real. Und ihre Taten waren es auch.
Was als vage Gerüchte begann, als unzählige ungeklärte Fälle und das Flüstern von Angst in den Gassen einer kleinen deutschen Stadt, entpuppte sich als das Werk einer der wohl kältesten und unbarmherzigsten Serienmörderinnen der jüngeren Geschichte. Eine Frau, die das Vertrauen ihrer Liebsten missbrauchte, Freunde zu Feinden machte und selbst ihre eigene Familie nicht verschonte. Sie war die "Stille Jägerin", die "Dunkle Killerin", der "Jahreskiller" – Namen, die das Grauen ihrer Taten nur unzureichend beschreiben können.
In diesen Kapiteln haben wir versucht, Maries Doppelleben zu entwirren: das der angesehenen Bürgerin und das der gnadenlosen Mörderin. Wir haben Zeugenaussagen gesammelt, Akten gewälzt und uns durch ein Labyrinth aus Lügen und Vertuschungen gekämpft, um die Stimmen der Opfer hörbar zu machen, die so lange im Schweigen gefangen waren. Von den frühen, unbemerkten Verbrechen bis zu den erschütternden Morden an ihren Ehemännern und den jüngsten Enthüllungen durch Pauls geheime Aufzeichnungen und Maries eigenes, verstörendes Geständnis – jeder Schritt auf dieser Reise war ein Tauchgang in die Abgründe der menschlichen Seele.
Dieses Buch ist mehr als nur eine kriminalistische Aufarbeitung. Es ist ein Versuch, das Unfassbare zu begreifen, die Mechanismen einer zutiefst gestörten Psyche zu beleuchten und gleichzeitig die unermüdliche Suche nach Gerechtigkeit zu würdigen. Es ist ein Denkmal für jene, deren Leben Marie Korn ausgelöscht hat, und ein Zeugnis der Beharrlichkeit derer, die sich weigerten, ihre Lügen unwidersprochen stehen zu lassen.
Möge dieses Werk dazu beitragen, dass die Opfer der "Stillen Jägerin" niemals vergessen werden und ihre Geschichte eine Mahnung bleibt, dass das Böse oft im Verborgenen lauert, selbst hinter der Fassade des Alltäglichen.
Hinweis des Autors: Dies ist ein rein fiktiver Roman. Alle Charaktere, Orte und Ereignisse sind Produkte der Vorstellungskraft des Autors. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen oder tatsächlichen Ereignissen ist rein zufällig und unbeabsichtigt.
Über die Autorin
Emilia Tonin, Jahrgang 2007, betritt mit ihrem ersten Roman "Die Stille Jägerin: Ein Requiem der Schatten" die literarische Bühne – ein außergewöhnliches Debüt, das bereits in jungen Jahren eine bemerkenswerte Tiefe und Reife offenbart. Mit gerade einmal 18 Jahren wagt sich Tonin an ein Thema, das so düster und vielschichtig ist, dass es den Leser unweigerlich in seinen Bann zieht und in die tiefsten Abgründe der menschlichen Psyche blicken lässt.
Ihre Fähigkeit, die komplexen Facetten von Gewalt, Manipulation und den daraus resultierenden unsichtbaren Wunden so authentisch darzustellen, ist eng mit ihrer eigenen Lebensgeschichte verbunden. Emilia wuchs in einem Umfeld auf, das von einer zerstörerischen familiären Dynamik geprägt war: eine gewalttätige Mutter, deren Handlungen tiefe Spuren hinterließen, und ein Vater, dessen wiederholte Übergriffe das Fundament der Familie erschütterten. Diese frühen, prägenden Erfahrungen formten Emilias Blick auf die Welt und weckten in ihr den unbedingten Drang, die vielschichtigen Ursachen und Auswirkungen von Gewalt zu erforschen und zu verstehen.
Das Schreiben wurde für Emilia zu einem essenziellen Ventil, einem Raum, in dem sie das Unfassbare verarbeiten und den Stimmen derer Gehör verschaffen konnte, die oft im Stillen leiden. "Die Stille Jägerin" ist somit weit mehr als ein fesselnder Kriminalroman. Es ist ein mutiges Zeugnis ihrer Auseinandersetzung mit unbequemen Wahrheiten, ein Spiegelbild ihrer scharfen Beobachtungsgabe und ihres unerschütterlichen Willens, die dunklen Seiten des Menschseins auszuleuchten, um letztlich einen Pfad zur Verarbeitung und zum Verständnis zu ebnen. Mit diesem Roman lädt Emilia Tonin ihre Leser ein, sich nicht nur mit der Fiktion auseinanderzusetzen, sondern auch über die Realität der Gewalt nachzudenken, die sich oft im Verborgenen abspielt.
Kapitel 1: Die Schatten von
Eichenhain (1943-1946)
Der Winter 1943 kroch eisig über Eichenhain, ein Vorort, dessen beschauliche Fassade von den allgegenwärtigen Sirenen und den fernen Grollen des Krieges durchbrochen wurde. Inmitten dieser bedrohlichen Kulisse, in einem kleinen, zugigen Haus in der Amselgasse, kam am 12. Dezember Marie Korn zur Welt. Ihre Geburt war kein Grund zur Freude, eher eine weitere Bürde in einer Welt, die bereits unter ihrer Last zusammenzubrechen drohte. Ihr Vater, ein einfacher Soldat, war nur wenige Wochen zuvor an der Ostfront gefallen. Ein Telegramm, kurz und grausam, hatte seine Existenz auf eine Zeile Papier reduziert.
Ihre Mutter, Helga Korn, eine Frau von steifer Haltung und noch steiferem Gemüt, empfing das Neugeborene mit einer Mixtur aus Pflichtgefühl und kalter Resignation. Helga war Lehrerin, eine Berufung, die sie mit preußischer Disziplin ausübte. Ihre Tage waren geprägt vom Unterrichten der wenigen verbliebenen Kinder in der Dorfschule, ihre Nächte vom Kampf gegen die Kälte und den Hunger. Marie war für sie kein zartes Bündel Glück, sondern eine Verantwortung, die sie mit der gleichen unerbittlichen Strenge anging wie einen ungezogenen Schüler.
Die Nachkriegszeit, die mit dem Frühling 1945 endlich über Eichenhain hereinbrach, brachte keine Erleichterung für die kleine Marie. Im Gegenteil, sie verfestigte nur die Mauern, die Helga um sich und ihr Kind errichtet hatte. Das wenige Essen wurde rationiert, Wärme war ein Luxus und Zuneigung ein unbekanntes Konzept. Während andere Kinder in den Ruinen spielten und versuchten, ein Stück Normalität zu finden, war Maries Welt auf das kleine Haus und die unerbittliche Präsenz ihrer Mutter beschränkt.
Helgas Narzissmus blühte in dieser kargen Umgebung. Sie sah in Marie weniger ein eigenständiges Wesen als eine Erweiterung ihrer selbst, ein Spiegel, der ihre eigene vermeintliche Stärke und Opferbereitschaft reflektieren sollte. Jede kindliche Äußerung von Neugier oder Unabhängigkeit wurde mit scharfen Worten zunichtegemacht. "Ein Kind hat zu gehorchen", war Helgas Mantra, das Maries früheste Erinnerungen prägte.
Bis 1946 war Marie ein stilles Kind geworden, dessen Augen mehr beobachteten, als sie je verrieten. Sie lernte schnell, ihre eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, ihre Emotionen zu verbergen. Die Stille im Haus war oft erdrückend, nur unterbrochen vom knirschenden Sand, der von den Schuhen der Mutter hereingetragen wurde, oder dem leisen Klappern von Geschirr. Marie spürte instinktiv, dass die Welt außerhalb der Amselgasse anders war, aber ihr einziger Bezugspunkt war die kalte, unnahbare Frau, die ihr das Leben geschenkt hatte. Und während Helga sich in ihrer Rolle als alleinerziehende Heldin suhlte, keimte in Marie etwas anderes, Dunkles. Etwas, das noch namenlos war, aber tief in den Schatten ihres jungen Herzens Wurzeln schlug.
Kapitel 2: Der Preis des
Gehorsams (1946-1949)
Die Jahre zwischen 1946 und 1949 legten einen dunklen Schleier über Maries ohnehin schon karge Kindheit in Eichenhain. Das Ende des Krieges hatte der Familie Korn zwar die ständige Angst vor Bombenangriffen genommen, aber es ersetzte sie durch eine andere Art von Terror: den der Isolation und der unerbittlichen Grausamkeit im eigenen Heim. Helga Korn sah in ihrer Tochter nicht länger nur eine Bürde, sondern zunehmend ein Objekt, an dem sie ihre aufgestauten Frustrationen und ihren tief verwurzelten Narzissmus ausließ.
Marie, nun drei Jahre alt, begann die Welt außerhalb der mütterlichen Kontrolle zu erkunden, und jeder Schritt in Richtung Unabhängigkeit wurde von Helga gnadenlos bestraft. Einmal, beim Spielen im Hof, stolperte Marie über einen losen Stein und schürfte sich das Knie auf. Der Schmerz ließ sie aufschreien, doch Helgas Reaktion war nicht Trost, sondern hämisches Lachen. "Tollpatschiges Ding", spottete sie und spuckte achtlos neben das weinende Kind, als wollte sie ihre Verachtung unterstreichen. Die Wunde an Maries Knie verheilte, doch die Narbe, die dieser Moment in ihrer Seele hinterließ, war weit tiefer.
Am Esstisch, dem einzigen Ort, an dem die Familie, so spärlich sie auch war, zusammenkam, wurde Maries Demütigung zur täglichen Routine. Während Helga sich oft ein Stück des seltenen Fleisches gönnte, das sie auf dem Schwarzmarkt erhandelt hatte, bekam Marie nur dünne Suppe, die kaum sättigte. "Du musst lernen, bescheiden zu sein", dozierte Helga mit vollem Mund, während Maries Magen knurrte und ihr Blick sehnsüchtig auf das dampfende Fleisch gerichtet war, das ihr verwehrt blieb.
Maries kindlicher Widerstand wuchs mit jedem Akt der Unterdrückung. Die anfangs nur stillen Beobachtungen wichen nun kleinen Akten der Rebellion. Ein absichtlich fallen gelassener Teller, ein Trotz Anfall, wenn sie nicht hören wollte – jede dieser kindlichen Auflehnungen traf Helga ins Mark. Ihre Reaktion war brutal und unnachgiebig. Maries Zimmer, ohnehin spartanisch, wurde zu ihrem Gefängnis. Tage und Nächte verbrachte sie oft eingesperrt, in der Dunkelheit und Stille, die nur von ihrer eigenen Angst und Wut durchbrochen wurden.
Mit der Zeit eskalierte Helgas Gewalt. Als Marie einmal wieder besonders trotzig war, packte Helga sie und schor ihr mit einer stumpfen Schere grob die Haare ab. Die schiefen, zerzausten Strähnen, die zu Boden fielen, waren nicht nur ein Zeichen von Helgas Rache, sondern auch ein Symbol für die Zerstörung von Maries Kindheit. Doch der absolute Tiefpunkt wurde erreicht, als Helga, im Wahn ihrer Wut, ein Küchenmesser ergriff und damit auf die kleine Marie losging. Nur durch Glück und Maries instinktives Ausweichen wurde ein tödlicher Stich verhindert. Das Messer hinterließ eine flache Schnittwunde an Maries Arm – eine weitere physische Narbe, die Zeugnis von der Brutalität ihrer Mutter ablegte. In diesen Momenten des reinen Terrors spürte Marie nicht nur Angst, sondern auch eine wachsende, kalte Entschlossenheit. Die Welt war ein grausamer Ort, das hatte sie gelernt, und wenn sie überleben wollte, musste sie lernen, sich zu wehren. Nicht mit Tränen, sondern mit etwas anderem, das in den Schatten ihres jungen Herzens immer stärker wurde.
Kapitel 3: Die Brennende
Scham (1950-1951)
Das Jahr 1950 brach an und mit ihm der Beginn von Maries Schulpflicht. Sechs Jahre alt, sollte dieser neue Lebensabschnitt ihr eigentlich eine Flucht aus dem Haus in der Amselgasse und der Tyrannei Helga Korns ermöglichen. Doch Helga sorgte dafür, dass selbst dieser kleine Hoffnungsschimmer ausgelöscht wurde. Am ersten Schultag, während sich die anderen Erstklässler nervös an den Händen ihrer Eltern festhielten, zog Helga Marie unsanft zur Dorfschule in Eichenhain. Vor der versammelten Klasse, den neugierigen Blicken der anderen Kinder und der Lehrerin ausgesetzt, demütigte Helga ihre Tochter mit einem herablassenden Kommentar über Maries Aussehen und mangelnde Intelligenz. Ein spöttisches Lächeln spielte um Helgas Lippen, während Maries Wangen vor Scham brannten. Das Bild der lachenden Mutter und der starrenden Gesichter der Klassenkameraden brannte sich tief in Maries Gedächtnis ein und verfolgte sie noch lange danach.
Die Schule selbst bot Marie kaum den erhofften Schutz. Zwar waren die physischen Übergriffe ihrer Mutter dort abwesend, doch die ständige Angst vor Helgas Reaktionen lähmte Marie. Die Unsicherheit und die Angst, etwas falsch zu machen, ließen sie in sich gekehrt und schüchtern wirken. Ihre Klassenkameraden, noch unschuldig und grausam zugleich, merkten schnell, dass mit der stillen Marie etwas nicht stimmte.
Eines Nachmittags, auf dem Heimweg von der Schule, stolperte Marie über eine Wurzel und fiel in den schlammigen Graben am Wegesrand. Ihre Kleidung war verdreckt, ihre Knie aufgeschlagen. Der Schock über den Sturz war nichts im Vergleich zu der Panik, die sie ergriff, als sie Helgas Schatten am Horizont sah. Sie wusste, was sie erwartete. Und tatsächlich, als Helga sie erreichte, gab es keine Spur von Sorge. Stattdessen brüllte Helga sie an, beschimpfte sie als "dreckige Göre" und "Schande". Dann folgten die Schläge, Tritte und Spucke, die Marie in den Dreck drückten, während Helgas wutverzerrtes Gesicht über ihr hing. Jeder Schlag, jede Beschimpfung war eine Bestätigung von Maries Wertlosigkeit in den Augen ihrer Mutter.
Zu Hause ging die Tortur weiter. Das Abendessen, meist nur die obligatorische Suppe, wurde zu einem weiteren Schlachtfeld. Wenn Marie, überfordert von den Ereignissen des Tages oder einfach nur satt, ihren Teller nicht leer aß, schlug Helga ihr den Teller mit der restlichen Suppe ins Gesicht. Die heiße Flüssigkeit verbrannte leicht ihre Haut, der Schmerz und die Erniedrigung vermischten sich zu einer brennenden Scham.
Selbst die Körperpflege wurde zu einer Waffe. Beim Baden, das ohnehin selten und lieblos stattfand, drehte Helga plötzlich den Wasserhahn auf die heißeste Stufe. Maries Aufschrei vor Schmerz und das brennende Gefühl auf ihrer Haut wurden von Helgas kalter Miene quittiert. Die Verbrühungen waren meist nur leicht, aber die Botschaft war klar: Maries Körper und ihre Schmerzgrenze gehörten nicht ihr, sondern waren dem Willen ihrer Mutter unterworfen.
Diese Qualen begleiteten Marie durch ihre gesamte erste und zweite Klasse, das heißt, durch die Jahre 1950 und 1951. Die unerbittliche Demütigung, die körperliche und seelische Gewalt formten das junge Mädchen auf eine Weise, die unwiderruflich schien. Die Tränen versiegten oft schon, bevor sie fließen konnten, ersetzt durch eine leere Starre in Maries Augen. Die Welt wurde zu einem Ort, an dem Schmerz und Leid die einzigen Konstanten waren, und die Quelle dieses Leidens war immer die Person, die ihr am nächsten stehen sollte. Doch tief in ihrem Inneren regte sich etwas, ein kalter, harter Kern, der begann, sich gegen die ewige Unterwerfung zu wehren.
Kapitel 4: Der erste Schatten
und die wachsende
Dunkelheit (1952-1955)
Die Jahre 1952 bis 1955 markierten einen Wendepunkt in Maries Entwicklung. Die ständige Qual durch ihre Mutter Helga – die Schnittwunden, die Verbrennungen, die Demütigungen, die nun auch Brandwunden zweiten Grades einschlossen, welche Helga Marie mit kochendem Wasser oder heißen Bügeleisen zufügte – hinterließen nicht nur physische Narben, sondern veränderten Marie grundlegend. Die stille, ängstliche Schülerin verschwand, und an ihrer Stelle trat eine wachsende Aggressivität, die sich nicht länger nur nach innen richtete.
In der Schule in Eichenhain eskalierte die Situation, insbesondere mit einem Klassenkameraden, Tim Schneider . Tim, ein rüpelhafter Junge mit einer Vorliebe dafür, schwächere Kinder zu hänseln, hatte Marie wiederholt ins Visier genommen. Seine Sticheleien waren wie das Benzin auf ein bereits schwelendes Feuer. Der Konflikt schwelte über Wochen, bis er sich eines Nachmittags entlud. Nach der Schule folgten Tim und Marie einem Streit in den angrenzenden Wald, einem Ort, der bald von einer unheilvollen Stille erfüllt sein sollte.
Was genau dort geschah, wusste nur Marie. Doch als Tim sich abwandte, um einen Ast zu untersuchen, nutzte Marie den Moment. Mit einem gefundenen, spitzen Stock stach sie zu. Nicht einmal, sondern wiederholt, in Tims Rücken. Ein kurzer, würgender Laut, dann Stille. Marie blickte auf den regungslosen Körper, ohne Reue. Nur ein kalter, fast zufriedener Ausdruck lag in ihren Augen. Sie säuberte den Stock grob an Moos und Blättern und verließ den Wald, als wäre nichts geschehen, ihr Herz pochen leise, aber nicht vor Angst, eher vor einer neuen, unheimlichen Erleichterung.
Als Tim später von Suchtrupps im Wald gefunden wurde, brach in Eichenhain Panik aus. Die Polizei ermittelte, befragte Klassenkameraden. Marie wurde ebenfalls vernommen. Man hatte sie zuletzt mit Tim gesehen, und die Fragen der Polizisten konzentrierten sich auf sie. Doch Marie, bereits eine Meisterin der Täuschung und des Verbergens, log kalt und überzeugend. Sie habe Tim nur kurz getroffen, er sei dann allein weitergegangen, und man würde sie ja nur wieder für etwas beschuldigen, was sie nicht getan habe. Ihre kindliche, aber unerschütterliche Leugnung, gepaßt mit der Angst der Ermittler, ein sechsjähriges Mädchen als Mörderin zu identifizieren, führte dazu, dass die Ermittlungen ins Stocken gerieten. Der Fall Tim Schneider wurde zu einem ungelösten Rätsel in der Chronik von Eichenhain.
Trotz der inneren Gewissheit ihrer Tat, oder vielleicht gerade deswegen, setzte sich Maries selbstzerstörerisches und aggressives Verhalten fort. Die Demütigungen und Misshandlungen durch Helga wurden zur täglichen Realität, aber Marie wehrte sich nun. In der Klasse begann sie, offen zu rebellieren. Schlägereien wurden alltäglich, Bleistifte verwandelten sich in Waffen, die sie rücksichtslos gegen andere Kinder einsetzte. Das Besondere daran war ein auffälliges Muster: Marie suchte sich vorwiegend blonde Mädchen und Jungen als Opfer aus. Ihre Attacken waren zielgerichtet und grausam, oft ohne ersichtlichen Grund. Die Lehrer waren ratlos, die Schulleitung überfordert. Niemand konnte sich erklären, warum die ehemals so stille Marie zu einem solchen Teufel geworden war und warum gerade blonde Kinder ihre besondere Zielscheibe waren. Doch für Marie war es klar. Irgendetwas in diesen blonden Köpfen erinnerte sie an eine Kälte, die ihr allzu vertraut war.
Kapitel 5: Die Brandnarben
der Seele und die dunkle
Ideologie (1955-1959)
Die Jahre 1955 bis 1959 waren für Marie Korn eine Zeit der stillen, aber tiefgreifenden Metamorphose. Die äußere Ruhe trügte, denn im Inneren festigte sich das Fundament für eine Persönlichkeit, die von den Qualen ihrer Kindheit geformt und nun eine erschreckende Richtung einschlug. Die Schule in Eichenhain wurde weiterhin zum Schauplatz ihrer kalten Aggressionen. Ein Vorfall, der ihre berechnende Bösartigkeit offenbarte, ereignete sich, als Marie eine Mitschülerin, Lena Meier, verpfiff. Lena hatte im Unterricht statt zuzuhören heimlich gemalt. Marie berichtete dies der Lehrerin, wissend um die zu erwartende Strafe. Doch als Rache nahm Marie eine Schere und schnitt Lena während einer Pause die Haare ab – ein Akt der Demütigung, der die gleiche Machtdemonstration spiegelte, die Marie selbst so oft erfahren hatte.
Ab 1957 und 1958 begannen sich bei Marie zunehmend beunruhigende Veränderungen abzuzeichnen, die niemand in ihrem Umfeld deuten konnte. Sie wurde radikaler in ihren Ansichten und äußerte offen ihre Absicht, nicht am schulischen Grillfest teilnehmen zu wollen. Stattdessen begann sie, immer wieder den Hitlergruß zu zeigen und Naziparolen zu brüllen, was ihr wiederholt Ärger und Strafen von der Schulleitung einbrachte. Das Kuriose war, dass Marie diese Konsequenzen mit einem höhnischen Lachen quittierte, anstatt sie ernst zu nehmen. Es war, als würde sie die Empörung der Erwachsenen genießen, eine Bestätigung ihrer eigenen dunklen Gedanken.
Das Jahr 1959, kurz vor ihrem Schulabschluss, brachte dann den Höhepunkt. Bei einer Demonstration auf dem Marktplatz der nahegelegenen Stadt, die für eine friedliche Gesellschaft warb, erschien Marie mit einem selbstgemalten Schild. Die Botschaft darauf war schockierend: Es forderte die Wiedereröffnung der Konzentrationslager und die Verbrennung der Juden. Diese eiskalte Provokation blieb nicht unbemerkt. Die Stasi wurde auf Marie aufmerksam und lud sie zu einem Verhör vor.
Was dann geschah, offenbarte Maries erstaunliche Fähigkeit zur Manipulation. Sie erzählte den Stasi-Beamten eine Geschichte von Missbrauch: Ihr Vater habe sie angeblich vergewaltigt, und ihre Mutter habe sie ihr ganzes Leben lang misshandelt. Letzteres stimmte zwar, aber die Stasi schenkte ihrer Geschichte keinen Glauben. Sie versuchten, Maries Vater zu befragen, doch Herr Korn, Maries Vater, war seit 1959 spurlos verschwunden, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Niemand wusste, was mit ihm geschehen war.
Also befragte man Helga Korn