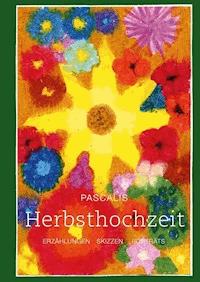Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Demonstration gegen den Fluglärm – wer schlösse sich da nicht gern an. Was ‚die da oben‘ planen, in Taten umsetzen, vollführen, paßt uns kleinen Leutchen keineswegs immer in den täglichen Kram. "Die" sind das Innendrin, das sorgfältige Berechnen, das Riskieren, das Tun. Wir das Außen, das Meckern, die gepeinigten Ohren ... Was sagten Sie? Bei dem unerträglichen Lärm verstehe ich Sie so sehr schlecht ... Isch hunn gesagt, daß unser schee Ländsche, dess lieb klee Zipfelsche vum herrlisch Rhoihesse, wo mer doch all lebe, schon arig geschunne is vun dem ständische Lärm ... Wir können’s nicht ändern – bläst dieser feine, zügige Ostwind, holt er uns die kleinen und großen Maschinen ganz selbstverständlich ins himmlische Blau. Wer hätte die Stille nicht tausendmal lieber. Bei West-, oder Süd- oder Nordwind überwiegt sie so gut, streichelt das Herz, gibt eigenen Gedanken wunderschön Raum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
I
Die Straße der Fliegenden Fische
II
Marcel
Dörfer
Franz-Hartwig
Rachel
Die Stadt
Manfred
Johannis-Fest
Maimorgen
Hochwasser
III
Vanessas Baby
Wein(wirtschaften)
Weizen
Mähdrescherzeit
Erdbeeren
Tante Emma
Eine topographische Karte
Andrea
Friedfische
IV
Kriemhild
Die Brüder oder Der Auftrag
Herbst
Die kleine Brücke
Großfürsten
Lärm
Totensonntag
V
Ein weißes Krägelchen
Glatteis
Flughafen
Bäcker
Die Straße der flitzenden Schwalben
Eine Zwergfledermaus
Eidechsen
Unser Uni
Den gelben Hubschrauber
Tessa (Samurai)
VI
Wie eine Feder
Das Antlitz der Erde
Der Maler
Der Tanz der Mücken
Das scharlachrote Band
Passagiere und Cargo
Dschingis-Khan
Schmutziger Winter
Die Fastnacht
Der Bischof
Heiligkeiten
VII
Quantensprung
Der Reiher
Flughafen-Jäger
Kraniche!
Vöglein in Schachteln und Kistchen
Erntedank und die Möglichkeiten des Erdreichs
Auch die Unmöglichkeiten
Rutschende Hänge
Erdbeben? Erdbeben!
Gewitter
VIII
Die gemäßigte Metropole
Das Kind
Der Mond
Fallende Sterne
Ein Brief für Rachel
Ein Anflug, ein Abflug
Superfisch
Kopf und Kragen
Eine startende Maschine
Mikosch
Die Rückseite des Schlößchens
Kein Tropfen Blut
IX
Jagden
Mikel Fitzgerald McLoy (Cargo again)
Zuckertüten
Freiluftereignisse
Hands up!
Die Dauer der Garzeit
Das Licht der Sonne
Trockenstrauß
X
Die Straße der Fliegenden Fische
I
Die Straße der Fliegenden Fische zieht sich, wenn wir die reale Entfernung als ihr Maß nehmen wollen, kaum mehr als achtzig Kilometer weit hin. Indessen reichen eine Million Gedanken, Aufzeichnungen, Notizen nicht aus, ihr Volumen auch nur annähernd zu erfassen. Vor allem bei Ostwind ziehen Hering und Wal, Seelachs und Hecht, Makrele, Kabeljau, Delphin und der Stör ihre Bahn, durchreiten schnittige Leiber das Gewebe der Luft wie sonst die uns weit mehr vertrauten Elemente von Wasser und See. Vorübergehend haben sie ihre Gewänder vertauscht, glatt und starr sehen sie aus, und sehr elegant, grau, weiß und blau ziehen sie im Blauen und Grauen und Weißen dahin.
Die Straße umfaßt viele Dörfer und mittlere Orte, doch nur eine Stadt. Tage umschließt sie, Wochen, Monate und Jahre, doch auch die Nacht. An die Lichter der Autos hat sich jeder gewöhnt, die langen Ketten der Pendler morgens und abends auf Straßen und Autobahn. Teilt sich hingegen das Dunkel dort oben, wird es geschnitten, beiseite geschoben von der unfaßlichen Helle wattstarker Leuchten, werden die Wolken beleuchtet, das Ballen und Ziehen und Schweben im Bruchwert von Blicken den Blicken zur Ansicht gebracht, erfaßt uns Staunen, Respekt. Leuchtfische! Auch an ihren Anblick sind wir gewöhnt, an ihre herrlich farbige Pracht dank der unterseeischen Filmerei, welche Wunder der Phantasie, der unglaublichen Tiefe! Überraschung sind sie uns noch heute von Mal zu Mal, wer hätte gedacht, solches zu finden, warum überhaupt diese Fülle und Schönheit dort unten, wem sind, waren sie bisher zugänglich, von Nutzen? Jahrmillionen gibt es sie schon, uns hingegen keineswegs, wer hat sich bisher an ihnen erfreut? Geübt an ihrem Gewimmel, ihrem friedlichen, feindlichen Tun? Ihrem Speisen und Prassen, Töten und Zeugen, dem unerschöpflichen Heranwachsen neuester Brut? Ein Tummelplatz gleich einer Maiwiese, auf vier Jahreszeiten, zwölf Monate gedehnt!
Und nun diese nicht anders üppige Weite nach oben! Nach Parterre, erster und zweiter Etage, die von den bescheidenen Völkern der Vögel bewohnt, von Fiepern und Schmätzern, Sängern und Turtlern, Kranich, Greifen und majestätischen Räubern, die Leere schlechthin – Platz in Hülle und Fülle und alleine für sie: die Welt der fliegenden Fische und die fliegenden Fische darin. Doch hier, genau hier über unserem kleinen Stück Land in atemberaubender Raumnot zur Schleuse verengt und wieder zur Ansicht gebracht, aus unfaßlicher Höhe vor unser Staunen geholt.
Was ist diese Straße genau? Eine Schneise, ein Korridor, eine Piste, ein Nadelöhr, durch den, die, das jeder der heranziehenden Flugfische muß. Das Ziel zwingt ihn dazu, die Landung, das Herabmüssen aus gewaltigen Höhen, die Wünsche also der Fracht, und um diese nur geht es. Langsam müssen sie werden, die nahezu Überschnellen, der Flughafen zieht sie an unsichtbaren Fäden heran, nimmt Piloten jeden Entschluß aus den erprobtesten Köpfen, als seien sie Kinder, denen das Spielzeug jetzt gefährlich zu scharf – Vor- und Rückstoß, Zielen und Treffen müssen einander in Mikroziffern der Kräfte, des Raums, in Maß und Meter entsprechen. Hätte einer die Gefahr der jeweiligen Reise zu gewichten, genau dieser Moment jetzt, da der Fisch wieder zum Landtier wird, werden muß, die Flosse wieder zum Fuß, Füße zu Rollen, die Erde ihn will und er sie auch, sie einander so zart und innig, kaum fühlbar begrüßen, als seien sie Mutter und Sohn, Liebhaber und Weib, ergäbe den weitaus höchsten, den risikoreichsten Wert.
Das ist es, was die Straße, das ‘Unten’, so fest mit dem ‘Oben’ verbindet: Das Unten starrt hinauf, kann es noch immer nicht fassen. Whale Watching ist das, Zeitvertreib höchster Vergnüglichkeit, anhaltenden Respekts. Die großen Körper! Dem Luftschiff glückt die Kopie im Auf und Ab seines Steigens und Tauchens, sich Drehens und Wendens nahezu perfekt (wann wird es zu singen beginnen –?). In einem chinesischen Restaurant hingegen, vor einem Aquarium, das mit einer Vielzahl buntester Fischlein das Auge ebenfalls lockt, mit zartem Schleiergefächel knielanger Flossengewänder, mit wunderschön schnappenden Lippchen, ja zärtlichen Küßchen von Mäulchen zu Maul, beweist sich das andere Extrem: Die Anmut solch zauberhafter Geschöpfe erreichte selbst die Luftfrau, die Reine, die machschnelle Concorde sicherlich nie. Und das Oben sieht hinab, voller Angst, wagt nie gänzlich, dem allen zu trauen, fürchtet das Versagen. Und ist doch für immer gefesselt, überwältigt von der Schönheit, der Fremde, der ganz und gar neuen Sicht seines Gewohnten. Der Möglichkeit, der Kraft, die nie mehr zu vergessen sein wird.
Wie konnte es nur gelingen? So plötzlich? Was sind knapp hundert Jahre im jahrtausendelangen Zug durch die Zeit? Wohl haben welche begonnen zu tüfteln, zu rechnen, auszuprobieren. Kühne Gedanken knapp unter die Wolken geschickt, das Verlangen auf die Schwingen der Vögel, keineswegs sicher, daß daraus jemals was wird. Doch es gelang! Urplötzlich ist das Geheimnis geknackt – Und seht zu jetzt, daß es auch klappt! Ein ganz und gar überraschendes Geburtstagsgeschenk – und welches! – für den spielenden, tüchtigen, Werkzeug sich schaffenden Mann. Wie Michelangelo, Mozart ...
Ja, sie sehen hinab auf den silbern, goldfarben blinkenden Strom, das sich windende Band, das Land, das es umschließt. Das Knie, das Bewegung verheißt und ermöglicht, sich beugt und entläßt. Ziehen, überfliegen die Höhen mit ihren Kuppen, die Täler mit Feldern und Wiesen, die Dörfer und Dächer, die Wege und das Gewimmel der Pünktchen darauf. Nichts hält sie auf, der Erdboden nicht und das Wasser, ihr Ziel sind Hafen und Ankunft, Sinkflug, Langsamtun, Entleerung und Rast. Was sie tragen, aufnehmen und wieder abgeben, ist Verdichtung, Essenz des Lebens dort unten, Gedanken, Worte, nicht Taten. Sie tragen schwer, doch anmutig, leicht, wer hat sie geschaffen: Ein paar der Pünktchen dort unten. Die griffen nur kurz in die Kiste der Aves, verwarfen, zur Demut gelehrt, das unnachahmbare Modell der beweglichen Schwingen. Begaben sich hinab, ganz hinab zu den Pesces, bedachten sorgsam und hartnäckig An-, Vor- und Auftrieb, Größe des Objekts und Entgegenkommen oder Widerstand des Elements – noch sehr, sehr vieles mehr, und wurden doch fündig so schnell, daß selbst ein Jahrhundert wie ein Lidschlag versprang.
Die Straße der fliegenden Fische wird durch den Strom geteilt in zwei fast gleich lange Hälften, wovon uns, unsere Beobachtungen, unsere Gedanken darüber, die westliche beschäftigen wird. Ein Landstrich, der den Brüdern auf der östlichen Seite bis noch vor kurzem als nahezu unbekanntes Terrain, als Outback, Ort finstersten, gut erhaltenen Mittelalters, kulturell als ein tiefschwarzes Loch erschien, Pampa, Wüste, der Rede nicht wert. In der Tat ein Landstrich, in dem der Wald nichts verloren hat – doch, in den breit hinziehenden Tälern jeden Quadratmeter Boden an den Weizen, am Hang und auf den Höhen jeden Quadratzentimeter an den Wein. Edel das Korn und edel die Rebe, ein Winkelchen derart eigener Herkunft, Gestaltung, Verborgenheit, mit fruchtbarstem Grund, die streichelnden Lüfte dazu, mit Menschen, die – nun, wir werden es sehen. Nicht schnell findet sich sonst derart nüchterne, selige Harmonie. Sie wußten es selbst, doch wußten einige solches auch nicht. Hatten jahrhundertelang keine anderen Felder und Dörfer gesehen, nicht auf Sand sich gerackert, am Berg und im Schnee, in der Kälte, in stockdunklen Wäldern, in Sümpfen gefront.
Niemand würde es begrüßen, wenn einer der Fische sein Element müßte verlassen, aus was für Gründen auch immer gezwungen wäre, sich an Land zu begeben. Langsam oder schnell, stürzend, abstürzend, brennend oder nicht, explodierend – schrecklicher Gedanke. Nein, es begleiten einen jeden (selbst aus Unwillen und Groll) aufrichtige Wünsche, erhoffen ihm gelungenen Urlaub und fröhliche Zeit, nach guter Reise gesegnete Rückkunft, sitzen sie alle von Zeit zu Zeit doch selber gern drin. Das Reich der fliegenden Fische ist zudem ein Paradoxum, auf den Kopf gestellt ist es: Die Tiefe stülpt sich nach oben, erreicht ihre gefährlichsten Schichten in Höhen, in sich weitenden Räumen, Gewölben, Palästen, türmenden Domen, die keiner begreift. Die kleinen Fischlein hingegen dürfen die untersten Schichten durchziehen, nahezu ohne Gefahr tun sie das auch: Hering und Heilbutt, doppelflossiger Ichthyos (aus mindestens dem Tertiär), lanzettförmiger Segler, die winzige Krabbe, Seepferdchen und: der Igel, stachelfrei, die schwebende Qualle, der Kugel-, Lampionfisch, ein bunter und praller Ballon. Sie schenken einander eine Fahrt mit dem langsam gleitenden Ding, dem erstaunlichen Riesen, dem verblüffenden Fremdling, der ganz niedrig über die Hügel schwimmt, niemals hineinpaßt in die vertraute, sichere Welt der Fußgänger und Autos, der Radler und Reiter und doch so wunderbar Auskunft gibt über deren Tun oder Nichtstun, über Felder und Wiesen und Büschchen, die Größe des Ackers erkennen läßt, den Bachlauf beschreibt und den Spaziergang der Weglein freundlich erklärt. Dort sitzt der Jäger auf seiner Kanzel, sie sprechen ihn an von oben aus ihrem Korb, die lärmende Flamme erschreckt ihn mehr noch, als die Stimme vom Himmel es vorher getan, auch ihm verdreht sich jetzt seine und gründlich auch ihre Welt ...
Angefeindet werden die fliegenden Fische zumalen, so wie jedes Leben zumalen sich von Feinden umringt sieht. Dann nämlich, wenn sich die Bereitschaft nicht zeigt, ihm, Leben, Referenz zu erweisen, da es sich aufschwingt zur ganz großen Tat. Zu Donner und Doria, zu Gloria mit Pauken, Trompeten und üppiger Schau. Wenn der Lärm belästigt, zur Last wird, die den Alltag verrät. Nicht anders geht es den fliegenden Fischen – so schnell kann es gehen! – als den Fröschen im Sumpf: Kleine Teiche schuf man für sie, Wasserweltchen mit den fast vergessen geglaubten Mücken und Fliegen, mit Kerfen, Libellen und Schilf, damit sie sich und einander wohl fühlen in der grünglatten Haut. Doch beginnen sie im Mai, im Juni ihr enormes Konzert, ihr lautstarkes Lebensgeschrei, das den Männern und Weibern der Sippe ein Lob ihrer mächtigen Liebe, noch mehr dem jetzt schlüpfenden Laich, vor allem jedoch der lind ruhenden Flut, der samtenen Nacht und der ganzen herrlichen Welt, schließt jeder die Fenster, schlüpft unter Decken und Kissen und stopft die Ohren sich zu.
II
Das Leben des mißlungenen Pünktchens Marcel. Für die oben erwähnte Gruppe kam er von vornherein nicht in Frage, denn er wurde behindert geboren. Seine Eltern merkten es erst nach einigen Jahren, gingen bekümmert von Arzt zu Arzt, keiner vermochte zu helfen. Einigermaßen brachten sie heraus, was überhaupt der kleine Sohn hatte, hörten schließlich ein langes lateinisches Wort und daß er so sein Leben lang bliebe. So wuchs er eben derart anders als üblich heran. Hübsch war sein Haupt, die Gesichtszüge von nahezu klassischer Schönheit, doch immer ein Staunen darauf, in den übergroß weit und erschrocken geöffneten Augen eine Frage, an die Welt, ihre Menschen, und was sie denn eigentlich seien und er für sie. Nichts konnte sich ihm da klären, er vermochte nicht, sich zu artikulieren, und das Gehör funktionierte anscheinend ebenfalls nicht. Doch Eltern kommunizieren mit ihren Kindern auf vielerlei Art, so wurde der Junge durchaus manierlich, kam klar mit den Anforderungen der Stunden, und erwies es sich als unmöglich, ihn jemals einer Schulklasse einzufügen, so nahmen sie ihn doch mit zu allen großen und kleinen Geschäften des Alltags, zu den Leuten, Verwandten und Freunden, auch in die Kirche. Er war immer am Hampeln, an den mageren Beinen saßen die Füße gänzlich verdreht, als hätte sie einer verkehrt angebracht. Die Arme korrigierten den jederzeit unsicheren Kurs, fuchtelten seitwärts, wie ein flatterndes Junghuhn, das weder seinen Ständern noch den unfertigen Flügeln vertraut, kam er den Gehsteig entlang. Fiel oft, hatte Knie und Ellbogen immerzu dick bandagiert, doch solches, das Stolpern, den Sturz nahm er selber kaum wahr. Eigentlich interessierte ihn nichts oder doch wieder alles, das war nicht zu erkennen, wie indessen und warum, bekam keiner heraus: Das fremde Geschöpf kreiste überwiegend um seinen eigenen verschlossenen Kern.
Die Kirche. Seltsam, dorthin ging Marcel sehr gern. Schon als Kleiner begehrte er Anschluß, drängte sich zwischen die anderen Kinder, die mochten ihn leiden. Aufmerksam folgte er der heiligen Handlung, schrie lauter und schneller als jedes und vollkommen unverständlich die Responsorien, das Alleluja, das Amen, den Dank. Verstand er doch etwas, und auf welche Weise kam es ihm zu? Man ließ Marcel zum heiligen Mahl gehen, auch später empfing er fast täglich – denn so oft sah man ihn dort – das eucharistische Brot. Bestand gar darauf und mit heiseren Rufen, mit Gefuchtel und Forderung auf dem starren Gesicht, wenn man ihn vergaß auf seinem Platz, denn nach vorn kommen konnte er nicht, kein Priester wollte sein Fallen riskieren. Randalierten wochentags Jugendliche draußen vor der Kirche – ein Treff lag direkt daneben –, stellten die ihre Verstärker, ihre Motorräder auf Brüll, ihr betrunkenes Lallen, so war es schon bewegend, zu sehen, wie Marcel – schöner und feiner, doch schlechter gelungen als jeder von ihnen – auf seinem Eckplätzchen saß. Nichts von dort ihn vertrieb, lockte, einzig die erhabene Handlung, die Lieder, die Lesungen, das Gebet ihn zu bannen verstanden. Ruhig saß er nie, nestelte ohne Unterlaß an seiner Kleidung, war er als erster zur Stelle, begrüßte er mit nach hinten gewandtem Haupt wohlwollend und krächzend jeden anderen Kirchgänger sonst. Sie mochten ihn alle, grüßten lächelnd, ja, sich geehrt fühlend, zurück. War die Messe vorüber, versäumte er nie, mit seinem seltsamen Gang nach vorne zu schaukeln. Ein Ballettänzer auf Spitzen, glich er einem unsicher sich drehenden, sich windenden Kreisel, geradeaus zu gehen vermochte er nicht, doch kam er an. Ging nieder an den Stufen des Altars auf seine spitzigen Knie, auf seine Ellbogen, sogar sein Gesicht, kroch dort derart ein wenig herum, korrigierte den Standort einer Schelle, glättete eine Falte im Teppich, klaubte ein Blütenblatt, ein Stäubchen aus dem samtenen Flor. Bei Prozessionen fuhren ihn seine Leute im Rollstuhl, er war immer dabei.
Lange behielt ihn seine Familie, sein Dorf, ohne weiter zu fragen, ob es nicht auch für ihn eine Möglichkeit gäbe, etwas zu lernen, unter seinesgleichen und betreut aus seinem Leben etwas zu machen. Dann entstand im Nachbardorf eine Werkstatt für behinderte junge Erwachsene – Marcel war bereits zwanzig –, so holte ihn täglich ein Bus, in allen möglichen einfachsten Disziplinen versuchte man es mit ihm. Doch ging dies geradezu phantastisch daneben, er begriff nichts, war zu keinerlei Zusammenspiel jemals bereit. Dazu schien er nicht glücklich und schwer aus seiner schönen Ruhe gebracht, so ließ man das wieder. Dann starb seine Mutter – Geschwister besaß er nicht –, der Vater verzweifelte an diesem Sohn, dem verödeten Haushalt, gab den Jungen in ein Heim für Alte, Gebrechliche, Debile. Marcel stürzte – sich? – dort aus einem Fenster im zweiten Stock, brach sich dabei so ziemlich alles, was ein Körper an Knochen besitzt, auch den Schädel, war nicht mehr bei Bewußtsein. Kam in die Stadt, in die Universitätsklinik, auf Intensiv, auch innere Organe hatten Schaden erlitten.
Als sich das Unglück herumsprach, dachte wohl jeder: Ein tragisches Ende, doch vielleicht findet er so seinen Frieden. Sie vergaßen ihn fast, niemand wußte so recht, wie es um ihn stand, nach einem halben Jahr hingegen war er noch immer am Leben. Man hörte, es ginge ihm besser, sogar, er sei in einer Rehabilitations-Klinik. In der Tat: Nach weiteren Monaten saß er auf seinem Platz in der Kirche wie eh und je. Blasser geworden, auch um ein weiteres dünner, unter dem geschorenen Haar quer über den Kopf eindrucksvoll eine riesige Narbe. Später sagten die Ärzte: Ein gänzlich entspannter Patient, der – wieder bei Bewußtsein – nicht fragt nach Wieso und Warum, wo bin ich, was ist mir passiert, der geschehen läßt, was ringsum und mit ihm geschieht. Im Laufe der folgenden Zeit war Marcel wie vor seinem Unfall, eher auf erstaunliche Weise gebessert, konnte normal essen, nahm wieder zu. Eine alleinstehende Tante gab ihm Asyl, versorgt ihn seitdem, läßt ihm seine Freiheit, seine Zeit. Er tanzt durch das Dorf, alle Wege bergauf und bergab, gelegentlich fallend wie früher, er kennt viele Leute, spricht sie an mit seinen seltsamen Lauten, seinen überweit offenen Augen, einem Lächeln, das er seinem verzerrten Gelächter nur mühsam entreißt.
*
Wie die Dörfer gleich Krusten auf ihrem Land sitzen. Im Hügeligen oder Flachen, im Tal und am Berg, am Steilhang, am Bach. Alt ist das Land, doch wo auf Erden ist es das nicht. Einmal hat es ein Meer auf sich getragen, genau hier, wo der Spargel jetzt wächst, das Feldgemüs und der köstliche Wein, eine Flut hat es geduldet, über die der Wind ging und das Brausen des Sturms, tosende Wellen sich in hochragende Ufer fraßen. Tropische Wärme die Brut jeder Art von Viehzeug beschwor, Krokodile und Echsen, Haie, Schildkröten, deren Zähne und Panzer und Schuppen in Sand- und Kiesgruben sich finden, wenn der Bagger tief gräbt. Die versteinerten Gehäuse von Muscheln liegen auf jedem Acker herum, unsere fliegenden Fische von heute könnten in den Wassern von gestern ihr lebendiges Spiegelbild sehen ...
Ringen die Dörfer ihre Hände, ihre Kirch- und Fernsehtürme zu den Himmeln empor, zu den Sternen, den Wolken, dem riesigen Blau, flehen sie um Stille, um Regen, um Sonne, um ein gutes Programm, so haben sie doch durch die Jahrhunderte mit ebendiesen Händen, mit der Kraft von Ochsen und Pferden, schließlich Traktoren ihren Meeresgrund wunderbar sicher bestellt. Im Regen wird dieser Grund allen Füßen und Rädern, allen Hufen und Klauen ein schwerstes Gewicht, das alles, ja, mehr noch umschließt, was ein Samenkorn für bestes Gedeihen braucht. Der Sommer hingegen mit einer Hitze, die eigentlich weitaus südlicher gelegenen Breiten gemäß, ihn zu unnachgiebiger Härte zu brennen versteht. Zu Backstein, in dessen heimlichen Kammern doch die Feuchte verweilt, gefangen ist, kräftig in Haft, damit den Würzelchen, den Hälmchen und Halmen, der Frucht und dem Korn nur ja nichts geschieht, hingegen die Reife zu Übermaß und vollkommenem Wohlgeschmack gelingt. Was gibt es für Ernten in diesem sonnengebadeten Land! In diesem Landstrich, von dem auch der Winter genau weiß, daß er dort nichts zu suchen hat. Dem das Frühjahr schon im Januar gelingt, es bereits dann mit blühenden Schneeglöckchen, knospenden Pfingstrosen, Amselgesang und dem Balzruf der Eulen verblüfft. Dem der Herbst keine Jahreszeit, doch ein Synonym für die Weinernte ist, höchstens – November, Dezember – ein etwas länger sich dehnender, erwünschter, zum Pausieren gerade geeigneter Regentag.
Franz-Hartwig war Winzer durch und durch, mit Leib und Seele, von früh und bis spät in die Nacht. In seinem mageren, zu jeder Jahreszeit braungebrannten Gesicht, in dem das Alter schon jetzt – er war noch keine dreißig – sich abzeichnete, trug er freundliche Augen und pfiffigen Witz, ein fleißiges Mundwerk mit sicherer Zunge, einem Gaumen, der jedes seiner und anderer Weinbauern Tröpfchen nach Herkunft, Lage, Jahrgang, Säure und Öchslegraden sicher zu testen verstand. Jedes Jahr fuhr er ins Ausland, in die Champagne, in die Provence und die schöne Toskana, hatte den weiten Flug nach Kalifornien geschafft, plante Argentinien und die Südafrikanische Republik, überall zog es ihn hin, wo die Traube wächst und seinesgleichen mit herrlichen Weinen beschenkt. Fremde Sprachen, Bräuche und Sitten bremsten ihn nicht, er kam immer zurecht, fand raschen Kontakt. Er lernte, er beobachtete, er prüfte die Böden, Klima und Sonneneinstrahlung, nippte und trank, schmeckte und genoß, lobte, verwarf. Kam er zurück, hatte er reiche Erfahrung gesammelt, dazu Freude und Spaß, setzte um, was von all dem in seinen eigenen Kram paßte.
Wenn Rachel durch die dichtgedrängten Reihen der wie Heringe in den Saal gepreßten, an schmalen Tischen, auf noch schmaleren Bänken hockenden Dorfbewohner ging, Getränke – Bier, Limo, Cola, Wein und Gespritzten – notierend, servierend, kassierend, verlor sie trotz der Enge und dem ständigen Sichwinden- und Ausweichenmüssen nichts von ihrer reizenden stolzen und aufrechten Haltung, nichts von ihrer Anziehungskraft, nichts von ihrer unerhörten Wirkung. Im Gegenteil, so ragte sie heraus, schwebte über der Masse der Gesichter, der starken, runden, mageren oder eckigen Schultern. Sie konnte von oben sanft und rätselhaft lächeln, sich über lockige, glatte, junge oder alte Schädel beugen, ihr langes, nachtschwarzes Haar wie einen Vorhang über Geflüster und Geheimnisse fallen lassen, mit ihren kleinen, zärtlichen Brüsten wie zufällig Männermuskeln berühren und dabei doch zugreifenden Armen, tätschelnden Händen immer aufs neue entgleiten. Rachel war nicht älter als zwölf! Es konnte nicht gut gehen.
Gut gegangen indes war der tollkühne Griff nach den Sternen der Regenbogenpresse, den ihre Mutter tat, als sie ihr, dem Kind aus einfacher Arbeiter-, höchstens kleinster Winzerfamilie, diesen phantastischen Namen gab – Rachel. Das hätte in dem kleinen Dorf im Herzen des Weinlands durchaus stupsnasig, flach-, trüb- und mondgesichtig ausgehen können, dazu kurz, krummbeinig – so war die Sippschaft überwiegend beschaffen. Doch die Mutter selbst war gut gebaut, schlank und dunkel, wenn auch von kaum bemerkbarem Reiz und rasch verblüht, wie auch der Vater, der, schmal, fast dürr, nur geringes Gelock und sparsame Lachfältchen am kantigen Schädel, im früh verrosteten Bubengesicht trug.
Rachel war eine Wucht. Sie war so süß und sexy, daß man sie schon als Kind, als Neun- oder Zehnjährige anstarren mußte: das herrliche Haar, das verschleierte Lächeln, die Art, wie sie sich bewegte – Ei, gugg doch emol, was e foi, foi Mädsche! Im übrigen war ihr Vater Mitglied in dem kleinen dörflichen Reiterverein, und sie selbst ritt gelegentlich auf einem dicken, lohfarbenen Welsh-Cob durch die Weinberge.
Mit dreizehn wurde es kritisch, und eines Tages – sie half nach wie vor im Boothämel-Hannes, dessen Wirt ein Onkel von ihr war, bei Vereinsfesten, Dia-Vorträgen und Fasnachtssitzungen – hatte jedermann Gelegenheit, betrübt festzustellen, daß sich etwas an, in ihr verändert hatte. Da war ein zu früher Zug von Wissen in ihrem Gesicht, ein Schmelz vergangen, eine Süße verloren. Ihre Augen blickten dunkel und unergründlich, so als wollten sie Ballast abwerfen, zurückgeben, Gesehenes, Geschehenes vergessen. Sie wich Männerblicken aus, sie sah nicht mehr gelassen aus sich heraus, vielmehr verhalten, fast könnte man sagen: verloren, ja, voller Trauer in sich hinein. Bald wußten es alle – sie war schwanger. Doch keine der Frauen im Dorf zerriß sich deshalb besonders das Maul, die Männer lächelten wohl ein wenig, schweigsam und hinterfotzig, zuckten die Schultern – war der Wein reif, so war er zu trinken, sie hatten es alle nie anders gehalten. Rachel, auch wenn sie hübscher, süßer und heißer war als seit Generationen viele der Mädchen, die geboren wurden, heranwuchsen und aufblühten wie die Blumen draußen im Feld, war keineswegs die erste, die ihre jüngsten Mädchenjahre zu derart rascher Weitergabe des Lebens nutzte.
Das Kind wurde freundlich erwartet, von ihr selbst erstaunt, ohne Mühe getragen, und als die Geburt rasch und glücklich verlaufen, setzten ihre Eltern eine freche und fröhliche Anzeige ins Ortsblättchen – Mer freue uns überglücklich am Enkelsche. Wer eigentlich der Vater des wohlgelungenen Säuglings war, wußte keiner so recht. Rachel hatte es nur ihrer Mutter anvertraut, doch beide Frauen wünschten ihn von ganzem Herzen zum Teufel, wohin er anscheinend auch verschwand, denn sie hörten oder sahen nichts mehr von ihm. Das Baby gedieh, und Rachel – vierzehn-, fünfzehn-, sechzehnjährig – nahm es mit, wo immer sie ging, es hing an ihr wie die Traube am Weinstock, sie waren eins wie Pflanze und Frucht.
In jenem kleinen Dorf wurde in dieser Zeit beschlossen, nach langem Gerangel mit Parteien, Ämtern und Einwohnern, eine längst fällige Kanalisation zu legen, auch die Hauptstraße zu befestigen, der Beschluß verwirklicht. Eine auswärtige Kolonne erschien mit schwerem Gerät, mit Kränen, Walzen und Preßluftbohrern, Betonrohre stapelten sich, Wohn- und Bauwagen standen am Ortseingang, und ein Dutzend fremder Männer bereicherte das dörfliche Leben für einige Monate. Sie waren nicht aus der Gegend, sondern angeworben im äußersten Norden Deutschlands, blond, zurückhaltend, langsam im Wort, mit einem Humor so trocken wie Wein aus ungünstigsten Lagen. Die Mädchen, kamen sie mit dem Bus aus den Schulen der Stadt, sahen, von der Haltestelle über Hügel von Sand, Kies und Werkzeuge steigend und bevor sie sich in ihre Gassen verliefen, den Fremden kichernd eine Weile bei der Arbeit zu, von den mittelalten und älteren Frauen wurden die Ostfriesen ausgeprochen gern mit Kaffee, sogar dem einen oder anderen Stück Kuchen versorgt. Die Friesen hießen Jan, Peter, Dirk, Wolle und Klaus und wirkten – dickbäuchig, breit und schwerfällig, wie sie waren – gutmütig, doch sonst nicht besonders reizvoll. Bis auf Thomas. Er war ein ausgesprochen hübscher Bursch, mit seinen knapp zwanzig Jahren fast noch ein Bürschlein und der Jüngste unter ihnen. Gut gewachsen, nicht zu groß, dazu braungebrannt und vergnügt, trug er keck schöne Locken, stets hing ihm eine Zigarette im Mundwinkel. Trotz seiner Jugend rauchte er stark, war still und schweigsam, sicherlich mehr als einsam, so fern der Heimat und mit nur den Kameraden im Wohnwagen als Umgang.
Eines Tages wurde er vor Rachels Elternhaus am äußersten Ende des Dorfes eingesetzt und war eben dabei, das Pflaster des Bürgersteigs auszuheben, als sie, ihr kleines Töchterchen auf dem Arm, eine volle Einkaufstasche untergehakt und das nachtschwarze Haar lang über den Rücken fallend, vorsichtig an ihm vorbeibalancierte. Er blickte hoch, der Blick blieb ihm haften, er starrte sie an, als sähe er zum erstenmal im Leben eine Frau. Ihr Gesicht, beladen und ernst wie der Schatten im Inneren des Weinstocks, berührte ihn gleich einem Schlag. Sie war in dem Haus, vor dem er arbeitete, verschwunden, bevor er den Mund zu bekam. Das war kein Mädchen, keine Frau, beides eher zusammen, eine kleine Mutter anscheinend auch schon. Sie hatte ihn kurz angesehen oder überhaupt nicht gesehen, ‘S geht schon!, gemurmelt, als er ein paar der Pflastersteine auf die Seite schob, damit sie es nicht allzu unsicher hatte, und nur die Andeutung eines stillen, in sich gekehrten Lächelns war über ihr feines Gesicht gegangen.
Rachel hatte Tom sehr wohl gesehen und etwas an seiner Frische, seiner Jugend, seiner braungebrannten Blondheit hatte sie ebenso berührt wie ihre Dunkelheit ihn. Da er weiter dort arbeitete, dauerte es nicht lange und ihrer beider Augen, sie selbst kamen über den Gartenzaun hinweg in das eine oder andere sparsame Gespräch. Schließlich brachte Rachel ihm und seinen Kollegen hin und wieder eine Kanne Tee, und er sah zu, daß zwischen den Auswurfhügeln in der für den Durchgangsverkehr gesperrten Straße immer noch ein Parkplatz für ihres Vaters Wagen blieb. Über kurz oder lang jedoch waren sie ein Paar, das heißt, zusammen mit Rachels kleiner Tochter eher ein Trio, und dies Dreigespann von Baby-, Kinder-, Jugendtum war bald auch im Ort, bei Veranstaltungen, im Gasthaus zu sehen – Tom hatte es erwischt, daß alle Fenster klirrten. Laß en nit bei disch schloofe, so lang er nit was von heirate sagt!, hatte die Mutter Rachel geraten, dann aber doch nichts gehört, als Tom nächtens in die kleine Kammer geschlüpft kam, und seine Kameraden spotteten gutmütig auf ihn ein, ob er denn ein weiterer Kindsvater werden wolle. Aber, sieh einer an, die beiden feierten Verlobung, richtig mit Anzeige, Ringen, Glückwünschen und so. Von da an nahm Rachel Tom zu den langen Abenden mit, die ihr Reiterverein im Lokal verbrachte, um sich wegen Kleinigkeiten die Köpfe heiß zu reden. Selbst noch immer zu jung, um an diesen Debatten Interesse zu haben, saßen sie zusammen, schweigend, zu viel rauchend, zu viel trinkend, mit alten, fast lasterhaften Kindergesichtern. Wie junges Obst, das, zu früh geerntet, nicht mehr die äußerste, süßeste Reife erfährt, aneinandergefädelt wie schmackhafte Backpflaumen, so hockten sie.
Rachel hatte mehr Glück als Verstand, daß sie an diesen Jungen geriet, der nicht nur verrückt nach ihr war, sondern sie wirklich zu lieben begann. Er hatte dieses sonderbare Land, das ihm erst wie der Orient selbst erschienen war, vom ersten Tag an, da er von weit her gekommen und hier eingesetzt worden war, gemocht, genau wie diese unverständlichen Menschen, die in ihren Weinbergen lachten und lebten, einander nur zu gern Schabernack – auch boshaften – antaten und Wein-, Apfel-, Erdbeerblütenfeste feierten. Alles war hier anders als zu Hause – schön so! Dabei merkte er rasch, daß die Leute keineswegs immer so fröhlich waren, wie sie oft taten. Schnell im Wort, hui, und flink damit, ja – Mann, hatte er zu Anfang die Ohren spitzen müssen, um sie überhaupt zu verstehen! Doch im Grunde ihrer Seelen so schwerblütig, wie er das von den Seinen zu Hause gewohnt war. Über Weihnachten fuhr er dort hin und eröffnete seiner lang verwitweten Mutter und zweien Schwestern, daß er vorhabe zu heiraten. Im übrigen wolle er dort unten leben bleiben; daß Rachel nicht zu verpflanzen war, wußte er bis dahin. Seine Familie fand sich damit ab – gewohnt, seit Menschengedenken der See, der Fremde so oder so die Männer, Söhne und Brüder überlassen zu müssen, war es immerhin gut, Tom lediglich in den Wellen des dortigen Hügellandes und den mäßigen Stürmen einer vielleicht ganz guten Ehe verschwinden zu sehen.
Im August wurde Hochzeit gehalten. Mer stehe Spalier, un wann es noch so haaß is, hört er, un in Wichs un schwarz Kapp! Klar, schwor der Verein, for die Rachel kann mer schon emol schwitze ... Und es wurde heiß, ein Sommer-Samstag mit 35 Grad selbst im schwärzesten Schatten und wie es nur dort zu kochen versteht. Aus hohem Korn und Gras, aus Obstgärten und Wingert stieg es in zitterndem Flirren fast greifbar empor, kroch ins Dorf, hing in den Gassen, nistete in den Winkeln der alten Höfe. Bei solchen Temperaturen Pferde auf Hochglanz zu bringen, ist schon was, Rachel! Trotz Bikini und Badehose, die allerhand Muskulöses oder Dürres, Fettes, Mageres, Braungebranntes oder Stubenbleiches zum Gelächter der anderen zum Vorschein kommen ließen. Die engen Reithosen, die heißen Stiefel, die schwarzen Jacken – es halfen nur deftigste Witze, um es ihnen allen erträglich zu machen. Aus den Gassen heraus und postiert auf dem Kirchplatz, der mit ausgehobenen Gräben und hohen Schutthaufen noch immer im Umbau steckte, boten sie indessen einen fabelhaften Anblick: Glänzende Tierleiber, Braune, Schimmel und Füchse, gestriegeltes Haar, poliertes Horn. Das knallte mit Eisen auf Pflaster, quietschte und kabbelte herum, stieg im Verlangen, laufen statt stehen zu dürfen, und wurde mit starken Schenkeln, mit festen Fäusten und lautem Zuruf zurechtgedrückt. Zuschauer sammelten sich, Autos mit Nummern aus Norddeutschland kamen vorsichtig die Hauptstraße entlang. Staub und Hitze strudelten auf, ein Köter kläffte und die Sonne biß. Das Brautpaar erschien in einer Kutsche. Der Verein konnte noch immer ohne weiteres seine zwei bis drei tadellos herausgebrachten Gespanne stellen, diesmal waren es zwei spiegelnde junge Rappstuten. Seltsam war der Kontrast der schwarzen Pferde zum jungen Glück – der Braut im ungebrochen weißen, bodenlang schleiergekrönten Kleid, dem lockenköpfigen jungen Mann im gut sitzenden Anzug, dem in Rosa gekleideten, mit einem flotten Hütchen geschmückten Kind. Dies hielt im Fäustchen einen winzigen Strauß roter Nelken, ähnlich dem großen Bukett seiner Mutter, den üppigen Gebinden an den Seiten, der Rückwand, den Rädern der Kutsche. Doch da ja auch Rachels Haar schwarz ist wie die Schweife der Stuten und lang unter dem Krönchen hervor ihr auf Rücken und Schultern fiel, sollen die Rappen bedeuten, was immer sie wollen ...
Rachels Gesicht war ernst, und sie stieg vom Wagen, als vollziehe sie ein Ritual. Sie blickte nicht hoch zu den spalierbildenden, stolzen und mächtigen Häuptern der Pferde, die nur um ihretwillen hier aufmarschiert waren, und keiner der Reiter bekam etwa als Dank für die Sauna, die er ihr zuliebe erduldete, ein freundliches Lächeln. Die nahmen das keineswegs übel und blickten ebenso still auf sie hinab – Ach, Mädje, leicht hast es trotz allem nit gehabt, und so könnt mer saache, ‘s iss grad noch emol gut gegange! Der kleine Zug der geladenen Gäste mit Frauen in kühnen Schleiergewändern, Männern im Zwang weißer Hemden und schwarzer Jacketts, mit einer städtischen Tante, wie aus dem Modekatalog entnommen, der besonders verlegen über Steinhaufen stolpernden friesischen Verwandtschaft, betrat in feierlichem Schweigen die Kirche. Lediglich die Zuschauer draußen, die dicken dörflichen Frauen, die neugierigen Mädchen, die alten Männer in ihren verschlissenen Hemden und Haaren lachten und scherzten und riefen der Braut und einander Aufmunterndes zu. Der nacktbäuchige Hund von vorhin wälzte sich vor den Hufen der Pferde wieder und wieder im Staub.
Es geschah weiter nichts von Bedeutung. Rachel stand, das Kind auf dem Arm, in der alten, nach der Hitze draußen angenehm kühl erscheinenden Kirche, vor dem Altar wie eine kleine mißglückte Madonna, und die Trauung, vom Pastor in Talar und Bäffchen vollzogen, brachte kein bräutliches Schimmern in ihr Gesicht. Als sie die Ringe tauschten, sah sie Tom jedoch an, daß ihm erneut eine Glut wie die draußen über den Rücken lief, und er erwiderte den Blick mit seinen schweigsamen Augen, als sei er ihr jetzt erst zum Manne geworden. Ho, Rachel würde die Pille begehren, solange sie lebte, nur um ja nie wieder schwanger zu werden! Doch eines Tages wollte er so stark sein für sie, daß sie endlich vergessen konnte und er den Sohn fordern und verwirklichen, den er sich von ihr erträumte – so sah es im Inneren dieses Knabenmannes aus.
Die Ehe hielt nicht. Nach zwei Jahren bekam Tom Heimweh, nach dem Norden, der Mutter, den schweigsamen Schwestern, nach Kühle und türmenden Wolken, dem Meer. Auch wollte sich Rachel nicht zu einem weiteren Kinde bequemen, noch immer keine zwanzig, fand sie das Leben zu schade dafür – so drückte sie sich aus –, die Scheidung wurde vollzogen. Franz-Hartwig, zwei Dörfer weiter, mit Rachel, die er noch nie gesehen, um einige Ecken verwandt, traf sie bei einer Hochzeit eines ihnen beiden nahestehenden Cousins – die Knie wurden ihm weich. Er vergaß seine Reisen, die bis dahin so verlockende Welt, eine dunkelhäutige Schöne in Brasilien und eine blonde in den Staaten, heiratete Rachel, bevor zweimal der Vollmond über seine Reben gerollt. Rachel war zufrieden, ihm eine sehr gute Frau, ebensolche Mutter, schenkte ihrer Tochter zwei Halbbrüder, Franz-Hartwig somit Söhne und Erben für den Betrieb. Sie wurde und blieb eine erneuert gelungene Kraft, eine tüchtige Wirtin des Ausschanks, der Straußwirtschaft, schließlich des erstaunlich feinen Lokals, das sie und ihr Mann einiges später zu führen begannen.
*
Die Stadt, über der die fliegenden Fische ihrer Landung entgegenziehen, ist nicht nur von oben so bunt, sauber geschachtelt, begehrenswert, freundlich und locker zu sehen, ihr kleines Gewimmel erfreut jeden streifenden Fuß. Man müßte ihr Rund um ein Zehnfaches mehren, erstrebte einer die Großstadt, selbst dann gelänge das nicht. Handlich ist sie, hübsch, an jeder Ecke unauffällig ein Parkhaus, Läden ohne schreiende Eleganz, gut also zum Einkauf, zum Bummel, zum Knabbern. Keiner sieht sich genötigt, in die neueste Mode zu fahren, Mensch kann er bleiben, Bewohner genau dieses Orts oder woher immer er kommt. Ein Fremder ist allzeit erwünscht, selbstverständlich, man nimmt ihn so wenig wahr wie die Luft, die man atmet, sei sie frisch oder staubig oder heiß oder kalt. Ein Türke, ein Schwarzer, der Mann aus den Staaten, die russisch Provinzler, Chineser, Chilener, nichts ist zu fremd, zu weit und zu nah, um den Alltag ins Schaukeln zu bringen – ein Exot ist alleine der Mann dieser Stadt.