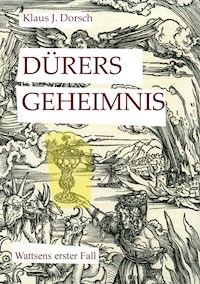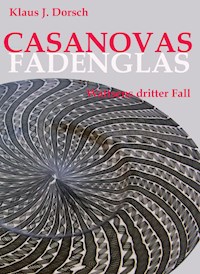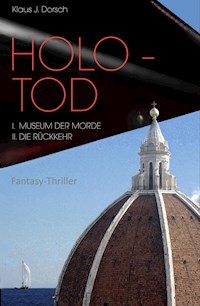2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wattsens Fälle
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet auf dem Christkindlesmarkt von Nürnberg verbreitet ein offensichtlich Geistesgestörter als Struwwelpeter verkleidet die Botschaft, zwei Menschen getötet zu haben. John G. Wattsen, der Leiter des Spielzeugmuseums, der von der Polizei als externer Berater hinzugezogen wird, hält das Ganze zunächst für einen üblen Streich. Doch es geschehen weitere Morde nach Vorbildern des alten Kinderbuches. Dahinter steckt eines der genialsten Verbrechen der Kriminalgeschichte – die Struwwelpeter-Morde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Klaus J. Dorsch
Die Struwwelpeter-Morde
Wattsens zweiter Fall
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Impressum neobooks
Kapitel 1
Klaus J. Dorsch
Die Struwwelpeter-Morde
23. Dezember, 22 Uhr
Die Löcher in den zerbrochenen Fensterscheiben starrten sie an wie hundert schwarze Augen und die Frau umklammerte den Elektroschocker in ihrer Manteltasche fester. Ihre Hände waren klamm, denn der Tag vor Weihnachten hatte eisige Kälte gebracht. Sie erschrak vor dem Flattern einer Krähe, die sich auf der Suche nach Futter in dieser Winternacht in den riesigen Raum verirrt hatte.
Die Frau brauchte einige Zeit, bis sich ihre Augen an das Halbdunkel der Halle gewöhnt hatten. Offenbar eines der leerstehenden Fabrikgebäude, wie man sie im Nürnberger Industriegebiet Nordost häufig fand. In den Ecken lag Schnee, der durch das marode Dach hereingeweht war. In der Mitte des Raumes brannte einsam und verloren eine nackte Glühbirne und verbreitete funzeliges Licht, das kaum bis zu den Wänden reichte und nur spärlich einen schmutzigen Tisch und zwei alte Holzstühle erhellte. Die karge Beleuchtung machte sie noch misstrauischer, dann es erschien ihr unwahrscheinlich, dass es hier überhaupt noch Strom gab.
Ein bärtiger Mann sprang von einem der Stühle auf. Wieder erschrak sie heftig, denn sie hatte seine dunkle, reglose Gestalt nicht gleich bemerkt.
„Was soll das?“ rief er ungehalten, „Haben Sie mich zu dieser
nachtschlafenden Zeit hierher bestellt?“
Aufgescheucht vom Lärm flog die Krähe auf und ihr schwarzer Schatten huschte wie ein gigantischer Raubvogel über die kahle Wand.
„Nein!“ antwortete sie ihm misstrauisch, „Sie mich etwa?“
„Bitte nehmen Sie Platz“, schnarrte eine laute, unangenehm verzerrte Stimme aus einem alten Lautsprecher, „Ihre Anwesenheit hier wird für Sie beide von großem Vorteil sein.“
Sie gehorchten zögerlich und sahen sich dabei verwundert um, als könnten sie den Sprecher irgendwo in der Dunkelheit ausmachen. Es war bitter kalt und ein ungewöhnlich scharfer Nordwind pfiff durch die scharfkantigen Löcher der vor Schmutz blinden Fensterscheiben, von denen einige aussahen, als hätte man hier Schießübungen veranstaltet.
Beide trugen dicke Mäntel und Handschuhe, der Mann hatte seine Fellmütze tief ins Gesicht gezogen. Mit der starken, schwarzen Hornbrille und dem dichten, ungepflegten Bart ähnelte er einer übel gelaunten Eule.
Er zuckte zusammen, als plötzlich aus dem Dunkel eine skurrile Gestalt auftauchte. Ein junger Mann offensichtlich, der einen orangeroten Kittel mit weißem Kragen und schwarzem Gürtel, dazu ein rotes Halstuch sowie grüne Strumpfhosen und schwarze Schuhe trug. Die Fingernägel an beiden Händen waren überlang und krallenartig gekrümmt. Das Auffälligste aber waren die langen, strubbeligen, blonden Haare, die wirr nach allen Seiten abstanden und den Kopf kugelig umgaben. Das schmale Gesicht weiß geschminkt, die Augen schwarz umrandet und der Mund blutrot, was ihm ein fast feminines Aussehen verlieh.
Sowohl der Mann wie auch die Frau sahen die pittoreske Gestalt mit einer Mischung aus Erschrecken und Neugier an. Vielleicht wäre man unter anderen Umständen durchaus belustigt gewesen, im Ambiente der kahlen, kalten Halle jedoch hatte der unerwartete Auftritt etwas zutiefst Bedrohliches.
„Was soll das für ein Affenzirkus sein?“ blaffte der Mann wütend, „Wer sind Sie? Was sollen wir eigentlich hier?“
Die Frau fühlte sich an eine Märchenfigur erinnert, die sie in ihrer Kindheit irgendwo mal gesehen hatte. Wahrscheinlich in einem Bilderbuch. Sie wusste aber nicht genau wo. Der Bärtige hingegen erinnerte sich gut: Struwwelpeter! Der Verrückte vor ihnen hatte sich als eine Figur aus einem alten Kinderbuch verkleidet. Was der ganze Blödsinn sollte, war aber auch für ihn völlig unklar. Zwar befand man sich bereits in der Faschingszeit, aber das Wochenende vor dem Faschingsdienstag, das in Franken oft den einzigen Höhepunkt des mitunter relativ kargen närrischen Treibens darstellte, lag noch einige Wochen entfernt, momentan bevölkerten noch Nikoläuse und Sternsinger den Markt.
Die Hand des Mannes griff nervös in die Tasche seines Mantels. Womöglich wollte er sein Handy zücken und die Polizei rufen oder hatte gar in Anbetracht der obskuren nächtlichen Einladung eine Waffe bei sich.
„Bleiben Sie ruhig, meine Herrschaften - bitte.“
Der Struwwelpeter sprach mit einer gekünstelten, hohen Stimme, die sehr unangenehm klang. Wie schepperndes Blech. Oder trockene Kreide, die auf einer Schultafel quietschte.
„Ich möchte Ihnen ein ungewöhnliches Angebot unterbreiten, das für Sie beide von einigem Interesse sein dürfte.“
Mit einer Verbeugung, die mehr der grotesken Verrenkung eines mittelalterlichen Mauriskatänzers ähnelte, legte er einen roten und einen grünen Briefumschlag auf den Tisch. Der Mann, der erneut aufgesprungen war, setzte sich nur widerwillig und sah die Frau an, die seinen Blick kurz mit einem leichten Achselzucken erwiderte, das Ratlosigkeit, aber ebenso Angst ausdrückte. Auch sie konnte sich offensichtlich keinen Reim auf diese seltsame Situation machen.
„Bitte schön!“ rief der Struwwelpeter mit der übertriebenen Gestik eines Zirkusclowns, der die große Attraktion ankündigt und schob gleichzeitig der Frau das eine, dem Mann das andere Kuvert zu.
Beide zögerten zunächst, öffneten dann aber fast synchron die Umschläge, entfalteten jeweils ein Blatt Papier und lasen. Es war ihnen anzusehen, dass sie sich beide unwohl fühlten und diese Farce möglichst schnell beenden wollten.
„Das ist ja absolut verrückt!“ rief der Mann plötzlich; das Blut schoss ihm ins Gesicht und seine Stimme überschlug sich fast zu einem diskanten Kieksen, „das ist … ungeheuerlich! Wie können Sie annehmen, dass ich … auf gar keinen Fall!“
Die Frau hatte den Brief nun ebenfalls zuende gelesen, ließ ihn sinken und starrte bleich und ungläubig vor sich hin, bevor sie flüsterte: „Das ist Wahnsinn! Das funktioniert nicht. Keinesfalls! Was glauben Sie denn von mir? Unter gar keinen Umständen! Sie sind ja komplett übergeschnappt!“
Der Mann und die Frau sahen einander an und waren erstaunt über die ähnliche Reaktion des anderen, obwohl sie begriffen, dass die Briefe wegen ihres höchst persönlichen Inhalts sehr unterschiedlich sein mussten.
Als sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Maskierten richteten, war sein Platz leer. Der unheimliche Struwwelpeter war so plötzlich verschwunden, wie er erschienen war.
Beide saßen sich eine ewig erscheinende Weile stumm gegenüber und starrten sich misstrauisch an. Keiner dachte mehr an die Kälte, die Nacht oder den Wind. Über ihren Köpfen zog die Krähe unter dem löchrigen Dach der Halle ihre Kreise, als ob sie ein herannahendes Unheil verkünden wollte.
Keiner dachte jedoch daran, aufzustehen und zu gehen. Keiner wagte etwas zu sagen.
Der Bärtige taxierte die Frau genauer. Sie war auf gewisse Weise nicht unattraktiv, wenngleich nicht im eigentlichen Sinne hübsch, auch nicht mehr jung, aber - das war ihm an ihren Bewegungen aufgefallen, als sie die Halle betreten hatte - offenbar von athletischem Körperbau. Wahrscheinlich hatte sie in ihrem Leben viel Sport getrieben. Sollte die Idee vielleicht doch ...
Der Mann zog ein Feuerzeug heraus und verbrannte beide Briefe, ohne die Frau nach ihrem Einverständnis zu fragen. Sie ließ es teilnahmslos geschehen. Dann hob er fragend die Augenbrauen. Wieder folgte ein langes, unschlüssiges Zögern, und die Frau schlug beide Hände vors Gesicht. Weinte sie? Als sie die Hände wieder sinken ließ, lächelte sie unsicher und verkrampft. Dann nickte sie fast unmerklich mit dem Kopf.
Der Mann gab ein grunzendes Geräusch von sich, das wohl seine Zustimmung signalisieren sollte und erhob sich.
Beide gingen durch eine rostige Eisentür in einen angrenzenden Raum und schlossen sich ein.
Kapitel 2
17 Tage vorher (6. Dezember, Nikolaustag)
„Allmecht! Des is ja der Ludwich! In der Dindn dersoffen! Ja wu gibsn sowos?“
Die raue Stimme von Hausmeister Lederer hallte durch den riesigen Raum und er starrte ein paar Sekunden lang fassungslos auf die Leiche des Ingenieurs. Der Körper schwamm in einem kaum drei Meter durchmessenden, zylindrischen Bottich, der 10.000 Liter schwarze Tinte enthielt. Die verbliebene Luft unter dem imprägnierten Laborkittel blähte die Gestalt auf und gab ihm das groteske Aussehen eines schwarz-weißen Heißluftballons. Der Bart hatte sich tiefschwarz verfärbt, sein Mund stand offen und war mit Tinte vollgelaufen und auch seine Augenhöhlen füllte die spiegelnde Flüssigkeit, als ob er eine Blindenbrille trüge.
„Helft mer doch!“ brüllte Lederer erneut und rannte zur Tür der Fabrikhalle, in der die nahe Nürnberg gelegene Firma die von ihr hergestellte Tinte bis zur Abfüllung in Patronen oder Glasfässchen lagerte: Zwei silberne, blankpolierte Metalltanks mit Schwarz, vier mit dem am häufigsten verkauften Königsblau, ein Bottich Grün und einer mit Rot - letztere hauptsächlich für den Lehrerbedarf.
„Kreizbirnbaamhollerstaudn! Gehts, helft mer! Der Ludwich licht im Dindnfass! Etzert kummt doch amol aaner her! Dersoffen is er, der Ludwich!“
Der Kriminalhauptkommissar, der wenig später mit den Fachleuten der Spurensicherung die Lobby der Firma mit dem Doppelnamen betrat, welche vor allem für ihre Bleistifte und Buntstifte weltweit bekannt war, warf einen geringschätzigen Blick auf die übertriebene Weihnachtsdekoration. Mindestens zehn überlebensgroße Weihnachtsmänner mit weißen Wattebärten und roten Mäntel schleppten große Jute-Säcke voll mit hübschen Geschenkkartons in den Firmenfarben, die so geschickt verpackt waren, dass man bei allen die enthaltenen Füller und Stifte-Sets mit dem Firmenlogo erkennen konnte. An den Wänden waren Ruten mit bunten Bändern aufgehängt, umgeben von duftendem Tannengrün, roten, glänzenden Glaskugeln und kleinen Nikolausfiguren – es war der 6. Dezember, erinnerte sich der Kommissar. Nikolaustag. Ein Tag, der in Franken weitaus höher geschätzt wurde als in nördlicheren Gegenden Deutschlands, vor allem bei den Kindern und natürlich bei Industrie und Handel, die darin eine Art „Vorweihnachten“ sahen und zu kleinen und großen Geschenken animierten.
Er hatte keine Kinder, was ihm in diesem Augenblick für einen kurzen Moment schmerzlich zu Bewusstsein kam. Der Beamte wirkte trotz seiner 46 Jahre noch sehr jungenhaft, fast pubertär, wozu sein leicht sommersprossiges Gesicht, die rötlichblonden Haare in Streichholzlänge, die hellen Brauen über den wasserblauen Augen und die etwas abstehenden Ohren beitrugen. Er schaute jedoch so arrogant, als müsse er dadurch ein Defizit an amtlicher Autorität ausgleichen, das ihm sein Aussehen bescherte.
„Wohrscheinlich erdrungn“, konstatierte der Leiter der Spurensicherung nach kurzer Untersuchung. Leipoldsheimer war ein außerordentlich intelligenter und fähiger Mann, dem nicht das Geringste entging, auch wenn dies sein urfränkischer Dialekt nicht unbedingt vermuten ließ. Wenn es sein musste, war er durchaus des Hochdeutschen mächtig, verwendete aber die Mundart seiner Heimat sehr bewusst – vor allem im Dienst. Er sah darin eine Möglichkeit, seine Individualität zum Ausdruck zu bringen, wie andere durch eine spezielle Haarfrisur oder modische Kleidung. Solcher Ausdrucksmöglichkeiten seiner Persönlichkeit war er jedoch durch das ständige Tragen von weißen Tatort-Schutzanzügen mit Kapuze fast gänzlich beraubt. Sein Dialekt, so meinte er oft ironisch, sei das Einzige, was ihn als Individuum Leipoldsheimer kenntlich mache und gleichzeitig den Tatort nicht kontaminieren könne.
„Mol vor der Obduktion ins Unreine gschbrochn, würd ich songn: Is noch net long her - vielleicht heit früh vor halber Siema - i glaab, der Hausmaster hot gmaant, der Ingenieur - haßt übrigens Wilhelm Ludwig - der hätt Frühschicht ghabt und hot scho um Sechsa ogfangt. Des ist scho a seltsamer Tod - meiner Herrn - hob ich so noch nie erlebt - in am Dank mit Dinden - sowos.“
„Todesursache Ertrinken?“ fragte der Kommissar unfreundlich knapp, der als Zugereister den Ausführungen des Spurensicherers nur schwer folgen konnte.
Leipoldsheimer sah kurz zu ihm auf. Der füllige Franke kannte schon dessen schroffe Art, die ihn in der Dienststelle bereits ziemlich unbeliebt gemacht hatte, obwohl er noch gar nicht so lange in Nürnberg Dienst tat.
„Also was ist jetzt?“ setzte dieser ungeduldig nach, „Können Sie schon was Genaueres sagen?“
„Ja, Genaueres ... wos soll ich scho derzu songn? Er hot a gscheite Beuln am Hinterkopf, die obber net ledal war, am Rand vom Boddich sin Spurn von am Gummiabrieb, a paar schwache Fußabdrück auf dem bolierten Metall - wohrscheinlich sen die vo seine eignen Schuh, aber des müss mer noch genauer untersuchn - und des Wichtigste: hier sin noch Bludspurn. Könnt gut sei, dass er ausgrutscht is oder den Halt verlorn hat - mitm Hinderkopf aufn Rand vom Dank gschlong und dann halt in des Zeig neigrutscht.“
Der Kommissar rätselte nur kurz, was Leipoldsheimer mit „Zeig“ meinte, beschloss aber, nicht danach zu fragen.
„Oder gestoßen wurde?“
„Oder gstoßen worn is. Genaueres ...“
„... nach der Obduktion, ich weiß. Wahrscheinlich doch nur ein Unfall. Ich will schnelle Ergebnisse um die Sache vom Tisch zu haben. Ich möchte Weihnachten zuhause sein.“
„Ja, die Kinner - meine zwaa sen aa scho ganz narrisch.“
Der Kommissar verstand, sagte aber nichts und ließ sich auch nicht anmerken, wie sehr ihn diese belanglose Äußerung traf. Er hatte keine Kinder, auch keine Frau mehr und - wenn er ehrlich war - nicht einmal Freunde.
Aber er hatte ein Gespür für Verbrechen und wusste, wenn er eines vor sich hatte.
Zumindest glaubte er das.
Kapitel 3
24. Dezember, Heiligabend
Eigentlich mag ich keine Weihnachtsmärkte. Man wird zum Kauf von blendendem aber letztlich wertlosem Tand verleitet, den man das ganze Jahr über nicht braucht (ja, nicht einmal an Weihnachten) oder man wird förmlich gezwungen, Dinge zu konsumieren, die man eigentlich aus verschiedensten Gründen lieber nicht essen sollte, schon gar nicht in dieser Menge und Kombination (beispielsweise Zuckerwatte/Steckerlfisch, vor allem in dieser Reihenfolge). Woran man sich aber nicht hält, mit der fadenscheinigen Begründung, es sei ja nur einmal im Jahr Weihnachten. Als ob es eine religiöse Verpflichtung zu Magenschmerzen an Festtagen gäbe. Allerdings konnte ich als großer Freund von Süßigkeiten an manchem Angebot einfach nicht vorübergehen - vor allem nicht an den gebrannten Mandeln, an denen meine Zahnärzte wahrscheinlich schon mehr verdient haben als die Standbetreiber während des gesamten Weihnachtsmarktes. Und wenn ich etwas Süßes gegessen hatte, musste ich unbedingt etwas Pikantes nachessen (ich nenne es „kontern“) und umgekehrt, was eine teuflische Spirale in Gang setzte. Je höherrangig das Eine umso gehaltvoller musste das Andere sein, beispielsweise musste ein gebackener Karpfen unbedingt mit Nougat gekontert werden – einfache Schokolade reichte höchstens für einen blauen.
Seit ich von Markt Essing nach Nürnberg gezogen war, gehörte der Christkindlmarkt – oder besser „Christkindlesmarkt“, wie man hier sagt – aber auch zu meinem Pflichtprogramm, vor allem heute, am Heiligabend, dem letzten Tag, an dem er geöffnet war.
Markt Essing. Wieder überrollte mich, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte, eine wahre Woge von Gefühlen, positive wie negative, wenn ich an die turbulenten Tage und grauenvollen Ereignisse in dem kleinen niederbayrischen Ort zurückdachte, die für mich teilweise so erschütternd gewesen waren, dass ich danach mehrere Monate psychiatrische Behandlung über mich ergehen lassen musste. Natürlich lag es auch an meiner ererbten Veranlagung, dass mir solche Geschehnisse mehr aufs Gemüt schlugen, als anderen – aber derartig mit Gewalt und Tod konfrontiert zu werden, hätte wohl auch robusteren Kalibern als mir zugesetzt.
Als Mensch, den die Psychologen als „Highly Sensitive Person“ bezeichneten, nahm ich Sinneseindrücke stärker wahr als andere, kompliziert ausgedrückt: Mein Thalamus im Gehirn funktioniert anders – viel mehr Reize werden als wichtig eingestuft und erreichen mein Bewusstsein. Menschen wie ich besitzen sehr hohe Mengen an Neurotransmittern, so dass beim Transport innerhalb der Nervenbahnen geringere Übertragungsverluste auftreten. So erreichen auch sensorische Reize mein Bewusstsein, die bei anderen Menschen erst gar nicht im Gehirn ankommen. Oder einfacher ausgedrückt: Ich sah, hörte und vor allem roch viel besser oder anders gesagt: viel mehr als die meisten Menschen, die viele Dinge übersahen, überhörten oder überrochen. Überrochen? Die Wortwahl bei dieser Aufzählung zeigt schon, dass man den Geruchssinn stark unterschätzt, obwohl diese Sinneseindrücke direkt in das Limbische System gelangen, wo die Emotionen gespeichert sind. Darum kann sich auch niemand der Faszination eines Weihnachtsmarktes mit seinen vielfältigen Gerüchen völlig entziehen, wenn er in seiner Kindheit diese mit positiven Erlebnissen verknüpft hat. Oder abermals einfach ausgedrückt: Wir fallen immer wieder darauf rein, haben das gekaufte Zeug dann zuhause herumstehen oder gehen mit Magen- und Zahnschmerzen ins neue Jahr. Friede auf Erden und den Händlern ein Wohlgefallen.
Es war für mich kaum möglich, Außenstehenden zu vermitteln, dass ich die Gerüche, die mich umgaben, wahrnahm, wie andere Menschen die Farben eines Bildes sahen: Der Markt war für mich überflutet von einer Wolke aus einem von mir als dunkelrot empfundenen, süßen Geruchsgemisch: als Grundton klebrige Zuckerwatte, darüber gebrannte Mandeln und der etwas künstlich wirkende Duft dieser roten Glasur, in die man die geschälten Äpfel tauchte. In diesen Geruch mischte sich mit gleicher Vehemenz der harzig-würzige Duft von frischen Tannenzweigen – für mich durchaus ein „dunkelgrüner“ Ton. Die oft für Weihnachtsartikel verwendeten Farben Rot und Grün fanden hier auch ihre olfaktorische Entsprechung. Wenn der Wind etwas auffrischte, wurden die Düfte durch einen frischen Hauch von kaltem Schnee vertrieben, um kurz danach wieder ihr angestammtes Territorium zurückzuerobern. Fein nuanciert dagegen nahm ich die Komponenten aus den Backwaren wahr. Zimt, Anis, Mandeln, Lebkuchengewürz. Nürnberger Lebkuchen. Wenn man sich durch die Gassen des Marktes zwischen den bunt beleuchteten (oft etwas kitschig und billig anmutenden) Buden hindurchzwängte, wechselten die Geruchseindrücke von Meter zu Meter: Hier plötzlich eine starke Note vom heißen Glühwein Nelken, Lorbeer, Koriander, dort ein säuerlicher, heller Duft von heißen Bratäpfeln. Der süßfaulige, dunkle Geruch der Zwetschgenmännla vermischte sich mit Stollen, der sich wiederum aus den Aromen von Rosinen, Marzipan, Zitronat und Gewürzen zusammensetzte und dessen Puderzucker in süßlichen Schwaden durch die Luft wehte. Wie braun-goldene Linien durchzog der scharfe, aromatische Duft von Gebratenem die rot-grüne Wolke: Nürnberger Rostbratwürste, die hier „Drei im Weggla“ hießen (weil drei der kleinen Würste gerade in ein Brötchen passten). Sie wetteiferten mit saftigen Steaks von rustikalen Holzkohlengrills in Nachbarschaft zu den langen, groben Thüringer Bratwürsten, die ich am liebsten fast schwarz gebraten mochte. All das konkurrierte mit einer beißenden Komponente, die ich als stahlblau empfand: der stechend scharfe Geruch von Steckerlfisch, in den sich auch noch der Uringestank aus den im Schatten der Lichter aufgestellten Dixi-Klos und ein undefinierbares Konglomerat aus den überquellenden Abfalleimern mischte.
Es war schon Nachmittag – der Markt würde bald schließen, eigentlich war er bereits vor einer Stunde offiziell zuende gegangen, was aber dem Publikumsaufkommen noch keinen Abbruch tat. Die Dunkelheit hatte heute bereits früh eingesetzt und breitete sich wie eine wohltuende Camouflage über die vielen Kabel, verschmutzten Mülltonnen und die auf dem Kopfsteinpflaster herumliegenden Abfälle, ließ die kitschigen Effektbeleuchtungen vor der blauschwarzen Kulisse des Himmels zu einem wundervollen Gesamtkunstwerk werden, das trotz seiner billigen Belanglosigkeit dennoch nicht nur Kinderherzen höher schlagen ließ.
Auch ich konnte mich dem Zauber des Ambientes zwischen der gotischen Frauenkirche und dem „Schönen Brunnen“ nicht entziehen und ließ mich einfach in der Masse der Marktbummler treiben, obwohl mir Menschenansammlungen stets ein unangenehm klaustrophobisches Gefühl bescherten und ich mich gerade in einer Ecke befand, die sich der Menge und Nationalität des Publikums nach auch in Nagasaki oder Tokio hätte befinden können.
Der Himmel verdunkelte sich ganz und es begann leicht in dicken Flocken zu schneien, der weiße, weiche Flor deckte nun auch noch die letzten Unzulänglichkeiten gnädig zu und knirschte bald angenehm unter meinen Stiefeln, was mich stets an meine Kindheit in Bad Tölz erinnerte, wo ich von meinen bayrischen Freunden „Johann“ genannt wurde, obwohl mein Name eigentlich nach meinem Großvater John lautete. Damals war Weihnachten für mich vor allem ein Fest kindlicher Sorglosigkeit gewesen. Man selbst bekam nur wenig mit von der Hektik und der Arbeit der Erwachsenen, alles was man zu tun hatte (und das erschien schwer genug), war, in erwartungsvoller Freude auf den großen Tag zu warten, begleitet von dem glitzernden Adventskalender, dessen simple, bunte Bildchen hinter den mittlerweile ausgeleierten Pappfensterchen man schon seit Jahren auswendig kannte, was der Freude und Erregung beim Öffnen aber keinen Abbruch tat.
Langsam wurde mir die beängstigende Postkartenromantik doch zuviel, zumal ich etwas wehmütig daran dachte, dass ich den Heiligabend alleine verbringen würde. Noch hatte ich an meinem neuen Arbeitsplatz, dem Nürnberger Spielzeugmuseum, keine Bekanntschaften oder gar Freundschaften geknüpft, die so eng gewesen wären, eine Einladung an diesem Tag zu rechtfertigen.
Mein nächster Gedanke hätte wohl weiterhin früheren Weihnachtsfesten mit meinen Eltern gegolten, doch das Handy in meiner Manteltasche meldete sich bereits mit der Kufstein-Melodie („Kennst Du die Perle, die Perle Tirols ...“), die ich meiner Mutter zugeordnet hatte. Sie begann aus Kostengründen ihre Gespräche stets ohne Anrede.
„A merry christmas winsch i der! Und von deim Daddy glei a. Der is scho beim Schneeschippn. In gonz Chicago schneits. Schneits bei eich a?“
Meine Mutter stammte aus Bad Tölz, hatte einen Amerikaner geheiratet, mit dem sie nun seit einigen Jahren in den Staaten lebte, ohne je ihren bayrischen Dialekt aufgegeben zu haben. Vielmehr mischte sie ihn mit englischen Vokabel, was beim Zuhörer eine gewisse Aufmerksamkeit erforderte.
„Ja,“ antwortete ich, „bin grad auf dem Christkindlesmarkt.“
„Ja, schee! Host a bissl a nice Maderl dabei?“
Ich musste erst überlegen, ob sie ein nettes (amerikanisch) oder ein neues (bayrisch) Mädchen meinte, wobei ich derzeit keines von beiden zu bieten hatte. Ich wusste, dass dieses Thema wie stets kommen würde, hatte aber nicht ganz so schnell damit gerechnet.
„… Ja, … ich … ich bin gleich noch verabredet …“
„Is nett?“
„… Ja, schon.“
„No holt di fei ran, i will a amol a Enkerla hom. Aber no in time.“
Es schnürte mir etwas die Kehle zu, weil ich meine Mutter nicht gern anlügen mochte, in punkto Enkel war jedoch im Moment nicht das Geringste in Sicht. Sie ließ aber sonst keine Ruhe. Ich wechselte schnell das Thema: „Wir hatten Anfang Dezember im Museum die erste große Ausstellungseröffnung. Über das Buch vom Struwwelpeter von Hoffmann. Du weißt schon.“
„Ja freili, des host scho als Bua gern glesen. Woahrscheinlich host deswegn dei Doktorabeit über den gmocht. Ah, wos i der noch verzöhln wollt, wos glaabst, wos die Millers widder gmocht ham?“
Mir wurde flau im Magen, denn jetzt drohte wieder eine der endlosen Stories aus der Nachbarschaft, auf die ich so gerne verzichtet hätte.
„Äh, du, ich muss jetzt leider Schluss machen, der Akku, ich ruf dich am Abend nochmal an. Oder morgen, da hab ich frei. Und hier ist es so laut.“
Tatsächlich war die Flut von Geräuschen auf dem Platz für mich sehr unangenehm. Nicht nur die Lautstärke einzelner Lärmquellen brachte meine Ohren zum Klingen, vor allem metallische wie Glocken oder Schellen verursachten mir körperliche Schmerzen. Es war überdies die Vielfalt der Töne und Klänge, der Stimmen und Geräusche, die ich sehr gleichwertig wahrnahm und die alle von meinem Gehirn in gleichem Maße beachtet wurden. Die dudelige Musik eines Kinderkarussells aus Lautsprechern mit schlechter, dröhnender Akustik mischte sich vor dem „Schönen Brunnen“ mit einem Live-Kinderchor, der ebenso laut wie falsch sang und auch noch von einem drittklassigen Bläserensemble begleitet wurde. Aus jeder Bude quäkte ein Radio oder ein CD-Player jeweils andere konkurrierende Weihnachtslieder in Endlosschleifen, dazwischen mischten sich Verkaufsgespräche, Gelächter, Unterhaltungen, schrill weinende oder quengelnde Kinder, deren Kaufwünsche nicht oder nur unzureichend (was der Normalfall war) erfüllt wurden und Stimmen in fremdländischen Sprachen wie zu einem Orchester mit falsch gestimmten Instrumenten, die einander zu übertrumpfen versuchten.
Eine neue Gruppe kichernder, offenbar schon vom Glühwein und Punsch etwas angeschickerter junger Japanerinnen hatte mich umzingelt, manche mit Rentierkappen einschließlich batteriebeleuchtetem Stoff-Gehörn, andere mit roten Nikolausmützen, bei denen man mit einer Schnur goldene Engelsflügel auf- und zuklappen konnte (was oft nach wenigen Versuchen nicht mehr funktionierte). Die meisten trugen aber jene unförmigen Stoffhüte, von denen Japaner wohl meinten, dass man sie auf Reisen in Europa tragen müsse. Aber da sollte man als Deutscher im Glashaus nicht mit Steinen werfen. Die Mädchen versuchten - angeregt durch den Kinderchor - „Oh Tannenbaum“ anzustimmen und lachten über das klägliche Ergebnis (sowohl beim Text wie auch bei der Melodie), während mir eines mit einer kleinen Flasche Obstler zuprostete und mir dabei etwas zurief, was aber im schüchtern-verschämten Gekicher der anderen unterging.
„Kimmts wohl scho, dei girlfriend?“ meldete sich meine Mutter nochmal, der die weibliche Stimme in der Nähe nicht entgangen war.
„Ja, Pfiat di Gott, Mama. Und a merry christmas fürn Papa! Habt ihr mein Paket schon bekommen?“
„Liegt scho unterm christmastree. Geh dankschö, des häts fei net braucht. Soll i ihr net aa a scheens Fest wünscha? Gib mers doch amol ons phone.“
„Nicht jetzt, Mama. Und danke für euer … Geschenk. Pfiat di also.“
Als ich die Verbindung trennte und noch über das Geschenk meiner Eltern nachdachte - einen selbstgestrickten Pullover mit einem amerikanisch-geschmacklosen, breit grinsenden Comic-Rentier mit Nikolausmütze (den ich aber möglicherweise für Kinderführungen im Museum zur Weihnachtszeit im nächsten Jahr tragen konnte – oder im übernächsten) und wie immer zwei Unterhemden (weiß, Doppelripp) dazu, in die mein Vater dankenswerterweise ein kleines Bündel größerer Dollarnoten gewickelt hatte - befand ich mich vor der Frauenkirche, die stimmungsvoll illuminiert war.
Sie kam mit ihrem fialenbekrönten Giebel und dem kleinen Türmchen zwischen den gewaltigen Zweiturm-Fassaden von St. Lorenz und St. Sebald filigran und liebenswert bescheiden daher und hatte mir deswegen schon immer gefallen. Die Fassade stammte von dem Bildhauer Adam Kraft, was man ihr auch ansah. Als Kulisse für den Weihnachtsmarkt wirkte sie auf mich fast wie das Werk eines größenwahnsinnigen Zuckerbäckers.
Eine Gruppe von Japanern hatte sich vor der Kirche versammelt und sie blickten still und erwartungsvoll nach oben. Es war kurz vor Sechs. Wahrscheinlich hatten sie heute Morgen in München („Europa in acht Tagen“) den Schäfflertanz am Rathaus gesehen und warteten nun gespannt auf das bekannte „Männleinlaufen“ hier über dem Balkon, das man allerdings in Nürnberg nur zur Mittagszeit geboten bekam.
Links neben dem doppeltürigen Eingangsportal stand eine große Video-Leinwand. Es lief eine Aufzeichnung von der Ansprache des diesjährigen Nürnberger Christkindes, für alle, die dieses wichtige folkloristische Ereignis am Eröffnungstag verpasst haben sollten. Am unteren Bildrand waren japanische und englische Untertitel eingeblendet.
Das Gedicht (der sogenannte „Prolog“) das von einem entsprechend kostümierten Mädchen mit ausreichend schauspielerischer Begabung und hochdeutschem Sprachvermögen auf der Außenempore der Frauenkirche vorgetragen wurde (wie ich wusste, verfasst von Friedrich Bröger, einem Sohn des Nürnberger Dichters Karl Bröger) nimmt Bezug auf das Jahr 1948, als es erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder einen Christkindlesmarkt in Nürnberg gegeben hatte und beginnt mit den Worten: „Ihr Herrn und Frau’n, die Ihr einst Kinder wart, Ihr Kleinen, am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt: Hört alle zu, was Euch das Christkind sagt!“
Ich blieb kurze Zeit stehen und hörte zu, da ich vorhatte, im nächsten Jahr eine Weihnachtsausstellung über diesbezügliches Nürnberger Spielzeug mit Führungen zu verknüpfen, die auch den Markt mit einbinden sollten. „Denn alt und jung zugleich ist Nürnbergs Angesicht, das viele Züge trägt. Ihr zählt sie alle nicht! Da ist der edle Platz. Doch ihm sind zugesellt Hochhäuser dieses Tags, Fabriken dieser Welt.“
Plötzlich wechselte das Bild - anstatt des Christkindes erschien ein Struwwelpeter, der aus der Dunkelheit mit grotesken Sprüngen herantanzte. Viele Kinder mit ihren Eltern blieben stehen und zeigten auf die bunte, grell-weiß geschminkte Gestalt, was nicht so ganz der originalen Vorlage entsprach. Ich war verwundert und glaubte zunächst, dass es sich möglicherweise um eine Werbeeinlage zu meiner Struwwelpeter-Ausstellung handeln könnte, die das Fremdenverkehrsamt, das für den Christkindles-Spot verantwortlich war, allerdings an völlig unpassender Stelle ziemlich unsensibel eingeschnitten hätte. Ich blieb ebenso erfreut, wie interessiert stehen, ein wenig verärgert aber doch darüber, dass man einen solchen Clip offenbar ohne meinen fachkundigen Rat produziert hatte. Aber Reklame konnte man immer brauchen.
Dennoch beschlich mich eine unangenehme Irritation.
„Ihr Herrn und Frau’n, die ihr einst Kinder wart! Hört alle zu, was der Struwwelpeter euch sagt! Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Polizei!“ schnarrte die kostümierte Gestalt mit einer schrillen Stimme, die ich für überzogen gruselig hielt. Aber die umstehenden Kinder waren durchaus nicht schockiert (da waren sie heutzutage wohl ganz anderes gewohnt) und einige lachten sogar über die seltsame Begrüßung.
„Vor allem ihr, liebe Krimifreunde, Polizisten und Kriminalisten, jetzt gut aufgepasst: Ich habe zwei Morde begangen! Ja, ihr habt richtig gehört: ZWEI! Zum einen habe ich den frechen Wilhelm Ludwig in einem Tintenfass ertränkt. Ihr wisst doch: das vom großen Nikolas. Der Ludwig wird nie wieder was Böses über unsere farbigen Mitbürger mit Migrationshintergrund sagen. Ho, ho! Da staunt ihr, was?“
Im Hintergrund war nun ein schwarz-weißes Foto eingeblendet, das eine Fabrikhalle mit mehreren metallenen Bottichen zeigte, von denen einer geöffnet war. Irgendetwas Seltsames schwamm darin.
„Und dann noch das arme Paulinchen – verbrannt mit Haut und Haar! Oh weh!“
Der Struwwelpeter legte einen Finger unter eines der schwarzgeränderten Augen, als wolle er dort die aufgemalte Träne abwischen.
„Tschja, die Eltern haben da wohl ihre Aufsichtspflicht verletzt. Rabeneltern! So schnell kann‘s gehen. Aber nun haben sie ja ihre gerechte Strafe.“
Das Foto wechselte: Nun sah man eine Wohnung, in der es gebrannt hatte, ein verkohlter Körper lag im Vordergrund. Das geht entschieden zu weit!
Einige Erwachsene schoben ihre Kinder weiter, die sich lauthals widersetzten. Japaner, die nichts verstanden, weil die Untertitel fehlten, lachten über die Figur, einer erklärte der Gruppe etwas von „Kalnawal“. Viele Leute schüttelten entrüstet die Köpfe. Ein Trachtler aus dem Oberbayrischen rief: „Wos is des widder für a spinnertes Zeigs. Des hot doch mitm Weihnochten nex zum turn! Heerts mer bloß auf dermit!“
Viele der Umstehenden forderten nun lautstark, dass der Film abgeschaltet werden sollte. Ein Marktordner kam herbeigesprintet und verschwand erst hinter der Leinwand, dann in der Kirche auf der Suche nach einem Stecker, den man ziehen könnte, was aber in der Dunkelheit etwas länger dauerte. Zwei Polizisten, die über den Hauptmarkt patrouillierten, kamen neugierig näher.
Inzwischen trat die skurrile Gestalt ganz nahe vor die Kamera, die nun seine blutrot geschminkten Lippen in voller Größe zeigte, was auf der vier Meter breiten Leinwand sehr beängstigend wirkte. Der Mund öffnete sich wie ein dunkler Schlund: „Aufgepasst, ihr Lieben: Ich werde weiter morden, denn meine Geschichten sind noch lange nicht zu Ende. Ach – und ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich noch.“
Mit seinem grotesken, grauenvollen Lachen fiel das Bild in sich zusammen, offenbar hatte der Mann hinter den Kulissen endlich den Stecker gefunden.
Bevor ich näher über das Gesehene nachdenken konnte, schoss mir durch den Kopf, dass dies nicht unbedingt eine gute Werbung für meine Ausstellung sein würde. Was sollte das Ganze? Für manche begann auch in Franken der Karneval (hier Fasching genannt) am 11. November, aber das ging als Scherz doch zu weit. Ich tippte eher auf das Projekt eines gesellschaftskritischen Möchtegernkünstlers, der vielleicht dem glühweinseligen Gefühlsdusel des Christkindlesmarktes einen Dämpfer verpassen und die Brüchigkeit unserer Wohlstandgesellschaft unter dem Deckmäntelchen von Tradition und Zuckerguss aufzeigen wollte. Oder so ähnlich. Vielleicht gar nicht so verkehrt vom Ansatz her, aber in dieser Form absolut geschmacklos.
Was mich jedoch im Moment am meisten verunsicherte, war der Umstand, dass ich meinte, den jungen Mann, der unter der Maske steckte, von irgendwoher zu kennen.
Kapitel 4
1844, 6. Dezember
Dr. Heinrich Hoffmann suchte aus den Stapeln von Patientenakten und Schriftstücken, die sich auf seinem überfüllten Schreibtisch türmten, das Frankfurter Intelligenzblatt vom 24. November 1844 heraus, steckte genüsslich eine Zigarre in Brand und verwahrte die Schwefelhölzer sorgfältig hinter der marmornen Eule, die zwischen zwei Tintenfässern über einer vertieften Ablagemulde für Schreibfedern thronte. Er verwünschte den engen Vatermörder-Kragen, der seinen Hals umschloss wie ein kneifender Schraubstock, aber er erwartete heute Vormittag noch wichtigen Besuch.
Sein Blick fiel auf einen handschriftlichen Text in einem Rahmen an der Stirnwand des kleinen Ordinationsraumes und er lächelte. Er hatte ihn selbst erdacht, weil sich einige seiner Besucher oft über garstige Gerüche im Hause beschweren: „Über Gestank klagt überhaupt heutzutage kein gebildeter Mensch mehr, seitdem Moschus und Patschouli in der Modewelt duften.“ Er liebte kleine satirische Spitzen gegen die Auswüchse der menschlichen Gesellschaft und eine Armenklinik war nun mal keine Parfumerie.
Er wandte sich wieder der Zeitung zu und studierte mit Hilfe einer Lorgnette aufmerksam die Inserate. Er suchte etwas ganz Besonderes, aber er wusste, dass seine Chancen, es zu finden, außerordentlich gering waren.
Eine viertel Seite füllte die Anzeige der Leipziger Feuerversicherung, die für auf ihre fünf Jahre Versicherten (und solchen, die es werden wollten) neuerdings einen besonderen Vorteil gewährte: Bei Vorauszahlung der vollen Prämie müsse man nur Beiträge für vier Jahre entrichten und erhielte sogar noch einen Anteil vom Firmengewinn. Vielleicht sollte man tatsächlich für das Hospital eine solche Versicherung abschließen, durch den Gebrauch von offenem Feuer brannte es häufig in der Stadt, aber die Armenklinik finanzierte sich ausschließlich aus mildtätigen Spenden und die reichten nur für das Nötigste – für eine Feuerversicherung gab es keine finanziellen Möglichkeiten.
Er überflog die zahlreichen Kleinanzeigen: In der Eschenheimerstraße No.39 war eine leichte (wohl einspännige) Chaise zu verkaufen. Tierarzt Riese bot einen neuen, englischen Sattel an. Zu je einem Preußischen Taler pro Band sollten die Bände 52 bis 60 der Dictionaire des sciences naturelles veräußert werden, was Hoffmann äußerst preisgünstig erschien. Bei Schneider im Hainerhof am Dom gab es heute frischen Rhein-Salm, Perigord-Trüffel und frasierten Wildschweinkopf. Leider war ihm aber gegenwärtig nicht nach Ausgehen zumute, da seine Frau hochschwanger war und er sie nicht mehr als notwendig alleine lassen wollte.
Eine besonders große und opulent gestaltete Anzeige warb für ein „Italienisches Nachtfest“ bei brillanter Gas-Illumination des gesamten winterlichen Gartens mit 16.000 Gasflammen, Blumen, die künstliches Gas auswarfen und einem brennenden Palmbaum mit illuminierten Fruchtstücken, einem wasser- und feuerspeienden Reptil in einer Felsengruppe, sowie frei in der Luft hängenden, brennenden Vögel mit abwechselnden Lichteffekten und griechischem Feuer. Als Höhepunkt wurde ein großes Brillant-Feuerwerk des hiesigen Pyrotechnikers Friedel angekündigt.