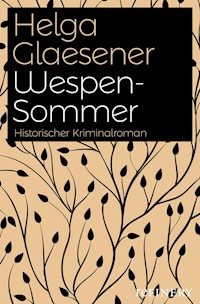9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hamburgs erste Kommissarinnen
- Sprache: Deutsch
Ein Frauenmörder auf St. Pauli, eine weibliche Ermittlungseinheit – und eine Spur, die nicht sein darf Hamburg, 1928: Seit einem Jahr gibt es im Hamburger Stadthaus eine weibliche Kriminalpolizei unter Leitung der resoluten Josefine Erkens. Auch die freiheitsliebende Paula heuert dort an. Als eine Tänzerin ermordet und obszön entstellt wird, gelingt es Erkens, Paula und eine weitere Kommissarin in der bisher rein männlich besetzten Mordkommission unterzubringen. Angeführt wird diese Ermittlungsgruppe von Martin Broder, der gezeichnet ist von den Gräueln des Großen Krieges und der sich schwertut mit den «unfähigen Weibern». Doch die Frauen arbeiten mit präziser Logik und kühlem Witz. Zunächst führen ihre Ermittlungen ins Rotlichtmilieu, als aber ein weiteres Opfer aufgefunden wird, keimt in Paula ein ungeheuerlicher Verdacht auf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Helga Glaesener
Die stumme Tänzerin
Kriminalroman
Über dieses Buch
Ein Frauenmörder auf St. Pauli, eine weibliche Ermittlungseinheit – und eine Spur, die nicht sein darf.
Hamburg, 1928: Seit einem Jahr gibt es im Hamburger Stadthaus eine weibliche Kriminalpolizei unter Leitung der resoluten Josefine Erkens. Auch die freiheitsliebende Paula heuert dort an. Als eine Tänzerin ermordet und obszön entstellt wird, gelingt es Erkens, Paula und eine weitere Kommissarin in der bisher rein männlich besetzten Mordkommission unterzubringen. Angeführt wird diese Ermittlungsgruppe von Martin Broder, der gezeichnet ist von den Gräueln des Großen Krieges und der sich schwertut mit den «unfähigen Weibern». Doch die Frauen arbeiten mit präziser Logik und kühlem Witz. Zunächst führen ihre Ermittlungen ins Rotlichtmilieu, als aber ein weiteres Opfer aufgefunden wird, keimt in Paula ein ungeheuerlicher Verdacht auf …
Vita
Helga Glaesener wurde in Niedersachsen geboren und studierte in Hannover Mathematik. Heute lebt sie in Oldenburg. 1990 begann die Mutter von fünf Kindern mit dem Schreiben historischer Romane, von denen gleich das Debüt, «Die Safranhändlerin», zum Bestseller avancierte. Seitdem hat sie zahlreiche weitere erfolgreiche Romane geschrieben, darunter auch diverse Krimis sowie zuletzt «Das Erbe der Päpstin». Für den hier vorliegenden St.-Pauli-Krimi aus der Weimarer Zeit hat sie intensiv zu dem spannenden historischen Hintergrund recherchiert: In Hamburg entstand in den 1920er Jahren eine der ersten weiblichen Kriminalpolizei-Einheiten in Deutschland, die Verbrechen an Frauen aufklären sollte. Ein zweiter Band ist in Vorbereitung.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Silke Jellinghaus
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Miguel Sobreira/Trevillion Images; Hulton Archive/Freier Fotograf/Getty Images
ISBN 978-3-644-00837-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1. Kapitel
So sah sie also aus: die Befreiung vom Mief der Kaiserjahre, der Mut, der mit der Faust die altbackene Prüderie zerschlägt, das ehrliche Lachen, das keine Kompromisse eingeht … Varieté! Der sensationelle Abend, an dem sie sich Zutritt zu der Welt der Unerschrockenen und Tabulosen verschaffen wollte, war gekommen, sie saß im Fiasko und …
Ja, was?
Paula lehnte sich in dem rot gepolsterten Sessel zurück und starrte in den halbdunklen Saal mit der Bühne, dem Klavier und den dicht besetzten Tischen. Die Luft war erfüllt von Zigarettenqualm, Weindunst, Schweiß und Parfüm, was das Atmen zur Schwerstarbeit machte. Es wurde gejohlt, gelacht, geklatscht und gerufen. Genau so, wie es in den Gazetten geheißen hatte, in denen diese halbseidenen Sehnsuchtsorte bejubelt wurden. Auch Paulas Kolleginnen schwärmten davon, wenn sie morgens völlig übermüdet zur Arbeit in die Bootsmanufaktur Borgmeister trotteten. Warum also kam bei ihr keine Begeisterung auf?
Bedrückt beobachtete Paula die halbnackten Frauen, die den Treibstoff für die Stimmung in dem spiegelverkleideten Raum bildeten. Obenherum waren sie mit Ketten aus aufgefädelten Kupferringen bekleidet, untenherum mit nur handbreiten Spitzenröckchen und winzigen Unterhöschen. Sie saßen auf dem Schoß ihrer Kundschaft, lachten, flüsterten und kreischten neckische Drohungen. Alles in breitem Platt, die Hamburger Herkunft ließ sich nicht leugnen. Und wenn ihnen einer zwischen die Schenkel griff, taten sie, als wären sie amüsiert und nicht hundemüde. Die Männer im Publikum winkten sie heran und schoben sie wieder von sich, ihre Begleiterinnen lachten generös und zogen an ihren Zigaretten. Genau, Prüderie war nicht mehr zeitgemäß, dafür aber etwas anderes, Schäbiges, für das Paula auf die Schnelle kein Begriff einfiel.
Sie nippte verdrossen an ihrem Champagner und gestand sich ein, dass es ein Fehler gewesen war hierherzukommen. Dafür besaß sie offenbar ein Talent: sich zu verrennen. Vor anderthalb Jahren hatte sie beschlossen, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Sie wollte nicht mehr das verwöhnte Fräulein Tochter des stinkereichen Zündholzfabrikanten Harry Haydorn sein. Sie wollte Abenteuer. Und als sie im Hamburger Anzeiger eine Annonce der Volkshochschule in der Oberalten-Allee entdeckte – Demokratie braucht Bildung! –, hatte sie spontan einen Kurs in Stenographie und Schreibmaschine belegt. Anschließend hatte sie sich bei Borgmeister beworben – und war genommen worden. Endlich selbständig!, hatte sie gejubelt. Sie war zu einer modernen Frau geworden, die ihren eigenen Weg ging.
Doch schon nach kurzer Zeit hatte ihre Stellung sich als öder Alltagstrott entpuppt. Acht Stunden stenographieren, was der alte Borgmeister hinter seinem Riesenschreibtisch ihr diktierte, und den Sermon anschließend abtippen. Einmal hatte sie sich getraut, ihm zu weniger gewundenen Sätzen zu raten. Damit man’s besser verstehen konnte, war doch in seinem Sinn. Hui, da waren aber die Fetzen geflogen. Wenn Borgmeister in Rage geriet, konnte er gestochen scharf formulieren. Was das Fräulein sich einbilde? Heerscharen von talentierteren Sekretärinnen warteten darauf, ihren Platz einzunehmen. Sie hatte die Arbeit nur deshalb nicht hingeworfen, weil sie ihren Eltern gegenüber kein Scheitern eingestehen wollte.
Walter, ihr Begleiter an diesem Abend, arbeitete ebenfalls bei Borgmeister. Er war Schiffsbauingenieur, und sie mochte ihn, weil er lustig und unkompliziert war und gern auch mal über den Chef herzog. In seiner Freizeit ging er rudern, er mochte Jazz und gut geschnittene Anzüge. Heute Mittag war er ins Büro gekommen und hatte ihr verstohlen zugeflüstert: «Ich will ins Varieté, hast du nicht Lust mitzukommen?» Und da hatte sie spontan zugesagt.
Nach der Arbeit war sie eilig nach Harvestehude gefahren, wo sie wegen ihres knickerigen Gehalts immer noch bei den Eltern wohnte, und hatte sich so gewagt angezogen, wie es ihr Kleiderschrank hergab. Dann retour zum Hauptbahnhof, wo Walter auf sie gewartet hatte, und nun saßen sie hier im Fiasko.
Tja, nomen est omen, dachte sie und blickte verstohlen auf ihre Armbanduhr.
Walter schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und brach in Gelächter aus. Galt seine Begeisterung dem Witz, den der freche Kerl auf der Bühne gerade gerissen hatte? Sicher nicht nur. Ihr Ingenieur war inzwischen angeschickert, und sein Zustand mochte auch etwas mit dem Akkordeonspieler zu tun haben, der sich zwischen den einzelnen Nummern an die Tische drängte und dabei «Mutter, der Mann mit dem Koks ist da» sang. Viele Gäste, darunter auch Walter, hatten nach den Briefumschlägen im Korb an seinem Gürtel gegriffen und dabei wie selbstverständlich ein paar Mark hineinfallen lassen. Walter hatte seinen Umschlag geöffnet und mit Hilfe eines Strohhalms ein weißes Pulver in die Nase gesogen. Er hatte auch ihr etwas davon angeboten, aber Paula hatte abgewinkt, hauptsächlich, weil sein Schnodder am Halm klebte. Dann war der Umschlag auch schon leer gewesen.
Inzwischen war ihr aufgegangen, worum es sich bei dem Pulver handeln musste. Kokain, natürlich. Das Lied vom Koks, das der Mann mit dem Akkordeon augenzwinkernd gesungen hatte, war eine Botschaft gewesen, und sie bereute, dass sie nicht doch zu dem Strohhalm gegriffen hatte. Denn das war es doch, was sie wollte: Ins pralle Leben eintauchen! Ihre Stimmung sank auf einen neuen Tiefpunkt.
Ein Mann am Nebentisch kniff eine der Animierdamen in die Brüste. Das Gesicht des Mädchens verzog sich schmerzhaft – und wurde im nächsten Moment durch ein gekünsteltes Lachen entstellt. Die hatte keinen Spaß an ihrer Arbeit. Wie auch? Sich von fremden Kerlen begrapschen lassen, als wäre man eine Birne auf dem Wochenmarkt!
Paula stieß Walter an. «Ich bin müde, lass uns gehen!»
«Was?» Wieder brach er in Gelächter aus, dann beugte er sich zu ihr vor, um sie zu küssen.
Angeekelt wandte sie das Gesicht ab. «Walter, ich …»
Bevor sie den Satz beenden konnte, drehten sich die Köpfe plötzlich zur Tür. Eine blonde Frau mit apart schrägen Augen hatte mit lautem Münzgeklapper das Fiasko betreten. Sie steckte in der Uniform der Heilsarmee – knöchellanger, biederer Rock mit Bluse, Umhang bis zur Hüfte, eine Kappe mit breitem Rand, die ihre Stirn beschattete, alles in verdrießlichem Schwarz. Dabei war sie so hübsch, als wollte sie damit ihre Aufmachung verspotten. Der Mann am Nebentisch warf ihr grinsend einen Luftkuss zu, doch die Uniformierte schüttelte wie zur Antwort stumpf ihre Sammelbüchse. Und da kippte die Stimmung. Vielleicht sahen die Gäste plötzlich wieder die Kriegsversehrten und Witwen vor sich, die in den Hamburger Straßen gegen das Verhungern anbettelten, jedenfalls griffen sie nach ihren Geldbörsen. Und als der Akkordeonspieler auch noch ein melancholisches Soldatenlied zu spielen begann, sprangen die Groschen nur so in die Dose. Die Heilsarmeefrau sandte dem Mann mit dem Akkordeon einen dankbaren Blick zu.
Nun, das war menschlich und schön, aber Paulas Widerwillen gegen das Fiasko wurde dadurch nur noch größer. «Hast du gehört, Walter? Ich will heim.»
Walter stierte schon wieder die Lustdamen an. Nichts deutete darauf hin, dass er sie gehört hatte oder überhaupt noch wahrnahm. Na gut, sie hatte zwei Beine, dann ging sie eben allein! Wahrscheinlich war sie ohne ihn sogar sicherer, besäuselt, wie er war. Paula schob ihren Sessel zurück, schnappte sich ihren Mantel und zog ihre Tasche von der Lehne. Wenig später stand sie draußen auf dem Spielbudenplatz.
Es war bereits kurz vor Mitternacht, doch die Gaslaternen und Lichtreklamen tauchten den Platz immer noch in buntes, unruhiges Licht. Autos bahnten sich hupend ihren Weg durch die Menschenmenge. Die Damen des leichten Gewerbes flanierten auf den Bürgersteigen und beugten sich zu Autofenstern hinab. Im Kiez verlief das Leben spiegelbildlich. Tagsüber waren die Straßen wie leergefegt, nachts begann ein fieberhaftes Treiben.
Paula ging zum Standplatz der Taxen hinüber, aber leider fand sich dort kein einziges Fahrzeug, nur einige Betrunkene lungerten auf einer Bank herum. Sie sah, wie sich einer von ihnen erhob und aus der Gruppe löste. Er starrte zu ihr herüber und beschleunigte seinen Schritt. Himmelherrgott!
Eine Tram hielt bimmelnd an einer Haltestelle in ihrer Nähe. Paula hatte keine Ahnung, wo die hinwollte, aber sie stürzte los, quer über den mit kahlen Bäumen bestandenen Grünstreifen zu den Gleisen. Leider hatte die Elektrische schon wieder Fahrt aufgenommen, bevor sie die Haltestelle erreichte. Paula hastete weiter, nur weg von dem Besoffenen, der ihr irgendetwas hinterhergrölte. Ihr ging auf, dass es vielleicht doch ein Fehler gewesen war, das Fiasko ohne Walter zu verlassen. Plötzlich fühlte sie sich wie Freiwild. Also umkehren und Schutz in Walters hoffentlich starken Armen suchen? Nein, das kam nicht in Frage, dafür war sie zu stolz. Außerdem müsste sie dann noch einmal an dem Besoffenen vorbei, und sie ahnte, dass sich hier auf dem Kiez niemand zu ihrem Beschützer aufschwingen würde. Instinktiv bog sie in eine Seitengasse ein.
Sie schritt aus, so schnell ihre hochhackigen Schuhe es zuließen. Ihr Herz tuckerte im Takt der klappernden Absätze. Die Straße mündete in eine Querstraße und kurz darauf in eine weitere, engere Straße und in noch eine. Irgendwann stand sie an einer breiten Treppe, und schräg unter ihr glänzte die schwarze Elbe mit den Landungsbrücken. Da wollte sie nicht runter. Der Platz vor den Gebäuden am Wasser war zu ungeschützt, es gäbe keine Möglichkeit, sich zu verstecken, falls es heikel wurde. Außerdem machte ihr das Wasser Angst. Sie hatte einmal in der Zeitung das Bild einer Wasserleiche gesehen, die von Aalen angefressen worden war. Scheußlich!
Paula machte kehrt und bog in eine weitere Straße ein, in der Hoffnung, das Millernthor zu erreichen, von wo aus sie den Weg in die anständigeren Stadtteile finden würde. Nur weg aus St. Pauli.
Doch der letzte Schwenker stellte sich als großer Fehler heraus. Denn plötzlich irrte sie zwischen hohen Hauswänden mit blätternder Farbe und blinden, teilweise mit Brettern vernagelten Fenstern entlang. Es war duster, Gaslaternen gab’s hier keine mehr. Huschten da drüben im Durchgang Ratten? Im Vergleich hierzu kam ihr der Spielbudenplatz mit seinen Vergnügungsstätten mit einem Mal wie ein sicherer Hafen vor. Leider hatte Paula keine Ahnung, wie sie zurückgelangen könnte. Sie hatte sich komplett verlaufen. Mangelnder Orientierungssinn, typisch Frau, würde Vater sagen.
Sie bog in eine weitere Straße ein. Hier brannte in einigen Wohnungen noch Licht. Außerdem gab es mehrere Amüsierbetriebe, die sich in den Kellern am Fuße von krummgetretenen Treppen befanden, von dort drangen Stimmen und Gelächter zu ihr herauf. Ihre Stimmung hob sich ein wenig.
Im nächsten Moment jedoch begann ihre Haut zu kribbeln. Da vorn, wo die Straße einen Bogen schlug – war da nicht was gewesen? Tatsächlich, eine Gestalt huschte von einem Hauseingang zum nächsten. Und dann, nicht weit entfernt, entdeckte sie einen weiteren Schatten, der sich in einen Hauseingang duckte. Erschrocken rettete Paula sich hinter ein Auto, das vor einem der Häuser parkte. Nur weg von hier! Egal wohin!
Doch leider war eine Flucht unmöglich. Wie aus dem Pflaster gewachsen, trottete auch von der anderen Seite der Gasse plötzlich eine Gestalt heran, den Kopf gesenkt, als wäre sie müde. Offenbar war Paula noch nicht bemerkt worden. Sie nutzte die Gunst des Augenblicks, um sich eine schmale Kellertreppe hinabzuflüchten.
Ängstlich starrte sie auf das schmutzig feuchte Mauerwerk am Eingang. Wenn einer der Schatten sie gesehen hatte, saß sie in der Falle.
Doch nichts geschah.
Langsam atmete sie ein und aus, dann nahm sie ein paar Stufen und spähte um das Mäuerchen. Gott, war sie erleichtert! Die Gestalt mit dem gesenkten Kopf entpuppte sich beim Näherkommen als die Frau von der Heilsarmee – Paula erkannte sie an dem scheußlichen Monstrum von Hut. Vielleicht war es ratsam, sich mit ihr zu verbünden? Dann wären sie wenigstens zu zweit.
Gerade wollte Paula ihren Vorsatz in die Tat umsetzen, als sie sah, wie die Frau eine der Kellerkneipen schräg gegenüber ansteuerte. Dort angekommen, riss sie sich die Kappe vom Kopf und löste den Knoten, mit dem sie ihr Haar gebändigt hatte. Üppige blonde Locken flossen über ihre Schultern. Jemand öffnete, und Paula sah, wie sich die Soldatin der Nächstenliebe in Männerarme warf. Küsse und Gelächter, dann klapperte der Spendentopf. Na, da sollte doch der Teufel …
Das Pärchen verschwand in der Kaschemme, und Paula beschloss, den Ausweg aus dem Straßenlabyrinth allein zu suchen. Doch plötzlich brach oben auf der Straße die Hölle los. Männer stürmten aus den Hauswinkeln, Pistolenschüsse zerrissen die Nacht, Rufe, Proteste, Befehle, Schmerzensschreie … Dann bogen hupende Polizeiautos aus den Seitenstraßen ein und versperrten die Zugänge zu den Kellerkneipen. Von den Pritschen im hinteren Teil der Wagen sprangen Uniformierte und rannten die Stufen hinab. In einigen Häusern wurden die Fenster aufgerissen, und neugierige Gesichter beugten sich heraus.
Die Polizisten zerrten Männer und Frauen, von denen einige nur in Decken gehüllt waren, aus den Kneipen. Ein paar der Frauen kreischten und spuckten die Polizisten an.
«Mitkommen!»
Paula erstarrte. Ein massiger Kerl mit Uniform und Tschako auf dem Kopf hatte sich vor ihr aufgebaut und richtete den Lauf einer Pistole auf sie.
«Ich?», fragte Paula entgeistert.
Wortlos packte er sie am Arm und zerrte sie zu einer grünen Minna, die ebenfalls in die Gasse gerollt war. Die beiden hinteren Türen des großen Wagens standen offen, und er schubste sie mit anderen Aufgegriffenen in das rollende Gefängnis. Zwei Holzbänke standen einander gegenüber. Paula wurde zum hinteren Ende des Kastenwagens gedrängt und stolperte vor einer der Bänke zu Boden. Ihr Oberkörper wurde von zwei behosten Männerbeinen zusammengequetscht. Neben ihr hustete jemand, andere fluchten, irgendwo schluchzte eine Frau. Als keine Seele mehr in das vierrädrige Monstrum passte, fiel die Tür zu. Mit einem Schlag war es stockdunkel. Stiller wurde es allerdings nicht. Der Mann, zwischen dessen Beine Paula geraten war, zog ihren Kopf an den Haaren so nach oben, dass er ihr einen schiefen Kuss zwischen Nase und Auge drücken konnte. Sofort schlug sie ihre Fingernägel in seine Beine, er fluchte und ließ sie wieder los.
Auf der Fahrt wurden sie ordentlich durchgeschüttelt, aber es dauerte zum Glück nur kurz. Dann wurde die Sardinenbüchse wieder geöffnet. Die Insassen mussten durch ein Spalier von Polizisten auf einen von Mauern umgebenen Innenhof treten, über ihnen blitzten Sterne wie Theaterbesucher, die ein amüsantes Spektakel beobachteten.
Paula starrte an den Hausfassaden hinauf, die den Hof umschlossen. Waren sie im Stadthaus gelandet, dem Sitz der Polizei? Die Gendarmen schubsten die Gefangenen weiter und bellten Kommandos.
Der Mann, zwischen dessen Beinen sie festgesessen hatte, nutzte das Gedränge und drückte sich an sie. Erneut versuchte er, Paula einen nassen Kuss direkt auf den Mund zu geben. Im nächsten Moment knallte eine Frau, die sich an ihn geklammert hatte, Paula wutentbrannt die Faust ins Gesicht. Paula taumelte, und einer der Polizisten legte dem Biest Handschellen an. Erst da bemerkte Paula, dass es sich bei der rabiaten Dame um die Heilsarmeesoldatin handelte. Sie hatte ihre Uniform in der kurzen Zeit bis zur Festnahme durch ein loses Gewand mit einem Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel getauscht.
Paula trat zu einem der Polizisten und erklärte mit so viel Würde wie möglich: «Hier liegt ein Irrtum vor. Ich …»
«Schnauze», herrschte der Mann sie an.
Ihr Zutrauen in die Ordnungsbehörden erlitt einen gehörigen Dämpfer. Sie war Paula Haydorn. Sie hatte das Lyzeum Lerchenfeld für höhere Tochter besucht. Ihr Vater gehörte zu Hamburgs Wirtschaftsgrößen. Und nun interessierte das keinen?
Man schubste sie mit den anderen Inhaftierten durch eine Tür in einen breiten Flur hinein und dort in Richtung einer Treppe, die in einen Keller hinabführte. Beängstigende Bilder tauchten in Paulas Kopf auf: eine finstere Zelle, in der sie, womöglich in Gesellschaft der Heilsarmeesoldatin und ihres Begleiters, die Nacht verbringen müsste. Später dann der Rausschmiss aus der Bootsmanufaktur, der Klatsch, den Walter verbreiten würde, die Reaktion ihrer Eltern …
Gehetzt starrte sie die Wände entlang. Lauter Türen, so weit sie sehen konnte. Unter einer von ihnen schimmerte Licht hindurch. Da arbeitete wohl noch jemand.
Plötzlich brach neben Paula ein Tumult aus, als der widerliche Küsser der Soldatin der Nächstenliebe eine schallende Ohrfeige versetzte. Vielleicht passte es ihm nicht, wie sie ihn für sich vereinnahmte. Die Frau taumelte gegen die Wand, richtete sich wieder auf und ging zum Gegenangriff über. Es gelang ihr trotz der Handschellen, ihn zu Boden zu schubsen, wo unter dem Gelächter der anderen Gefangenen ein peinlicher und beschämender Kampf entbrannte.
Während die Polizisten versuchten einzuschreiten, nutzte Paula die Gelegenheit und huschte zu der Tür mit dem Lichtspalt. Hastig zupfte sie ihr Kleid zurecht, dann klopfte sie und schlüpfte ins Zimmer, ohne auf Antwort zu warten.
Irritiert sah sie sich um. Was hatte sie erwartet? Sicher nicht drei Frauen. Nicht um diese Zeit, nicht in einem feinen Büro, das kaum für die stupide Schreibarbeit geeignet war, die man Weibsbildern gewöhnlich zumutete. Und ganz sicher kein Büro, in dem Papiere durch die Luft segelten und man einander anzischte.
«Gut, ich hab’s verstanden», fauchte die Werferin der Kladde, aus der die Blätter gesegelt waren, eine noch junge Frau mit weiblichen Kurven und akkurater Dauerwelle. Bei ihr schien es sich tatsächlich um eine Sekretärin zu handeln. Aufgebracht zupfte sie am gestärkten Kragen ihrer weißen Bluse und zog diesen dabei so fest, als wollte sie sich damit erwürgen. Dann schnappte sie sich eine Handtasche von einem Tisch in der Ecke, der fast vollständig von einer der hochmodernen Mercedes-Elektra-Schreibmaschinen eingenommen wurde. Kurz hielt sie inne, als wartete sie auf eine Entschuldigung, dann rauschte sie zitternd an Paula vorbei aus dem Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu.
Danach herrschte erst einmal Stille. Vom Flur klangen die Geräusche nur sehr gedämpft zu ihnen herein. Die beiden anderen Frauen blickten einander an. Die ältere von ihnen, ein scharfäugiges Weib um die vierzig, deren biedere Kleidung wirkte, als wollte sie damit ihre geistige Regsamkeit verschleiern, saß hinter einem großen, dunklen Schreibtisch. Die andere stand beim Fenster, und … Paula versuchte, nicht zu starren, doch das war unmöglich. Dass es sich um eine Frau handelte, stand fest. Aber sie trug Hosen, ein weißes Hemd mit Kragen und einen gestreiften Schlips. Es war keine Kleidung, die der männlichen nur nachempfunden war, sondern es handelte sich um Originale, todsicher in einem Geschäft für Herrenmoden gekauft. Auch ihr dunkles, lockiges Haar war geschnitten wie bei einem Mann. Ihr Lächeln wirkte … hochnäsig? Ironisch? Auf jeden Fall selbstbewusst.
Zum ersten Mal in dieser Nacht verspürte Paula plötzlich das Kribbeln, dessentwegen sie am Abend zum Kiez aufgebrochen war. Kurzerhand bückte sie sich und begann, die verstreuten Papiere aufzusammeln. Sie legte die Seiten ordentlich aufeinander, packte sie in die Kladde zurück und platzierte diese neben der Schreibmaschine. Als sie sich wieder umwandte, waren die Blicke der Frauen auf sie gerichtet.
«Und was bringt uns zu so später Stunde die Ehre Ihres Besuchs?», fragte die Ältere hinter dem Schreibtisch.
«Ich will Anzeige erstatten.»
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Dann brach die Frau in Gelächter aus.
Paula fühlte eine seltsame Erregung in sich aufsteigen. Diese beiden arbeiteten offenbar für die Polizei. Dunkel erinnerte sie sich, dass sie auf einer Abendgesellschaft ihrer Mutter von einer Weiblichen Kriminalpolizei gehört hatte, die vor einigen Monaten ins Stadthaus eingezogen sein sollte. Ein Skandal, den man aber dulden müsse, weil einflussreiche Männer, deren Namen Paula nichts sagten, sich für diese neue Abteilung eingesetzt hätten. Das mussten sie sein, die mutigen Kriminalinspektorinnen, die sich gegen das Verbrechen stellten.
Es gab Momente, die nach Entscheidungen verlangten. Paula angelte sich ein Formular vom Schreibmaschinentisch der Polizistin, schnappte sich einen Bleistift und begann, auf die leere Rückseite zu zeichnen. Die Handarbeitslehrerinnen am Lyzeum hatten sich stets über ihre zwei linken Hände beklagt. Häkeln, stricken, sticken, das kriegte Paula nicht hin. Hatte sie auch keine Lust zu. Aber wenn man ihr einen Stift in die Hände drückte, war sie in ihrem Element.
Mit entschiedenen Strichen warf sie die Konturen der eifersüchtigen Heilsarmeesoldatin auf das Papier. Sie hielt kurz inne, um sich die Form der Lippen in Erinnerung zu rufen, setzte die mandelförmigen Augen ein, dann folgten mit zarten Strichen die Wangenkonturen … ein kleines Muttermal seitlich des linken Ohres war ihr aufgefallen … die Haare …
Als Paula fertig war, schob sie das Blatt über den Schreibtisch. Die Frau im Kostüm nahm es entgegen. Sie zog die Augenbrauen zusammen und reichte das Papier an die Kollegin mit dem Schlips weiter.
Diese stieß einen leisen Pfiff aus. «Ist das die Frau, über die Sie sich beschweren wollen?» Ihre Stimme war dunkel und kühl.
Paula nickte.
«Wie heißt sie denn?»
«Weiß ich nicht. Ich habe sie nur zweimal kurz gesehen. Einmal im Fiasko, das ist …» Gut, das brauchte sie wohl nicht zu erklären. Sicher kannten die Kämpferinnen gegen das Verbrechen sich auf St. Pauli aus. «Sie hat dort in einer Uniform der Heilsarmee Geld gesammelt. Später wurde ich Zeugin, wie sie eine Kellerkneipe aufsuchte, in der sie vorhin auch festgenommen wurde. Die Frau sammelt garantiert nicht im Auftrag der Heilsarmee. Sie ist eine Betrügerin.» Paula schnappte sich ein zweites Blatt. Auch den widerlichen Galan der Frau bannte sie aufs Papier. «Ich vermute, dass sie für diesen Mann tätig ist.»
Die Frauen starrten auf die Zeichnung.
«Erich Stöver und seine Gerlinde. Sieh einer an!», murmelte die ältere der beiden, die offenbar den höheren Rang bekleidete. «Und was treibt Sie dazu, die beiden anzuschwärzen?»
«Ist das nicht Bürgerpflicht?»
«Eine Bürgerpflicht, die Sie …», ein Blick auf die Wanduhr über der Tür, «nachts um halb eins ins Polizeipräsidium treibt?»
Im Flur war es still geworden. Es schien auch niemand nach Paula zu suchen. Sehr gut. Wenn man sie hier aus dem Zimmer warf, konnte sie mit ein bisschen Glück das Stadthaus unbehelligt verlassen.
Die Frau mit der Krawatte deutete auf Paulas Gesicht. «Unangenehme Begegnung gehabt?»
Paulas tastete nach ihrer Wange und spürte eine Schürfwunde. «Kann man so sagen», entgegnete sie wortkarg. Ihre Hoffnung sank wieder.
«Dann waren Sie möglicherweise Teil der kleinen Gesellschaft, die gerade von unseren Kollegen mit einem Bett für die Nacht versorgt wird?»
Paula begann zu ahnen, dass man in diesem Gebäude, wo das Aufdecken von Lügen zum Tagesgeschäft gehörte, durch die Wahrheit am ehesten überzeugen konnte. Also schilderte sie, wie sie mit Walter im Fiasko gewesen war, wie sie das Lokal ohne ihn verlassen hatte und dann in dieses …
«Razzia», erläuterte die Frau hinterm Schreibtisch. «Man nennt es Razzia.»
Wie sie also in diese Razzia geraten und anschließend hier gelandet war. Sie ließ auch Erichs widerliche Küsse nicht aus.
«Und nun wollen Sie, dass wir ihn und Gerlinde drankriegen.»
Paula stutzte. War daran etwas verkehrt? Es hörte sich so an, auch in ihren eigenen Ohren. Ein wohlhabendes Mädchen will einer armen Göre, die sich mit ein paar Tricks durchs Leben schlägt, das Wasser abgraben.
«Die beiden sind mir ziemlich egal», brach es aus ihr heraus. «Ich habe aber keine Lust, die Nacht in einer Zelle zu verbringen, darum stehe ich hier. Das Zuhören liegt Ihren Kollegen leider nicht besonders. Außerdem …» Ihr Blick wanderte zu dem Schreibtisch in der Ecke. Dann sagte sie etwas, das sie selbst wohl am meisten überraschte: «Ich bin Sekretärin. Ich arbeite in der Bootsmanufaktur Borgmeister, drüben am Schaarsteinweg, schon seit zwei Jahren. Ich kann telefonieren, organisieren, stenographieren, tippen … Alles also, was man von einer guten Kraft erwartet.» Sie gab sich einen Ruck. «Kann es sein, dass hier gerade eine Stelle frei geworden ist?»
Die Frau hinter dem Schreibtisch brach erneut in Gelächter aus.
2. Kapitel
Schweißgebadet grub Waldemar Moor sich aus seinen Kissen. Albträume waren sein Fluch, immer schon gewesen. Gewöhnlich trieften sie von Gewalt, es wurde darin gedroschen, gestochen und gewürgt, was das Zeug hielt. Aber das Schlimmste war das hassenswerte Kreischen der Weiber! Sein Kopf dröhnte davon, auch jetzt. Teufel noch mal, wo hatten die bloß ihre Stimmen her!
Stöhnend kam er auf die Füße und torkelte zu der Waschschüssel mit dem blauen Porzellanrand. Er hatte sie vor dem Schlafengehen mit kaltem Wasser gefüllt, das tat er immer. Hastig schaufelte er sich das kühle Nass ins Gesicht. Raus mit dem Dreck aus seinem Kopf! Er schöpfte mit beiden Händen, das Wasser lief ihm Brust und Bauch hinab und sammelte sich um seine nackten Füße. Die Stimme, die in seinem Schädel tönte, wurde leiser, aber ganz verstummen …
Abrupt hob Moor den Kopf und starrte auf sein Spiegelbild in dem silbernen Rahmen. Nee, er hatte gar nicht von Weibern geträumt, ging ihm plötzlich auf. Sondern von Jonny. Der kleine Jonny war durch seinen Traum gegeistert. Ihm hatte auch diese schrille Stimme gehört. Moors Mund wurde trocken, als blitzartig die Erinnerung zurückkehrte. Sein Jonny war ins Hafenbecken gefallen, er zappelte im Wasser, er schrie und gurgelte …
Das wäre ja auch fast mal wirklich passiert. Jonnys Mutter, das Dreckstück, hatte nicht richtig auf ihn aufgepasst. Die ließ ihn einfach am Elbe-Kai laufen. Hundert Schritte voraus, was ihr jede Chance nahm, ihn zu retten, wenn er über die Kante zu fallen drohte – wobei sie ohnehin nicht schwimmen konnte. Moor hatte das Ganze zufällig bemerkt, als er die breite Treppe zu den Landungsbrücken hinabstieg, auf der Suche nach den beiden. «Zwei Jahre! Der ist zu lütt», hatte er hinuntergebrüllt. Wie konnte sie den kleinen Bengel einfach …
Als Moor sich umdrehte, prallte er gegen die Tür seines Kleiderschranks. Das brachte ihn zur Besinnung. Die Annemie war weg, dafür hatte er ja gesorgt, gleich nach dem dämlichen Hafenspaziergang. Jetzt hütete Edith seinen Sohn. Auf die konnte er sich verlassen, sie war zuverlässig wie der Sonnenaufgang. Er hatte mit ihr eine Art Vertrag geschlossen. Dafür, dass sie tagsüber auf Jonny aufpasste, musste sie abends erst gegen zehn zum Busenwackeln auf die Bühne, und danach brauchte sie auch keinen Kunden mehr anzunehmen. Das waren ihre Bedingungen gewesen, und ihm war’s die Sache wert. Sein kleiner Sohn war wie ein Stück von seinem Herzen.
Moor ging über den Flur zu dem Badezimmer, das er sich vor Jahren geleistet hatte. Damals war sein Laden noch gut gelaufen. Direkt nach Kriegsende waren die Deutschen wie besessen davon gewesen, ein Stückchen Glück zu ergattern, und sei’s nur für ein paar Stunden in einem Puff. Sogar die Kriegsversehrten hatten ihm die Bude eingerannt, und er hatte eigens einige Zimmer für sie herrichten lassen, mit besonders hohen Betten. Das Tingeltangel war berühmt geworden für das Gespür der Mädels, wie man sich von einem Krüppel rannehmen ließ. Aber dann war die Inflation gekommen, die Aktien, die er sich gekauft hatte, waren ihr Papier nicht mehr wert gewesen, und inzwischen kniff es an allen Enden. Der Dreckskerl von der Bank, bei der er ein Darlehen für das Tingeltangel laufen hatte, rückte ihm fast wöchentlich auf die Pelle.
Moor verscheuchte die unangenehmen Gedanken. Er erledigte sein Geschäft, kehrte in sein Zimmer zurück und begann, sich anzukleiden. Im Spiegel fiel ihm ein Kratzer unter seinem linken Auge auf. Wann hatte er sich den denn eingefangen? Er hatte keinen blassen Schimmer. Zu viel gesoffen, dachte er müde und fuhr sich über den schwarzen Schnurrbart. Das war in letzter Zeit sein Dilemma. Sobald es sich anbot, griff er zur Flasche. Er musste aufpassen.
Der Chef des Kleingartenvereins Immergrün hatte ihm das letztens auch unter die Nase gerieben. «Wenn du so weitersäufst, bist du für uns nicht mehr zuverlässig genug. Ich sag’s dir im Guten.»
Solche Sätze stellten, auch wenn sie dreimal im Guten gesagt wurden, eine Drohung dar, darüber war Moor sich im Klaren. Das Immergrün war einer der mächtigsten Hamburger Ringvereine. Es mischte im Drogenhandel mit und bestimmte, wer an welchen Stellen die Puffkunden abgreifen durfte. Es war für seinen Laden überlebenswichtig, dass er dort Mitglied war.
Er zog sich die Hose über den Hintern und die Hosenträger auf die Schultern. Dann griff er zum Jackett, denn er legte Wert darauf, gut gekleidet zu sein. Gehörte zum Renommee und machte ihm außerdem Spaß. Als er zur letzten Musterung vor den Spiegel trat, fiel ihm wieder der Kratzer auf. Solche Verletzungen stammten von Frauen. Männer verpassten einander ein blaues Auge oder brachen die Nase. Ein paar besonders Harte stießen auch die Finger in die Augen. Aber kratzen … Moor durchwühlte sein Gedächtnis. Vergebens. Der Suff hatte die verdammten letzten Stunden wegradiert. Er musste sich wirklich zusammenreißen.
Mürrisch trat er in den Flur und stieg die Treppen hinab. Als sein Blick auf die mit Goldfarbe bemalten Wandleuchter fiel, die er entlang der Treppenstufen angebracht hatte, gestattete er sich trotz seines teuflischen Kopfwehs ein Lächeln. Annemie hatte die gekauft, als sie noch lebte, und sie hatte auch die Holzgeländer goldgelb streichen lassen. Sah gediegen aus, da hatte sie ein Händchen für gehabt.
Das kurze Glücksgefühl erlosch jedoch, als Moor die Bar betrat. Fredi war dabei, die Tische abzuwischen. Er hatte das Grammophon angestellt und tänzelte mit seinem nassen Lappen rum wie … wie eine Klosettfliege, dachte Moor, und ihn packte der übliche Groll, wenn es um seinen älteren Sohn ging. Der Trottel machte ihn rasend. Er war zwölf Jahre alt, benahm sich aber wie ein Kleinkind. Mit ein paar raschen Schritten war Moor bei ihm und knallte ihm eine. Fredi stolperte, in seinen Augen flackerte es kurz, aber dann riss er sich zusammen und begann, wie ein Verrückter zu wischen. Sogar zum Aufmucken fehlte ihm der Mumm. Gut, dass Jonny aus anderem Holz geschnitzt war!
«Wo steckt der Kleine?»
«Der ist doch mit Edith raus», flüsterte Fredi.
«Hm!» Moor warf einen Blick auf seine Taschenuhr. Halb sieben. Gegen acht kamen die ersten Gäste. «In einer Stunde blitzt es hier. Ist das klar?» Er hieb eine Faust auf den Tresen. «Was hab ich gesagt?»
«In einer Stunde blitzt es», echote Fredi und schrubbte wie besessen über das Holz.
Moor nickte brummend. Er schielte zu der verspiegelten Wand der Bar, von wo ihn die Ginflaschen verheißungsvoll anblitzten, aber der Jonny ging vor. Was, wenn er sich im Zoo verlaufen hatte?
Im Zoo?
Na, endlich blitzte mal was Konkretes in seinem zugekleisterten Schädel auf. Edith hatte mit dem Kleinen zum Zoologischen Garten fahren wollen, genau. Das hatte sie gesagt. Sein Junge war ganz wild auf die Tiere. Besonders die Affen hatten es ihm angetan. Natürlich auch das Raubtiergehege, aber bei den Affen quiekte er immer vor Vergnügen. Moor beschloss, eine Spritztour zu machen. Sein roter Quadrilette parkte an der Straße. Die Karre hatte er sich trotz seiner Geldnöte im vergangenen Herbst geleistet. Irgendwann musste man sich schließlich auch mal was gönnen. Vorsichtig wegen der Kopfschmerzen, schob er sich hinters Steuer.
Die Strecke zum Zoologischen Garten war kurz, er lag direkt beim Dammtor-Bahnhof, gegenüber vom Botanischen Garten. Als Moor das Auto parkte, sah er, dass die Leute bereits aus dem Haupteingang strömten. Das Kassenhäuschen war leer, aber einer der Zoowärter, der daneben die Stellung hielt, rief ihm etwas zu, wahrscheinlich, dass keine Besucher mehr reindürften. Moor achtete nicht darauf. Hastig eilte er an den Hirschgehegen vorbei. In der Raubvogelvoliere krakeelten die Habichte und Falken. Eine Frau keifte ihre Kinder an, die sich nicht zum Ausgang zerren lassen wollten. Los, rüber zum Affenhaus.
Als Moor das Gebäude mit den geräumigen Käfiganlagen betrat, schlug ihm der typische Tiergeruch entgegen. Er lief durch die Gänge und rief nach Jonny. Keine Antwort. Stattdessen tauchte ein weiterer Zoowärter auf und forderte ihn auf, sich zum Ausgang zu begeben.
Moor stand wieder im Freien – und kam sich plötzlich wie ein Idiot vor. Hatte Edith wirklich mit seinem Jungen hierhergewollt? Er begann, an seiner Erinnerung zu zweifeln. Er hatte ja gar keine. Gereizt rieb er mit den Fingerkuppen über die immer noch schmerzenden Schläfen.
Die Wärter wurden rabiat, sie wollten in den Feierabend und trieben die Bummler Richtung Tor. Aber Moor, der es hasste, wenn man ihm Vorschriften machte, bog hinter dem Affenhaus auf einen Nebenweg ab und strebte in die entgegengesetzte Richtung, wo es noch einen weiteren, kleineren Ausgang gab. Was natürlich blödsinnig war. Wenn Edith und Jonny den Zoo besucht hatten, hätten sie das große Tor genommen, weil sich dort die Haltestelle der Tram befand. Trotzdem ging er weiter, vorbei am Konzertplatz und dem Elefantengehege, wo ein dicker Idiot gereizt zum Ausgang deutete. Als er den Bürgersteig der Rentzelstraße erreichte, blieb er stehen. Warum, verfluchte Scheiße, war er nur so nervös? Das passte doch gar nicht zu ihm.
Moor trottete unter den Kastanien entlang und bog in die Jungiusstraße ab. Hier lag, dem Zoo gegenüber, der alte Friedhof, den sie vor knapp zwanzig Jahren geschlossen hatten, weil er die Toten nicht mehr fasste. Er schritt an der Außermauer entlang, bis er ein flaches Gebäude mit einem gewölbten Eingangstor unter einer Kuppel erreichte. Unruhig blieb er stehen. Er war hier mal mit Edith und Jonny zusammen reingegangen. Dunkel erinnerte er sich an eine Kapelle mit zwei Ausgängen rechts und links, die auf den eigentlichen Friedhof führten. Edith hatte sie zu einem Grab geführt, in dem ihr einziges Kind bestattet worden war, das sie in jungen Jahren geboren und kurz nach der Geburt wieder verloren hatte. Jonny war in Tränen ausgebrochen, als er begriff, dass man in der grauen Erde ein Baby eingebuddelt hatte, und Moor hatte Edith angeblafft, dass sie sein Bengelchen nicht mit traurigen Geschichten verstören solle.
Mit einem Mal begann sein Herz zu wummern. Was, wenn Edith den Jonny erneut auf den Friedhof mitgeschleift hatte? Weiber schossen doch immer quer. Die hielten sich an keine Regeln, wenn man sie nicht Auge behielt. Von seiner Unruhe getrieben, öffnete er das Tor. In dem kreisrunden Andachtsraum hatten es sich die Obdachlosen aus der Stadt gemütlich gemacht. An den Wänden lagen Strohsäcke und in den Ecken Lumpen. Doch noch waren die Herumtreiber nicht zurückgekehrt. Die bettelten in den Hauptstraßen, bis die Sonne unterging.
Er durchquerte den Raum und verließ ihn durch eines der Seitentore. Langsam schritt er den Hauptweg entlang, der von alten Bäumen gesäumt wurde. Die Gräber – fast alle voller Unkraut – reihten sich aneinander. Einzelgräber, Sammelgräber, Gruften. Auf einem moosbesetzten weißen Gefäß entzifferte er den Schriftzug Gertrudenvase – was auch immer das bedeuten mochte. Es dämmerte bereits. Der Anblick der Gräber schlug ihm aufs Gemüt. Was tat er hier eigentlich? Er sollte nach Hause fahren. Sicher wartete sein Junge dort bereits auf ihn. Und doch konnte er sich nicht losreißen. Eine Angst, die er selbst nicht begriff, trieb ihn weiter.
«Jonny?»
Hörte er ein leises Weinen? Oder war das Einbildung? Moor blickte zu einer zweiten, kleineren Kapelle, die sich seitlich an eine der Friedhofsmauern schmiegte. Kam das Geräusch von dort? Jedenfalls stand die Tür einen Spalt weit offen. Zögernd ging er auf das verfallende Gemäuer zu und zog die Tür ganz auf. Im Dachgebälk fehlten etliche Ziegel, sodass die verblassende Abendsonne helle Flecken in den Raum warf. Rechts von der Tür entdeckte er den ehemaligen Altar. Dahinter erhob sich eine überlebensgroße Figur aus Pappmaché. Sie stellte einen schwarzen Mann mit einem kriegerisch ausgestreckten Arm dar. Doch sein Blick wurde sofort abgelenkt und von etwas Weißlichem angezogen, das vor dem Altar lag. Eine … Gott, da lag eine nackte Frau.
Er trat näher und stierte entsetzt auf ihren Leib, in dem von der Brust bis zur Scham ein langer, blutiger Schnitt klaffte. Blut bedeckte den Fliesenboden, auf dem sie lag. Er blickte in ihr Gesicht. Und hörte jemanden schreien.
Sich selbst.
Außer sich vor Angst brüllte er Jonnys Namen.
3. Kapitel
Dann erfolgte die Diagnose nach Angaben der Verhörten durch eine von ihr vorgenommene Untersuchung der Nackenhaare. Minna Engholm zeigte eine Lupe vor (etwa anderthalbfache Vergrößerung), die sie zur Betrachtung der Haare verwendete und mit deren Hilfe es ihr angeblich möglich gewesen sein soll …
Paula unterdrückte ein Gähnen. Ihr Blick ging zur Uhr über der Tür. Schon fast neun. Sie hatte seit vier Stunden Feierabend. Aber die Abschrift des Verhörs musste noch fertig werden, das Gericht wollte die Seiten morgen früh vorliegen haben. Und würde sie auch bekommen. Paula war ehrgeizig, alles, was in ihren Händen lag, sollte glatt laufen.
Josefine Erkens, die Leiterin der Weiblichen Kriminalpolizei, hatte sie tatsächlich eingestellt, nachdem Paulas Vorgängerin – der Name M. Fleischmann prangte noch auf einer hölzernen Kiste mit Farbbändern – am Abend der fliegenden Kladde gekündigt hatte. «Persönliche Zimperlichkeiten», hatte Frau Erkens schmallippig erklärt, als Paula vorsichtig nach der Ursache der Kündigung fragte. Und sie selbst für den nächsten Tag zu einem Vorstellungsgespräch einbestellt. Paula hatte ein Diktat mitstenographieren und es unter den kritischen Blicken der Kriminaloberinspektorin und der Krawattenmadame abtippen müssen. Da war sie schnell und routiniert gewesen. Kein Problem.
Außerdem hatte man weitere Zeichnungen von ihr verlangt. Josefine Erkens hatte sie einen ganzen Tag lang in ihrem Büro sitzen und von jeder Person, die den Raum betrat, eine Bleistiftskizze machen lassen. Nach vielen kritischen Blicken war die Entscheidung gefallen. «Wir nehmen Sie. Sie werden für die WKP als Sekretärin arbeiten – und so etwas wie unsere Kamera sein.»
Besaßen sie denn keine? Egal, Paula fragte nicht weiter nach. Hauptsache, sie konnte das langweilige Borgmeister-Büro gegen das brodelnde Leben im Kriminalkommissariat tauschen. Was für ein unfassbares Glück! Ein Glück, das auch jetzt, nach drei Monaten, noch anhielt.
Inzwischen hatte sie übrigens herausgefunden, dass sich auf dem Dachboden ein komplettes Atelier befand. Ein Polizeifotograf nahm dort Fotos von Verdächtigen und überführten Straftätern auf, und zwar immer nach demselben Schema: eins von vorn, eins von jeder Seite. Anschließend wurden auf derselben Etage die Fingerabdrücke abgenommen, besondere Auffälligkeiten notiert und alles Wissenswerte inklusive der bereits begangenen Straftaten auf Karteikarten niedergeschrieben. Die Schränke, in denen diese Karteikarten aufbewahrt wurden, standen in Reihen hintereinander quer in der rechten Hälfte eines riesigen Raums. In der anderen Hälfte des Raums saßen ein halbes Dutzend Frauen, die von morgens bis abends die Karten durchgingen, um aktuelle Verbrechen mit früheren zu vergleichen und Verdächtige herauszufiltern.
«Und das funktioniert blendend», hatte Alice Dornapfel, eine der Kriminalassistentinnen der WKP, erklärt. Sie hatte Paula in der vergangenen Woche einen Blick ins Atelier werfen lassen. «Dich hat Frau Erkens auch nicht wegen deiner Fertigkeiten an der Schreibmaschine eingestellt – es ist einfach gut, wenn sich jemand die Gesichter von Zeugen und anderen Besuchern merken und brauchbare Skizzen anfertigen kann.»
Paula gähnte. Sie starrte auf das Blatt, das aus der Mercedes-Elektra ragte. Ihre Augen brannten. Aber jetzt nicht weiter trödeln. Die letzten Sätze in die Tasten hauen und dann endlich nach Hause und ins Bett!
… möglich gewesen sein soll, zahlreiche Krankheiten zu erkennen und zu behandeln. Außerdem benutze sie Sympathie zum Kurieren vor allem der inneren Leiden ihrer Patientin … tippte sie. Sympathie! Diese Frau war wirklich meschugge. Eine Lupe und Sympathie! Aber die Kranken, die ihr die Bude einrannten, hatten ja auch nicht alle Tassen im Schrank. Sie verschreibe zudem Medikamente nach eigener Rezeptur, die ihre Patienten sich aus der Apotheke …
Draußen im Flur wurden plötzlich Schritte laut. Die Tür flog auf, und Caroline Wagner, die Kommissarin mit der Krawatte, die Paula in ihrer ersten Nacht im Stadthaus kennengelernt hatte, stürmte ins Zimmer. Ihr Gesicht hellte sich auf, als sie sie erblickte. «Na, wenigstens einmal Glück. Los, ich brauche Sie!»
«Wofür?»
«Mord! Auf dem alten Friedhof beim Zoo wurde jemand umgebracht! Und die Tippse, die sonst immer mitkommt, geht nicht ans Telefon.»
Das war noch so etwas, was bei der Kripo aufregend war: Jedem, der dort in bedeutsamer Funktion arbeitete, wurde ein eigenes Telefon gestellt, damit er im Fall des Falles erreichbar war. Ihr selbst leider nicht – ihr Dienst beschränkte sich ja auf die acht Stunden tippen täglich, für die sie eingestellt worden war. Aber jetzt war die Gelegenheit, einmal in eine echte Ermittlung hineinzuschauen. Natürlich würde sie die ergreifen.
Minuten später saßen sie im Auto, einer schäbigen, dunkelgrünen Karre mit Kratzern und Beulen. Sicher der Privatwagen von der Wagner, dachte Paula. Traute man den weiblichen Kommissaren das Steuern eines Dienstautos nicht zu? Oder war es einfach üblich, dass die Beamten gelegentlich ihre eigenen Fahrzeuge benutzten? Paula schluckte die Frage herunter. Nur nicht die eigene Unwissenheit zur Schau stellen.
Ihre Kollegin lenkte den Wagen in rasantem Tempo durch den Tortunnel auf die Stadthaus-Brücke.
Der Friedhof beim Zoo … Paula kannte den Ort nur aus der Zeitung. Gelegentlich wurde darüber berichtet, dass er von Obdachlosen okkupiert worden war. Viele Hamburger empörten sich darüber, andere, besonders die Sozialisten, gönnten den armen Teufeln den regengeschützten Unterschlupf in kalten Nächten. Paula neigte den Sozialisten zu.
Trotz ihres beachtlichen Tempos und der quietschenden Reifen begann Caroline Wagner, Informationen abzuspulen. «Die Männer der A1 sind vor Ort. Ich hab’s aus der Zentrale. Sie wollen uns aber todsicher nicht dabeihaben. Nur lassen wir uns dieses Mal nicht abwimmeln. Das vorab. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Frau, wir sind also zuständig.»
Die A1 war die Kriminalinspektion für die richtig heiklen Sachen. Mord, schwerer Raub, Erpressung, Vermisstenzentrale … Dass man den Frauen von der WKP nichts zutraute, diese Überzeugung teilte man dort aber wohl mit sämtlichen Kollegen. Paula sah oft genug, wie hinter dem Rücken der Kommissarinnen Augen verdreht wurden.
«Und was machen wir, Frau Wagner, wenn …»
«Sag Caro zu mir.»
Einen Moment verschlug es Paula die Sprache. Sie duzte sich inzwischen mit den meisten Frauen der WKP, aber die Wagner hatte bisher für Distanz gesorgt. Einmal hatte Paula von ihr wissen wollen, wie man Kriminalassistentin wurde. Tippen war ja gut und schön – doch inzwischen wurde sie von einem wahren Fieber erfasst, wenn sie den Spekulationen über die Täter und Hintergründe der Straftaten lauschte. Die Kommissarinnen, die vor allem bei Jugendstraftaten und Fällen von Gewalt gegen Jugendliche, Kinder und Frauen eingesetzt wurden, mussten nicht nur klar kombinieren können, sondern auch brutalen Kerlen kalt in die Augen sehen. Das wollte sie ebenfalls tun, inzwischen mit ganzer Seele. «Die Stellen sind alle besetzt», war die kühle Antwort gewesen.
Geriet diese Mauer gerade ins Wanken? Caroline Wagner, beziehungsweise jetzt: Caro, galt als engste Vertraute von Josefine Erkens. Wenn sie Paula zu einem Mordfall mitnahm und ihr auch noch das Du anbot – konnte man daraus schließen, dass sie und die Erkens ihre informelle Bewerbung doch in Erwägung zogen? Oder ging es tatsächlich nur ums Protokollieren?
«Ich heiße Paula. Was machen wir, wenn die Kollegen sich weigern, uns durchzulassen?»
«Glaubst du, die schmeißen sich auf uns?»
Also einfach durchmarschieren! Paula lächelte.
Minuten später hatten sie den Friedhof erreicht. Caro hielt mit quietschenden Reifen, dann ließ sie den Wagen wieder anrollen. Die Autos der Mordkommission waren direkt aufs Friedhofsgelände gefahren, sie zögerte nicht, es ihnen gleichzutun. Auf dem engen Weg schrammte der Wagen an Grabsteinen und einigen Eisenketten entlang, die die größeren Gemeinschaftsgräber umgaben, bis sie vor einer kleinen Kapelle bremste.
Die Männer der A1 hatten ihre Autos direkt vor dem Eingang geparkt. Auch das sogenannte Mordauto. Es handelte sich dabei um eine Spezialausfertigung – ein geräumiger Wagen mit viel Platz für Kameras, Stative und Kisten voller Technik … Angeblich gab es sogar einen Klapptisch und eine Reiseschreibmaschine darin, für die Sekretärin, die das, was den Kommissaren bei der ersten Tatortbegehung auffiel, direkt in die Maschine tippen musste – die Frau, die Paula heute Abend ersetzen sollte.
Neben dem Mordauto parkten der grüne Opel des Polizeiarztes und zwei schwarze Dienstwagen. Die Scheinwerfer aller Fahrzeuge waren auf die offene Tür der Kapelle gerichtet. Von den Kriminalbeamten selbst war keiner zu sehen, nur ein Schupo hielt neben der Tür Wache.
Als sie ausstiegen, entdeckte Paula ein Stück weit entfernt auch noch einen roten Peugeot, an dem ein Mann mit einer Schiebermütze lehnte.
«Das ist Kalkhoff», murmelte Caro, die ihrem Blick gefolgt war. Kalkhoff war eine präsidiumsbekannte Nervensäge vom Hamburger Fremdenblatt, sogar Paula hatte schon von ihm gehört. Angeblich tauchte er sensationsheischend bei jedem Tatort auf. Es wurde gemunkelt, dass er jemanden im Stadthaus bestochen hatte, der ihn informierte, oft genug noch vor den zuständigen Beamten. Ganz schön dreist, wie ungeniert er sich hier herumtrieb.
«Wir werden den Kollegen sagen, dass du das Protokoll schreiben wirst», erinnerte Caro an ihre Strategie.
Paula schnappte sich ihre Handtasche, in der sich ein Stift und ein Block befanden, für den Fall, dass die Sache mit der Reiseschreibmaschine und dem Tisch nicht stimmte. Gemeinsam gingen sie die wenigen Schritte zur Kapelle. Nachtvögel stießen über ihnen in den Baumwipfeln schrille Rufe aus, aus dem baufälligen Gemäuer selbst drangen gedämpfte Stimmen.
An der Eingangstür wurden sie von dem Schupo aufgehalten, der dort eine Zigarette paffte – was ihm umgehend einen Rüffel von Caro einbrachte. «Der Erkennungsdienst wird hier alles aufsammeln, und Kippen besonders gern. Schon davon gehört?», blaffte sie. «Keine falschen Spuren legen, verdammt!»
«Spuren, ja?» Beleidigt trat der Mann seine Fluppe aus und ließ den Stummel unter Caros strengen Blicken in der Hosentasche verschwinden. Nicht gut, dachte Paula. Sie wusste, dass die Schutzpolizisten oft die Ersten am Tatort waren und außerdem nah dran am Volk. Falls dem Mann irgendetwas aufgefallen war, würde er es Caro garantiert nicht mehr auf die Nase binden. Die Kollegin war scharfsinnig, aber sich in Leute hineinzufühlen, lag ihr nicht.
Recht hatte sie aber natürlich trotzdem. Die Polizeiarbeit hatte sich rasant gewandelt, das hatte Paula schon oft von Josefine Erkens gehört. Man ging jetzt, besonders an den Tatorten, methodisch vor. Die Kommissariate besaßen einen eigenen Erkennungsdienst, der nach Fingerabdrücken, Fußspuren und anderen Beweisen suchte und alles genau dokumentierte und aufbewahrte. Später im Kommissariat wurden sämtliche Hinweise – natürlich auch die, die später noch hinzukamen – in Form von Fotos und Pappkarten an große Korktafeln geheftet, und rote Bindfäden zeigten Zusammenhänge auf. Wie bei einem Puzzle versuchten die Kommissare, ihr Wissen zu einem stimmigen Bild zusammenzufügen. Angeblich hatten sie dieses Vorgehen aus Berlin übernommen, wo der Gott der Verbrechensaufklärung namens Ernst Gennat die Polizeiarbeit auf höchstes Niveau gebracht hatte. Leider schienen seine Methoden sich bei der Schutzpolizei noch nicht herumgesprochen zu haben.
Sie wollten weiter, aber jetzt stellte sich ihnen der Mann mit der Schiebermütze und einem anbiedernden Grinsen in den Weg. Der Journalist versuchte es mit Charme. «Hab gehört, jemand hat hier eine Frau aufgeschnitten? Mann, tut einem das leid. Was genau ist denn …»
«Verschwinden Sie, Kalkhoff. Sie stören!», schnauzte Caro.
Mit einer übertriebenen Verneigung gab der Mann den Weg frei.
Da der Kapelle Teile des Dachs fehlten, leuchtete der Mond in das Gemäuer. Die Autoscheinwerfer taten ein Übriges, den Tatort zu erhellen. Paula fiel als Erstes ein Klapptisch auf, der sich an der Seite des Raums befand und mit einem Sammelsurium aus Pinseln, Pinzetten, Zollstöcken und Handschuhen bedeckt war.
Die Techniker fotografierten und leuchteten Ecken aus, die Kommissare hielten Abstand, um keine eigenen Spuren zu fabrizieren. Dr. Schuppe, der Polizeiarzt, kniete hinter dem Tisch auf dem Boden. Paula wurde von jemandem angerempelt und beiseite gedrängt – es war einer der Kommissare, sie kannte sein Gesicht, aber nicht den Namen. Caro war längst auf einen der männlichen Kollegen zugetreten und stellte Fragen.
Während Paula wartete, dass jemand sie zum Protokollieren rief, fiel ihr eine mannshohe Pappfigur auf, die hinter dem Altar stand und einen Afrikaner darstellte. Vermutlich stammte das Ding aus dem Zoo gegenüber, wo es als Werbung für eine der beliebten Völkerschauen gedient hatte. Da die Techniker dort offenbar schon durch waren, umrundete sie den Altar und stellte sich neben die Figur. Dabei gelang es ihr, einen Blick auf die Leiche zu werfen.
Sie musste schlucken. Der Mörder hatte seinem Opfer das Kleid bis zur Brust hochgeschoben. Alles, was nicht unter dem Kranz aus Stoff lag, war nackt. Und nicht nur das: Jemand hatte die Frau von der Scham über den Bauchnabel bis zur Brust aufgeschnitten. Haut und Fleisch klafften breit auseinander. In einer blutverschmierten Metallkiste neben dem Leichnam, die wohl vom Erkennungsdienst stammte, lagen Fleischteile. Organe, dachte Paula. Der Dreckskerl hatte die arme Frau wie ein Schlachtschwein ausgeweidet. Offenbar hatte er ihr die Eingeweide wie eine breite Kette um den Hals gelegt – davon zeugte der blutdurchtränkte Stoff ihres Blusenkragens. Auch die linke Ohrmuschel hatte er ihr abgetrennt.
Paula kämpfte gegen den Brechreiz an und wollte sich gerade abwenden, da spürte sie Schuppes Blick auf sich. Der Arzt hatte sich erhoben und zog mit einem spöttischen Lächeln seine Handschuhe aus. Sie riss sich zusammen und zückte scheinbar unbeeindruckt Block und Bleistift.
Am Tatort gab es eine geordnete Abfolge, nach der vorgegangen wurde. Auch das hatte Alice ihr verraten. Paula hatte sie sich gemerkt.
Zum Ersten: Allgemeiner Überblick. Dieser Punkt war bereits erledigt.
Im zweiten Schritt wurden alle vorhandenen Spuren mit Hilfe kleiner nummerierter Dreiecke kenntlich gemacht. Das war ebenfalls geschehen. Viel hatte man aber wohl nicht gefunden, denn Paula entdeckte nur eine Handvoll der gelben Dinger auf dem Boden.
Drittens …
Paula wurde durch Caro abgelenkt, die immer noch mit dem leitenden Kommissar sprach, wobei der Mann jetzt lauter wurde und zunehmend gereizt wirkte. Martin Broder, sie erinnerte sich an den Namen. Ein Mann um die dreißig, dunkle Augen, dunkle Haare, Anflüge von Geheimratsecken, äußerlich ruhig, doch in seinen Mundwinkeln saß … ja was? Zorn? Überdruss? Bitterkeit?
«Bin fertig», rief einer der Spurensicherer quer durch die Kapelle. «Ihr könnt jetzt die Bilder machen.»
Genau, Fotografieren – das war Schritt drei der vorgeschriebenen Abfolge.
Sein Kollege hatte die Kamera schon auf das Holzstativ montiert. Eine Ernostar. Paulas Vater hatte genau so ein Modell. Man konnte damit auch unter widrigsten Lichtverhältnissen brauchbare Fotos schießen. Kurz darauf erhellte das erste Blitzlicht die Kapelle.
Caro umrundete den Altar und gesellte sich zu Paula. «Ist eine echte Sauerei», murmelte sie und starrte auf die Tote. Dann rief sie in Broders Richtung: «Ich bilde mir ein, dass ich sie kenne. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo oder wann ich sie gesehen habe. Muss eine Weile her sein. Wahrscheinlich kommt sie aus dem Milieu.»
Aha. Paula legte den Block auf dem Altar ab und begann mit ihren Notizen.
Ein weiteres Blitzlicht leuchtete auf.
«Vielleicht ein Verbrechen aus Leidenschaft?», mutmaßte einer der Kommissare, ein rundlicher Typ mit Schirmmütze.
«Die wurde seziert, Volker», widersprach Dr. Schuppe müde. «Wenn’s um Leidenschaft geht, stichst du zu. Oder schlägst drauf. Aber das da drüben … Die Frau wurde regelrecht ausgeweidet. Systematisch, kalt.»
Das war wichtig. Paulas Stift flitzte übers Papier. Noch ein Blitzlicht und noch eines. Dann wurde eine Leiter über der Toten aufgestellt, damit man sie auch von oben ablichten konnte.
«Hat jemand etwas gefunden, das als Tatwaffe gedient haben könnte?», fragte Broder.
Niemand antwortete. Offenbar also nicht. Er wandte sich an Schuppe. «Glaubst du, sie ist schon tot gewesen, als der Täter …?» Er fuhr mit der Hand über seinen Hals.
«Ihr wurde die Kehle durchtrennt, tja, aber welche Verletzung zuerst da war … Ich muss sie auf meinem Tisch liegen haben.»
«Das war einer von auswärts», orakelte Schmidtke, ein älterer Kommissar, den Alice Paula einmal vorgestellt hatte, weil er früher bei der Sitte gearbeitet hatte und man sich deshalb kannte.
«Warum?», fragte Broder.
«Ist ’n Gefühl.»
«Sie werden nicht für Gefühle, sondern fürs Denken bezahlt!» Der Anpfiff kam nicht von Broder, sondern von einem Mann, der unvermittelt durch den Kappelleneingang getreten war. Es war Dr. Schlanbusch, der stellvertretende Polizeipräsident und direkte Vorgesetzte der Mordinspektion.