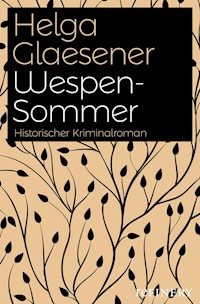
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Toskana-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Weil sie den von der Familie ausgewählten Mann nicht heiraten will, wird die junge Florentinerin Cecilia Barghini nach Montecatini verbannt. Sie soll bei dem streitbaren Richter Enzo Rossi als Gouvernante arbeiten. Doch in dem scheinbar so verschlafenen Ort lauern Gefahren: Ein Mord geschieht, ein Kind verschwindet. Cecilia und Enzo müssen trotz aller Gegensätze zusammenarbeiten, wenn sie den Mörder rechtzeitig fassen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Cecilia Barghini ist viel zu eigenwillig – das findet jedenfalls ihre strenge Großmutter. Obwohl ihre heimliche Affäre mit einem Theaterautor unglücklich endete, weigert sie sich, den von der Familie ausgewählten Mann zu heiraten. Im Florenz des Jahres 1780 ist Cecilia damit gesellschaftlich geächtet, sie wird aufs Land geschickt und soll dem verwitweten Richter Enzo Rossi bei der Erziehung seiner Tochter Dina beistehen. Gleich bei der Ankunft in dem malerischen Toskana-Städtchen Montecatini beschließt Cecilia, dass sie hier nicht bleiben will: Der Richter ist jähzornig, das Haus verwahrlost, Dina ein unerzogenes Gör. Da übernimmt Enzo Rossi die Ermittlungen in einem rätselhaften Mordfall, und Cecilia kann ihre Neugier nicht zügeln – wem in dem kleinen Ort wäre so viel Grausamkeit zuzutrauen? Ohne es zu wollen, wird Cecilia zur Detektivin; sie beschließt, zu bleiben und sich gegen den sturen Richter durchzusetzen. Doch dann verschwindet die kleine Dina, und Cecilia und Enzo müssen dem gefährlichen Mörder gemeinsam entgegentreten.
»Helga Glaesener ist eine von Deutschlands heimlichen Bestseller-Autorinnen.« Bild der Frau
Die Autorin
Helga Glaesener, 1955 geboren, hat Mathematik studiert, ist Mutter von fünf Kindern und lebt mit ihrer Familie in Aurich, Ostfriesland. Seit ihrem ersten Bestseller Die Safranhändlerin hat sie bei List zahlreiche historische Romane veröffentlicht.
In unserem Hause sind von Helga Glaesener bereits erschienen:
Du süße sanfte Mörderin · Die Rechenkünstlerin · Der singende Stein · Die Safranhändlerin · Safran für Venedig (nur als E-Book) · Weihnachtswolf (nur als E-Book) · Wer Asche hütet · Wölfe im Olivenhain (nur als E-Book)
Helga Glaesener
Wespensommer
Roman
List Taschenbuch
Neuausgabe bei Refinery
Refinery ist ein Digitalverlag
der Ullstein Buchverlage GmbH,
Berlin Juni 2018 (1)
© 2006 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
E-Book: LVD GmbH, Berlin
ISBN 978-3-96048-205-5
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
In necessariis unitas, in dubiis libertas,in omnibus autem caritas
Für Ingrid, Claudia und Regina,für Frank und Klaus,
in der Hoffnung auf noch viele gemeinsame Jahre.
Prolog
Florenz im Dezember 1779
Inghiramo Inghirami, Tragödiendichter und Schreiber von Opern- und Oratorienlibretti, trat vor das Portal des Teatro della Pergola. Es war halb fünf, und über Florenz brach eine frühe Nacht herein. Schneeflocken tanzten im Licht der Straßenlaternen wie eine himmlische Balletttruppe, die sich übermütig dem gestrengen göttlichen Blick entzogen hat. Sie wehten über die Gesimse, Giebel und Balustraden des gegenüberliegenden Ospedale Santa Maria Nuova und legten sich sammetweich auf den Rasen und die Büsche des krankenhauseigenen Gartens. Sie bestäubten die Götterfiguren, die dort standen, und bedeckten das bucklige Straßenpflaster. Verzaubert hob Inghiramo die Handflächen und ließ die kalten Sterne auf seiner Haut schmelzen. Er war glücklich. Cecilia würde kommen. Sie hatte ihm ein Billett geschickt und es versprochen.
Seinem sonst so zynischen Blick entging der von Syphilis gezeichnete Bettler, der in viel zu dünnen Lumpen unter einem Vordach des Ospedale zitterte und möglicherweise erfroren sein würde, bevor die Vorstellung im Teatro beendet war. Er sah auch die Frauen nicht, die an die Kutschen herantraten und in Zimt eingelegte Orangen – und andere, verbotenere Früchte – feilboten, und die Ratten, die die Pfeiler hinaufflitzten und sich unter den Dachbalken tummelten. In einer Stunde würde sich drinnen im Theater der Vorhang heben, und seine Merope – Drama in drei göttlichen Akten von explodierender Sprachgewalt! – die Premiere erleben. Und Cecilia würde Zeuge sein …
Ein krausköpfiger Junge in einer viel zu großen blauroten Uniformjacke, die wahrscheinlich aus dem Fundus des Theaters stammte, verteilte Flugzettel an die Passanten. »Mörder will Königin schänden … Drama des berühmten Inghirami … Mörder will Königin schänden … Beginn punkto sechs … nur noch wenige Karten … Mörder will Königin … wenn es gefällig ist, der Herr …«
Dem Herrn war es nicht gefällig, ungeduldig schlug er ihm die Zettel aus der Hand. Der Junge hob sie wieder auf, blies den Schnee fort und brüllte weiter, was man ihm aufgetragen hatte. »Mörder will Königin schänden …!« Mit ein wenig Glück würde er sich heute Abend eine Suppe in der Garküche an der Ecke des Ospedale leisten können.
Inghiramo blickte die Straße hinab. Der Mond hatte sich einen Platz zwischen den zerrissenen Wolken erkämpft, und sein blasses Licht zeichnete die Umrisse der Kirchendächer, Türme, und Hausfassaden weicher, sodass es aussah, als wären sie eine von Rosalbo Carriera gemalte Kulisse. Undeutlich erkannte er eine Gruppe Studenten, die ein Denkmal mit Schneebällen bewarfen.
Die ersten Zuschauer erreichten das Theater, und ein riesiger Schwarzer, den man wegen des exotischen Ambientes angestellt hatte, dirigierte die Sänften in den Portechaisensaal, wo sie in den dafür vorgesehenen Gefachen verstaut wurden. Hastig klopfte sich Inghiramo den Schnee von der Jacke. Er kehrte ins Theater zurück. Cecilia mochte die Leidenschaft seines Lebens sein, aber er würde ihr nicht wie ein Schoßhündchen schon an der Tür entgegenhecheln.
Im Vestibül nahm er einem der Diener, die in weißgoldenen Uniformen über den Marmor schritten und den Theaterbesuchern Erfrischungen kredenzten, ein Glas Champagner ab und wartete.
In den von Kerzenschein glänzenden Spiegeln, die die Wände bedeckten, erblickte er seine Gestalt. Was er sah, gefiel ihm. Nachtschwarze Culotten, eine ebenso schwarze Weste, fedrige graue Spitzenmanschetten von der Feinheit eines Spinnennetzes … dazu eine schmale Nase, die aussah, als wäre sie einmal gebrochen gewesen … schön, schön. Eine düstere, eine tragische Erscheinung. Das Geschenk, das Gott ihm dazugegeben hat, waren die dunklen Augen, diese prächtigen schwarzen, von innen leuchtenden Edelsteine, die selbst in Augenblicken höchsten Frohsinns von einem geheimen Leiden zu künden schienen. Als Kind hatten sie ihm gelegentlich eine Extraportion Salzfleisch eingebracht – und die Prügel seiner Brüder, die sich völlig zu Recht schlecht behandelt fühlten …
»Keine Verwandten, Herr. Nur die alte Schraube von Großmutter.«
Inghiramo fuhr zusammen, als er so unvermittelt angesprochen wurde. Sein Diener Fernando stand zitternd vor ihm in einem schneebedeckten, fadenscheinigen Mantel. Von den löchrigen Schuhen tropfte der Matsch. Er warf einen sehnsüchtigen Blick zum Redoutensaal, aus dem die Wärme eines kräftig eingeheizten Kamins drang. »Es gab einmal einen Großonkel …«
»Psst, nicht doch!« Inghiramo winkte seinen Lakai hastig in eine Ecke. Es fehlte noch, dass sie Aufmerksamkeit weckten.
»Ein Großonkel, Herr, aber der ist tot. Keine Brüder, keine Vettern …«
»Ich hab’s verstanden! Ab nun …«
»Nur die Alte und das Mädchen …«
»Fort mit dir!«
Während Fernando gehorchte, schwebten die ersten Damen herein, Flaggschiffe in Damast und Seide, mit Turmfrisuren, in denen ihre Frisöre Pfauenfedern, Perlenketten, kleine Figuren, Spangen, Spitzentücher und Blumenarrangements drapiert hatten. Die Herren umschwirrten ihre Begleiterinnen und säuselten Artigkeiten in die winzigen Ohren unter den Turmaufbauten.
Inghiramos gute Laune schwand. Plötzlich sah er sie vor sich, die Laffen, wie sie im Parkett miteinander gackern würden wie auf einem lausigen Fischmarkt, während die Schauspieler seine Verse ins Parkett schleuderten. Man konnte dagegen nichts machen. In der Provinz wurde das Theater gewürdigt, hier diente es nur als Kulisse für Geschwätz und Tratsch.
Er hätte sich vielleicht in eine üble Stimmung hineingesteigert, doch in diesem Moment betrat Cecilia Barghini das Vestibül. Inghiramo verschmolz mit dem Schatten einer Säule und beobachtete, wie sie an der Seite ihrer Großmutter kerzengerade durch den strahlenden Spiegelsaal schritt.
Sie trug eine weiße, mit Schneeflocken bestickte Seidenrobe, und ihr lockiges Haar war durch eine einzige rosafarbene Blüte verziert – ein wohltuender Unterschied zu den aufgedonnerten Gänsen. Sie lachte und plauderte mit ihrer Großmutter und legte den Kopf schief, wozu sie eine Neigung hatte.
Sie hatte blonde Haare, was er eigentlich nicht mochte, denn Blond stand für Heiterkeit und Heiterkeit für Commedia und Commedia für Idioten. Er konnte auch die Sommersprossen nicht leiden, die sich vulgär auf ihrer Nase tummelten. Sie neigte zur Fülle. Noch nicht jetzt. Eingezwängt in ihr Korsett, gab sie eine tadellose Figur. Aber in wenigen Jahren, wenn sie ausreichend genascht, vielleicht Kinder geboren hatte, würde sie auseinander gehen. Dafür hatte er einen Blick. Sie würde sich in ein Hausmütterchen verwandeln, in eine Küchlein servierende Matrone.
Und wenn er all das wusste – warum, zur Hölle, war er ihr dann verfallen? Hatte er, der berühmte Inghirami, nicht Dutzende Liebschaften gepflegt? War nicht sogar eine Comtessa in sein Bett gekrochen? Und er hatte sie am nächsten Morgen schluchzend in ihr Kleid steigen lassen, und sie hatte es hingenommen, dass er sie mit dem Wedeln seiner Hand verscheuchte, weil ihm in Hexameter geformte Leidenschaft aus dem schwarzen Federkiel floss. Und nun versteckte er sich wie ein Hanswurst hinter einer Säule!
Aber was sollte er tun? Er hörte ihr Lachen, und sein Herz entbrannte von neuem, als hätte ein Lampenknecht es mit dem Feuerstab berührt.
Trotz ihres niedlichen Aussehens war Cecilia nicht dumm, sogar schlagfertig, gemessen an den Möglichkeiten einer Frau. Er erinnerte sich an die erste bewusste Begegnung, als sie ihm zur Bearbeitung der Cleopatra gratuliert hatte. Sie war beeindruckt gewesen, sie … nun ja, sie hatte Cleopatras Abschied kritisiert – und er musste zugeben, diese Stelle war nicht die stärkste des Stückes. Aber sie hatte es in einer Weise getan, die ihm ob des freundlichen Witzes den Atem verschlug.
Von da an waren Blicke getauscht, vorsichtige Worte gewechselt und schließlich Billetts zugesteckt worden. In aller Heimlichkeit natürlich, denn Großmamma wachte mit dem Misstrauen eines Hofköters über die Enkeltochter.
Inghiramo seufzte. Er machte sich nichts vor – ein Tragödiendichter, der einer unbescholtenen jungen Dame der guten Gesellschaft nachstellte, begab sich in Gefahr. Nicht in die eines Duells, wie Fernandos Recherchen ergeben hatten. Aber man konnte ihn einlochen, ihn auf die Galeere schicken, ihn aus der Stadt jagen, ihn von bezahltem Gesindel verprügeln lassen …
Er sah, wie sie sich verstohlen umdrehte, als sie die Treppe erreichte. Wagemutig trat er hinter der Säule hervor und winkte ihr zu. Cecilia klappte mit einer mutwilligen Gebärde den Fächer zusammen und spreizte ihn wieder. Und schon war sie in dem Gang verschwunden, der zur Loge ihrer Familie führte.
Inghiramo machte sich auf den Weg zum Proszenium. In einer halben Stunde würde die Vorstellung beginnen. Das Teatro della Pergola hatte eine schlechte Saison hinter sich. Nehmen wir eine Komödie, etwas Märchenhaftes … Gozzi läuft immer!, hatte der Vorstand der Società di palchettisti gefordert, und sein Wunsch hatte Gewicht, denn die Theatermäzene sorgten dafür, dass der Laden nicht geschlossen werden musste. Gozzi läuft immer – natürlich! Das zum Erbrechen stupide Publikum brüllte bei jedem Purzelbaum des Harlekin, als hätte man es mit einer Sensation überrascht.
Aber der Impresario hatte sich durchgesetzt. Merope hatte das Zeug, die Seelen der Menschen zu berühren. Ein Stück voller Qual und Abgründigkeit. Wofür leben wir, Signori, wenn nicht für die Unsterblichkeit!
Rosetti, der Eifersüchtling, der für das Teatro degli Intrepedi schrieb, hatte heimlich die Proben besucht und seine Zunge gewetzt, um das Drama in Verruf zu bringen. Am Ausmaß seines Bemühens konnte man erkennen, wie beeindruckt er gewesen sein musste. Gott ja, ich bin gut, dachte Inghiramo und fühlte, wie ihm warm ums Herz wurde.
Von einer Seitentür aus verfolgte er wenig später die Premiere. Die Schauspieler spielten mit Inbrunst. Egisto wurde vor seine Mutter geführt und des Mordes an einem Fremden angeklagt. Die Königin, die ihn nicht erkannte, war seltsam berührt – gut gemacht, Luisa, wärest du nicht so alt, ich küsste dir die Tränen fort –, und sie zögerte, das Todesurteil auszusprechen. Polifonte erklärte ihr trügerisch, dass es sich bei dem Mordopfer um ihren Sohn handele …
An dieser Stelle musste Inghiramo zähneknirschend mit ansehen, wie Romano, der Herr über die technischen Zaubereien, die Windmaschine in Gang setzte. Inghiramo hasste das Gerät wegen seiner Unzuverlässigkeit. Drehte man zu stark an der Winde, dann wurde ein Luftstrom auf die Bühne geblasen, der die Röcke hob. Ein willkommenes und oftmals gesteuertes Missgeschick bei einer Komödie – aber für die Merope tödlich. Er hatte sich die Windmaschine verbeten, tausendmal! Ein einziger nackter Hintern, und sein Drama würde im Gelächter der Stadt untergehen …
Luisas Rock hob sich gerade eben über ihre hübschen Knöchel.
Inghiramo hatte noch einen brenzligen Moment durchzustehen, als zwei Tauben freigelassen wurden – Tauben kacken jedes Mal, keine Tauben, Romano! Aber das Federvieh hielt an sich, und die Merope wurde frenetisch bejubelt.
Inghiramo fühlte, wie er sich auflöste vor Erleichterung. Er blickte zu den Logen und sah, dass Cecilia aufgestanden war. Sie klatschte, und er bildete sich ein, auf ihren Wangen Tränen zu sehen. Er hatte ihr Herz erschüttert! Und sie war wunderschön. Sie würde niemals fett werden.
Was schert mich das Publikum, dachte er, als er taumelnd vor Seligkeit das Proszenium betrat und sich verbeugte. Welche Mühe kostete es ihn, kühl zu bleiben, schwermütig, abweisend. Seine Seele jubelte.
Cecilia klatschte immer noch. Der Hofköter lächelte leutselig und winkte mit dem Fächer. Wirkliche Wunden, aus denen wirkliches Blut fließt, sind eine böse Sache, dachte Inghiramo. Und dann: Gott, du weißt, ich liebe sie.
Als er eine Stunde und viele Verbeugungen und Komplimente später den Redoutensaal betrat, wo die Theatergäste sich an Spieltischen und vor einem weißen Marmorkamin versammelt hatten, fasste er sich ein Herz. Er beugte sie über Cecilias Hand und ließ ein winziges Stück Papier darin verschwinden.
NEUN MONATE SPÄTER
1.Kapitel
Ich hab’s getan.
Ich habe es wirklich getan.
Die Kutsche rumpelte dahin. Über Schlaglöcher, über Steine, über Äste, die sich unter den Rädern im staubigen Sand drehten. Ihr taten sämtliche Knochen weh. Und immer dieser Satz im Kopf: Ich hab’s getan. Wie ein Glockenspiel, das nur eine einzige Melodie beherrscht.
Vielleicht werde ich verrückt, dachte Cecilia.
Sie schaute zum Fenster hinaus. Die Berge des Apennin, sanfte, grüne Riesen mit weichen Kuppen und lang gestreckten Kämmen, waren zurückgewichen und zum fernen Panorama geworden. Stattdessen zog eine Hügellandschaft vorbei. Zypressenalleen zwischen violetten Zichorienfeldern, Pinien, die aussahen wie grüne Sonnenschirme, Parzellen mit Weinreben, stramm in Reihe wie die Soldaten der herzoglichen Garde, dazu eine leidenschaftliche Sonne, die die Dächer der Bauerngehöfte mit Feuer überzog …
Nicht direkt ins Licht sehen. Das schadet den Augen.
Danke, Großmutter Bianca. So viele gute Ratschläge. Eine tadellose Erziehung. Und dann habe ich’s einfach getan.
Sie saß in einem behäbig rumpelnden Reisewagen der toskanischen Post, Strecke Florenz-Montecatini – acht Stunden, Signorina, wenn kein Rad bricht und der Herrgott ein Einsehen hat – und würde in wenigen Stunden ein neues Leben beginnen.
Der Mann, der ihr gegenüber saß, blätterte geräuschvoll in dem Journal, das er las. Seit die schwangere Dame mit dem papillotierten Haar und der Kürbiskern kauenden Zofe in Pistoia die Kutsche verlassen hatte, war er der einzige Mitreisende. Ein trübsinniger Herr mit dicken Tränensäcken. An seinem Gürtel baumelte eine emaillierte Uhr, die er zu lieben schien, denn er unterbrach seine Lektüre alle Augenblicke, um sie in die Hand zu nehmen und die Zeit abzulesen. Er hatte sich als Signore Secci vorgestellt. Cecilia versuchte den Namen von Signore Seccis Gazette zu erkennen, aber das Vorderblatt war geknickt.
Sie blickte wieder zum Fenster hinaus. Ich hab’s getan, dachte sie, und nun geht es mir, wie es in den Büchern steht. Das übermütige Boot, das aus dem Hafen segelt, wird vom Sturm verschlungen.
Einen Moment kämpfte sie mit den Tränen.
Der Tag war heiß gewesen, wie jeder Tag in diesem drückenden Sommer. Die Schnürbrust, dieses Folterwerkzeug aus Holz, mit einer Eisenstange quer über die Brust, nahm ihr die Luft zum Atmen. Und ihre Haare – Stefana hatte sie matronenhaft streng unter einer Haube versteckt – fühlten sich an, als krabbelte eine Heerschar Läuse über die Kopfhaut. Was hoffentlich nicht stimmte, was bitte, bitte nur Einbildung war. Bei Ungeziefer war sie empfindlich!
Signore Secci hatte seine Lektüre beendet. Verächtlich warf er die Gazette neben sich aufs Polster und schaute an seiner Reisegenossin vorbei auf einen imaginären Punkt, der sich irgendwo im grünen Samt über ihrem Kopf befand.
»Sicher werden wir bald da sein«, bemerkte Cecilia. Der Mann tat, als wäre er taub. Vielleicht litt er an Schüchternheit?
Sie schloss die Augen. Die Kutsche ruckelte um eine Kurve, und der Weg wurde noch schlechter als zuvor. Jetzt holperten sie eine Anhöhe hinauf. Cecilia tastete nach der Armlehne und hielt sich fest. Eine ihrer Spangen löste sich und eine Locke kroch unter ihrer Haube hervor. Das würde sie richten müssen, wenn sie angekommen war. Buona sera, Giudice Rossi. Ich weiß, Sie erwarten mich nicht. Mein Name ist Cecilia Barghini …
Skid!
Wenn sie dem göttlichen Inghiramo für etwas dankbar sein musste, dann für dieses Wort. Er hatte es aus Dänemark mitgebracht, wo er für den geisteskranken König ein Theaterstück inszeniert hatte. Es war ein Schimpfwort, und die Bedeutung war ihr einigermaßen klar, weshalb sie es niemals laut aussprach. Aber allein die Möglichkeit, es über die Zunge rollen zu lassen, war kostbar. Ich will hier nicht sein, skid, skid!
Sie musste an Augusto denken, der selbst gern fluchte, den dieses Wort aus ihrem Mund aber sicher schockiert hätte. Augusto Inconti war der Mann, der ihr vor zwei Monaten einen Heiratsantrag gemacht hatte. Ein reicher Mann, ein umgänglicher Mann. Ein Mann, der gern scherzte. Leider war es so, dass seine Scherze der Komik entbehrten, und wenn sie komisch waren, dann hatte man sie schon hundertmal gehört. Und fast immer verpatzte er die Pointe.
Wie hochmütig du bist, Cecilia. Der Herrgott wird dich strafen. Aber nun muss er das gar nicht, Großmutter, denn du hast ihm die Rute aus der Hand genommen und besorgst diesen Teil allein.
Unvergesslich, das vergangene Wochenende: Zunächst Augusto, der ihr einen Strauß Rosen überreichte, Schweißperlen auf der Glatze, die Knopflöcher über dem Wanst gespannt, leutselig wie ein Patenonkel, der dem Schützling ein Andachtsbüchlein in die Hand drückt. Es wird Zeit, Mädchen, sehe keinen Sinn darin, die Sache hinauszuschieben. Wir packen’s einfach an. Großmutter, die überrascht und gerührt tat. Stefana, die unter ihrer Dienstbotenhaube eine Träne zerdrückte. Und schließlich die Braut, die sagte: Es tut mir Leid, Augusto, es tut mir schrecklich Leid, aber … es ist unmöglich.
Doch lieber später?
Nein, gar nicht.
Augusto war gegangen, und Großmutter hatte Cecilia zum ersten Mal, seit sie zurückdenken konnte, geschlagen. Das war die Möglichkeit, die der Herrgott dir in seiner Gnade geboten, die ich dir ergattert habe – und du trittst sie mit Füßen!
Danach zwei Tage Schweigen.
Und dann Großmutters Urteil, das da hieß: Montecatini – Giudice Rossi. Der Mann, durch seine Frau Grazia mit Großmutters Familie verwandt, war verwitwet und hatte eine kleine Tochter. Du wirst das Kind erziehen.
»Endlich«, sagte Signore Secci und schaute erneut auf seine Uhr.
Cecilia beugte sich vor. Sie hatten einen befestigten Platz erreicht. Durch die Staubwolke hindurch sah sie zur Linken eine Kirche und zur Rechten ein großes, schmuckloses Kastengebäude mit langen Fensterreihen, das sie für ein Armenhospiz hielt, denn auf den Bänken unter den Fenstern saßen Krüppel, die Erbsen pulten und sich damit amüsierten, Steine nach einer buckelnden rot getigerten Katze zu werfen. »Verzeihung, ist das hier schon Montecatini?«
»Das Bad«, sagte Signore Secci und blickte demonstrativ beiseite, als hätte er Angst, andernfalls mit einer Flutwelle weiterer Fragen überschüttet zu werden.
Die Kutsche nahm noch eine Kurve, Katze und Greise verschwanden, und sie fuhren durch eine schnurgerade, frisch gepflasterte Allee, die elegant von Ulmen und Akazien gesäumt war. Hinter den Bäumen reihten sich Handwerkerhäuser und Werkstätten mit flachen, roten Ziegeldächern und kleinen Fenstern. Dazwischen lagen rosa verputzte Villen, vor denen in Kübeln Zitronenbäumchen und Sommerflieder wuchsen. Die Geländer der eisernen Balkone verschwanden unter bunten Blumen. Alles wirkte neu, als wäre die Straße in den letzten fünf Jahren aus dem Staub gestampft worden. Selbst die Damen, die mit wagenradgroßen Strohhüten auf den Köpfen am Straßenrand flanierten, sahen aus, als hätte man sie aus einem Modejournal geschnitten.
Vom Kutschbock erscholl ein begütigendes Heho. Die Kutsche passierte eine Baustelle mit einem halb fertigen Gebäude und dann ein einstöckiges, lang gestrecktes Haus mit einem Arkadengang und einem Dreiecksgiebel, das an einen griechischen Tempel erinnerte. Sie fuhren einen Wendekreis, das schwankende Ungetüm kam zum Stehen.
Signore Secci stemmte sich vom Sitz hoch und stieg aus, ohne sich zu verabschieden. Die Gazette ließ er auf dem Polster liegen, und Cecilia klemmte sie sich rasch unter den Arm, bevor sie ihm mit steifen Gliedern ins Freie folgte.
Sie blickte sich um. Das also war Montecatini? Sie wusste selbst nicht, was sie erwartet hatte. Enzo Rossi lebt in einem Bauernkaff zwischen Pistoia und Pisa. Vielen Dank, Großmutter Bianca. Aber dies hier ist kein Kaff. Es ist gar kein richtiger Ort. Es ist eine Ansammlung von Neubauten, aus der vielleicht einmal etwas entstehen wird, vielleicht aber auch nicht.
»Wir sind in Montecatini?«, wiederholte Cecilia ihre Frage zum Kutscher gewandt.
»Bei den Thermen, Signorina. Das Haus hier und die Anlagen dahinten und die meisten Werkstätten gehören zu den Bädern, die sie gerade restaurieren. Ich dachte, ehrlich gesagt, Sie sind auch zum Kuren gekommen. Sonst hätt ich Sie vorn abgesetzt, wo …«
»Ich suche Signore Rossi, den Richter.«
»Der wohnt oben in der Stadt.«
Cecilia folgte der Bewegung seines Kopfes und entdeckte auf der nächstgelegenen Hügelkuppe eine kleine Ortschaft. Mehrere Kirchen zielten mit den schwarzen Turmspitzen in den brennenden Abendhimmel. Sie waren umgeben von schäbigen Wohnhäusern und den Resten einer Mauer, die einmal den Ort geschützt hatte. Ein mittelalterliches Städtchen, wie es sie in der Toskana zu Dutzenden gab. Sie konnte allerdings nicht die ganze Stadt überblicken. Durch den Berg war der westliche Teil des Ortes ihren Augen entzogen.
»Eigentlich ist das da oben das richtige Montecatini, Signorina. Steht aber nicht auf meinem Fahrplan. Ist nämlich noch ein ganzes Stück Weg rauf«, meinte der Kutscher und wartete. Darauf, dass sie sagte: Natürlich fährst du mich, und hier sind zwei Scudi? Sie hätte es rasend gern getan. Nur besaß sie keine zwei Scudi. Du wirst ja versorgt sein, Cecilia!
»Sie nehmen die Koffer mit und lassen sie in der Poststation, bis sie abgeholt werden.« Cecilia klaubte einige Dinare aus ihrem Beutelchen. Der Kutscher schwenkte seinen Hut nicht gerade begeistert, aber er nahm die Münzen an und kletterte zurück auf seinen Bock.
Seufzend wandte Cecilia sich um. Wie der Pfad ins obere Montecatini verlief, war nicht genau zu erkennen. Er begann hinter einer Steinbrücke, verschwand aber bald zwischen den Hängen. Ob er sich irgendwann teilte und man damit rechnen musste, sich zu verirren, blieb offen.
An der Ecke des Kurgebäudes waren Bauarbeiter unter Anleitung eines korpulenten Mönchs damit beschäftigt, ein langes, dünnes Rohr mit Schellen an der Hauswand zu befestigen. Oben auf dem Dach saß ein Faxen schneidender Spaßvogel mit bloßem Oberkörper, der eine Eisenstange hielt. Die Sonne überzog ihn mit Licht, sodass er wie der rot bemalte Teufel aus dem Theater aussah. Cecilia trat heran.
»Verzeihen Sie, Padre …«
»Tiefer!« Der Mönch reckte das Doppelkinn und versuchte einen besseren Blick auf das Loch zu haben, das zwei seiner Arbeiter direkt unter dem Rohr aushoben. Sand flog von den Schippen.
»Ich krieg nasse Füße«, beschwerte sich einer der Grabenden.
»Gütiger! Graben wir nach Grundwasser? Tiefer!«
»Verzeihung«, machte Cecilia sich lauter und etwas ungeduldig bemerkbar. Sie hatte keine Zeit zu verschwenden, und es war ja wohl nicht zu viel verlangt, einer Dame eine Auskunft zu geben.
»Ramm sie endlich rein!« Dieser Satz galt dem feixenden Mann auf dem Dach, und als Folge wurde die Eisenstange angehoben und etwas mit ihr getan, was Cecilia nicht erkennen konnte. Reingerammt vermutlich.
»Sie kommen nicht drauf, Signorina, was?«
Sie brauchte einen Moment, um zu bemerken, dass der Mönch zu ihr sprach.
»Ein Blitzableiter.«
»Tatsächlich.«
»Fabelhafte Erfindung. Ein Amerikaner ist drauf gekommen. Signore Benjamin Franklin. Gescheiter Mann, wenn auch mit politischen Ambitionen, was einem das Herz brechen könnte. Sollte sein Talent nicht verschwenden, um eine Horde … Sehen Sie? Die Stange steht auf dem höchsten Punkt des Gebäudes. Sie lenkt den Blitz auf sich und führt ihn über einen Draht hinunter in die Erde, wo ihm die Puste ausgeht. Signore Franklin hat es mit einem Drachen ausprobiert. Der Mann, der den Blitz vom Himmel holte! Die Frage ist nur: Kugel oder Spitze.«
»Ich würde gern wissen …«
»Ist sie drin?«, brüllte der Mönch in Richtung Dach und fuhr zu Cecilia gewandt fort: »Franklin spricht sich für die spitze Variante aus. Und ich will ja wohl meinen, dass er mehr davon versteht als dieser englische … dieser eng… Cospetto! Halt es!« Die Eisenstange schlitterte über das Dach, drehte sich und schlug neben Cecilia und dem Mönch auf. Sand spritzte, und die Männer in der Grube zogen die Köpfe ein. »Hornochse, verfluchtes Rindvieh …«
»Verzeihung, Padre, ich sehe, dass ich störe, aber ich muss heute Abend noch zu Giudice Rossi, und ich weiß nicht, ob dieser Weg …«
»Bleib, wo du bist! Ich reiche ihn dir wieder rauf. Rossi wohnt oben, am Markt, Signorina. Diavolo! Ich hätte mich doch für die Kugel entscheiden sollen.« Er hielt ihr die Eisenstange entgegen, an deren einem Ende sich Draht kräuselte, während das andere in eine gefährlich anmutende Spitze mündete. Ja, in der Tat – die Kugel wäre besser gewesen.
»Dort über die Brücke?«
»Und dann immer dem Weg nach. Los, Junge greif zu! Und sei verdammt, wenn er dir auch nur einen Millimeter aus den Händen …«
Also immer dem Weg nach.
Cecilia marschierte los, die Gazette unter dem Arm, über die Steinbrücke und dann den kleinen Pfad hinauf.
Es war wirklich nur ein Pfad, ein gottverlassener Weg, den niemand pflegte und der seine Richtung wechselte, ohne dass sie auch nur den Schimmer eines Sinns darin zu erkennen vermochte. Unkraut griff nach ihren Röcken, und Steinchen bohrten sich durch die Sohlen ihrer dünnen grünen Seidenschuhe. Die Häuser blieben zurück, und sie fand sich plötzlich in einer Natur, die sie nicht kannte und die ihr wegen der Stille und Einsamkeit unheimlich war. Nur Vogelpiepsen und Katzenschreie waren zu hören. Und dazu das verdammte Abendrot, das den letzten Schimmer Romantik verloren hatte und ihr aus rot glühenden Augen blinzelnd die Nacht androhte. Sie begann zu keuchen – nicht nur vor Unruhe, sondern auch, weil sie es nicht gewohnt war, längere Wege zu Fuß zurückzulegen. Wie denn auch? Auf den florentinischen Straßen verdarb man sich im Gossenschmutz die Schuhe, für jeden Schritt außer Haus hatte sie die Sänfte benutzt.
Und dann wurde es tatsächlich dunkel. Das Himmelsfeuer erlosch. Die Bauernhäuser und Schuppen, die an den Hügeln klebten, wurden zu Schatten in der Finsternis und verschmolzen vollends mit ihr.
Vielen Dank, Großmutter! Deine Enkeltochter spaziert mutterseelenallein durch die Nacht. Keine Zofe, kein Lakai, keine Anstandsdame … Ist es das, was du gewollt hast? Cecilia kamen die Tränen, und sie wischte sie wütend fort, weil sie es hasste zu weinen und weil sie selbstmitleidige Leute verachtete. Sie würde schon zu dem vermaledeiten Marktplatz kommen.
Von dem kleinen Städtchen war mittlerweile kein Ziegelchen mehr zu entdecken. Der Weg wand sich in endlosen Serpentinen aufwärts. Wie lange war sie bereits unterwegs? Zwei Stunden? Sie schätzte, dass es auf zehn Uhr zuging. Vielleicht hatte sie sich längst verlaufen.
Als sie um eine Kurve bog, sah sie ein finsteres Wäldchen vor sich auftauchen. Beunruhigt blieb sie stehen. Es war natürlich töricht, sich zu fürchten, denn wer würde in dieser Einsamkeit auf der Lauer liegen, um Reisende zu überfallen? Wo die Post doch nur bis zu den Thermen fuhr. Wo sie doch ganz offensichtlich der einzige Mensch auf Gottes Erden war, der diesen Weg benutzte. Dennoch tönten in ihrem Ohr plötzlich lästige Moritatenfetzen über Mordbuben, die Kutschen überfielen und schönen Damen die Hälse durchschnitten …
Sie klemmte die Gazette unter den anderen Arm und ging beherzt weiter.
Der Wald empfing sie wie die Umarmung eines schwarzen Riesen. Es wurde stockfinster. Um sie herum knackten Zweige, und über ihr raschelte das Laub, als würde sie von Waldgeistern beäugt, die sich im Geäst tummelten. Sie hörte Tiere – hoffentlich waren es nur Tiere –, die durch das Gestrüpp strichen. Ängstlich tastete sie mit den Schuhspitzen nach Dachslöchern und anderen Hindernissen. Jawohl, Großmutter, mir ist entschieden mulmig. Hast du damit deine Genugtuung?
Plötzlich kam ihr ein neuer Gedanke. Sie stellte sich vor, wie es sein würde, wenn sie Giudice Rossi aufweckte. Der Mann hatte ein jähzorniges Temperament, das wusste sie aus den Erzählungen der Verwandtschaft. Die arme Grazia hatte viel geweint. Und er erwartete sie nicht. Niemand hatte sie angemeldet. O lieber Himmel, sie war zu müde, viel zu müde, um sich von einem Fremden anbrüllen zu lassen.
Rossi würde nicht brüllen. Die Erfahrung hatte gelehrt, dass das Schicksal stets mit Überraschungen aufwartete. Das Unglück, das vorhergesehen wurde, blieb aus. Dafür schlug ein anderes zu. Nach dieser oft geprüften Theorie würde Enzo Rossi sie also freundlich empfangen. Und hatte er dafür nicht allen Grund? Sie kam ja nicht als Bettlerin, sondern um ihm behilflich zu sein.
Der Wald begann sich wieder zu lichten.
Cecilia trat aus dem Gefängnis der Bäume – und blieb stehen, wie von einem Zauberstab berührt. Der Mond war aufgegangen, sein Licht fiel auf die Hänge und versilberte die Olivenhaine und die Weingärten, als hätte Gott ein Schatzkästchen darüber ausgegossen. Der Weg war zu einem Gürtel aus Edelsteinen geworden, die Bäume ein filigraner Schmuck auf dem nachtblauen Dekolleté des Himmels. Selbst der Raubvogel, eine Eule wahrscheinlich, der in einem nahen Zweig hockte, sah aus wie ein in Edelmetall gegossenes Schmuckstück.
Verzückt hielt sie den Atem an. Dies hier war … betörend schön. Gottes Engel hatte sein flammendes Schwert gesenkt und Evas Tochter die Rückkehr ins Paradies gestattet. Sogar der kleine Friedhof längs der Straße kam ihr vor wie ein Platz des Friedens. Als Cecilia nach einigen weiteren Schritten hinter einem Ausläufer des Wäldchens die Stadtmauer auftauchen sah – noch dazu mit einem sperrangelweit geöffneten Tor –, war sie restlos glücklich.
Und dann kam der Mann.
Es war gar kein Mann. Es war ein Geist, der weder den Weg benutzte noch durch ein Tor trat, der aus keinem Versteck hervorsprang, sondern sich aus dem Nichts materialisierte. Cecilia nahm ihn zunächst nur als Bewegung in den Augenwinkeln wahr. Sie fuhr herum, und da lief er, vor den äußeren Reihen eines Weinackers. Er hatte die Arme angewinkelt und bewegte sich mit federnden Sprüngen.
Und er war völlig nackt.
Seine Haut schimmerte weiß wie Hühnerknochen, der Schopf umrahmte sein Haupt wie ein schwarzer Heiligenschein. Der Mond beleuchtete ihn vom Kopf bis zu den mageren Beinen, die wie Teile einer Maschine ruckten, und nur ein Blinder hätte das unaussprechliche Ding übersehen können, das an ebenso unaussprechlicher Stelle wie ein Pendel schwang.
Errötend wandte Cecilia den Blick ab – nur um sofort wieder hinzublicken. Der Mann hatte seine Richtung geändert, er kam jetzt auf sie zu. Weil er sie ebenfalls entdeckt hatte? Sie stand vor dem dunklen Waldsaum, ihr Musselinkleid war aus weißem Stoff mit gelben Blumen, nicht gerade unauffällig. Ihr Herz pochte. Und nun? Das einzige Versteck bot der Wald – und dorthin würde sie auf keinen Fall zurückkehren. Wahrscheinlich wäre es das Beste, laut zu schreien.
Unvermittelt blieb der Nackte stehen und musterte sie. Er war noch einen Steinwurf weit entfernt, sie konnte seine Gesichtszüge erkennen. Er war jung, wohl kaum älter als zwanzig Jahre. Seine Zungenspitze kreiste auf den Lippen, die im alles verhexenden Licht der Nacht ebenfalls schwarz aussahen. Er wirkte zornig und gefährlich und … bösartig. Sie hätte nicht sagen können, warum, aber sie hatte den Eindruck, mit diesem Menschen sei ein zutiefst verdorbenes Geschöpf in das Paradies eingedrungen. Die Schlange selbst. Der Teufel.
Einen Moment erwog sie die Möglichkeit, dass sie über den Ereignissen der letzten Tage tatsächlich den Verstand verloren hatte. Der Teufel nahm sie in Augenschein, mit einem genüsslichen Lächeln, das ihr das Blut aus dem Kopf trieb. Der Wald schien mit seinen schwarzen Armen plötzlich zu locken. Ihre Muskeln zuckten. Ihr Körper und ihre Seele drängten auf Flucht …
Aber da setzte der Mann sich wieder in Bewegung. Mit federnden Schritten rannte er in die ursprüngliche Richtung. Cecilia sah, wie der weiße Rücken sich einer Hecke näherte – im nächsten Moment war er verschwunden.
Gut, sagte sie sich, also gut.
Beherrscht wandte sie sich zur Stadtmauer. Das Tor befand sich in nächster Nähe. Es stand offen, da hatte sie sich nicht getäuscht. Sie schritt an einer Kirche vorbei. Nackte Männer im Paradies … Plötzlich wurde ihr bewusst, wie sehr ihre Füße schmerzten, bestimmt hatte sie sich Blasen gelaufen. Dem heiligen Gebäude folgte eine Hausmauer mit einer Nische, in der eine Madonnenstatue mit einer Krone aus verwelkten Sommerblumen thronte. Sie ging weiter. Die verdammten Schuhe. Ganz richtig, ich fluche, Großmutter.
Sie passierte Häuserreihen mit geschlossenen Fensterläden, hinter denen glücklichere Geschöpfe in ihren Betten schlummerten. Zu ihrer Linken befand sich eine Mauer, hinter der es abwärts ging zu den Hügeln, wo sich der nackte Teufel herumtrieb.
Sie bückte sich und zog die Schuhe und die weißen Seidenstrümpfe von den Füßen. Was tut’s, Großmutter? Wen interessiert es schon? Wenn sie nur besser Luft bekäme! Verdammte Schuhe, verdammte Schnürbrust … Zwischen den Häusern öffnete sich eine Bresche, eine Gasse führte mit breiten Stufen aufwärts – ins Innere des Städtchens, wie sie hoffte.
Cecilia versuchte erneut die Zeit zu schätzen. Die Bewohner von Montecatini lagen längst im Schlaf. Also ging es wohl auf Mitternacht zu. Hatte sie tatsächlich so lange für den Weg gebraucht? Sie wünschte, sie hätte die altmodische Taschenuhr ihres Vaters nicht in den Koffer gepackt.
Die Gasse teilte sich in zwei weitere Gässchen. Wieder nahm sie das steilere, das nach oben führte. Ihre Erregung schwand und wich einer bleiernen Müdigkeit, während sie Stufen erklomm, sich an rauen Hauswänden entlangtastete und sich in Hauswinkel mit Bänken und abgestellten Stiefeln verirrte. Dies ist ein Albtraum, dachte sie. Es passiert gar nicht wirklich.
Die letzten Schritte brachten sie auf einen ovalen, großen Platz. Eine Riesin in einer Tunika, die etwas wie einen Tuchfetzen in der Hand schwenkte, blickte ihr von einem Denkmalsockel aus entgegen. Der Marktplatz – und sie hoffte sehnlich, dass dieses Städtchen nicht mehrere davon besaß – war gefunden.
Mit zusammengebissenen Zähnen schlurfte Cecilia über das Pflaster. Das Mondlicht fiel auf einige Kaffeehausstühle, die der Besitzer im Freien hatte stehen lassen. Sie setzte sich auf einen davon und streifte ihre Schuhe wieder über die Füße. Die Strümpfe stopfte sie in den Ärmel. Sie war kurz vor dem Ziel – nun musste sie nur noch herausfinden, in welchem Haus Enzo Rossi, der Richter von Montecatini, lebte.
Und das war möglicherweise einfacher als gedacht, denn in einem der Häuser brannte noch Licht. Also geklopft und gefragt. Besuchszeiten, Großmutter? Ist es etwa meine Schuld, dass ich hier mitternächtlich nach einem Unterschlupf suche? Ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich glücklich bin.
Das Haus war hässlich, aus grauen, schmutzigen Steinen, mit schäbigen Fenstern und Türen. Noch verkommener wirkte es durch seine Nachbarschaft zu einem schmalen, mit Türmchen, Balkonen und Zinnen geschmückten rosa Gebäude, das vielleicht nichts Gutes über den Geschmack seines Erbauers aussagte, aber wenigstens auf liebevolle Pflege schließen ließ.
Cecilia schritt durch einen vernachlässigten Vorgarten. Aus den Fenstern des hässlichen Hauses drang eine laute gereizte Stimme. Ihr Mut sank erneut. Man stritt sich also. Und sie war müde. Sie war so müde, dass ihr die Vorstellung, inmitten des Unkrauts einfach einzuschlafen, wie eine Verführung erschien.
Die Tür besaß einen altmodischen Türklopfer in Form eines Löwenkopfes. Sie pochte. Der Streit nahm munter seinen Fortgang. Cecilia pochte ein zweites Mal und wartete.
Schwere Schritte polterten eine Treppe hinab. Endlich. Die Tür wurde aufgerissen. Aus einem bulligen, schlecht rasierten Gesicht starren ihr verkniffene Augen entgegen. »Was?«
»Ich suche das Haus von Giudice Rossi. Nach meiner Kenntnis …«
Ihr Blick fiel auf einen roten Talar und eine schulterlange Perücke, die an einem Nagel im Korridor hingen. O bitte nicht. Gütiger, wenn das stimmte …
Der Mann, der sie anstierte, war fett und schmutzig. Aus seiner Jacke stieg ein Aroma, als hätte er sie vor hundert Jahren angezogen und seitdem nicht mehr vom Leib gepellt.
»Giudice Rossi?«
»Was?«
»Ich bin Cecilia Barghini, die Cousine Ihrer verstorbenen Frau. Ich bin gekommen, um Ihnen bei der Erziehung Ihrer Tochter beizustehen.« Jedes einzelne Wort klang lächerlich. Rossi stierte weiter. Er war nicht nur schmutzig, sondern auch schwachsinnig. Seinen brillanten Verstand, der ihn, wie es hieß, unter seinesgleichen berühmt gemacht hatte, hatte er offenbar im Schnaps ertränkt.
»Glaube kaum, dass hier eine Frau gebraucht wird.« Oben knallte eine Tür. Dann stürzte etwas Blechernes eine Treppe hinab. Penetranter Fischgeruch machte sich breit. »Und wenn, dann auf keinen Fall vor morgen früh.«
»Es ist spät, und ich bin müde«, sagte Cecilia.
»Wer ist da?«, brüllte jemand aus dem oberen Geschoss.
»Eine Cousine der verstorbenen Signora.«
Cecilia meinte die Stimme eines Kindes zu vernehmen, doch sie wurde übertönt. »Schmeiß sie raus.«
Der dicke Mann – also nicht Rossi, sondern irgendein Faktotum? – nickte bedächtig mit dem Kopf. »Tja, Signora …«
Die Stäbchen der Schnürbrust brannten, als hätte man sie mit einer Zange aus dem Fegefeuer geholt und an ihren Leib gedrückt. Cecilias Füße wollten aus den Schuhen platzen. Sie war so erschöpft, dass ihr übel war. Und sie hatte einen Nackten gesehen! Sie verlor die Geduld. Mit fester Hand schob sie den Mann beiseite.
Das Haus war dunkel, sie konnte durch eine offene Tür zur Linken in ein Zimmer mit einem Esstisch sehen, geradeaus lag ein Flur. Am Ende des Flures begann eine Treppe, und vom ersten Treppenabsatz fiel Licht durch ein Fenster auf die Stufen. Auf dieses Licht steuerte Cecilia zu. Sie brauchte einen Ort, an dem sie sich die Schnürbrust vom Leib reißen konnte. Alles andere war egal.
Vor der Treppe lagen glänzende Fischleiber. Der Fette überholte Cecilia und baute sich inmitten der Fische vor ihr auf.
»Und?«, fragte sie und merkte, dass sie den Tonfall ihrer Großmutter imitierte.
»Nicht dort rauf. Nehmen Sie dieses Zimmer«, sagte er und wies auf eine Tür zur Linken, die ihr entgangen war. Cecilia öffnete sie und blickte in einen dunklen Raum. Undeutlich erkannte sie die Umrisse mehrerer Möbel. Sie sah ein Bett. Das reichte. Sie trat ein und zog die Tür hinter sich ins Schloss.
Kaum allein, warf sie die Gazette beiseite und riss die Knöpfe ihres Kleides auf.
Sie hätte gedacht, dass sie nach diesem schrecklichen Tag tief und fest schlafen würde. Stattdessen quälte sie sich in einem Albtraum, in dem ein nackter Mann durch die Dunkelheit strich. Sie war ganz allein, und sie wusste: Er führte etwas im Schilde.
2.Kapitel
Heilige Katharina, warum wurde ich geboren!« Die greinende Stimme, die Cecilia weckte, dehnte die Wörter in die Länge, als wären es nasse Strümpfe. »Ich bück mich geeern. Ich meeerk meinen Rücken gar nich. Macht doch eure Schweinereieiein. Brauch keiner nich Rücksicht neeehmen …«
Cecilia zog das Kissen, das neben ihrem Ellbogen lag, über das Gesicht, warf es aber gleich wieder von sich, als ihr der Mief alten Schweißes in die Nase drang.
In der Diele schepperte ein Eimer. »Guuuter Fisch. Wo das Geld aus dem Hiiintern wächst … Und anderen tut der Bauch weeeh vor Hunger …«
»Er hat ihn die Treppe runtergeworfen«, wurde die nölende Frau von einem Kind unterbrochen.
»Ach nee. Und wie is der Fisch zu ihm hochgekommen? Das würd ich mal gern wissen. Und wie er überhaupt ins Haus gekommen is.«
»Vom Meer. Eine große Welle ist gekommen und hat die Fische durchs Fenster getragen …«
»Und der Eimer? Bringt das Meer die Fische etwa im Eimer?« Die Frau triumphierte, als hätte sie einen spitzfindigen Beweis geführt.
»Denkst du, er wird mich verprügeln?«
»Hau ab. Du bist im Weg. Bist immer im Weg …«
Die Schelte ging unter im Lachen des Kindes. Eine Tür knallte, das Kind sang, während es fortrannte.
Ich will hier nicht sein, dachte Cecilia. Sie starrte auf die krummen Deckenbalken, die vom Rauch unzähliger Nachtlichter geschwärzt waren. In einigen steckten Nägel, wohl um Bohnen oder Fleisch zu trocknen oder eine Wäscheleine zu spannen. Das Zimmer stank, als hätte man das schmutzblinde Fenster noch nie zum Lüften geöffnet. Sie mochte nicht daran denken, welches Ungeziefer in der Matratze und zwischen den Laken hauste. Sie mochte überhaupt nicht denken. Gequält lauschte sie dem Gemecker der Alten, die den Fisch auflas und hinaustrug. Allmächtiger, wie der stank. Von wegen guter Fisch.
Ihr Bauch tat weh. Stand etwa die monatliche Blutung bevor? O bitte, nicht auch noch das, dachte sie und hätte sich die Decke über den Kopf gezogen, wenn sie sich nicht so sehr vor ihr geekelt hätte.
Im Haus war es wieder still geworden. Hatte die Kinderstimme Dina gehört, Cousine Grazias armer Tochter, die bei ihrem Vater aufwachsen musste, weil ihre Mutter die Unvorsichtigkeit begangen hatte, an den Blattern zu sterben? Cecilias Herz füllte sich mit Mitleid.
Aber nicht lange. Schmeiß sie raus – die wütende Stimme der vergangenen Nacht! Schmeiß sie raus. Nachts um zwölf und zu einer Dame, wie ein Blinder hätte erkennen können. Zu einer Verwandten der eigenen Frau. Nun gut. Auch in Ordnung. Demnach bestand keine Notwendigkeit mehr, sich über dieses grauenhafte Haus oder die Familie, die es bewohnte, Gedanken zu machen. Man musste beinahe dankbar sein.
Aber vor allem musste man aufstehen.
Gut, dass sie die Koffer bei der Poststation gelassen hatte. Sie würde sich anziehen, sie würde den Weg wieder hinabsteigen, sie würde die nächste Kutsche nehmen und … Cecilia wurde unsicher.
Du bist wieder da?
Gerade hatte sie sich aus dem Bett schwingen wollen, nun sank sie in die Kissen zurück. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, ob Großmutter Bianca womöglich etwas wusste von dem, was zwischen ihr und Inghiramo Inghirami geschehen war.
Dieser erbitterte Wutausbruch …
Aber nein, wenn sie etwas gemerkt hätte, wenn sie eines der Billetts in die Finger bekommen hätte, die zwischen der Via Porta Rossa und dem Teatro della Pergola hin und her gewandert waren, wenn sie einen der in die Luft gehauchten Küsse gesehen hätte, wäre das Donnerwetter schon im vergangenen Dezember hereingebrochen. Cecilia erinnerte sich daran, wie huldvoll Großmutter dem berühmten Bühnendichter bei der Aufführung der Merope applaudiert hatte. Sie hatte nicht den Hauch einer Ahnung gehabt. Sogar als der Bauch ihrer Enkeltochter schwoll, war sie blind geblieben.
Der Gedanke an das Kind, das im sechsten Monat der Schwangerschaft abgegangen war, drang wie ein Messerschnitt in Cecilias Herz. Wie dumm von ihr! Hatte sie nicht eine Strategie entwickelt? Einfach nicht daran denken. Das hatte ihr über die letzten Monate hinweggeholfen, als sie sich so wund fühlte, als hätte man sie mit dem Henkersgaul durch die Stadt geschleift. Es war ihr Zauberspruch geworden, ihr Amulett aus Worten: Nicht daran denken. Der Weg zum Überleben. Die Zeit heilt alle Wunden, hatte Stefana, ihre Zofe und Vertraute in dieser schwierigen Zeit, immer gesagt.
Großmutter war zornig geworden, weil Cecilia, die mit ihren zwanzig Jahren bereits ein Dutzend schmeichelhafter Anträge abgelehnt hatte und auf dem besten Weg zur alten Jungfer war – deine Eltern sind tot, ich bin für dich verantwortlich, Kind! –, Augustos Angebot zurückgewiesen hatte. Inzwischen hatte sie sich zweifellos wieder beruhigt. Es war nichts wirklich Schlimmes geschehen. Wahrscheinlich hoffte sie heimlich schon auf die Rückkehr ihrer Enkeltochter.
Der Hausherr begehrte zu wissen, wo – di satanasso! – seine Schuhe seien.
Entschlossen kroch Cecilia aus dem Bett.
Eine Tür knallte. Rossi musste seine Schuhe gefunden oder die Suche aufgegeben haben.
Cecilia nahm das Zimmer genauer in Augenschein. Es sah aus wie eine Rumpelkammer. Offenbar hatte man sämtliches Mobiliar, das sich im Lauf der Jahre angesammelt hatte und dann überflüssig geworden war, hier abgestellt. Mehrere Stühle mit Polstern aus verblichenen Stoffen, ein Kabinettschrank, der schief stand, weil ihm ein Fuß fehlte, eine Truhe aus der Zeit, als Kain seinen Bruder Abel erschlug … Alles war von einer dicken Staubschicht überzogen.
Cecilia hätte sich gern das Gesicht gewaschen, aber sie fand keinen Klingelzug, was sie nicht wunderte, und sie hatte auch keine Lust, das greinende Weib durch einen Türspalt um Wasser zu bitten. Mit gerümpfter Nase nahm sie das Betttuch auf, suchte den Zipfel, der am saubersten wirkte, und rieb sich den Schweiß vom Körper. Nach Meinung ihrer Großmutter, die weiße Leibwäsche für die Grundlage der Hygiene und Wasser für Teufelszeug hielt, sowieso die einzig mögliche Art der Reinigung. Wasser öffnet die Poren und gibt den Körper schutzlos sämtlichen Krankheiten preis, weiße Wäsche, Kind, weiße Wäsche …
Cecilia griff nach der Schnürbrust – und hielt inne. Fast hätte sie gelacht. Seitdem sie zurückdenken konnte, hatte ihr an jedem Morgen ihres Lebens eine Zofe beigestanden und die Bänder der Schnürbrust straff gezogen und in ihrem Rücken verknotet. Allein konnte sie diese Aufgabe nicht bewältigen. Einen Moment war sie ratlos.
Andererseits – auch gut. Die Haut an ihrem Oberkörper war wund gerieben, also zur Hölle mit dem Foltergerät. Die Schnürbrust flog auf das Bett, und sie zog sich das Kleid über den Kopf. Glücklicherweise ließen sich die Knöpfe schließen, auch ohne Korsett. Versuchsweise nahm Cecilia einige tiefe Atemzüge. Sie hob die Arme, drehte sich. Es fühlte sich wunderbar an. Sie zog die Schultern hoch – keine Naht drohte zu platzen. Ein Blick in den staubigen Spiegel, der an der Wand der schrecklichen Rumpelkammer lehnte, zeigte sie ein wenig fülliger als sonst, aber keineswegs hässlich.
Ihre Laune hob sich. Sie flocht mit ungeübten Fingern die Haare und betrachtete das Ergebnis. Auch das – nicht schlecht, wenn man bedachte, dass sie noch nie im Leben eine Bürste in der Hand gehabt hatte. Die blonden Haare, die sie von ihrer österreichischen Mutter geerbt hatte, fügten sich einigermaßen in die Spangen und ringelten den Nacken hinab. Ein bisschen wild vielleicht?
Ach was, nicht schlecht, wiederholte Cecilia laut.
Giudice Rossi befand sich im Speisezimmer. Was hieß: Er saß in einem Lehnstuhl mit einem ausgeblichenen grünen Streifenpolster, vor ihm auf dem Tisch stand ein Becher dampfender Schokolade, und er las in einer Gazette.
Als sie eintrat, klingelte er nicht, sondern erhob sich selbst und rückte ihr wortlos einen zweiten Stuhl zurecht. Demnach erinnerte er sich an den vergangenen Abend. Er entnahm einem verschrammten Aufsatzschrank einen zweiten Becher, hielt ihn ans Licht und setzte ihn, offenbar zufrieden mit dem Zustand der Sauberkeit, vor ihr auf der Tischplatte ab. »Schokolade?« Das war das erste Wort, das er sprach.
»Gern. Und für den Fall, dass es bei meiner Ankunft in der … stürmischen Stimmung unterging – ich bin Cecilia Barghini. Grazias Großcousine aus Florenz.«
»Barghini, ja?«, wiederholte er, als wäre ihr Name ein schwer zu merkendes Fremdwort.
Die Schokolade, die er ihr eingoss, war heiß und roch scharf nach indianischem Pfeffer.
Er setzte sich wieder, streckte seine langen Beine aus und starrte sie an. Starren: Damit zeigte er eine Unart, die seltsamerweise in keiner innerfamiliären Liste seiner Fehler je aufgetaucht war. Cecilia hielt sich gerade, blies sacht über die dampfende Schokolade und wünschte sich, sie hätte am Morgen doch ihre Zofe zur Seite gehabt.
»Nun sagen Sie es schon.«
Erstaunt blickte sie ihn an. »Was, bitte?«
»Weiß ich nicht. Aber Sie sagen’s, und dann ist es gut.«
Rossi trug keinen Morgenrock, wie man es um diese Zeit von einem Herrn innerhalb seines Hauses hätte erwarten können, sondern eine Kniehose aus abgewetztem, braunem Leder und dazu ein am Kragen offenes, schmuckloses Hemd. Der Himmel mochte wissen, wo er es erstanden hatte. Kein Schneider auf Gottes Erden hätte sich abhalten lassen, wenigstens eine daumenbreite Rüsche an die Ärmel zu nähen.
Er war mager gebaut und hatte ungewöhnlich lange, knochige Hände. Sein Haar fiel lose auf die Schultern, was dem aus England eingeführten und auch in der Toskana gern kopierten neuen Stil entsprochen hätte, wäre nicht so deutlich gewesen, dass diese Locken weder die ordnende Hand eines Friseurs noch die zähmende Glut des Brenneisens zu spüren bekamen. Giudice Rossi schnitt sein Haar offenbar selbst, und er hatte Glück, dass die Natur ihn weder mit überbordender Fülle noch mit kahlen Stellen herausforderte.
»Und?«
»Und? O ja, Signore Rossi. Ich werde abreisen. Noch heute.«
»Wenn Sie es so wünschen«, sagte er und gab sich nicht einmal den Anschein, etwas anderes als erleichtert zu sein.
»Ich bin gekommen, um mich zu erkundigen, ob Sie Beistand bei der Erziehung Ihrer Tochter brauchen. Nur damit es noch einmal erwähnt ist.«
»Ich brauche keinen Beistand. Dina wird in einem Kloster aufwachsen.«
»Eine … weise Entscheidung, Signore Rossi, mit der Sie dem Kind zweifellos einen Gefallen tun. Sie wissen nicht zufällig, wann die nächste Kutsche geht?«
Seine Miene verdüsterte sich. »Sind Sie mit der Post gekommen?«
Ja, wie denn sonst? War er etwa über Pferdeburschen und Lakaien gestolpert?
»Die Post geht nur einmal die Woche. Sie ist …« Er zog eine Uhr aus seiner Hosentasche und blies verstimmt den Atem durch die gespitzten Lippen. »… vor exakt einer Stunde bei den Thermen abgefahren. Schlecht. Sehr schlecht.« Nach einer Pause des Nachdenkens wandte er sich ihr wieder zu. »Sind Sie zufällig mit einer der Damen aus der Stadt bekannt … Nein? Mit sonst jemandem aus der Gegend?«
»Ich wünschte, es wäre so.«
Die Sonne hatte begonnen, das Zimmer zu erobern. Nicht nur der Schrank, auch die Stuhllehnen und die Schnitzereien an der Tischkante waren grau von Staub. Auf den Bodendielen tanzten Flusen. Irgendwann musste hier einmal Wohlstand geherrscht haben: Die Wände waren mit einer hübschen grünen Samttapete bespannt, deren Farbe sich allerdings mit der des Lehnstuhls biss. Zwei mit Goldfirnis überzogene sizilianische Spiegel schmückten die Wand rechts und links vom Kamin. Die Schubladen des Aufsatzschranks waren mit elfenbeinernen, sicher wertvollen Knäufen versehen. Ihre Pendants fanden sich an den Seiten eines ovalen Weinkühlers wieder …
»Ich würde Ihnen einen Wagen zur Verfügung stellen, wenn ich einen besäße. Ist aber nicht so.« Rossis Bedauern kam aus ehrlichem Herzen. »Es fällt mir auch niemand ein, bei dem man Sie unterbringen … Billings?« Der Hoffnungsstrahl auf seinem Gesicht erlosch. »Wohl eher nicht.«
»Sie machen sich zu viele Gedanken. Ich kann gut für mich selbst sorgen«, erklärte Cecilia im klaren Bewusstsein, dass sie Unsinn redete. Sie besaß noch exakt drei Dinare.
»Die Gasthöfe sind rammelvoll. Da ist um diese Zeit nichts zu …«
»Die Leute warten, Rossi.« Der Fette vom Vorabend hatte den Kopf ins Zimmer gesteckt. Sein Bulldoggengesicht mit den traurig hängenden Wangen entblößte eine Reihe schwarzer Zahnstummel, als er raunzte: »Raniero, der Idiot, hat seinen Schwager mitgebracht. Die beiden sind auf Ärger aus.«
»Die Zimmer sind ab Juni für den ganzen Sommer ausgebucht«, murmelte Rossi. »Evelina Pompeo?« Er maß Cecilia mit einem abschätzenden Blick und schüttelte den Kopf. »Signora Secci …« Während er ins Leere starrte, ließ er seine weiblichen Bekannten Revue passieren. »Was ist mit Enrichetta, Bruno?«
»Was soll mit der sein?«
Der Giudice stand auf, ging in den Flur und zog den roten Talar vom Nagel. Er passte zu seiner schäbigen Kleidung etwa so gut wie ein goldener Sattel auf einen Zugochsen. Umständlich schob er sich in die Ärmel. »Weißt du, ob Enrichetta ihren verdammten Grenzstein zurückgesetzt hat?«
Der Fette schnaubte verächtlich. »Für die ist der Streit die Sahne auf dem Keks. Die geht vors Appellationsgericht. Die geht bis zum Granduca – Gott segne ihn – und verflucht dabei Ihren Namen. Was ist denn los, wenn ich fragen darf?«
Rossi band die Haare im Nacken zu einem Zopf und stülpte sich die silbergraue Allongeperücke über den Kopf. Er musste geübt darin sein, sich selbst anzukleiden, denn sie saß perfekt auf seinem Kopf, ohne dass er den Wandspiegeln auch nur einen Blick gegönnt hätte. Sie stand ihm.
Draußen auf der Straße war es lebendig geworden. Leute begrüßten einander. Ein Esel schrie, sein Besitzer brüllte in gleicher Tonlage … Platz da, Platz da. Etwas krachte zu Boden, jemand pfiff ein Lied. Das Durcheinander eines anbrechenden Tages.
»Man sollte sich beeilen«, mahnte der Dicke.
Rossi stützte sich mit beiden Händen auf dem Tisch ab und starrte Cecilia an. Sie starrte zurück. Er seufzte. Sie seufzte nicht, denn sie hatte eine gute Erziehung genossen.
»Wie es scheint und wenn Ihnen nicht noch etwas einfällt, sitzen Sie hier fest, Cousine. Dann darf ich Sie wohl bitten, in der kommenden Woche mein Gast zu sein?«
Cecilia zögerte einen Moment, als sie in der Tür stand. Es war ungewohnt für sie, allein auf die Straße zu gehen. Stefana und meist auch Ariberto, Großmutters erster Lakai, hatten sie begleitet, wenn sie in Florenz das Haus verließ. Aber der Richter war beschäftigt und würde ihr wohl auch kaum jemanden zur Seite stellen, und sie hatte keine Lust, die nächsten sieben Tage im Innern dieses grässlichen Hauses zu verbringen. Sie trat in den Sonnenschein.
Der Tag versprach, heiß zu werden, wie alle Tage, seit der Sommer über die Toskana hereingebrochen war. Aus dem rosa Haus mit den lächerlichen Türmchen und Balkonen – offenbar der Gerichtssaal des Städtchens – ertönte Gelächter, das von Brunos tiefer Stimme beendet wurde. Er drohte jemandem mit einem Tritt in den Hintern, wenn er sich nicht schleunigst setze. Und: »Ruhe bitte!« Eine Frau beschwerte sich, dass ein Hund unter ihre Bank gekackt hatte. Jemand fand, dass die bekackte Bank zu dem bekackten Gericht passe. Im Kaffeehaus, das dem Gericht gegenüber lag, lasen gut betuchte Müßiggänger die Gazetten. Am Rande des Platzes fegte ein Mann in Lumpen Stroh zusammen.
Cecilia schlenderte die Gasse hinab, fort von der Gerichtsverhandlung. Der Ort war um einiges größer, als sie vermutet hatte, und er summte vor Geschäftigkeit. Sie sah eine Frau, die in einer Gartenlaube aus einem Trog mit geschmolzenem Hammelfett Kerzen zog. Ein Polsterer stopfte einen Sattel aus, im Haus nebenan zogen mehrere Wagner mit Zangen einen Metallreifen aus der Glut. Jemand schälte Berge von Karotten und Rettich, vielleicht für eine Garküche.
Die Häuser waren alt und die Mauern so oft ausgebessert, dass man die Jahrhunderte an den unterschiedlich verwitterten Steinen ablesen konnte. Putz und alte Farbe bröckelte von den Fassaden. Doch überall sah sie Blumen. Sie wuchsen in den Gärten, aber auch in Töpfen und alten Stiefeln und in allen möglichen anderen Gefäßen. Nett, dachte Cecilia und wunderte sich, warum sie nicht angeödet war.
In einer der Gassen entdeckte sie einen Kolonialwarenladen. Einen gewissen Luxus gab es also auch hier. Doch der hochtrabende Name, der sie ins Ladeninnere lockte, täuschte. Auf einfachen Tischen wurden billige Stoffe angeboten, in einem Regal lagen Hüte mit verstaubten Federn und Stoffblumenarrangements aus einem vergangenen Jahrhundert. Ein Sondertisch diente als Ablage für gebrauchte Perücken, ein zweiter hielt Puderbläser bereit. Aus den Schubläden in der Ladentheke, wo ein hoffnungsfroher Vorbesitzer einmal Kakaobohnen und Vanilleschoten aufbewahrt haben mochte, quollen Haubenbänder, Kordeln und Quastenborten.
»Signore Mencarelli schneidert auch«, sagte die blasse, scharfäugige Frau, die den Laden von einem Hocker aus überwachte.
»Wie bedauerlich. Ich bin nur wenige Tage im Ort. Zu kurz, als dass sich eine Anprobe lohnte.« Cecilia vermied es, das abgewetzte Kleid anzusehen, das die Verkäuferin trug, und wie immer, wenn sie heuchelte, stieg ihr die Röte in die Wangen.
»Ja, das ist wirklich schade.« Die Frau lächelte, und Cecilia entfloh ins Sonnenlicht. Sie hatte genug vom Spazierengehen. Außerdem wurde die Hitze langsam lästig. Unter ihren Achseln breitete sich klebriger Schweiß aus. Sie machte sich auf die Suche nach dem Marktplatz, was schwieriger war, als sie angenommen hatte. Die Gassen mit ihren Treppchen und kleinen Plätzen bildeten ein verzwicktes Labyrinth, das sie noch zwei weitere Male vor das Stoffgeschäft führte. Sie wollte gerade hineingehen, um sich nach dem Weg zu erkundigen, als sie quäkende Kinderstimmen hörte.
»Ziegenfloh, Ziegenfloh. Feine Sachen, Kopf voll Stroh! Ziegenfloh, Ziegenfloh. Feine Sachen …«
»Selbst Kopf voll Stroh«, brüllte ein selbstbewusstes Stimmchen. »Und … ihr seid mir viel zu blöd. Und … trampelig. Und …«
»… Ziegenfloh … Kopf voll Stroh …«
Cecilia lugte um die Häuserecke. Die Kinder hatten sich in einem verwilderten Obstgarten versammelt. Eines von ihnen, ein vielleicht achtjähriges Mädchen, stand mit verschränkten Armen auf einem Baumstumpf, die anderen umringten es und tanzten durch das Unkraut, das fröhlich um ihre dünnen Beine fegte. Eine zerbrochene Zaunlatte diente als zusätzliches Vergnügen, indem sie es wie bei einem Hindernisrennen übersprangen.
Das Mädchen auf dem Stumpf reckte das Kinn. »Solche wie euch seh ich gar nicht«, log es stolz.
»Lumpenkönigin!«, krähte einer der Jungen, womit wahrscheinlich das erste wahre Wort in diesem Streit fiel. Das Opfer seiner Schmähsucht trug eine elegante Robe aus weiß-blau geblümter Seide, die der Schneider zweifellos kreiert hatte, um sie à la polonaise, mit Seitenposchen, zu tragen. Da die Poschen fehlten, fiel der Rock in grotesken Wellenlinien bis auf die Füße des Mädchens. Zerrissene Rüschen baumelten wie Trauergirlanden herab. Die schmutzigen rosa Schuhe hatten sich in den Resten des Saums verheddert.
»Gossenpack!«, konterte das Mädchen die letzte Beleidigung. Der Junge begann, Unkraut auszurupfen und damit zu werfen, aber die Kleine hielt stolz auf ihrem armseligen Thron aus.
Eines der Kinder blickte sich nach neuer Munition um und entdeckte Cecilia – und damit war das Spiel beendet. Kreischend stoben die Jungen und Mädchen davon und ließen die Lumpenprinzessin auf ihrem Thron zurück.
Es war Grazias Tochter, daran bestand kein Zweifel. Die Stimme gehörte zu dem Mädchen, das am Morgen die krause Geschichte über die Fische und die Welle erfunden hatte. Aber war das tatsächlich möglich?
Cecilias Erinnerung an ihre Großcousine beschränkte sich auf wenige Besuche in der Kindheit, bevor Großmutter Bianca sich mit ihrem Bruder zerstritten und das familiäre Band zerschnitten hatte. Fest stand jedoch, dass Grazia schön gewesen war. Sie war einige Jahre älter gewesen als ihre damals noch sehr kindliche Cousine, und damit als Spielgefährtin ungeeignet. Doch Cecilia konnte sich noch gut an den Stich der Eifersucht erinnern, den es ihr versetzte, als sie Grazia am Speisetisch gegenüber saß: rabenschwarze, reizend gekringelte Locken, die sich in die Frisur fügten, als hätte Gott selbst sie als Krone erdacht. Die warmen, strahlenden tiefbraunen Augen. Das Lächeln. Und – was vielleicht am schlimmsten war – Grazias natürliche Freundlichkeit, die jedem Versuch, ihr einen Makel anzuheften, von vornherein das Wasser abgrub.
Der Tochter hingegen waren sowohl Schönheit als auch Freundlichkeit vorenthalten worden. Schwarze Wildkatzenaugen blitzten Cecilia misstrauisch an. Die borstigen, ungekämmten Haare, die dringend einer Wäsche und eines Schnitts bedurften, standen in alle Richtungen. Unglückseligerweise hatte die Natur dem Kind auch noch ein dreieckiges Gesicht gegeben, sodass es – selbst bei nachsichtigster Betrachtung – mehr einem Äffchen als einer jungen Dame ähnelte.
Und äffchengleich sauste es plötzlich los. Es wich Cecilias impulsiv ausgestreckter Hand aus und war verschwunden.
Cecilia schlug die Richtung ein, in die das Kind gerannt war, konnte es aber nicht mehr entdecken. Dafür fand sie sich überraschend doch wieder auf dem Marktplatz. Die Gerichtsverhandlung schien vorbei zu sein. Vor dem Denkmal lungerte ein Bettler, der sein Mittagschläfchen hielt, und einige Frauen standen beieinander und begutachteten gemeinsam einen kleinen, bunten Teppich.
Das Haus des Richters gewann durch das Tageslicht nicht. Ein angelaufenes Messingschild neben der Tür verkündete, dass es sich bei dem Gebäude um den »Palazzo della Giustizia« handelte. Wappen der Amtsvorgänger, die sich über die Hauswand zogen, deuteten auf früheren Glanz. Aber es konnte sich nie um einen Prachtbau gehandelt haben. Die Wände waren schmucklos – kein einziges Ornament! – und die Fensterlöcher schäbige Rechtecke. Wenigstens den Garten könnte man pflegen, dachte Cecilia und ärgerte sich, weil sie sich darüber Gedanken machte.
Sie brauchte nicht zu pochen, die Haustür war angelehnt. Cecilia trat ein und blickte sich suchend um. Durch eine Tür zur Rechten, die ihr bisher noch nicht aufgefallen war, konnte sie über einen kleinen Flur in das Gerichtsgebäude nebenan blicken. Neugierig ging sie die wenigen Schritte. Das rosafarbene Haus schien ehemals ein Theater gewesen zu sein. Im Hintergrund befand sich eine überraschend große Bühne, auf der zwei Tische – sicher für den Richter und seine Beisitzer – standen. Zur Straße hin reihten sich Stühle für das Publikum.
Die Wände waren mit Tapeten beklebt, auf die ein mäßig begabter Künstler Gartenphantasien gemalt hatte. Stuck hatte sich das Städtchen offenbar nicht leisten können, denn man hatte die Decke mit Imitationen aus Papiermaché geschmückt, die sich an einigen Ecken bereits lösten. Schmale Treppen führten zu den beiden Logen hinauf, die man mit Leitern voll gestellt hatte.
Cecilia kehrte ins Wohnhaus zurück.
»Hallo?« Sie schaute in das Speisezimmer, wo immer noch die schmutzigen Tassen vom Frühstück auf dem Tisch standen. »Hallo!« Niemand antwortete ihr.
Sie stieg die schmale Treppe ins Obergeschoss hinauf. Ein verwinkelter Gang führte zu den Zimmern. Cecilia öffnete die Türen eine nach der anderen. Ein Abstellraum voller Besen, ein weiterer Abstellraum, der ehemals ein schönes, sonniges Zimmer gewesen war, nun aber als Möbellager diente. Und schließlich ein bewohnter Raum – das Arbeitszimmer des Giudice.
Sie riskierte einen neugierigen Blick. Der Bücherschrank – rotes Holz mit Bleiglastüren – war bis ins letzte Winkelchen mit Büchern voll gestellt, und auch auf dem Boden lagen Bücher. Kleine Türme zu Babel, würde Padre Eliseo sagen, der nichts von Gelehrsamkeit hielt. Ein gestapeltes Vermögen, war Cecilias Meinung, die eine Ahnung hatte, dass beispielsweise der Contract social von Rousseau oder Beccarias Über Verbrechen und Strafe ihr Nadelgeld für einen Monat verschlungen hätten. Hier also hortete Rossi seine Reichtümer.




























