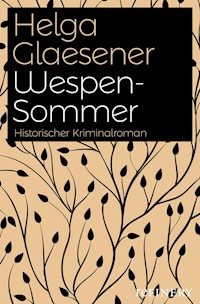8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franzis Ehe ist ein zwanzig Jahre währender Irrtum. Als sie plötzlich von ihrem Mann verlassen wird, sitzt der Schock tief. In der ostfriesischen Provinz will sie sich erholen. Dort lernt sie Karl kennen, den durchtrainierten Sportlehrer, und Ocke, den gutsituierten Bürgermeister. Die beiden balgen sich um sie. Doch Franzi will keine Romantik, sondern Rache! Und sie schmiedet einen Plan, der es in sich hat ...
Das E-Book ist vormals unter dem Pseudonym Ida Hansen erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Helga Glaesener
Ein Riesenherz im Friesennerz
Für Claudia, ohne die dieses Buch nie entstanden wäre.
Und natürlich auchdie anderen Lehrer meines Herzens, die über ihrem Schuldienst ergraut sind, aber nie den optimistischen Blick auf ihre Schüler verloren haben.
Kinder sind das Letzte. Im Ernst. Als bei Ingmar und mir vor achtzehn Jahren die Nachwuchsfrage anstand, hatten wir das ausgiebig diskutiert. In ihren ersten Lebensjahren sind sie blond und lockig, haben blaue Kulleraugen und sehen aus, als hätte man sie aus Puderzucker gebacken. Kitsch hoch drei, hat Ingmar gesagt. Das Peinlichste, was Mutter Natur sich ausdenken konnte, gleich nach dem Sonnenuntergang.
Wenn Oma das Kleine nach der Geburt in die Arme gedrückt bekommt, sagt sie: »Ogottogott, ist der …« Nicht cholerisch, weil er die ganze Station zusammenbrüllt, oder clever, weil er auf Anhieb die Sache mit den Brustwarzen kapiert, oder ein kleiner Schwarzenegger, krebsrot vom Kampf ins Leben hinein. Nein, es ist süß. Und sie hat recht. Süß ist das Markenzeichen des kleinen Menschen. Von der Stupsnase bis zu den Murmelzehen. Ein genialer Kunstgriff der Natur, die die menschliche Art ums Verrecken erhalten will.
Ingmar ist Künstler. Er spielt die erste Geige im Herforder Symphonieorchester. Strawinski aus Überzeugung, Mozart und Lehár wegen der Hypothek auf unserem Einfamilienhaus. Aber manchmal muss er an Sister Act ran. Dann schluckt er vor der Probe Magentabletten und schrammt mit dem Wagen das Trafohäuschen an unserer Grundstücksgrenze. Er ist also ein echter Künstler. Und als solcher für das ungeschminkt Ehrliche. Deshalb sind die Wände unseres Hauses unverputzt, und die Heizungsrohre liegen offen. Wie der Mensch sich einrichtet, so ist er, sagt Ingmar. Er hätte es nicht ertragen, etwas um sich zu haben, das unverfroren auf den Faktor süß setzt.
Und das ist gut so. Denn etwa ab dem zweiten Lebensjahr mutieren die Blondschöpfe. Plötzlich klebt ein Schild an ihrer Zimmertür: Hier wohnt der Chef. Es folgt ein tägliches Drama mit Schreiattacken an der Supermarktkasse, wo sie ihre Mütter gegen das Schienbein treten. Mit vierzehn trinken sie sich ins Koma. Mit fünfzehn kriegen sie selbst Kinder, denen sie ihr Zweiwortvokabular aus Scheiße und Arsch beibringen. Mit sechzehn erschlagen sie in der U-Bahn Passanten.
Das Kind, das ich vielleicht bekommen hätte, wenn Ingmar sich nicht – dem Himmel sei Dank – durchgesetzt hätte, wäre jetzt im U-Bahn-Passanten-Mord-Alter gewesen. Es hätte das Auge schweifen lassen auf der Suche nach einem anderen Kind, dem es das Handy abziehen kann, und dabei mit den Fingern den Schlagring in seiner Hosentasche liebkost und überlegt, wie es an mein Erbe kommt.
Glück gehabt, dachte ich. Wenigstens in dieser Sache.
Der Zug, in dem ich saß, fuhr durch Ostfriesland. Hannover – Bremen – Oldenburg – Norddeich Mole. Hinter den staubigen Fensterscheiben sah ich Kühe. Sonst nichts. Kühe scheinen in Ostfriesland ein Endlos-Panorama zu bilden. Du siehst einen grünen Strich, das ist die Wiese. Und einen blauen, das ist der Himmel. Und dazwischen Kühe. Alles sehr übersichtlich. Gut für jemanden wie mich, dem gerade ein Tsunami die Welt in Trümmer gelegt hatte.
Interessanterweise blickten die Kühe alle in dieselbe Richtung. Als wären sie im Kino und stierten auf eine unsichtbare Leinwand, auf der ein barmherziger Rindergott einen für Menschen unsichtbaren Actionfilm ablaufen ließ, in dem Bruce-Hilda dem Bauern, dem Dreckskerl, so richtig die Kante zeigt. Müssen Sie mal drauf achten. Ist wirklich so.
Es knisterte in den Lautsprechern. Der Zugführer erklärte uns auf Deutsch und Plattdeutsch, dass wir demnächst Bad Zwischenahn erreichen würden.
Neben mir saß ein dicker Mann mit Krawatte, der schnarchte. Bei jedem Seufzer zitterte seine Hand auf dem Oberschenkel. Der Junge gegenüber – U-Bahn-Passanten-Mord-Alter – hatte sein iPod aus der Tasche gekramt und zog den Finger mit dem sabbernden Blick eines Süchtigen über das Display. An seiner Seite, sozusagen Auge in Auge mit mir, befand sich eine Frau meines eigenen Jahrgangs. Ihr Mund war verkniffen. Sie trug einen langen Rock aus bunter Wolle und einen selbstgestrickten, ärmellosen Pulli über massigen Oberarmen. In ihrer wiederverwendbaren Jutetasche stapelten sich Ökoäpfel mit braunen Stellen. Sie sah aus wie ein Mensch, der recht hat. Grundsätzlich. Ausnahmslos.
Ich hatte zu lange auf die Kühe gestarrt und merkte erst jetzt, dass meine Reisetasche sie aufregte. Es war voll im Zug. Die Gepäckablage mit Rucksäcken verstopft. In den Gängen standen entnervte Reisende, die auf die Inseln in den Urlaub wollten. Also hatte ich die Reisetasche zu meinen Füßen abgestellt. Ließ sich nichts dran ändern. Aber die Frau war trotzdem sauer. Sie schaute mich an, merkte, dass sie endlich meine Aufmerksamkeit gewonnen hatte, und starrte nachdrücklich zu dem Gepäckstück. Gab mir also, sozusagen nonverbal, ein Signal. Wissen Sie, das stört jetzt wirklich.
Half nur nichts. Gepäckablage besetzt, wie gesagt. Sie versuchte es trotzdem weiter. Immer noch nonverbal. Zog die Füße ein. Stöhnte. Wollte sich strecken … ging aber nicht. Stöhnte. Schaute auf die Reisetasche. Stöhnte.
Wenn Sie mögen, können Sie Ihre Füße auf der Reisetasche abstellen, wie der Junge, wollte ich sagen, aber die Frau merkte, was ich vorhatte, und machte sofort die Lippen schmal und signalisierte mir auf diese Weise – nonverbal, klar –, dass ein Kompromiss für sie nicht in Frage käme.
Ich sah den Schaffner, der die Schiebetür aufwuchtete. Würde sie sich jetzt beschweren? Schafft man so was überhaupt, nonverbal, bei einem Mann, der seit dem Morgen durch die Gänge stapft und Karten entwertet und renitenten Jugendlichen klarzumachen versucht, dass das Schönes-Wochenende-Ticket nur am Wochenende gilt und nur, wenn die Namen eingetragen sind, und dass sie das auch wissen, verflucht?
Die selbstgestrickte Dame versuchte es. Stöhnte. Starrte. Aber der Schaffner knipste unbeeindruckt das Datum auf ihre Karte, und somit ging der Punkt an mich. Trotzdem schaffte das Weib es immer noch, irgendwie im Recht zu sein. Und das war der Moment, da packte mich der Teufel. Ich räusperte mich und sagte mit einem Blick auf die Tasche: »Tut mir leid.« Und dann: »Ich wusste nicht, dass die Züge hier mitten in der Woche so voll sind, ich komme nämlich von außerhalb.« Und dann: »Ich bin Witwe. Mein Mann ist gestorben. Montag vor einer Woche.«
Das saß. Witwe. Hammerhart. Mit Witwe hast du eine Wirkung wie mit einem Keulenschlag. Die Arme ist Witwe. Entsetzlich. Das Wort macht glauben, dass gerade eine Pretty-Woman-Geschichte grausam zu Ende gegangen ist. Jahre voller Glück und inniger Zärtlichkeit, der Blick in eine paradiesische Zukunft gerichtet – und peng, alles von der Faust das Schicksals zertrümmert.
Wenn man bedenkt, dass sich ungefähr 82,7% aller Eheleute scheiden lassen, und dann noch mal die 50,8% dazunimmt, die’s noch aufschieben, weil sie argwöhnen, dass ein Wust an Papierkram auf sie zukommen könnte, dann sollte man meinen, die Inserenten von Traueranzeigen bekämen körbeweise Glückwunschkarten vor die Tür. Ist aber nicht so. Ich bin Witwe … Da setzt der Verstand aus. Und der Fluchtinstinkt ein.
»Mein Beileid«, sagte die Frau. Nächster Halt war Westerstede-Ocholt. Sie packte ihre Ökoapfeltasche und drängelte sich durchs Abteil. Aber sie stieg nicht aus. Das sah ich, als ich den Bahnsteig überblickte. Wahrscheinlich war sie nur ein Abteil weiter, wo sie von nichts Schlimmerem belästigt wurde als von Handygeplapper und Bierdosengeschepper.
Ich starrte wieder auf die Wiesen. Die Häuser, die jetzt gelegentlich auftauchten, sahen aus, als hätten sie schon beim Bau des Regionalzuges, in dem ich saß, eine Renovierung nötig gehabt. Der Anblick deprimierte mich. Heike, meine Cousine, die blöderweise nach Kanada ausgewandert war und meinen Kummer wegen Ingmar deshalb telefonisch therapieren musste, hatte gesagt: Warum ausgerechnet Ostfriesland? Hannover wäre prima. Da kannst du tagelang um den Maschsee rennen, was erwiesenermaßen gut gegen Kummer ist. München würde auch gehen, wegen dem Panorama. Oder Paris. Lauter Kerls mit knackigem … Na gut, nicht Paris. Aber Prag …
Ich hatte zu ihr gesagt: Das verstehst du nicht. Konnte sie auch nicht, weil sie keine Postkarte von meinem Bruder Norbert bekommen hatte. Der wohnt in Ekelborn, das liegt zwischen Aurich und Leer. Und auf der Karte, mit der er mir zum Geburtstag gratuliert hatte, waren die Kühe auf den Wiesen zu sehen gewesen, und darunter hatte gestanden: Ostfriesland, das Urlaubsparadies, in dem die Zeit stehen bleibt. Und als ich wieder denken konnte – nicht Montagabend, sondern acht Tage später, mit drei Aspirin und einem Zahnputzbecher Eierlikör im Blut –, hatte ich mir gedacht: Mensch, das ist es.
Ich sehe es nämlich so: Wenn du Witwe wirst, dann kommt was über dich. Dieser Mensch vom Max-Planck-Institut in München, der Sebastian Deisler gegen Depressionen behandelt hat, würde es ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn nennen. Heike einen Scheiß, aber das wird schon wieder. Ich nenne es Vergeudung. Von Zeit.
Wenn du nämlich in diesem chemischen Ungleichgewicht aus Scheiß, aber das wird schon wieder steckst, dann setzt dein Leben aus. Der Film bleibt stehen. Plopp. Die Zeit verstreicht aber trotzdem. Du reißt ein Blatt vom Kalender ab und noch eins und noch eins, und du kannst am Papierkorb nachmessen, wie dein Leben verrinnt, während in deinem Kopf die Chemie rumstümpert und dein Leben aussehen lässt wie ein Hundehäufchen.
In den wenigen klaren Momenten begreifst du aber, dass du die Blätter nicht hinten wieder anhängen kannst. Sie sind weg. Vergeudet. Es ist, als wenn du beim Fußball-Weltmeister-Endspiel auf der Ersatzbank sitzt. Oder beim Klassentreffen neben der Langweilerin, die dir von ihrem Goslarurlaub erzählt. Das Leben findet statt, nur leider ohne dich. Das hat mich erschreckt, trotz Aspirin und Eierlikör.
Und da ist mir die Geburtstagskarte eingefallen. Ostfriesland, das Urlaubsparadies, in dem die Zeit stehen bleibt. Ich hatte es schwarz auf weiß. Es gab einen Flecken Erde, der meinem seelischen Zustand angemessen war, wo ich vom Scheiß zum Jetzt-wird-es-wieder trudeln konnte, ohne dass mein Papierkorb an verlorener Zeit überquoll. Ja, so hatte ich mir das überlegt. Und als ich in Leer meine Reisetasche aus dem Zug wuchtete, war ich überzeugt, völlig richtig zu handeln.
Ich schaute mich nach Norbert um, in der Hoffnung, dass er mich abholen würde. Aber er war nicht da. Nur ein Hund, der an dem Zaun neben der Bahnhofshalle sein Bein hob. Man möchte staunen, wenn man sieht, worüber der Mensch in Tränen ausbrechen kann.
»Wieso abholen?«, fragte Norbert, drückte dem Taxifahrer einen Schein in die Hand und bugsierte mich verdutzt durch den Windfang in seine Küche aus Buche-hell mit blauen Kanten.
»Weil ich dir doch geschrieben habe.«
»Hast du nicht.«
»Hab ich doch.«
»Hast du …«
»Nun lass sie erst mal«, sagte Geli, meine Schwägerin, die aus dem Wohnzimmer gekommen war. Sie hatte goldblonde Struwwelhaare, um die ich sie glühend beneidete, und ein gutes Herz. Glaubte ich jedenfalls. Wir hatten nie viel Kontakt gehabt. Ingmar fand die beiden spießig, und was sie selbst von uns hielten … Na ja. Unsere nackten Heizungsrohre hätten mit der putzigen gelben Porzellan-Entenfamilie auf der Fensterbank kaum harmoniert. Gelis Hände füllten den Wasserkocher mit Wasser und suchten Teebeutel aus einer Holzschachtel. »Roibusch Kirsche oder Schwarz?«
»Ja«, brummte ich.
»Du kannst auf eine Oder-Frage nicht mit Ja antworten«, sagte Norbert, und ich merkte, wie nervös ich ihn machte, sicher wegen der verheulten Augen. Mit Emotionen kommt er nicht klar. Er hat mir mal die Schulter getätschelt, als ich meinen ersten VW Golf zu Schrott gefahren hatte. Das war der heftigste Gefühlsausbruch, den ich je bei ihm erlebt habe.
»Lieber Kirsche«, sagte ich.
»Und?«
»Und was?«
»Warum bist du hier?«
»Na, weil sie uns besuchen möchte.« Geli lächelte mich entschuldigend an und griff im Kühlschrank nach der Teesahne.
»Ich sehe, dass sie uns besuchen will, aber …«
»Ingmar ist gestorben«, sagte ich. Damit war es raus und zum Teufel mit allen Umständlichkeiten.
»O Gott«, sagte Geli.
»Wieso das denn?«, fragte Norbert.
Ich hatte meine Tränen auf dem Leeraner Bahnhof vergossen und war zu müde, um seinen Mangel an Feingefühl zu kompensieren. »Er ist eben tot.«
»Aber … Ich meine: Wann? Und woran ist er gestorben?«
»Es war was mit dem Herzen.«
Mein Bruder saß mir gegenüber und versuchte, sein Gehirn auf Trab zu bringen. Das kann man bei ihm sehr schön beobachten. Er zuckt dann mit der linken Nasenwand und sein Adamsapfel wölbt sich vor. »Beileid«, brachte er schließlich raus. »Wann ist denn die Beerdigung?«
»War schon.«
»Was soll das heißen: War schon? Willst du etwa sagen, dass die Beerdigung bereits …«
Ich nickte.
»Franzi, also wirklich! Ich bin dein Bruder. Da sagt man Bescheid, wenn jemand … damit mein ich den Ehemann, mein eigener Schwager sozusagen …«
»Ich hab dir geschrieben«, log ich. »Und … es ging auch alles so schnell. Und mir war nicht nach Gesellschaft zumute.«
»Aber wenn jemand aus dem engsten Kreis der Familie stirbt …«
»Nun lass sie doch erst mal«, sagte Geli.
»Aber …«
»Lass sie!« Geli bekam eine steile Falte zwischen den Augen. Da hielt er endlich den Mund.
Eine Viertelstunde später lag ich in frischer Bettwäsche in einem Zimmer mit weißen Deckenpaneelen. Über mir, neben der Deckenleuchte, schwang sich ein hölzerner Peter Pan in wildem Flug. Ich starrte ihn an und fühlte mich wie ein ausgewrungener Waschlappen.
Die nächsten vier Tage verbrachte ich im Bett. Stumpf gegen alles, was um mich herum geschah, zog ich mir rein, was der Mini-uralt-Fernseher des Gästezimmers zu bieten hatte. Ich sah, wie der Bauer sich eine Frau krallte, wie die Supernanny die Kinder der beiden zu bändigen versuchte und wie Richterin Salesch sie als jugendliche Rotznasen schließlich in den Knast brachte, nachdem die Therapie bei Frau Kallwass gescheitert war. Wahrscheinlich waren es gar nicht die gleichen Kinder. Aber ich beglückwünschte mich nach jeder Sendung, dass Ingmar so entschiedene Ansichten zum Thema Nachwuchs gehabt hatte. Soweit ich überhaupt die Energie zu einer emotionalen Regung aufbrachte.
Geli – sie arbeitete in einem Tante-Emma-Laden oder so, hatte aber wohl gerade frei – versorgte mich mit Essen. Und schließlich kam Norbert und wollte wissen, ob ich Hilfe beim Papierkram bräuchte.
»Was?« Ich setzte mich im Bett auf, ein bisschen unwillig, weil Richterin Salesch gerade einen impertinenten Stinker fertigmachte, der – ja, denkste denn, wir merken nicht, was los ist!!! – die Eidechse seiner Freundin durch die Ritzen eines Kanaldeckels entsorgt hatte und das kaltschnäuzig bestritt. Zugegeben, das Niveau hätte Ingmar nicht gefallen, aber wo ich einmal drin war in der Handlung …
»Entscheidungen, die Versicherungen und Rentenangelegenheiten und Ähnliches betreffen, sollten zeitnah erledigt werden«, sagte Norbert. »Es gibt Fristen, die der Begünstigte einhalten muss.« Er arbeitet bei dem Wasser- und Schifffahrtsamt in Aurich, wahrscheinlich redete man dort so. »Franziska?«
Ich zog die Decke unters Kinn und sagte ihm, dass er störe. Da trollte er sich. Kurz darauf fragte Geli mich, ob ich Ole am nächsten Morgen zur Schule bringen könnte.
»Wen?« Ich war verwirrt. Dann fiel es mir wieder ein. Ole war ihr Sohn. Ich war ihm mal auf dem Weg zum Klo begegnet, wo er mich angestarrt hatte. Irgendwas Dürres, Stummes, das mir bis knapp zur Brust reichte.
»Normalerweise habe ich die Sache im Griff«, erklärte mir Geli und setzte sich auf die Bettkante. »Meine Freundin Esther hat auch einen Kleinen. Wir haben einen Plan, nach dem wir uns mit der Betreuung abwechseln. Aber der funktioniert gerade nicht, weil meine Vierhundert-Euro-Kraft vom Teeladen einen Bänderriss am Knie hat und Esther die Schwiegermutter zu Besuch.«
Andere Leute hatten auch Sorgen. Komisch, wie mir das aus dem Blickfeld geraten war. »Klar bring ich Ole.« Ein Kind zur Schule zu transportieren sollte kein Thema sein. Geli legte mir seit Tagen Radieschen in Rosenblütenform aufs Leberwurstbrot. Da konnte man sich schon mal revanchieren.
Es war Norbert, der mich am nächsten Morgen aus dem Bett warf. »Hör mal, wenn du sagst, dass du eine Aufgabe übernimmst, muss man sich auch darauf verlassen können. Sonst hat es ja keinen Sinn, irgendwelche Absprachen …«
»Nun lass sie doch«, brüllte Geli von unten aus der Küche.
»Wenn man das Leben meistern will, braucht man Ordnung«, flüsterte Norbert, fest entschlossen, dem Wabbel aus Emotionalität, der ihm entgegenschwappte, etwas Handfestes entgegenzusetzen. »Wir sind kein Künstlerhaushalt, Franziska. Bei uns ist das anders als bei euch. Ohne Verlässlichkeit läuft gar nichts. Geli und ich kommen nur zurecht, weil wir unser Leben perfekt durchorganisiert haben.« Er ist zwei Jahre älter als ich und Verlässlichkeit sein Steckenpferd. Wenn das, was meine Mutter erzählte, stimmt, hat er im Sieben-Stunden-Rhythmus in seine Windel geschissen. Konnte man die Uhr nach stellen. Darauf war sie stolz gewesen. Er auch.
Dass ich einen Künstler heiratete, einen Musiker, der fast ausschließlich aus Gefühl bestand, hatte Norbert als persönlichen Affront gesehen. Deshalb hatten wir uns nach der Hochzeit auch kaum noch getroffen. Das letzte Mal bei der Beerdigung meiner Mutter, von der ich nur noch die Blicke in Erinnerung habe, mit denen Norbert Ingmars rostroten Anzug musterte.
Egal.
Ich kroch aus dem Bett, mogelte mich an der Dusche vorbei und schlüpfte in die Jeans und das frische Shirt, das Geli taktvoll auf dem Stuhl in meinem Zimmer drapiert hatte. Ole wartete im Flur auf mich. Ein Knirps von sieben Jahren mit knotigen Knien in streichholzdürren Beinen und einer Riesenbeule in der Tasche seiner kurzen Hose.
»Franzi bringt dich zur Schule und holt dich wieder ab«, sagte Geli.
Wir nickten beide. Ole bekam einen Kuss, ich eine Umarmung. Dann machten wir uns auf den Weg. Die Sonne schien, und in der Luft lag der Staub der gemähten Felder, die sich kilometerweit hinter der Straße ausbreiteten. Überall piepsten Vögel. Vogelpiepsen ist Mist, wenn man gerade seinen Ehemann verloren hat. Sonne auch. Zum Glück war Ole keine Plaudertasche. Wir marschierten ungefähr fünf Minuten stumm nebeneinander her. Dann fragte er: »Weißt du, was ein Triceratops ist?«
»Keine Ahnung.«
»Er hat drei Hörner. Ein kleines auf der Nase und zwei große. Er ist riesig. Wie ein Panzer. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Der frisst nur Pflanzen.«
»Ach so«, sagte ich.
Weitere himmlisch ruhige Minuten verstrichen. Dann fragte Ole: »Gehen wir gar nicht zu meiner Schule?«
Ich blieb stehen. »Wieso?«
»Ja, weil: Die Schule ist doch da, wo die Häuser sind. In der Stadt. Weißt du gar nicht, wo die Schule ist?«
»Nein.« Ich schaute in den lichtblauen Himmel und dann zum Horizont, wo die Kühe wieder Bruce-Hilda schauten, und seufzte. »Wo geht’s denn lang?«
Wider Erwarten kannte Ole sich aus. Wir bogen auf einen Feldweg ab, liefen an einer gemähten Wiese mit roten Mohnblumen vorbei, erreichten ein zweites Neubaugebiet und dann die älteren Häuser von Ekelborn und die Einkaufspassage. Wir kamen zu spät, natürlich. Und irgendetwas in mir rührte sich, als Ole stoisch durch die Glastür der hässlichen, mit grellen Farben auf gute Laune getrimmten Flachdachschule verschwand. Bekam er jetzt Ärger? Schob er die Verspätung auf die Tante? Oder setzte er sich souverän über alles hinweg? Quatsch, kein Kind ist souverän. Sah man doch bei der Supernanny. Ich seufzte.
Die nächsten vier Stunden vertrödelte ich in einem Café mit Backwaren- und Süßigkeitenverkauf, weil ich nicht die Kraft hatte, nach Hause zu gehen. Die Maschine, die in meinem Gehirn mit der Chemie experimentierte, verbrauchte Unmengen an Energie. Was blieb, reichte gerade, um alle dreißig Minuten einen frischen Cappuccino zu bestellen.
Als die vier Stunden vorüber waren, wusste ich, dass das Ekelborner Bildungszentrum aus drei Schulen bestand. Keine Ahnung, vielleicht war es auch eine einzige, die sich auf drei Komplexe verteilte. Jedenfalls waren die Gebäude durch Mauern und breite Wege und einige Einfamilienhäuser und eine Turnhalle voneinander getrennt.
Zuerst wurden die Kinder aus dem grauen Betonbau, der wie von meinem Herforder Haus inspiriert wirkte, in die Freiheit entlassen. Die Mädchen steckten in engen Tops und Röcken, die nur mit Mühe über die Hintern passten, und hatten Mascara um die Augen, als wollten sie zum Mitternachtsball der Vampire. Die Jungs trugen weite Jeans und spuckten auf den Gehweg.
Nach einer Viertelstunde kamen die Kinder aus dem Ziegelbau, der vom Café am weitesten entfernt lag. Und dann die Grundschüler. Ich musste Ole hinterherrennen, weil er vergessen hatte, dass ich ihn abholen würde. »Wie war’s?«, fragte ich. Er hatte einen Schulkameraden bei sich. Einen Knirps, etwas kleiner als er selbst, bei dem Mutter Natur vergessen hatte, das süße blonde Kraushaar in schwarze Borsten zu verwandeln. »Kann Arnold mitkommen?«, wollte er statt einer Antwort wissen.
Tja, konnte er? Der Nachteil, wenn man selbst keine Kinder hat, ist, dass man die Regeln nicht kennt. Was dürfen sie, wenn sie ungefähr sieben Jahre alt sind? Kann man einen Arnold einfach einsacken? Ist alles lässiger, heutzutage? Besitzen die Kids Handys, mit denen sie ihre Mütter informieren? In sieben Jahren würde Arnold Vater sein, da musste man sich mit dem Erwachsenwerden wohl beeilen. Andererseits …
»Er muss zu Hause fragen!«, bestimmte ich.
»Oder kann mit ich zu Arnold? Der hat einen Spinosaurus. Braun mit Flecken und mit einem Kamm auf dem Rücken. Und weißt du, was das Coolste ist? Beim Fressen, wenn er in ein Tier reinbeißt, tut er das so wild, dass das Blut spritzt.«
Arnold nickte mit glänzenden Augen. Liebes bisschen, dachte ich. Kinderhorden drifteten um uns herum wie die Flut um den Fels der Kopenhagener Meerjungfrau. Ich rang mich zu einer Entscheidung durch. »Arnold fragt seine Mutter, und morgen kann er mit, okay?«
Wider Erwarten gab es keinen Kampf. Vielleicht waren die Jahre zwischen Kassenquengler und junger Vater der Entspannung gewidmet. Weiterer Trick von Mutter Natur, um das Überleben der Brut zu sichern. Arnold winkte und rannte davon. Ole zeigte mir den Weg nach Hause. Kurz vor der Tür sagte er: »Mein Turnbeutel ist weg.«
»Ist das schlimm?«
»Nö«, meinte er.
War es aber doch. Als Norbert davon hörte, abends beim Essen, fand er, dass ein Kind mit sieben Jahren gelernt haben müsse, auf seine Sachen aufzupassen. »Das ist doch wahrhaftig nicht zu viel verlangt.«
»Meine Güte«, sagte Geli, die gerade versuchte, das Angebrannte von den Schnitzeln in der Pfanne zu kratzen. »Ole passt prima auf. Jedenfalls meist. Und wir vergessen doch auch mal was.«
»Ich nicht«, sagte Norbert, was ich hundsgemein fand, weil es stimmte. In sein Gehirn war ein elektronischer Bürohengst integriert, der alles, was sich normale Menschen mit dem Kuli auf den Arm notieren, speicherte und punktgenau zum perfekten Zeitpunkt wieder ausspuckte.
Norbert begann mit seinem Lieblingsvortrag: Ordnung ist das halbe Leben, und die andere Hälfte besteht aus einer Balance aus energischem Zupacken und konzentrierter Entspannung. Geli balancierte die angekohlten Schnitzel zum Tisch und verdrehte die Augen. Ich schaute zum Fenster hinaus. Die Dämmerung war hereingebrochen, und die untergehende Sonne steckte die Felder in Brand. Gelbe und rote Feuerbänder leuchteten unter einem tiefblauen Himmel. Eine Allee zeichnete sich wie ein kilometerlanger Schattenriss gegen die Farben ab. Es war ein ähnlicher Anblick, wie man ihn durchs Fenster hinter meinem Schreibtisch beobachten konnte, wenn ich noch spät arbeitete.
»Tante Franzi …« Ole stupste mich an. Er hatte aus einer Ketchup-Tube Linien auf seinen Teller gedrückt. »Siehst du, was das ist?«
Ich riss mich vom Abendhimmel los und schüttelte den Kopf.
»Ein Spinosaurus. Wie der von Arnold. Das hier …«, er deutete auf einen besonders dicken Klecks, »ist das Blut aus seinem Maul.«
Ich nickte, und dann entschuldigte ich mich, was niemand mitbekam, weil Norbert den Schweinkram auf Oles Teller entdeckte und Zeit in seine Tischmanieren investierte. Ich ging aufs Klo, schloss die Tür, setzte mich auf den Klodeckel und begann zu heulen. Ich vermisste Ingmar. Ich vermisste ihn so sehr, dass ich auf meinen Fingerknöchel biss.
Rückblende: Es war kurz nach unserer Hochzeit. Wir hatten eine dreitägige Minihochzeitsreise nach Wangerooge hinter uns – von meinen Eltern als Hochzeitsgabe spendiert – und waren wieder daheim in unserer Zweizimmerwohnung. Der Urlaub hatte unsere Ersparnisse dahinschmelzen lassen, und wir aßen an unserem wackligen Küchentisch mit dem tiefen Ratscher in der Mitte ein Käsebrot.
»Ich liebe dich«, sagte ich, aber irgendwie klang es anders als früher, und ich wusste auch, warum. Die Reise natürlich. Wir hatten unsere Hochzeitsspaziergänge bei Nieselregen unternommen – was jeden Hauch von schmalziger Romantik im Keim erstickte –, aber trotzdem hatte Ingmar das Unternehmen irritiert. Schon das Wort Honeymoon-Suite (so wurde unser Zimmer genannt) war geeignet gewesen, ihn zu reizen. Er fand die mit goldenen Eheringen bestickten Samtkissen auf unserem Bett grauenhaft, und über den Blumenstrauß mit der herzchenübersäten Glückwunschkarte, den uns der nette Portier ins Zimmer gestellt hatte, hätte es fast einen Streit gegeben.
Nun sah ich, wie er zu seiner Geige schielte, um sich damit zum Üben ins Schlafzimmer zu verziehen. Ein paar Tonleitern und ein bisschen Zwölftonmusik, um die Atmosphäre zu reinigen. Ich wusste, was er dachte: Ich bin kein spießiger Ehemann, sondern ein Künstler. Ich liebe Franzi, aber ich wünschte, ich könnte diese ganze peinliche Ehe-Angelegenheit vergessen.
Aber er musste wohl etwas in meinem Gesicht gelesen haben, denn plötzlich öffnete er die Balkontür. Draußen fand gerade ein Sonnenuntergang statt wie der vor Gelis Küchenfester und später in meinem Arbeitszimmer. Jetzt haut er ab, dachte ich. Doch stattdessen schnappte er sich die Geige, zog mich auf den Balkon – und begann Perhaps Love zu spielen.
Perhaps Love ist Superkitsch, sogar dann, wenn es von Placido Domingo gesungen wird. Zufällig war es auch mein Lieblingsstück, und Ingmar hatte sich daran erinnert. Ich musste mir Tränen der Rührung verkneifen, als ich meinen frischgebackenen Ehemann anschaute. Ingmar sah anbetungswürdig aus mit seinen schwarzen Kraushaaren und dem stillen Ernst, mit dem er den Bogen über die Saiten zog. Und dazu der flammende Himmel über dem mit Efeu überwucherten Mülltonnenschutzdach …
Ich starrte auf Gelis Tampondöschen für Gäste und dachte: Scheiße ... Scheiße! Und hatte plötzlich das himmelserbärmlichtraurige Bedürfnis, auf Ingmar einzuprügeln. Er sollte nicht fort sein. Das gab’s doch gar nicht. Wie hatte er es fertigbringen können, sich aus meinem Leben zu stehlen? Einfach so! Das war doch … einfach scheiße, hundsgemein …
Geli, die mich eine Viertelstunde später im Flur abfing, nahm mich in die Arme, und ich sagte noch einmal: »Scheiße«, und da zog sie mich auf die Terrasse.
Nachdem sie mich auf den bequemsten Stuhl verfrachtet und mir eine Decke um die Schultern gewickelt hatte, holte sie eine Flasche Wein, goss die Gläser voll und sagte: »Das mit Ingmar tut mir schrecklich leid.«
Pause.
Als sie merkte, dass ich über das Thema nicht reden wollte, hielt sie einfach die Klappe. Geli war schon besonders, komisch, dass mir das erst jetzt auffiel. Wir starrten in die Flamme einer dicken Honigwachskerze und hörten den Grillen zu, die hinter dem Garten in den Wiesen zirpten. Es war immer noch warm. Der Abend roch nach Ferien und Nachtblumen und der Honigkerze, und langsam beruhigte ich mich. Ingmar hätte das Ambiente schnulzig gefunden. Na und? Ich versuchte, ihn aus meinem Kopf zu verbannen. »Wie sieht’s denn bei dir aus?«, fragte ich.
Geli zog die Schuhe aus, legte die Füße auf einen freien Stuhl und erzählte mir, dass ihr Teeladen auf die Einnahmen in den Sommermonaten angewiesen war. Die Touristen kauften ostfriesischen Tee wie verrückt. Es war ein Souvenir, das nicht irgendwann auf einer Anrichte verstaubte, sondern mit dem Umweg über das Verdauungssystems in der Kanalisation verschwand. Einfach perfekt. Ein echter Renner. Deshalb musste sie ihren Laden im Sommer auch offen halten. Sie wollte schließlich Gewinn machen.
Aber die Schwiegermutter ihrer Freundin fühlte sich in Ostfriesland wohl und hatte beschlossen, sich von Esther die Seniorenheime zeigen zu lassen. Und ein Bänderriss heilt auch nicht in vierundzwanzig Stunden. Geli war deshalb dazu verdammt, in den kommenden Tagen in aller Herrgottsfrühe, weit vor Schulbeginn, nach Aurich zu fahren. Aber Norbert konnte mit dem Fahren nicht einspringen, weil es ihn aus dem Rhythmus brachte, wenn er eine Stunde später zur Arbeit kam, obwohl das im Grundsatz möglich war. »Dein Bruder ist manchmal komisch. Darf ich das sagen?«, fragte sie.
»Hat er doch nie ein Geheimnis draus gemacht.«
Geli schwankte einen Moment zwischen Treue und Frust, dann ließ sie alle partnerschaftliche Solidarität fahren. »Er ist so ein Miesmacher. Mein Teeladen ist unsolide, sagt er, und orakelt die ganze Zeit, wie alles den Bach runtergehen wird. Ich soll die Buchhaltung effektiver führen und straffer einkaufen und meine Werbung … Du verstehst schon. Er findet die getrockneten Blumen in meinem Schaufenster daneben, weil man sie abspülen muss, wegen dem Staub … Irgendwie ist alles falsch, was ich mache. Schon aus dem Grund muss ich durchhalten. Muss ich doch, oder?«
»Klar. Weißt du, was ich früher gemacht habe, wenn ich ihn ärgern wollte?«
Geli nahm einen Schluck aus ihrem Weinglas und zog fragend die Augenbrauen hoch.
»Ich hab zu ihm gesagt: ›Mädchen, Mädchen!‹« Ich versuchte, meinen damaligen Tonfall zu imitieren, aber ich hatte das Äffchen leider nicht mehr richtig drauf.
»Ist es nicht komisch, wenn ein Mädchen einen Jungen damit kränkt, dass es ihn ein Mädchen nennt?«, fragte Geli.
»Klar. Deshalb hab ich’s ja auch gemacht. Weil er es nicht gecheckt hat. Weil dadurch bewiesen war, wie blöd er ist. Ich hab ihn natürlich auch gern heulen sehen.«
»Ach so«, sagte Geli. Sie ist ein Einzelkind. Ich hätte ihr das Ganze nicht erzählen sollen. Geschwister muss man erlebt haben, um den Guerillakrieg zu begreifen. Weil ich mein Image wieder aufpolieren wollte, versprach ich ihr, Ole am nächsten Tag nicht nur zur Schule zu bringen, sondern auch gleich nach dem Turnbeutel zu fahnden.
»Das ist er«, sagte Ole. Er leckte eine Eislawine von dem Ed-von-Schleck, das ich ihm spendiert hatte, und harrte der Dinge, die da kommen würden oder auch nicht. Er war kein Hektiker, das hatte ich mittlerweile gemerkt. Ein Junge, der das Leben nahm, wie es kam. Es hatte ihm nichts ausgemacht, dass Arnold mit einem schwarzbezopften Mädchen davongestapft war, statt wie verabredet auf ihn zu warten. Es machte ihm auch nichts aus, dass wir mit seinem Lehrer sprechen wollten.
»Der mit dem weißen Hemd und den aufgekrempelten Ärmeln?«, vergewisserte ich mich.
Ole nickte und rieb einen Eistropfen, der ihm aufs Shirt gekleckert war, in den Stoff.
Der Mann mit dem weißen Hemd lehnte mit verschränkten Armen an einer Linde, die den Eingangsbereich der Grundschule beschattete, und beobachtete den Ausgang der gegenüberliegenden Betonschule. Er trug einen Stoppelhaarschnitt und Jeans und sah aus wie der Sportlehrer, der er auch war. Kein Bauchansatz oder sonst ein Zeichen sympathischer Genießermentalität, sondern ein durchtrainierter Schwarzenegger-Typ mit stählernen Muskeln. Sicher joggte er und kraxelte in den Sommerferien auf die Zugspitze. Nur die steilsten Wände natürlich. Allein durch Eis und Schnee. Und oben die Fahne in den Bauch der armen Mutter Erde gerammt. Zack. Ich konnte ihn auf Anhieb nicht leiden. »Wie heißt er?«
»Herr Kremer.«
»Gut.« Es hatte keinen Zweck, Zeit zu vertrödeln. Ich tat, gefolgt von Ole, die wenigen Schritte. »Verzeihung.«
Kremer riss seinen Blick nur ungern vom Strom der Schüler los, der sich auf den Fußweg ergoss. Er musterte erst Ole, dann mich. Irgendwie von oben herab. Lehrerblick. Einfach ekelhaft.
»Es ist wegen des Turnbeutels«, erklärte ich und kämpfte gegen das Schuldgefühl an, das ich reflexartig entwickele, wenn ich vor einem Lehrer stehe. »Er ist verloren gegangen. Blöde Sache. Wir waren schon beim Hausmeister, aber der hat gesagt …«
»Moment.« Unvermutet sprintete Kremer los. Aus dem Stand auf hundert, quer über die Straße und hinein in einen Pulk von Jungen, die lässig Richtung Busparkplatz schlenderten. Er packte einen von ihnen am Genick und schleppte ihn unter die Linde. Sondereinsatzkommando Kremer. Klasse.
»Okay, Kai – das Messer«, forderte er mit einem Ton in der Stimme wie der Ruhrpott-Schimanski aus dem Fernsehen und streckte die Hand aus. Sein Opfer – ein schlaksiger Pickelknabe von etwa fünfzehn Jahren in einer Bundeswehrhose – verzog gekränkt das Gesicht. »Das hab ich doch schon abgegeben.«
»Ist mir bewusst! Ich will das andere.« Kremers Stimme klang wie ein Gewitter.
»Ich … also ehrlich ...«
»Rucksack ausräumen.«
»Da ist keins drin.«
Ole schleckte und beobachtete interessiert, wie Kai den Rucksack von der Schulter zog und begann, hier und dort hineinzugreifen.
»Hilft’s, wenn ich ihn ausschütte?«, fragte Kremer ironisch.
Widerstrebend beförderte Kai etwas Schwarzes mit silbernen Metallnieten aus dem Rucksack. »Das gehört aber meinem Bruder. Muss ich zurückgeben. Keine Ahnung, wie das in meine Tasche …« Er verstummte und ließ sich das Ding abnehmen.
Kremer drückte auf einen Knopf – die Messerklinge sprang aus dem schwarzen Knauf. »Von deinem Bruder«, sagte er mit hochgezogenen Brauen. Er warf einen Blick auf eine Gruppe von drei Jungen, die den Vorfall aus einiger Entfernung beobachteten. Dann ließ er die Klinge wieder verschwinden. »Du erscheinst Samstag um sechzehn Uhr oben im Lehrerzimmer.«
»Aber da ist Wochenende.«
»Was bedeutet, dass wir viel Zeit füreinander haben werden. Glückspilz.«
»Aber …«
»Wenn du nicht da bist, steh ich bei deinen Eltern auf der Matte. Kapiert?«
Kai fummelte seinen Rucksack auf die Schulter und schlich mürrisch zu seinen Freunden zurück, wo er mit Schadenfreude empfangen wurde. Ich spürte, wie es mir kalt den Rücken runterlief. So sahen sie also in echt aus, diese U-Bahn-Killer mit den Messern im Gepäck. Ich hüstelte mir die Kehle frei. »Also der Turnbeutel …«
Kremer versenkte das Messer in der Tasche seiner Jeans und ging in die Knie, um Ole ins Auge zu fassen. Er betrachtete ihn einige Sekunden lang, in denen Ole weiterschleckte, nur nicht mehr mit Genuss. »Ich weiß. Er ist weg. Irgendeinen Schimmer, wo er sein könnte, junger Mann?«
Ole schüttelte den Kopf.
»Ich will mal versuchen, das zu erklären«, sagte Kremer, dieses Mal in meine Richtung. »Wenn die 2b mit dem Sportunterricht fertig ist, gehen sechsundzwanzig Schüler in die Kabinen. Sie ziehen ihre Sportsachen aus, packen sie in die Turnbeutel, steigen in ihre Klamotten und ziehen ab. Aber einer ist da, der rafft das mit dem Zusammenpacken nicht. Die Turnhose fällt ihm vom Hintern und bleibt auf dem Fußboden liegen, und der Turnbeutel ist irgendwo im Nirwana verschwunden, was Ole?«
Ole war mit dem Eis fertig. Er hielt nur noch den Holzstil in der Hand. Kremer nahm ihm das klebrige Ding aus der Hand. »Hol mal dein Mitteilungsheft raus.«
Ole zog die Schultern nach hinten, so dass der Ranzen über die knochigen Arme zu Boden krachte. Er öffnete ihn und begann darin zu kramen wie der kriminelle U-Bahn-Messerstecher, nur mit mehr gutem Willen. In mir begann sich Empörung zu regen. Ole wollte ja. Aber er hätte einen Kompass gebraucht, um sich in dem muffigen Aufbewahrungsteil voller Hefte, Bücher und Plastikdinosaurier zurechtzufinden. Er war komplett überfordert, das konnte man sehen. Welche Schule verlangte von einem Siebenjährigen, eine halbe Bibliothek mit sich rumzuschleppen?
»Das hier ist ein Eoraptor«, sagte Ole und zog einen grün-blauen, langbeinigen Saurier zwischen den zerknitterten Heften hervor.
In Kremers Gesicht regte sich kein Muskel. »Dein Mitteilungsheft.«
Ole verstaute den Eoraptor sorgfältig am Rand der Tasche und suchte erneut.
»Ich geb dir einen Tipp: Es liegt neben der Zahlenwerkstatt.«
Na bitte, mein Neffe brauchte nur ein klein wenig Hilfe, um zurechtzukommen. War es nicht die Aufgabe eines Lehrers, seine Schüler anzuleiten? Sozusagen der Kern seines Bildungsauftrags? Und musste man mit dieser Hilfe geizen, nur um zu beweisen, dass man ein Schimanski-Klon ist? Kremer nahm das Heft in Empfang. »Irgendeine Idee, was drinsteht?«
Ole schüttelte den Kopf. Wenn er ein bisschen älter gewesen wäre, mit der entsprechenden Lebenserfahrung, hätte er sich gedemütigt gefühlt. So wippte er nur ein bisschen auf den Fersen. Ich bekam das Heft in die Hand gedrückt, mit der stummen Aufforderung, den Part des Schämens zu übernehmen. Scheiß-Schimanski. Die Eintragungen hatten Mitte Mai begonnen.
Ole hat keinen Turnbeutel.
Könnten Sie sich bitte um Oles Turnbeutel kümmern?
Oles Turnbeutel … liest das hier eigentlich jemand?
Ole turnt demnächst nackt.
Ole braucht einen Turnbeutel!!!!
Ole braucht … Das Wort Turnbeutel war durchgestrichen. … ein neues Mitteilungsheft.
Haha. »Gibt’s kein Telefon?«, fragte ich spitz.
»Bitte?«, fragte Kremer.
»Vielleicht hätte man diese Korrespondenz abkürzen können, indem man …«
»Korrespondenz ist, wenn Mitteilungen aus beiden Richtungen kommen, Frau Seewald. Ich schreib dir, du schreibst mir – das ist Korrespondenz.«
Ich zwinkerte, verwirrt, weil er mich mit meinem Mädchennamen ansprach. Bis ich kapierte, dass er mich für Oles Mutter hielt. Na großartig. Hier tauchte eine wildfremde Frau auf, nahm ein Kind in Beschlag und hätte wahrscheinlich mit ihm abhauen können, ohne dass der Lehrer auch nur einen Finger krümmte. Noch nie was von Entführungen gehört? Warum verlangte er keinen Ausweis?
»Frau Seewald …«
Ich hätte ihn gern unterbrochen. Ihm klargemacht: Mein Name ist Franziska Brunner, ich bin die Tante. Und seit zwei Wochen und einem Tag Witwe. Ich leide, und Turnbeutel gehen mir auf den Keks. Aber ich war zu stolz dafür. Unbestimmt regte sich in mir auch ein Funken Solidarität mit Geli. »Komm, Ole, wir gehen einen Turnbeutel kaufen.«
»Auf Wiedersehen, Herr Kremer«, sagte Ole höflich.
Scheißpauker.