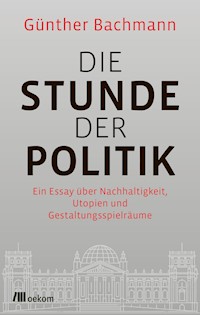Inhalt
Kapitel 1Nachhaltigkeit – die Macht einer Idee
Krisen verstellen den Blick
Wer wollte nicht dabei sein?
Eine neue Verantwortung des Könnens
Die Asse-Begegnung mit der Ewigkeit und die Macht des Positiven
Am Anfang sind alle Anfänger
Gegen die Besserwisserei
Kapitel 2Nachhaltigkeit als Zukunftsfahne der politischen Vernunft
Die Futurale Frage
Transformationen sind keine Magie
Decarbonisierung braucht Differenzierung
Made in Germany – nachhaltig?
Der alte und immer neue Streit um die Deutungshoheit
Kapitel 3Rollen verstehen – Politikbashing ist zu einfach
Wandel, Strategie und Komplexität
Die eine Seite der Komplexität …
… und die andere
Der gar nicht so weiche Faktor Kultur
Nachhaltigkeitsstrategien vor acht
Kapitel 4Den Utopieverlust der Moderne wettmachen
Gro Harlem Brundtland – aber kein XY-ismus
Michelangelo, Dürer und wir: das Momentum der Veränderung
Die Rio-Hoffnung
Der Fluch der Vergeblichkeit
Kopenhagen – die Ikone allen Scheiterns
Paula Caballero wendet das Blatt
Gegen die Logik des Gewohnten
Der Mut zur großen Alternative
Kapitel 5Hans Carl von Carlowitz’ Botschaft des Unmöglichen
Carlowitz, Lenin, Wirtschaftsminister
Der heutige Carlowitz
Brautpreise als Indikator
What if – was wäre, wenn
Das größte Risiko stellt dar, wer negiert, welches Risiko er selbst ist
Die Überwindung der Unterforderung
Kapitel 6Aus dem Reich des Möglichen
Das Säulenmikado wird oft gespielt, aber nie gewonnen
An übermorgen denken, um im Heute mitzuhalten
Wie das gute Porzellan
Mehr als 300 Seiten – worauf es aber wirklich ankäme
Kapitel 7Fridays for Future – eine neue Fahne der politischen Vernunft
Utopie ist machbar: Die Jungen fordern die Boomer heraus
Die neue Formel für Erfolg
Kapitel 8Nachhaltigkeitsprojekt Energiewende
Energiefreiheit wird zur Droge
Das Einüben des anderen Blickes
Fukushima oder die Politikwerdung der Energiewende
Die Szene muss umlernen
Licht und Schatten im Megaprojekt
So geht Energiewende!
Kapitel 9Gelingen und Misslingen
Wenn Krisen übermächtig werden
Warum Erfolg und Scheitern keine so einfachen Themen sind
Stresstest Corona
Kleine Träume und das harte Brot der Demokratie
Ökosteuer – in der politischen Debatte verdrängt
Nachhaltigkeit als gesellschaftliches Ereignis
Macht und Kultur – Gatekeeper-Institutionen
Verliebt in das Misslingen?
Denkfehler aufarbeiten
Kapitel 10Stolpernd ins Neue
Möglich ist …
Projekte nach Corona zur Überwindung des Vorsorgeparadoxes
Transrapid in Grün – Lernen vom Solardesaster
Die Magie des Weniger ist – viel Arbeit
Am Ende ein Anfang
Orientierung im Mosaik unserer GeschichteEine Tabelle über das »Was« und »Wann« der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik seit 1960
Mein Dank
Kapitel 1
Nachhaltigkeit – die Macht einer Idee
Auf der Erde leben heute mehr Menschen als jemals zuvor. Noch nie ging es dem Durchschnitt der Menschen so gut wie heute, von dem Geldreichtum der rund 50 Millionen Millionäre und über 2000 Milliardäre ganz abgesehen. Gleichzeitig ist das menschliche Überleben prekär und in einem bisher nicht gekannten Maße bedroht. Das liegt daran, dass wir eigentlich nicht auf der Erde leben, wie es oft heißt, sondern von der Erde. Wir leben und arbeiten, reisen und wohnen auf eine Weise, die weder für die Erde insgesamt noch für uns selbst zuträglich ist, schon gar nicht ist sie es für die vielen, die nicht an der Wohlstandswelt teilhaben und nicht in den Genuss unseres hohen Lebensstandards kommen. Ein ambivalenter Engpass. Hier stoßen Werturteile und Haltungen von Jung und Alt aufeinander, von Menschen, die ihre Lebensleistung verteidigen, und Menschen, die um ihre und ihrer Kinder Zukunft fürchten. Hier fängt die Macht an, die sich rund um die Idee der Nachhaltigkeit entwickelt. Sie tritt gegen alte Mächte an, deren Reflexe nur auf Kapital und Kontrolle folgen. Die Macht dieser Idee setzt Umdenken an die Stelle von Weitermachen, naturbasierte Lösungen an die Stelle von fossilem Wachstum. Und sie setzt auf Kultur, Selbstwirksamkeit und Wissen. In ihrem Sinn versprechen Regeln zur nachhaltigen Entwicklung genau jene Freiheit und Freiwilligkeit, die es durch Verzicht auf die Zerrüttung der Natur zu erhalten gilt.
Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr, bedingt durch die Corona-Krise und bedingt durch die Klima- und Naturkrisen, die wir zwar schon lange kennen, die aber jetzt bedrohlich auflaufen. Nie war der Ruf lauter nach einer Politik, die nachhaltige Lösungen realisiert. Nie war mehr Geld im Spiel als mit dem europäischen Green Deal angekündigt. Nie hat die private Wirtschaft mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt. Selbst die staatlichen Konjunkturprogramme für den Neustart nach der Pandemie stehen in bisher nicht gekanntem Umfang unter Nachhaltigkeitsvorbehalt. Und das alles soll genau jene Politik bewerkstelligen, der die Medien und viele Fachleute fortwährend die Kompetenz absprechen, da das Unverständnis über Politik, ihre Möglichkeiten und Gestaltungsspielräume leider auch nie größer war?
Politik scheue das offene Ansprechen von Problemen, traue dem Volk nicht die Wahrheit über das Klima und die Erdressourcen zu, sondern halte es lieber im Unklaren und mit Wahlgeschenken bei Laune; das Volk sei daraufhin unzufrieden, begehre auf und sammle sich hinter der Wissenschaft. Diese Sichtweise ist insbesondere bei Klimaaktivist*innen weit verbreitet. Sie kommt auch in dieser genauen Prägnanz und Verkürzung bis weit in Kreise wissenschaftlicher Meinungsführer*innen vor. Und ihr wird kaum widersprochen. Zuverlässig fällt in fast jedem Gespräch mit engagierten Stakeholdern – egal, ob sie aus Unternehmen, dem Naturschutz, der Wissenschaft oder Stiftungen kommen – der Satz: Ach Gott, ja, die Politik, die kann es eben doch nicht.
Dem widerspreche ich.
Die Rede von »der Politik« konstruiert ein Gesamtsubjekt, das es gar nicht gibt und bei dem die unterschiedlichen Aufgaben von Legislative, Exekutive und Rechtsprechung ebenso verschwimmen wie der Föderalismus und der reale Politikbetrieb mit seinen Regeln für Abstimmung und Koordination. Und das sind nur die Binnenwelten der per Wahl beauftragten Politik. Zu einem modernen Politikbegriff gehört auch das, was zivilgesellschaftliche Akteure tun, gehören Netzwerke, Vereinbarungen und wirtschaftliche Akteure. In diesem Sinne umfasst Politik die Gestaltung der öffentlichen Dinge, in und mit der Öffentlichkeit.
Kritiker*innen »der Politik« machen es sich bewusst bequem, indem sie die Binnenwelten negieren und der Politik stattdessen die Kompetenz rundweg absprechen. Schließlich müssen sie dann ja auch nichts machen. Sie tragen ihre Forderungen umso selbstbewusster vor, je sicherer sie davon ausgehen, dass die Politik »es nicht kann«. Wenn auch sonst nichts vorangeht, so garantiert das wenigstens das eigene Gefühl, recht zu haben. Natürlich ist »die Politik« nichts Geradliniges, das Ursache und Wirkung, Problem und Abhilfe linear miteinander verbindet. Natürlich gibt es Schattierungen, Positions- und Meinungskämpfe. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn Politik mitunter als zu unentschieden und zögernd erscheint. Denn in der Auseinandersetzung darüber, ob ein politischer Beschluss anders, entschiedener und geradliniger ausfallen könnte, entfalten sich Alternativen. Die verkürzende Verallgemeinerung aber lässt Alternativen verschwinden und entwertet sie obendrein noch durch permanente Alarmstimmung. Ohne Unterlass berichten die Medien in Brennpunkten, haben Breaking News und alarmieren das Publikum, während sie die Krisenrhetorik rund um Rettung, Kollaps, Untergang routiniert abwickeln.
Die Binnenverhältnisse von Macht, Politik und Nachhaltigkeit zeigen andere Bilder jenseits des Schwarz-Weiß. Sie zeigen die Räum für Gestaltung und Utopie. Dieses Buch erzählt die Eckpfeiler der Nachhaltigkeitsidee mit anderen Sichtachsen als sonst üblich. Es erklärt die Hintergründe dessen, was in puncto Nachhaltigkeitspolitik wie passiert ist, was möglich wäre – und vor allem auch, was gerade nicht in Gang kommt. Es teilt Erfahrungen aus dem politischen Betrieb der Nachhaltigkeitspolitik. Es richtet sich an alle Aktiven, Abwartenden, die sich für mehr Nachhaltigkeit aussprechen und ihrer Haltung mehr Gewicht verleihen wollen. Ob Lehrer*innen, Förster*innen, Lokführer, Mechatroniker, Klempner, Bäcker, Einzelhändler, Landwirte, Unternehmer*innen, Wissenschaftler*innen, Auszubildende, Studenten und Schüler*innen, Büchereiangestellte, Betriebsleiter, Behördenmitarbeitende und Politiker und freie Geister aller Art.
Einfache Rezepte dafür, wie man Nachhaltigkeit politisch durchsetzt, stellt dieses Buch nicht vor. Rezepte gehören in die Küche, nicht in die Politik. Wirkungsvolle Politik ist immer ein Grenzgeschäft. Sie bewegt sich immer an den Grenzen des Machbaren, respektive des mehrheitlich als machbar Eingegrenzten. Das gilt sowohl für die gewählte Politik in Parlamenten und Regierungen als auch für die nicht minder politischen Tätigkeiten in allen sonstigen Einrichtungen. Der Erfolg verschiebt das, was gerade noch als machbar gilt, und macht daraus das neue Normale. Das motiviert zum eigenen Mitdenken und Mittun. Es schärft den Blick auf die Verantwortung und die Handlungsmöglichkeiten in Wirtschaft und Politik. Die eigene Verantwortung wirksam zu machen ist der stärkste Hebel für das Umdenken und die breite Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung.
Sagen wir es noch einmal ganz grundsätzlich: Nachhaltigkeit ist ein ethisches, politisches und wirtschaftliches Prinzip bei der Nutzung von natürlichen und sozialen Ressourcen. Es bedeutet, dass alle Menschen heute in der Lage sein sollen, ein würdevolles Leben zu leben, ohne ihren Kindeskindern und künftigen Generationen einen Planeten zu hinterlassen, auf dem das alles dann nicht mehr geht. Die Erde und ihre Ökosysteme setzen dem Menschen absolut wirkende ökologische Grenzen. Daher müssen die heutigen ökologischen, sozialen und ökonomischen Fehlentwicklungen vermieden, vermindert und beseitigt werden. Nachhaltigkeitspolitik setzt auf die gezielte Transformation von Produkten, Dienstleistungen, der Infrastruktur sowie der Lebensweisen und -stile, mit denen diese genutzt werden.
Wie soll das einfach sein? Zumal wenn manchen großen Worten über die Große Transformation die Verbindung zu den Menschen fehlt, die Entscheidungen fällen und handeln oder eben nicht handeln. Es ist ein Jammer: Forderungen nach konsequenter Wendepolitik – Sofortausstiege aus der fossilen Energie, Stopp der Massentierhaltung als Beispiele – sind verständlich, oft sogar richtig, aber sie verpuffen allzu häufig. Ihnen fehlt das Gespür für Opportunitäten, Irritationen, Abzweigungen und die situative Intelligenz, die häufiger, als man gemeinhin denkt, Geschichte ausmachen. Umgekehrt gibt es auch bei den politischen Entscheider*innen einen grundsätzlichen Mangel. Zu selten nur bringen sie die Fehlentwicklungen, Risiken, Krisen und Katastrophen mit politischen Gestaltungsräumen und ihren Vorstellungen von Regieren zusammen. Im Klartext: Akteure mit berechtigten Forderungen oder tollen Ideen versetzen sich zu wenig in diejenigen hinein, die zu entscheiden haben, und Letztere registrieren die Forderungen nur als eine weitere Gruppe von Spezialinteressen.
Kompetente Empathie ist Mangelware – und folglich auch der Erfolg für die eigenen Forderungen. Misslingen kann programmiert sein. In den Binnenwelten zwischen Politik, Macht und Nachhaltigkeit liegen mehr Möglichkeiten, als üblicherweise aus der dürren Nachhaltigkeitsrhetorik der bekannten Appelle, Werbeauftritte und Programmpapiere hervorgeht. Diese Bekenntnisrhetorik wie auch ihr Zwilling, die permanente Empörung über den »inflationären« Gebrauch des Begriffes »Nachhaltigkeit«, sind untauglich, um das im eigentlichen Sinne Politische an der Zukunftsfahne des 21. Jahrhunderts zu verdeutlichen.
Wir müssen misstrauischer werden gegenüber den Positionen des Mainstreams, auch und gerade in der Nachhaltigkeitspolitik, unserem eigenen Mainstream: Wenn der Einspruch gebetsmühlenartig nur als ein »Ja, aber« daherkommt, ist er der neue Fatalismus. Wenn das Aufstöhnen über Komplexität nur das Neue abwehrt, ist es eine Ausrede. Wenn politische Positionen ihre Identität nur aus Krisen, Problemen und Misserfolgen beziehen, wird der Hang zum Misserfolg leicht zum Habitus.
Eine politische Forderung ist nicht allein schon deshalb gut, weil sie dabei die Position des Absenders bestärkt. Was die Nachhaltigkeitspolitik stark vorangebracht hat, sind Wendepunkte, an denen Menschen vom Plan abweichen und es riskieren, ihr Umfeld zu irritieren. Das Vollkommene muss man als Ideal denken, aber darf ihm nicht nachhängen, um frei genug zu sein, das Nächstbessere real zu tun, selbst auf anscheinenden Umwegen. Davon, also von Erfolgen und Fehlern, handelt dieses Buch.
Wer sich nun freut, dass ein Nachhaltigkeitsbuch von Fehlern redet, freut sich zu früh. Fehler sind, erstens kein Beweis für Vergeblichkeit, sondern für Ungeschick, falsche Einschätzungen oder Irrwege. Zweitens zeigen die letzten zwanzig Jahre mehr Gelingendes als Misslungenes. Drittens ist das Sprechen über Fehler eine Investition in die Zukunft. Und viertens: Der mit Abstand größte Fehler liegt in dem Glauben, es könne alles so bleiben, wie es ist.
Krisen verstellen den Blick
Eine Krise lade zu Neuanfängen ein, Krisen seien im Grunde nichts als Chancen, so heißt es häufig. Not macht erfinderisch, weiß eine alte Volksweisheit, und die moderne Beratungsindustrie formuliert den gleichen Gedanken mit einem von Churchill entlehnten »Never waste a good crisis«. Auch die Klimadebatte setzt auf die Katastrophe, von der man sich eine läuternde Wirkung verspricht, wenn die Menschen zum Beispiel den Schwund des Polareises erst einmal am eigenen Leib spüren. Sozialkulturell hat diese Vorstellung tiefe Wurzeln bis hin zu den Posaunen der biblischen Offenbarung.
Niemand hätte etwas dagegen, wenn diese Allgemeinplätze denn im wirklichen Leben funktionieren würden. Aber leider ist das nicht so. Es ist eher wie das Pfeifen im Wald. Wo Angst herrscht, verengen Krisen den Blick. Auf Bedrohung reagieren Gesellschaften sehr häufig beharrend und wie manisch genau diejenigen Handlungen wiederholend, die in die Krise geführt haben. In der Krise wollen sie »nun aber wirklich« jenen Konzepten zum Durchbruch verhelfen, die zuvor schon prekär und untauglich waren. In Deutschland ist hierfür das ökonomische Mengenwachstum ein guter Kandidat.
Anderswo, im globalen Süden, empfindet man das Reden von der Krise als Chance fast obszön, ist die Situation beispielsweise durch Corona viel dramatischer. Millionen von Menschen arbeiten weltweit ohne soziale Absicherung in sogenannten informellen Wirtschaftsbereichen. Sie werden vom Corona-Lockdown von einem Tag auf den anderen vor die Aufgabe gestellt, das unmittelbare Überleben ihrer Familien zu organisieren. Ihnen bleibt keine Zeit für anderes. Das Geld von den im Ausland arbeitenden Staatsangehörigen bleibt aus (deren Geldüberweisungen in die Heimat oft ein Rückgrat der Nationalökonomie ist). Entwicklungsgelder schwinden, weil die reichen Länder ihre Hilfe als einen Prozentanteil ihres Bruttosozialprodukts berechnen und die Lockdown-Einbrüche die Zahlungen mindern. Wildtiere in Nationalparks können nicht mehr gegen Wilderei geschützt werden, weil der Tourismus ausfällt, der die Naturreservat-Ranger finanziert. Die Aufzählung solcher Auswirkungen könnte ganze Bände füllen; und dann wäre noch kein Wort über die Todesopfer der Pandemie gesagt und kein Respekt gegenüber Helfenden und Pflegenden ausgesprochen.
Ja, es gab die positiven Bilder aus dem Corona-Lockdown, etwa die Seepferdchen in der Lagune Venedigs. Das tiefe Blau eines Himmels ohne Kondensstreifen war für viele Menschen ein ganz neuer Eindruck. Die Ruhe auf den Straßen nutzten Füchse, Rehe, Pumas, Bergziegen und Schakale zu Besuchen in der Stadt. Das empfinden viele Menschen als eine Erinnerung an die Zukunft. Aber bestimmend für das Verstehen von Krisen ist das nicht; bestimmend sind die voyeuristischen Katastrophenbilder von Elend und Verwüstung.
Unsere Lebenswirklichkeit besteht im Grunde in einem solchen Ausmaß an Krisen, dass die Krise selbst zur Normalität wird. Krisen schütteln die Geopolitik und den Welthandel, sie betreffen die pandemische Unsicherheit digitaler Infrastrukturen, die Erderwärmung, die Ausrottung seltener Arten, die Wilderei und Naturzerstörung durch illegalen Rohstoffabbau. Dazu kommen die Megakrisen mit entgrenzten Folgen wie zum Beispiel die Wasserkrise des vietnamesischen Mekong oder die Heuschrecken Ostafrikas.
Krise ist das Normale. Wir gewöhnen uns an sie wie an eine Dauerwerbesendung im Fernsehen. Krise nimmt uns gefangen. Aber Krisen beschleunigen auch Einsichten in Alternativen, was die Idee der Nachhaltigkeit bezeugt. Sie ist eigentlich ein Krisenkind. Der Raubbau am Wald (damals hieß das Holznot), die Widersprüche zwischen Wachstum, Umwelt und Entwicklung, diplomatische Sackgassen, überfischte Meere, Katastrophen und Naturzerstörung stehen ihr Pate.
Gemessen an diesen akuten Problemen, können alle Nachhaltigkeitspolitik und -initiativen vielleicht nicht mehr sein als schüchtern tastende Anfänge. Aber immerhin: Die letzten 20 Jahre haben mehr Praxiserfahrungen, Ziele, Instrumente und Vereinbarungen zur Nachhaltigkeit geschaffen als die gesamte Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wichtiger als der gefangene, alleinige Blick auf die Krise ist die Erinnerung an das Erreichte und Gelungene. Die Erfahrung lehrt, dass Anfangen Mut macht. Das Erfahren von Veränderbarkeit und Selbstwirksamkeit, gepaart mit einem landauf, landab hohen Bewusstsein für Nachhaltigkeit, sollte die Chancen auf Erfolg erhöhen. Denn noch nie setzten sich mehr Menschen dafür ein, Lebensmittel nicht wegzuwerfen, Abfälle zu recyceln, für gesunde Ernährung oder für einen wirkungsvollen Klimaschutz und eine intakte Umwelt auf die Straße zu gehen. Noch nie zuvor haben so große Teile der Wirtschaft die Nachhaltigkeit als Paradigma anerkannt. Noch nie hat die Politik ehrgeizigere Ziele für Nachhaltigkeit in den Raum gestellt. Hinzu kommt: Die intellektuellen und materiellen Ressourcen und Möglichkeiten der Menschheit sind so umfassend und vielfältig wie nie zuvor. Ein Sieg über den Hunger in der Welt wäre möglich, die Eingrenzung der Erderwärmung wäre möglich. Es wäre möglich, die Abfallfluten einzudämmen und in völlig neue Wertschöpfungskulturen einzubauen. Es wäre möglich, Chancen auf Teilhabe und Bildung gerecht zu gestalten. Es wäre sogar denkbar, die Schadstoffe Nummer eins und zwei, das Kohlendioxid und das Methan, zu einer werthaltigen Ressource zu machen – anstatt sie in die Atmosphäre zu blasen. Sogar ein anderes Verantwortungsbewusstsein darüber, was Wirtschaft ausmacht und was Natur für das Wirtschaften bedeutet, wäre möglich.
Am ungewöhnlichsten ist der Wandel in der kulturellen Bewusstseinsmacht. Seit einiger Zeit nehmen sich Bürger*innen, Käufer und Verbraucherinnen mehrheitlich vor, sozial und ökologisch verantwortlich zu handeln. Die Marktmacht von nachhaltig agierenden Unternehmen wächst. Nachhaltigkeitsmanagement kann Unternehmen mehr Effizienz, eine bessere Reputation, zufriedenere Mitarbeiter*innen, eine höhere Qualifikation junger Mitarbeitenden bringen. Möglich sind auch Vorteile durch frühzeitiges Erkennen, wo die nächsten Innovationen stecken. Am Ende kann das sogar den Gewinn steigen lassen. In der politischen Welt können sie Ansehen und Karrieren starten.
Die Zeiten sind vorbei, da Nachhaltigkeit gehässig ignoriert oder gütig auf morgen verschoben werden konnte.
Wer wollte nicht dabei sein?
Was Nachhaltigkeit angeht, so scheint es, dass alle dafür sind. Man wünschte sich zuweilen sogar mehr Meinungsvielfalt und mehr Streit. Heute reden auch diejenigen von Nachhaltigkeit, die es sich nicht verdient haben: Der DAX-Konzern Wirecard bekannte sich zur Nachhaltigkeit und stellte seine Unternehmensverantwortung öffentlich aus, während er in den Bilanzskandal hineinschlitterte. Die Exponenten der deutschen Fleischindustrie Tönnies, Westfleisch und Wiesenhof sind mit professionellen Nachhaltigkeitsberichten im Internet präsent, die in einem krassen Gegensatz zu den Ursachen der Corona-Ausbrüche in ihrem Umfeld stehen. Mit 2,5 Tonnen Leergewicht, acht Zylindern und 600 Pferdestärke bauen BMW und die anderen Autokonzerne ihre Stadtpanzer an der Zukunft der urbanen Mobilität vorbei. Unoriginell und peinlich zeigen sie die Grenzen der technologischen Effizienz auf. Auch minder schwere Fälle erklären mitunter zu oberflächlich etwas als nachhaltig, was einer genaueren Überlegung nicht standhält. Zu schnell ist man mit Formeln zur Hand, denen zufolge man nur »nachhaltig auftreten« müsse, um kreativ zu wirken. Die so Agierenden verbergen damit nur ein tiefes Kreativitätskoma.
Unterscheiden zu können wird daher immer wichtiger. Nichts muss auf Anhieb perfekt sein. Aber die Anfänge sollten eine Herausforderung sein. Das kann unterschiedliche Formen annehmen, zum Beispiel als Einrichtung eines Jugendparlamentes (Pfaffenhofen), als bürgerschaftlicher Nachhaltigkeitsbeirat (Augsburg, Freiburg), als Bündnis von Aktiven »wir.in.der.Region« (Kreis Unna) oder indem ein Landkreistag seine Schulen durch außerschulische Beteiligung an Nachhaltigkeitsprojekten unterstützt und dafür eine Stelle einrichtet (Landkreis Saarlouis). Die Beispiele aus der privaten Wirtschaft sind noch vielfältiger und gehen in Richtung »blaue« Produkte (blau, weil aus in den Ozeanen gefundenem Plastik) und Zirkularität (z. B. Einsatz von Recyclingmaterial), Mitarbeiterprozesse oder/und Anwendung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Nicht alles klappt auf Anhieb. Aber eines ist klar: Tastendes Abwarten und ängstliche Rückversicherung bringen noch weniger, als hätte man erst gar nicht angefangen. Gut gemeinte Vorsicht darf nicht blockieren, was möglich wäre, und Risiken nicht per se ausschließen. Der Wille, etwas über alle Zweifel Erhabenes zu schaffen, darf nicht den nächstbesten Schritt verhindern.
Eine neue Verantwortung des Könnens
Wenn die Welt besser werden soll und auch besser wird, dann liegt das an mir und Ihnen und allen um uns herum. Jede und jeder kann etwas tun. Ratgeber und innovative, weil Spaß bringende Beispiele gibt es genug. Das mag die Muskelenergie sein, mit der Schüler*innen auf dem Schulhof einen Zehn-Liter-Eimer um zehn Meter hochziehen, um mit diesem Experiment zu berechnen, wie viele »Eimer« dem CO2- und Energieaufwand entsprechen, der für die Autofahrt zur Schule, die Klassenreise oder zu warme Schulräume aufgewendet wird. Das mag der nachhaltige Einkauf sein, die etwas andere und viel spannendere Ernährung. Der Alltag lässt vieles zu. Hunderte von guten Alltagsratschlägen sind auf dem Markt.
Etwas zu können ist eine neue Verantwortung. Sie ergänzt die Welt des kategorischen Imperativs Kant’scher Prägung. Pflichten und verbindliche Vorgaben sind unverzichtbar. Auf sie alleine wird man sich nicht verlassen dürfen. Das Gezwungensein, die Unfreiwilligkeit, das reine Müssen bergen zu wenig positive Energie. Um genau die aber muss es mit Priorität gehen. Die positive Energie steckt im Gelingen und im Können, in der Teilhabe an etwas Großem und im Wagnis zur Hoffnung; sie steckt in der Kompetenz, etwas anders machen zu können und eine anders-neue Normalität zu stiften. Und das ist nun nichts Individuelles mehr, sondern Politik und politische Vernunft in ihrer reinen Form.
Die Generation der heutigen Entscheider*innen trägt eine besondere Verantwortung für die politische Vernunft. Und schon ist eine junge Generation am Start, die eine neue Fahne der politischen Vernunft schwenkt. Die Erderwärmung und die Corona-Pandemie lassen uns schnell und gewissenhaft an den Aufgaben wachsen. Wir wissen Bescheid und wir wissen, was wir können. Die dunkle Zeit ist vorbei, in der uns immer größere Appelle an Umkehr und Gewissen immer kleiner machten.
Die Orientierung auf nur eine einzige Große Transformation ist irreführend. Wir verfügen heute über mehr Ressourcen, mehr Fahrpläne, mehr Vorbilder und mehr Techniken als die Generationen der Protestbewegung der 1970er-Jahre und der nachfolgenden Umwelt-, Demokratie- und Bürgerrechtsbewegungen. Die Werkzeuge sind genauer, die Technologien innovativer, die Talente besser ausgebildet, das Wissen ist differenzierter, die Überzeugungen sind präziser als je zuvor. So gut wie die heutige war noch keine Generation zuvor in der Lage, die Umwelt zu gestalten und sich für Gerechtigkeit und Würde einzusetzen.
Wenn wir eine Welt wollen, in der jeder und jede die Möglichkeit hat, ein würdevolles Leben zu führen, einen Arbeitsplatz zu finden, sich zu bilden, und wenn wir die Umwelt erhalten und künftigen Pandemien und Unwägbarkeiten vorbeugen wollen, dann wird das gemeinsam gelingen. Mit zwei wichtigen Voraussetzungen: erstens Aufmerksamkeit für das Handeln der anderen und zweitens der Fähigkeit zu einem 360°-Zukunftsscan. Wie viel Wohlstand auch immer man anhäuft und wie grün und bunt der Mitmachgarten auch immer blüht: Wenn alle jenseits des Gartenzaunes hungrig und elend sind oder der Garten von Erdrutschen, Heuschrecken oder Hochwassern abgeräumt wird, wäre noch jeder Wohlstand eine Last. Ein besseres Verständnis der Binnenverhältnisse von Politik und gesellschaftlicher Gestaltung ist nötig. So beängstigend die Herausforderungen auch sind, die Zeit der Verzwergung ist vorbei. Nachhaltigkeitspolitik kann sowohl authentisch als auch ästhetisch sein. Hinter sich lassen muss sie die billige Resignation, die in dem Widerspruch und Unwillen ausdrückenden »Ja, aber« steckt. Dieses Ja-aber prägt noch fast jede Diskussion um Alternativen zum nachhaltigen Konsum und Wege in die Klimaneutralität. »Ja, das Argument sei schon überzeugend, und eigentlich wisse man ja, …« – an dieser Stelle kommt das gewichtige, seufzend gesprochene »aber«: Aber Deutschland allein könne ja nichts ausrichten, das E-Auto ist eben unpraktisch, die Hühnereier aus Käfighaltung kommen dann eben aus dem Ausland, alle machen ja doch nicht mit, zu teuer, zu esoterisch, und gegen das Auftauen des Permafrostes von Nordsibirien kann die Politik ja auch nichts machen.
Das ist hier beispielhaft aufgeführt. Manche Aber-Argumente haben sogar ein Fünkchen Realität für sich. Sie zerstören diesen Funken jedoch gleich selbst mit dem abwehrenden Aber. Es drückt das Gefühl von Hilflosigkeit gegenüber anscheinend unkontrollierten Megaprozessen aus, sei es das Schmelzen der Polarkappen, das Abholzen von Primärwäldern, die Plastikflut in den Ozeanen. Ein nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen ist das, was Fachleute ein Allmendeproblem nennen. Eine Allmende, zum Beispiel eine Wiese im Dorf, ist eine begrenzte Ressource, die allen frei zur Verfügung steht. Die Folge ist meistens, dass das Allgemeingut zerstört wird. In diesem Sinne eine Allmende ist die Erde als Ganzes, sind Ozeane und die Lufthülle. Um der Tragik der Allmende entgegenzuwirken, sind klare, durchsetzbare und global wirksame Regeln nötig, innerhalb derer sich die Nutzung entfalten kann und sich Freiwilligkeit lohnt.
Ist dem die Politik gewachsen? Sieht sie es auch so? Die politische Klasse erfährt Nachhaltigkeit nur selten als eine Bestärkung ihrer Gestaltungskraft, als Bürgernähe und kreatives Regieren. Viel eher ist für sie Nachhaltigkeit mit Misstrauen und Unsicherheit verbunden. Und ganz überwiegend regiert einfach der bürokratische Aufwand für das Anfertigen von Berichten und Maßnahmenpapieren. Nachhaltigkeitsstrategien sind oft blutleer oder verfangen sich im feinen Geäst komplizierter Berechnungen und Statistiken. Das macht sie politisch schwer verdaulich. Wo Experten über statistische Indikatoren herrschen, da sieht man mehr Vergangenheit als Zukunft. Natürlich sind harte Zahlen und Fakten über das Hier und Jetzt nötig und unverzichtbar. Aber eben nicht alleine. Selbst die ambitioniertesten Klimaziele, etwa ausgedrückt mit dem Anspruch, den Klimanotstand abzuwehren oder durch die Angabe des Jahres, bis zu dem eine Kommune oder eine Institution klimaneutral sein will, zeigen doch allenthalben, wie schwierig es ist, daraus die einzelnen politischen Schritte abzuleiten. Um lebendig zu werden, brauchen Ziele und Zahlen eine weite Aura aus Ideen und Methoden des Zukunftsblickes. Und wie wäre es, wenn dabei das ständige Ja-aber durch ein Ja-und ersetzt würde?
Der Politik kommt mehr Bedeutung zu, als ihr derzeit zugetraut wird. Das ist eine Chance für Politiker*innen und alle, die Politik gestalten. Mit dem Thema Nachhaltigkeit könnten sie die oft beklagten Demokratielücken schließen. Als Wahlbürger können wir das auch, durch Nachfragen im Wahlkreisbüro und Interesse daran, was die Abgeordneten etwa für mehr Nachhaltigkeit tun. Treffen demokratisch legitimierte Ziele und Zwecke auf bürgerschaftliche Teilhabe, Netzwerke, harte Daten, mitreißende Projekte und den Mut zur Hoffnung, dann entsteht Macht neuer Art. Und um diese Macht muss es gehen.
Die Asse-Begegnung mit der Ewigkeit und die Macht des Positiven
Die Idee von Nachhaltigkeit legt nahe, dass von Dauer sein soll, was sich im Wechsel der Generationen bewährt. Da kann man einmal nachschauen, wie sich das mit der Ewigkeit ganz praktisch verhält. Nämlich da, wo wir Müll auf Dauer lagern wollten, damit er nachfolgenden Generationen nicht gefährlich wird.
Die Überraschung kommt auf 700 Metern unter null in der Asse. Die Asse ist ein Höhenzug im Landkreis Wolfenbüttel. Einst wurde hier Salz gewonnen, Hunderte Meter tief im Berg, dann experimentierte man mit nuklearem Müll. Man lagerte in der Schachtanlage weit über einhunderttausend Fässer mit mittel- und schwach radioaktiven Abfällen ab. Auf ewig, wie es hieß. Nach einer kurzen Nutzungsdauer müssen diese Abfälle für Hunderttausende und vielleicht Millionen von Jahren geschützt gelagert werden. Den Gewinn hatten maximal zwei Generationen, das Erbe fällt Hunderten und Tausenden von Generationen zur Last.
Angesichts dieses faulen Tausches ist es nur allzu verständlich, dass die Ewiglasten wenigstens ordentlich verpackt und gesichert übergeben werden. Aber die Ewigkeit hält nicht einmal ein paar Jahrzehnte. Das ist die Botschaft der Asse. Sie kommt tief unten im Salzbergwerk. Dort ist die Luft trocken, und alles ist still. Hier haben Wissenschaftler*innen seit den 1960er-Jahren die Endlagerung radioaktiver Abfälle großtechnisch erprobt und praktiziert. Hier liegt der schwach und mittelradioaktive Teil der Hinterlassenschaft aus Kernkraftwerken, der Nuklearindustrie und -forschung.
Ich war mit meinen Mitarbeiter*innen aus der Geschäftsstelle des Nachhaltigkeitsrates in einer Schachtanlage der Asse, in weißer Bergmannstracht, mit Lampe um den Hals und einem fünf Kilo schweren Rettungsgerät über der Schulter. Wir besichtigten das Thema Nachhaltigkeit genau dort, wo es ernst wird. Wir erinnerten uns an die Lehrbücher über das Vorkommen von Salz und dass es einer der endlagertechnischen Vorzüge von Salzstöcken ist, dass dort kein Wasser vorkommt, sodass die Atomfässer rostfrei überdauern. Bis wir in 700 Meter Tiefe einen Bach munter plätschern hörten.
Wenn 2022 das letzte deutsche Kernkraftwerk vom Netz geht, wird die Menge an radioaktivem Müll insgesamt auf fast 30.000 Kubikmeter angewachsen sein. Jeder Rückbau wird weiteren Müll hinzufügen. Die Bundesregierung will allen Atommüll in tiefen Gesteinsschichten sicher endlagern. Wo das sein wird, steht noch nicht fest. Man denkt über die Salzschichten, Tongesteine und Granitformationen nach. Mit der tatsächlichen Einlagerung wird man erst in vielen Jahrzehnten beginnen. Heißer Strahlungsmüll wird bis dahin zwischengelagert, heißt es. Das allein wird schwierig genug.
Der Müll in der Asse ist also noch der vergleichsweise harmlosere Teil. Dennoch ist die Asse ein Denkmal für phänomenale Nachlässigkeiten, die systemhafte Pfadabhängigkeit von Fehlern und falschem Vorsatz sowie für unverantwortliche »Wissenschaft« – kurz, ziemlich exakt für das, wogegen Nachhaltigkeitsstrategien anzugehen versuchen.
Das unschuldige Plätschern von Wasser macht nachdenklich. An 350 Stellen tritt Wasser in das Asse-Bergwerk und wird von den Bergleuten unter großem Einsatz aufgefangen und entsorgt, 2020 rund 14 Kubikmeter täglich. Ohne die dauerhafte Arbeit der Bergleute würde das Wasser an die Abfälle gelangen, die Bergung wäre unmöglich. Was unterdessen jetzt chemisch und physikalisch in den 13 verschlossenen Müllkammern passiert, ist nicht bekannt.
Die Schachtanlage kann nur noch so lange betrieben werden, wie das Salz dem Wasser standhält. Die Sache hängt am seidenen Faden. Die Ewigkeit kann schnell beendet sein, sie liegt nicht allein in der Hand der Ingenieure. Das Wasser trat schon in Zeiten des »Forschungsbergwerks« ein, mit verheerenden Folgen für die Sicherheit der Lagerräume. Aber die Nuklearforscher verschwiegen das. Ihre unzureichende Benachrichtigung der Öffentlichkeit war 2008 auch der wesentliche Grund dafür, dass die Politik den Forschern die Zuständigkeit für die Ewigkeit entzog. Schließlich platzte mit dem Schmelzen der Reaktorkerne in Fukushima endgültig der Traum von der billigen und ewig verfügbaren Energie aus dem Atom. Was bleibt, sind Ewigkeitslasten und offene Rechnungen. Der nuklearindustrielle Selbstbetrug ist noch nicht zu Ende. Er heißt jetzt sichere Endlagerung.
Diese Hypotheken für alle Zukunft sind real und unermesslich und doch nur ein erster Fingerzeig für das Gesamtproblem. Die Asse zeigt nichts grundlegend Neues, aber sie schärft den Blick. Es gibt andere Ewigkeitsversprechen. Sie mögen zwar nicht genauso explizit sein wie bei der Kernenergie, aber sie sind genauso brüchig. Als erste Generation auf diesem Planeten können wir nicht davon ausgehen, dass es alle zukünftigen Generationen genauso gut haben werden wie die heute lebende Generation. Ein würdevolles Leben aller (bald) neun oder zehn oder mehr Milliarden Menschen ist im Rahmen der ökologischen Ressourcen des Planeten und bei sonst gleichen politischen und technischen Bedingungen schlicht nicht möglich. Es wäre dann ein anderer Planet. Aber wider diese Einsicht wirtschaften und konsumieren wir, als könne dies ewig so weitergehen. Böden sind geduldige Ökosysteme, aber sie können nicht auf endlose Dauer als pures Gefäß für Düngemittel und Pestizide genutzt werden. Ozeane reagieren langsam, aber sie reagieren auf Versauerung, Lärm und Raubbau.
Weil das jedoch immer mehr Menschen in den Blick gerät, ist die Idee der Nachhaltigkeit als Inhalt und Anspruch von Politik heute stärker als je zuvor. Alle krisenhaften Situationen der letzten Jahre, insbesondere aber auch die Corona-Krise zeigen, wie notwendig Nachhaltigkeitspuffer sind. Die Anfälligkeit einer zentral auf Liefereffizienz ausgerichteten Gesellschaft und Wirtschaft ist hoch. Die Corona-Nothilfen müssen an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet werden. Nur welche sind das im Einzelnen? Wer kontrolliert sie? Wer zahlt, wie werden Nutzen und Risiken verteilt? Noch stehen Nachhaltigkeitsstrategien in zugiger Luft und auf wackligem Grund, je nach Sichtweise kümmerlich oder in verborgener Schönheit. Manchmal erscheinen sie wie das bestgehütete Geheimnis der Regierung. So etwa, wenn die Bundesregierung gemeinsam mit allen Regierungen aller Staaten alljährlich in New York für zwei Wochen zusammenkommt, um Erfahrungen zur nationalen Umsetzung der UN-Agenda 2030 zur nachhaltigen Entwicklung auszutauschen. Dieser alljährliche Gipfel ist nicht einmal mehr so konferenzermüdend, wie man von außen meinen könnte. Es gibt durchaus auch innovative Formate und kurzweilige Laboratorien, in denen es auch schon mal ungeschminkt zur Sache geht. Und es treffen sich dort nicht nur Menschen, deren Beruf die Nachhaltigkeitspolitik ist, sondern auch solche mit Berufung, Anliegen und praktischen Netzwerken außerhalb von Regierungen. Das macht den Austausch zusätzlich und abseits der diplomatischen Dokumente interessant.
Aber gibt es dazu eine einzige Meldung in den Tagesthemen? Widmet sich dem auch nur eine einzige gebührenbezahlte Talkshow, von denen wir so viele haben? Geht eines der Hauptstadtmedien und politischen Wochenblätter auf Hintergrund und politische Ergebnisse ein? Finden wir wenigstens eine Rumpfform engagierter Resonanz in den sozialen Medien?
Die Fragen zu stellen heißt, sie zu verneinen. Die herrschenden Medien interessieren sich für Nachhaltigkeit allenfalls dann, wenn sie Skandale aufdecken oder Geschichten erzählen können, die das Anliegen und die Ziele von Nachhaltigkeit widerlegen. Die Macht des Positiven unterliegt dem strategischen Beschweigen, ein Begriff, den Claus Offe einst (nicht für Nachhaltigkeitsthemen) prägte.
Dennoch lohnt es sich, von der Macht des Positiven zu sprechen. Vermutlich halten sich alle Menschen auf der Erde, wenn man sie direkt fragt, für – im weitesten Sinne – »gute Menschen«. Was würde wohl passieren, wenn das tatsächlich wahr wäre, die Menschen sich tatsächlich so verhielten (und sich nicht einreden ließen, »Gutmenschen« seien nervige Selbstdarsteller) und wenn es Institutionen und Arrangements gäbe, die diese Wahrheit in Handeln umsetzten?
Die 17 Ziele des universellen UN-Zukunftsvertrages wagen eine erste Annäherung an die Antworten auf diese Frage. Diese Sustainable Development Goals (SDGs) werden weiter unten näher beschrieben. Dass sie vereinbart worden sind, hat eine Geschichte der besonderen Art. Hier reicht der Hinweis, dass manche dieser Zielstellungen ganz ungewöhnlich utopisch sind, zum Beispiel die Idee der Bodenneutralität, was meint, dass Fläche für den Siedlungsbau nur in Anspruch genommen werden sollte, wenn anderswo Fläche renaturiert wird. Oder das Ziel, allen Kindern in aller Welt Bildung zu sichern und ihnen darunter auch alles das zu vermitteln, was sie für ihre Entscheidungen zur nachhaltigen Entwicklung brauchen. Andere Ziele sind lange bekannt und alles andere als utopisch. Ihre bloße Existenz garantiert keine positiven Veränderungen, aber sie zeigen auf, wofür sich der Einsatz lohnt, weil es mit der nichtnachhaltigen Gegenwart nicht unbegrenzt weitergehen kann und (!) weil es anders werden kann. Das Können entscheidet.
Ökologie und Digitalisierung radikalisieren die gesellschaftlichen Umbrüche. Die Ökologie steht für die Beziehungen der Menschen zu den natürlichen Lebensgrundlagen auf ihrem Einen Planeten, die Digitalisierung steht dafür, wie die Menschen untereinander Fortschritt und Verteilung organisieren. Beide fordern alles heraus, was wir als gegeben und beherrschbar ansehen. Diese Herausforderung geht über die reine Ökologie und die reine Wirtschaftsorientierung hinaus und ergreift die Art, wovon sich die Menschheit ernährt, wie sie produziert und konsumiert, wie sie den Reichtum und den Hunger verteilt. Und wie sie Politik macht.
Häufig fordern Wissenschaftler*innen und Aktivisten von politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen den Einstieg in eine neue Politik. Um den Worten Nachdruck zu verleihen, hat es sich eingebürgert, auch gerne einmal übertreibend von »Rettung« zu sprechen. Gerettet wird heute alles; und in der Pandemie wird auch schon einmal »die Wirtschaft« gerettet, der Tourismus oder die Beschäftigung. Wo gerettet werden muss, da ist der verzögerte oder gar abgewendete Anfang eine unterlassene Hilfeleistung und eigentlich strafbar. Dieser moralischen Aufrüstung beugt die andere Seite natürlich vor. Wer Politiker und CEOs zu einem Anfang rät, fördert zunächst einmal Argwohn zutage. »Anfangen« kommt nicht mit dem unschuldigen Flair des englischen »Trial and Error« daher. Mindestens in Deutschland ist es – oft ungewollt und meistens unbewusst – beladen mit Schuld und Vorwurf. Das macht die Sache nicht leichter.
Die üblichen Reaktionen sind: Was habe ich denn bisher falsch gemacht? Warum ausgerechnet ich? Wer das leichte Wort Anfang sagt, muss auch das harte Aufhören sagen: Wo liegen die Konflikte?
Aller Anfang ist schwer, sagt man dafür, dass es viel Mühe bereiten kann, mit etwas Neuem zu beginnen. Wenn die meisten zögern, kostet es einige Überwindung, als Erster voranzugehen. Dazu kommt, dass niemand gerne bei einem »Anfängerfehler« ertappt wird. Eine andere, ebenfalls übliche Abwehrreaktion stellt das »Rettungs«-Anliegen als trivial dar. Die Welt sei kein Ponyhof, heißt es dann, und den Umgang mit dem Problem solle man doch lieber den wirklichen Expert*innen überlassen.
Am Anfang sind alle Anfänger