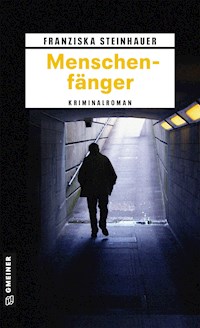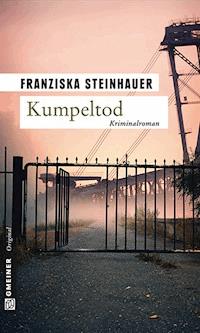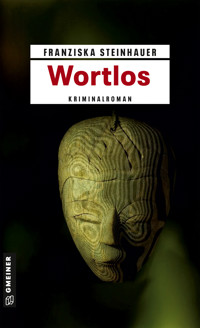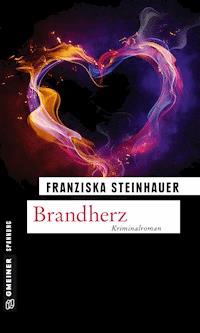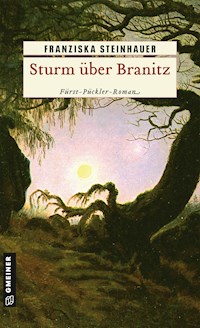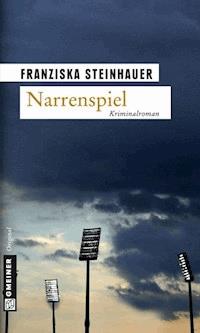9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Im Herbst 1813 wird von Anglern eine geschundene Frauenleiche gefunden. Gerüchte über ein riesiges wildes Tier kursieren, das sein Unwesen in der Gegend treiben soll. Der Medicus Dr. Prätorius hingegen hält einen Menschen für den Schuldigen. Während sich in Leipzig eine Typhusepidemie ankündigt und Truppenbewegungen die Bevölkerung verängstigen, wird eine weitere Leiche entdeckt. Unruhe macht sich breit. Da wird Dr. Prätorius ins Lager der Franzosen gerufen, um einen Kranken zu behandeln …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Franziska Steinhauer
Die Stunde des Medicus
Ein Roman zur Völkerschlacht
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vernet-Battle_of_Hanau.jpg
ISBN 978-3-8392-4296-4
Vorspann
»Das ist dochnicht dein Ernst!«Corinna von Blanstaff knallte das Buch zu, in dem sie gelesen hatte, und warf es wütend auf den Tisch. »Das hast du nicht wirklich getan!«
Ihr Mann, groß und stattlich, senkte bedrückt den Kopf. Ich habe schließlich geahnt, dass es Ärger gibt, dachte er bitter, das muss ich nun eben aushalten, er wird sich verziehen.
»Dein Bruder hat sich dein Wort erschlichen – und was unternimmst du? Nichts! Schlimmer noch: gar nichts!«, keifte seine Frau.
»Nun, Corinna, so ist es nicht gewesen«, begann er leise seine umfassende Beichte. »Es entsprach meinem Wunsch, dass er bei Hofe vorsprechen solle. Ich selbst machte …«
Corinna fiel mit einem eigenartigen Laut tiefer in ihren Sessel zurück. Hartwig musterte sie einen Augenblick besorgt, entspannte sich aber sofort, als er den tiefen Hass in ihren Augen lodern sah. Alles in bester Ordnung. Es bestand kein Anlass für die Befürchtung, seine Frau könnte gesundheitlichen Schaden nehmen.
»So wird er statt deiner vorstellig?«
»Ja.«
»Und wird mit Amalie nach Dresden umziehen?«
»Nun, bekommt er die Position als Berater – natürlich.«
»Und was wird aus dir?« Hartwig wunderte sich über die plötzliche Ruhe in ihrem Ton. Ihm schien, es könne nichts Gutes bedeuten, wenn Corinna nach dieser Neuigkeit nicht geifernd durchs Wohnzimmer lief. Wahrscheinlich, schloss er, spart sie sich ihren Atem für den ganz großen Streit auf, bastelt schon an beleidigenden, verletzenden Formulierungen, die sie mir dann voller Genuss vor die Füße speit.
»Ich bleibe hier und kümmere mich um das Gestüt, wie ich es schon mein Leben lang gehalten habe. Mir steht nicht der Sinn nach höfischem Treiben. Dort frönt man nur den eigenen Eitelkeiten und muss ständig mit Intrigen und Boshaftigkeiten rechnen. Nein, nein. Ich lebe lieber beschaulich – und meine Pferde hintergehen mich nicht.«
Corinna schoss aus dem Sessel hoch, reckte ihre zehn krallenbewehrten Finger vor sich in die Luft, zielte damit genau auf Hartwigs Gesicht. Aus ihrer Brust drang ein tiefes Grollen, ähnlich dem Knurren eines hungrigen Kettenhundes.
Mit Erstaunen sah der Gatte seine Frau heranfliegen.
Ihre verzerrten Gesichtszüge.
Die Speichelfäden, die aus ihrem Mund flogen, wie der Geifer von den Lefzen seiner Jagdhunde. Die kalten Augen.
Kurz bevor ihre Hände ihm ernsthaft gefährlich werden konnten, packte er Corinnas Handgelenke und drückte fest zu, bis beide Hände blau wurden. Seine Frau versuchte nach seiner Nase zu schnappen wie ein tollwütiges Tier. Laut klapperten ihre großen Zähne nach jedem vergeblichen Versuch aufeinander. Sie trat gegen seine Schienbeine gleich einem ungebärdigen Pferd, versuchte sich aus der eisenharten Umklammerung zu befreien.
»Aber ich bin mit diesem Leben nicht zufrieden!«, schrie ihr Mund. »Ich will diese Langeweile nicht länger ertragen müssen. Hier gleicht ein Tag genau dem anderen. Die größte Aufregung ist die Jagd – und an der nehme ich nicht teil, weil mein Gatte der Meinung ist, das sei keine adäquate Beschäftigung für die Dame des Hauses! Bei Hofe gibt es zu jeder Stunde Zerstreuung. Soirees, Matinees, Konzerte, Theater, Belustigung!«
»Nun, du sorgst im Moment jedenfalls für meine Belustigung. Welch alberner Auftritt, Corinna!«
Die zornbebende Frau funkelte ihren Gatten an. »Dir geht es nur um dich«, fauchte sie. »Deine Ruhe, deine immer gleiche Tageseinteilung, an die sich alle sklavisch halten müssen. Alles durchorganisiert. Mir fehlt Leben und Abwechslung. Zerstreuung!«
»Zerstreuung benötigen nur jene, die nichts mit sich selbst beginnen können, ist für all die bedauernswerten Geschöpfe, die sich mit sich selbst langweilen. Intelligenten Menschen ist diese Empfindung fremd, ihnen ist der Geist Zerstreuung genug.«
Der Schlag hatte getroffen.
Mitten ins Schwarze.
Bleich rang Corinna um Fassung. Das ist es also, schrie ihre innere Stimme gepeinigt, nur weil ich seine Genügsamkeit nicht teile, hält er mich für ein dummes Püppchen, zu nichts zu gebrauchen und von der Ödnis seiner Tage abgestoßen. Er glaubt, er hat ein Recht darauf, mich hier lebendig zu begraben – und wenn ich mich wehre, beweise ich damit in seinen Augen nur meine Einfältigkeit.
Hartwig schob die schmale Gestalt in den Sessel zurück, drückte sie fest in die Polster. Dann stützte er seine Hände auf den Armlehnen ab, beugte sich weit zu ihr hinunter, bis seine überraschend bewegliche Nasenspitze beinahe ihre berührte.
»Wenn du je an den Hof geladen werden willst, so solltest du dich mit meinem Bruder und seiner Frau gutstellen!«, wisperte er gefährlich. »Ich nämlich werde dich nicht dorthin bringen. Und – ich denke, Theodor und Amalie haben genug Schicksalsschläge erlitten. Sie verdienen diese Chance, all das hinter sich lassen zu können. Wage es nicht!«
Damit stieß er seinen schweren Körper vom Sessel hoch, hieb mit der Reitgerte einmal entschlossen gegen die hohen, glänzenden Stiefel, machte auf dem Absatz kehrt und verließ das Haus ohne jeden Abschiedsgruß.
Corinna zuckte zusammen, als die schwere Tür ins Schloss schepperte.
Ihr Atem ging schwer, das Herz rammte heftig gegen das Mieder, als wolle es ein Loch hineinschlagen.
Hinter Corinnas Stirn tobten die Teufel.
Ich bringe dich um, dachte sie, diesmal bist du endgültig zu weit gegangen!
Schon bald beruhigte sich ihr zitternder Körper bei der Planung eines Anschlags auf Hartwigs Leben. Gift? Nein, verwarf sie die erste in der Erregung geborene Idee, ein Reitunfall wäre so viel besser! Erst als die Nebel des Zorns wieder Licht in ihr Bewusstsein dringen ließen, erkannte sie, dass sie auf diese Weise zwar Hartwig los wäre, allerdings wahrscheinlicher ins Zuchthaus als in die Gesellschaft bei Hofe gelangen würde. Sie verschob den Mord bis auf Weiteres, denn eine neue Frage begann sie zu beschäftigen: Welche Regelungen hat er eigentlich für den Fall meines Witwentums getroffen?
Corinna atmete tief durch und klingelte nach dem Mädchen, wies es an, ihre schönsten Kleider herauszulegen, und hatte beim Anziehen schon einen völlig neuen Plan, wie sie die Absichten Hartwigs vereiteln könnte. Ein wenig Geschick wäre schon vonnöten, Selbstbeherrschung war oberstes Gebot. Aber die würde sie schon aufbringen. Ab sofort ging es um alles!
Denn – das wusste Corinna genau – hier wollte sie nicht im Pferdegestank untergehen!
»Mutter!«, zischte sie in den Spiegel, in dem sie das Ergebnis ihrer Verschönerungsbemühungen bewunderte. »Du hast mich ins Verderben verheiratet. Deine Tochter an einen Langweiler verschenkt, dem jeder Apfel Pferdescheiße mehr ist als seine Frau!«
Zwei Stunden später ratterte sie vom Hof.
Die Fahrt würde deutlich länger dauern als gewöhnlich.
Durch die anhaltenden Truppenbewegungen waren die breiten und bequem zu befahrenden Straßen von Soldaten blockiert. Sie musste auf die holprigen Waldwege ausweichen, die nicht dazu geeignet waren, schweres Kriegsgerät zu transportieren. Nervös tastete Corinna nach dem Russischwörterbuch in ihrer Reisetasche und atmete auf, als ihre Fingerspitzen es erspürten. »Französisch ist ja sehr angenehm – aber die Sprache der Völker des Zaren ist nicht leicht zu erlernen. Da ist es gut, vorbereitet zu sein. Schließlich weiß man nie, mit wem man auf der Strecke zusammentrifft!«, erklärte sie sich selbst, um ihre Ängste zu vertreiben.
Wer zaudert, erreicht sein Ziel nicht, wusste sie sicher, also werde ich nicht zaudern!
Die erste Frau
Wahrscheinlich wird keinervon unsden Tag je vergessen. Den nicht und was danach folgte wohl auch nicht.
Mein Bruder Klaus und ich waren zusammen mit Onkel Matthäi aufgebrochen, um unser Geschick im Fischfang zu verbessern. Meine Mutter war der Meinung, es könne nicht schaden, wenn wir in der Lage wären, den Speisezettel der Familie deutlich zu erweitern. Natürlich kannte ich den wahren Grund. Meine Mutter, eine sehr kluge Frau, wusste, dass Brüder unseres Alters ihre Kräfte und ihr Können messen müssen. Sicher, es stimmte was im Dorf geredet wurde, nämlich dass sie deutlich klüger als schön war, uns jedoch störte das nicht.
Wir drei hatten also unsere Rucksäcke gepackt. Wegzehrung für uns, Köder für die Fische, unsere selbstgebastelten Angelruten. Es würde für die Fische nicht einfach sein, uns zu entkommen, denn wir waren schon recht geübte Angler.
Außerdem stand der Mond auf unserer Seite.
Lorenz, ein kauziger Mann aus dem Dorf, von dem niemand sagen konnte, wie alt er war oder woher er stammte, hatte uns im Sommer erklärt, nach Neumond und vor Vollmond würden die Fische besonders gut beißen.
Und in der letzten Nacht hatte sich der Mond gar nicht am Himmel gezeigt.
Klaus und ich waren sicher, wir würden so viele fangen, dass wir Hilfe beim Heimtragen bräuchten.
Matthäi führte uns zu einer Stelle an der Parthe, die ein wenig versteckt lag. Das dunkle Wasserband machte hier eine Biegung, das Ufer verschwand fast vollständig unter Gestrüpp und kam erst weiter flussabwärts wieder zum Vorschein. Matthäi behauptete, hier fühlten die Fische sich sicher, fänden Schatten, und die anderen Fischfänger kämen nur selten her zum Angeln, weil sie sich durch das Unterholz arbeiten mussten, das sei vielen zu beschwerlich. Klaus watete durchs Wasser, was nach den vielen Regenfällen, die selbst den kleinen Fluss hatten anschwellen lassen, gar nicht so einfach war, und setzte sich an der gegenüberliegenden Uferseite auf einen Stein.
Wir warfen unsere Ruten durch die Luft, ließen die Regenwurmköder eintauchen und warteten. Schweigend.
Sehr lange.
Wortlos. Lautlos.
Ich beobachtete, wie Klaus eine stattliche Forelle fing und in seinen Eimer warf.
In meinem schwammen nach kurzer Zeit auch schon drei, unser Onkel war auch erfolgreich. Mehr Beute, als wir zum Abendessen allein verzehren konnten.
Die Sonne krabbelte am Himmel empor. Es wurde erst warm, dann unerwartet heiß für einen Herbsttag.
»Matthias«, erklärte mir Onkel Matthäi, »ich glaube, wir machen noch eine Stunde weiter. Die beißen heute so gut, da fällt genug an für eine Ladung in der Räucherkammer. Deine Mutter wird sich freuen.«
Klaus war auch einverstanden, er hatte wohl einen Rückstand auszugleichen, und so blieben wir am Fluss.
Ich glaube, es war Matthäi, der sich zuerst beschwerte. »Es stinkt!«
Und das stimmte tatsächlich.
»Kommt vom Wasser«, behauptete Klaus. »Hier ist wenig Strömung. Es wird brackig.«
Erneutes Schweigen.
Wir behielten unsere Angeln fest im Blick.
Nach einer Weile maulte Matthäi: »Es stinkt nicht nach verdorbenem Wasser!«
Mein Onkel konnte manchmal nervtötend rechthaberisch sein.
»Sind bei euch auch so viele Wespen?«, fragte ich, denn, wenngleich ich es nicht zugegeben hätte, die Stiche waren schmerzhaft, das Gesumme lästig.
Dem Lärm nach zu urteilen, musste das Nest im Gebüsch hinter mir sein.
»Bei mir nicht«, rief Klaus grinsend, doch Matthäi, der ein paar Meter von mir entfernt stand, nickte. Bei ihm waren die Biester also auch.
»Du bist am anderen Ufer«, stellte ich fest. »Vielleicht mögen die nicht übers Wasser fliegen. Dann hast du die bessere Seite gewählt.«
Ich beobachtete, wie Matthäi aufstand und im Unterholz verschwand.
Der viele Tee vom Frühstück drückte, nahm ich an.
Nach einer Weile kam er zurück.
Nahm wortlos seine Rute wieder in die Hand.
Starrte ohne Regung aufs Wasser.
Überraschend begann er heftig zu würgen.
In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie jemanden so kotzen sehen.
»Mensch, Matthäi! Was ist dir?«, ich lief zu ihm und bemerkte sofort, wie ungewöhnlich bleich er war. Deutlich weißer als sein Hemd.
Langsam kam er wieder zu Atem. Spülte sich den Mund mit Flusswasser aus.
Starrte mit glasigen Augen vor sich hin.
»Besser?«, erkundigte ich mich, und mein Onkel nickte und schüttelte gleichzeitig den Kopf.
»Sollen wir nach Hause gehen?«, fragte Klaus, der angewatet kam.
»Nein, nein«, stöhnte Matthäi. »Wir können sie doch nicht einfach so da liegen lassen.«
Dieser Satz ergab keinen Sinn. Schließlich waren wir nur zu dritt; und keiner von uns weiblich.
Vorsichtshalber legte ich meine Hand auf seine Stirn. Bei meinem letzten heftigen Fieber hatte ich jede Menge Unfug geredet, hatte Dinge gesehen, die außer mir keiner sah. Drachen, die sich in der Schublade räkelten, Zwergengesichter an der Wand hinter meinem Bett, seltsame Fabelwesen, die durch das Zimmer tobten.
Doch Matthäi war nicht heiß.
Klaus nahm eine Handvoll Wasser und schleuderte es ins Gesicht unseres Onkels. »Der hat einen Sonnenstich!«
»Verdammt, hört auf damit«, fluchte Matthäi. »Da hinten liegt eine tote Frau.«
»Wo soll hier eine tote Frau herkommen?« Klaus gab sich gern herb männlich. »Hattest du was in deinem Tee? Von den seltsamen Pilzen, die wir für den Medicus gesammelt haben? Die gegen Schmerzen helfen sollen? Wer weiß, vielleicht erzeugen sie auch Trugbilder.«
»Sie liegt da. Ganz still«, gab Matthäi mit sonderbarer Stimme zurück und deutete vage auf das Dickicht. »Einfach so.«
»Wo genau?« Ich schluckte aufgeregt.
»Dort. Wo die Wespen sind.«
Als wir nachsehen wollen, hielt mein Onkel uns mit eisernem Griff zurück. »Entweder alle zusammen oder keiner.«
Allein hätten Klaus und ich uns wohl ohnehin nicht dorthin gewagt.
Eine Tote.
So etwas hatten wir noch nie zuvor gesehen. Kaninchen und Mäuse, ja, gelegentlich eine Katze oder einen Hund, aber noch nie einen verstorbenen Menschen. Verpassen wollten wir das ganz sicher nicht. Falls sie wirklich dort lag und kein Hirngespinst war.
Matthäi rappelte sich auf und schleppte sich voran.
Es kam uns vor, als mache er immer einen Schritt vorwärts und drei zurück.
Und dennoch näherten wir uns. Das Brummen der Wespen wurde stetig lauter.
Obwohl Klaus und ich – anders als mein Onkel zuvor – auf das vorbereitet waren, was wir finden sollten, traf es uns wie ein mächtiger Hieb in Magen und Knie.
Eine Wolke übelsten Gestanks hing über der kleinen Lichtung.
Wir schoben unsere Nasen in die Ellenbeuge, legten dann die Hand des anderen Armes auf die Schulter, um zu verhindern, dass sie etwa rausrutschten.
Wespen sind nicht leicht zu beeindrucken.
Es dauerte ziemlich lang, bis sie sich mehrheitlich dazu entschlossen, den abziehenden Fliegen und Brummern zu folgen.
Als sich der schwarze, schillernde Teppich gehoben hatte, sahen wir sie.
Die Frau war vielleicht zu Lebzeiten eine Schönheit gewesen, erkennen konnte man das jetzt allerdings nicht mehr.
Die Tiere des Waldes hatten sich an ihr gütlich getan, die Insekten ebenfalls. Die Oberlippe fehlte ganz, und so erkannten wir den Kieferknochen und ihre Zähne. Zwei oder drei fehlten in der Reihe, aber das konnte nach ihrem Tod passiert sein. Ich hatte unter einer toten Ratte auch schon deren Zähne entdeckt. Das musste keine Folge eines Kampfes gewesen sein.
Die Lider fehlten ebenfalls.
Von den Augen war nichts zu erkennen, die bedeckte eine sich bewegende weißliche Masse.
Selbst an der Nase und den Ohren war schon gefressen worden.
Unterhalb des Halses schien sie auf den ersten Blick unverletzt.
Zarte, weiße Haut.
Blonde, gelockte Haare. Eine Hochsteckfrisur, aus der sich im Sterben viele Strähnen gelöst hatten. Glatte Arme wie aus Porzellan. Ein glänzendes rotes Kleid, ein grüner Unterrock. Das Kleid musste aus Seide sein, es schimmerte im Licht. Die Verschnürung des Mieders hatte sich gelöst, ihre Brüste waren nur noch teilweise bedeckt.
Zwischen den Falten ihres Kleides, auf ihrem Körper, in ihrem Gesicht, überall krochen weißliche Maden herum. Ich hatte gar nicht gewusst, dass es um einen toten Körper so laut zuging. Die Luft vibrierte förmlich vor Rauschen, Summen und Brummen. Vielleicht war ein verendetes Eichhörnchen nicht groß genug, um derart viele Fresser anzulocken. Fliegen, Wespen und Käfer, an einem Arm hatte ein wildes Tier geknabbert, vielleicht ein Wildschwein.
Die Finger zeigten eine seltsame grün-violett-schwarze Farbe, die Kuppe war nicht an allen zu entdecken. Ich zählte. Sechs. Insgesamt.
Klaus starrte sie unverwandt an. »Bist du sicher, dass sie tot ist?«, fragte er dann überflüssigerweise. Er flüsterte, als wolle er die Ruhe der Fremden nicht stören.
Auch Matthäi wisperte nur: »Daran kann es wohl keinen vernünftigen Zweifel geben. Das halbe Gesicht fehlt! Und sieh nur all das Leben, das auf ihr herumkrabbelt.«
»Sie war bestimmt sehr schön. Was meinst du, ist ihr passiert?«
»Das kann ich dir auch nicht sagen«, brummte mein Onkel, der nicht ganz so nah an sie herangetreten war, wohl, weil ihm schon wieder übel wurde. »Frauen wie diese sind normalerweise weder bei Tag noch gar nach Einbruch der Dunkelheit allein unterwegs. Außerdem: Was sollte sie hier an der Parthe denn gewollt haben?«
»Angeln?«, schlug Klaus vor.
»Sei nicht so dumm!«, wies ich ihn zurecht. »Weibsleute angeln nicht.«
»Stimmt«, unterstützte mich Matthäi, »die flanieren. Gehen bei teuren Putzmacherinnen einkaufen.«
Stumm sahen wir auf die Tote hinunter. »Ich weiß nicht, irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Bestimmt habe ich sie schon mal in der Stadt gesehen. Obwohl man das ja nur schwer sagen kann …naja, ihr seht ja selbst, das Gesicht … und auch sonst«, murmelte unser Onkel kopfschüttelnd.
Jetzt erst fielen mir die vielen Wunden auf, die an den unbedeckten Stellen ihres Körpers zu sehen waren, der verfärbte Schal über ihrem Hals und die Flecken auf ihrem glänzenden Kleid.
Ich fröstelte in der Mittagshitze.
Klaus streckte seine Hand nach dem Saum des Kleides aus, zwei Finger griffen sacht danach. Langsam versuchte er, den Rock anzuheben. Matthäi bemerkte seine Absicht und schlug ihm kräftig auf die Wange. »Lass das! Du solltest dich schämen!«
Klaus trat bebend einen halben Schritt zur Seite mit rotem Gesicht, geschwollener linker Wange und Tränen der Wut in den Augen.
»Sieht fast so aus, als wäre sie eingeschlafen und hätte das Aufwachen verpasst.« Mit einem zärtlichen Ausdruck in den Augen, den ich bei ihm noch nie zuvor bemerkt hatte, strich Matthäis Blick über das stille Gesicht der Toten.
Ich hatte eine ungewöhnliche Bewegung entdeckt. »Nein, das tut es nicht«, widersprach ich laut und zog mit einer raschen Bewegung den Seidenschal von ihren schmalen Schultern.
»Oh Gott!« Selbst der so neugierige Klaus wich erschrocken zurück. »Die Kehle ist ja völlig zerfetzt.«
Da ich seit einigen Monaten beim Medicus als Gehilfe arbeiten durfte, wusste ich sehr genau zu sagen, was man in den Tiefen der Wunde sehen konnte: Wirbelknochen. Wer auch immer das getan hatte, war mit äußerster Gewalt vorgegangen. Alles Gewebe war zerrissen, die Blutgefäße, Muskeln und Sehnen. Der Kopf war so gut wie abgetrennt.
»Da kriecht dieses Gewürm auch schon drinnen rum. Obwohl der Schal darüber gebunden war.« Matthäi wandte sich angewidert ab.
»Wir müssen es jemandem sagen!«, forderte ich.
»Wem?« Klaus sah mich verblüfft an.
»Wir könnten es Mutter erzählen. Sie weiß sicher, was zu tun ist.«
»Die Geschichte glaubt uns doch keiner. Was sollen wir denn sagen? Dass wir zufällig beim Angeln eine tote Frau gefunden haben?«, höhnte mein Bruder.
»Hört mir zu!« Ich war inzwischen richtig wütend. Sie konnten doch nicht tatsächlich diesen Fund verschweigen wollen! »Diese Frau wird vielleicht schon vermisst. Solche wohnen nicht im Dorf oder bei einem der Bauern. Solche leben eher im Herrenhaus. Sicher sucht ihre Familie längst nach ihr. Wenn wir es nicht erzählen und das rauskommt, handeln wir uns eine Menge Ärger ein!«
»Vielleicht kann es wenigstens noch für ein paar Tage unser Geheimnis bleiben. Wenn sie bis dahin nicht gefunden wurde, zeigen wir sie deiner Mutter.« Matthäi schmiedete gern Kompromisse. Streit war ihm ein Gräuel.
»Da bin ich dabei!«, rief Klaus und schlug die Handflächen so fest zusammen, als müsse er angestaute Kräfte abbauen.
Was blieb mir übrig?
»Wir könnten den Medicus holen. Der ist doch Fachmann für solche Dinge. Vielleicht kann er uns auch sagen, wer oder was sie so zugerichtet hat.« Die Mienen der beiden anderen verdüsterten sich, und ich redete schnell weiter: »Ich meine ja nur: Wenn es ein wildes, böses Tier war, gefährden wir durch unser Schweigen womöglich das ganze Dorf!«
Die beiden starrten mich an.
»Im Wald ist es immer gefährlich. Selbst beim Angeln. Ein Hecht könnte dir zum Beispiel den großen Zeh abbeißen.« Klaus nahm Dinge nicht gern ernst. Vielleicht wollte er sich auch einfach nicht mit diesem Problem beschäftigen.
Wir kehrten also an den Fluss zurück, als sei nichts geschehen.
Warfen die Angeln aus. Lustlos. Freudlos. Uninteressiert.
Stierten schweigend ins Wasser.
Viele Fragen rumorten in mir – und den Geruch des Todes wurde ich auch nicht mehr los.
Ich hatte den Eindruck, meine eigene Haut dünste ihn aus.
Eine Frau wie diese geht normalerweise niemals allein im Wald spazieren, überlegte ich, sie muss also einen Begleiter gehabt haben. Als das wilde Tier angriff – ist er da geflohen? Oder wurde er ebenfalls zur Beute? Lag er auch irgendwo im Unterholz? Ich werde mich zum Medicus schleichen, beschloss ich, er wird mir raten können. Gleich heute Nacht besuche ich ihn!
Als ich einmal aufsah, war Klaus verschwunden.
Kurze Zeit später kam er zurück. Seine Finger zitterten so sehr, dass er die Rute nicht aufnehmen konnte. Sein Gesicht war rot, als habe es eine erbarmungslose Wüstensonne verbrannt.
Mir war sofort klar, was er getan hatte.
Als ich Matthäis Blick begegnete, sah ich, dass er es ebenfalls wusste – und noch mehr. Nämlich, dass ich Klaus ein wenig um seinen Mut beneidete.
Und ich erkannte in seinen Augen, wie sehr wir ihn anwiderten.
»Das hat dir gefallen, wie?«, flüsterte die schmale Gestalt, und die plumpe neben ihr produzierte ein zustimmendes Geräusch. Wohlig und zufrieden klang es.
»Es war alles, wie du es wolltest, nicht wahr? Die kurze Hatz, der erfolgreiche Schlag, das Entdecken des Körpers, die zarte Haut, das weiche Fleisch. Ich kann mir vorstellen, dass du bald wieder so ein Erlebnis haben möchtest. Die Leipziger wird es trotz der ganzen Belastungen durch die Soldaten, die vielen Kranken und Verletzten treffen. Wir haben ja nicht irgendein dahergelaufenes Weibsstück geschlagen, nicht wahr?«
Die grünen Augen des plumpen Wesens begannen zu leuchten, Geifer troff von seinem Kinn, der Atem ging schneller – es war, als verstünde es jedes Wort. Besorgt bemerkte die schmale Gestalt, dass Gier und Aufregung in den kraftstrotzenden, massigen Körper zurückkehrten, der sie selbst um mindestens zwei Köpfe überragte.
»Wir suchen uns schon bald ein anderes Opfer, ich verspreche es dir!«, beeilte sie sich zu versichern. »Diesmal war es die Tochter des Stadtschreibers, mal sehen, wer uns das nächste Mal vor die Klauen läuft.« Ein prüfender Blick in die Augen des anderen. Gut, lang können wir nicht auf die nächste Beute warten, das ist wohl nicht zu übersehen, dachte die schmale Gestalt, während sie weiter beruhigend über den Rücken des Jägers streichelte, ich muss dir schon sehr bald neue Beute zuführen.
»Hier können wir jedenfalls nicht mehr herkommen. Man wird sich schon bald um diesen stinkenden Körper versammeln.«
»Wollt ihr wohl hier bleiben?« Die raue Stimme war besorgt. Sie flüsterte nur. Doch das schien rein gar nichts zu bewirken. Offensichtlich waren sie einen anderen Ton gewohnt, einen energischen und unnachgiebigen. Er sah sich um. Traute sich etwas lauter zu werden. »Hiergeblieben!« Auch das verfing nicht. Das kann nicht wahr sein, die verraten mich noch, dachte Baltus besorgt. Soldaten und Gesindel trieben sich genug herum.
»Ihr seid nicht zum Weglaufen eingesetzt!«, fauchte er ihnen wütend nach. »Ihr sollt – im Gegenteil –
zusammenhalten und aufpassen!«
Die beiden Hunde schienen ertaubt zu sein.
Zielstrebig setzten sie ihren Weg fort.
Der Hirte warf einen prüfenden Blick auf die Schafe, befand, er könnte sie wohl einen Moment allein zurücklassen, und folgte den ausgerissenen Hütern. Bevor er im Unterholz verschwand, drehte er sich noch einmal zur Herde um. »Wehe, wenn nachher auch nur eines fehlt. Wenigstens ihr könntet ruhig hier weitergrasen und auf uns warten.«
Die Hunde waren nicht zu sehen und Baltus fluchte herzhaft. Er blieb stehen, lauschte. Wandte sich dann entschlossen nach links. Wenn das meine Hunde wären, na, denen würde ich schon ordentlich Bescheid stoßen! Einfach die Herde und den Hirten im Stich zu lassen, so etwas ist unglaublich. Drei Tage bei Wasser und Brot! Das wäre die gerechte Strafe. Wenn mir jetzt die Viecher abhauen, muss ich ganz allein dafür bei den Bauern geradestehen. Glaubt mir doch keiner, dass die Misthunde weggelaufen sind, wühlte sich der Ärger durch sein Denken. Ihm wurde heiß, wenn er daran dachte, wie er begründen müsste, warum die Hälfte der Schafe … In Zeiten wie diesen geriet der Hirte selbst schnell in Verdacht für den eigenen Bedarf oder zum Verhökern … Er mochte sich gar nicht ausmalen, was man ihm noch alles unterstellen könnte.
»Wo seid ihr bloß?« Er kam nur langsam voran, stolperte immer wieder über Wurzeln und Zweige, die knapp über den Boden krochen. Da! In einiger Entfernung konnte er die Hunde winseln hören. Ein neuer Schrecken durchfuhr ihn. Waren die beiden in die Falle eines Wilderers geraten? Die Hirtenhunde waren gut ausgebildet, auch wenn sie das gerade nicht beweisen wollten, und teuer waren sie außerdem. Wenn er die beiden verlöre, erginge es ihm nicht besser als beim Verlust der Schafe. Sein Magen randalierte. Vorsichtig schlich Baltus weiter. Schon nach wenigen Schritten wurde ihm der Gestank bewusst, der im Unterholz hing wie Pesthauch. »Miasma!«, murmelte er erschrocken. Doch die Sorge um die Tiere trieb ihn tiefer ins Gestrüpp.
Als er die beiden Tiere und die Frau fand, zuckte er zurück.
»Wart ihr das?«, fragte er die Hunde und wusste schon, dass die beiden Ausreißer nichts mit dem Tod dieser Frau zu tun haben konnten. Sie roch nicht nach frisch geschlachtetem Fleisch, ein wenig blutig – nein, sie stank bestialisch. Fliegen summten herum, und er starrte auf das Gewusel der Würmer, die über ihren Körper krochen. Wie bei den Schafen, die er manchmal erst lange nach dem Abfließen des Hochwassers hatte finden können. Nein, nein, diese Frau war schon länger tot. Er rief die Hunde, die nun bereitwillig folgten, packte sie am Halsband und zerrte sie von der Stelle fort.
Als der Medicus, den das Gerücht über den Fund erreicht hatte, an den Fluss kam, wusste er schon in groben Zügen, was er vorfinden würde. Matthias hatte den Zustand der Frau recht genau beschrieben. Er beugte sich über den Körper, schnüffelte, schob die Brille auf der Nase zurecht und inspizierte die Wunden voller Interesse. Aus seiner kleinen Ledertasche nahm er Papier und Bleistift, begann damit, Form und Verteilung der Verletzungen sorgfältig zu skizzieren. Dabei öffnete er das Mieder der stillen Frau etwas weiter, drehte den Leichnam hin und her, hob den Rock an. Schauderte.
»Bisse. Und tiefe Kratzer. Aber manche auch nur oberflächlich. Hm. Ausgeweidet.« Der Bleistift huschte eilig übers Papier. Denn nun, da die Kunde schnell die Stadt erreichen würde, blieb ihm nicht viel Zeit, mit der Toten – wie er es nannte – Zwiesprache zu halten. »Sieht fast so aus, als wäre derjenige, der für deinen Zustand verantwortlich ist, in den Tagen nach deinem Tod mehrfach hier gewesen. Jedes Mal kamen Verletzungen hinzu. Hier, diese unter dem Arm, ist wohl von heute?«
Die Tochter des Stadtschreibers, wusste er. Ein braves Mädchen, das nach dem frühen Tod der Mutter mit dem Vater allein wohnte und ihm den Haushalt führte. »Was wolltest du nur hier? Hatte er dich geschickt?« Das ist unwahrscheinlich, dachte Prätorius, der Stadtschreiber ist immer sehr besorgt um das Kind, er lässt es in diesen unruhigen Zeiten nicht allein in den Wald gehen.
Von fern schnaubte ein Pferd, das offensichtlich gegen den widerlichen Gestank protestierte, ein hölzerner Wagen quietschte. Der Leichenkarren. Man kam, um den Kadaver in die Stadt zu holen.
Als er von Weitem die aufgeregten Stimmen hörte, die von der Ankunft Schaulustiger aus Leipzig kündeten, erhob er sich rasch und verschwand.
Dass zwei Paar Augen ihn bei seinem Tun beobachteten, bemerkte er nicht.
»Meinst du, das Vieh ist noch in der Nähe?«, fragte einer der Männer ängstlich, die das Fräulein aufladen und in die Stadt bringen sollten. Dabei wanderten seine Augen wie Irrlichter über die Büsche.
»Nee. Bei dem Lärm, den all die Leute gemacht haben? Ist sicher abgehauen.«
»Wer oder was auch immer die Ärmste angefallen hat, es war mit Sicherheit nicht heute. Sie ist schon seit einer ziemlichen Weile tot«, beruhigte Karl, der seit vielen Jahren für den Bestatter arbeitete, die beiden anderen.
»Aber es wäre durchaus vorstellbar, dass dieses Untier zurückkommt. Gerade wegen der Stimmen. Klingen für das Vieh eben nahrhaft.« Bernhard war nicht so mutig, wie er vorgab. Er lauschte während der Arbeit ständig auf ein verräterisches Geräusch, war jederzeit wachsam und bereit, das Fräulein fallenzulassen, um sein eigenes Leben zu sichern. Sie war ja schon tot und er wollte es so bald nicht sein.
»Bernhard!«, zischte Karl ihn wütend an.
»Aber ist doch wahr«, sprang ihm der Freund bei. »Ich hab ja auch gedacht, es lauert noch. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden beobachtet.« Dabei wirbelte er einmal um die eigene Achse.
Zu entdecken war niemand.
»Ja«, bestätigte auch Bernhard, »ich spür es auch, jemand guckt uns zu. Ganz deutlich. Ist wie Jucken zwischen den Schulterblättern, und danach kriecht so ein unangenehmer Schauer …«
»Schluss jetzt!«, herrschte Karl die beiden Hasenfüße an. »Wir laden auf und bringen sie nach Hause zurück. Hier kann sie auf gar keinen Fall bleiben. Also!«
Sie hoben die Tote möglichst pietätvoll auf den Karren, was gar nicht einfach war, denn ihre Arme fielen zur Seite, der Kopf ließ sich nur schlecht halten, insgesamt war sie überraschend schwer zu greifen. Das weiche Gewebe gab nach, je fester sie packten, desto entschlossener wich es aus. Als es endlich geschafft war, setzten sie sich in Bewegung. Bernhard ging hinten und behielt die Umgebung im Auge, falls ihnen das Biest folgen sollte.
Karl murrte: »Mein Schwager sagt, als er den Brotwagen über die Dörfer gefahren hat, sind ihm überall Soldaten begegnet. Die Leute in Liebertwolkwitz haben sich schier nicht zum Kaufen an den Wagen getraut, dabei würden die am Ende wohl ohne die Brotversorgung verhungern. Überall Soldaten und Kanonen, haben sie erzählt, viele verschiedene Uniformen. Das ist die Vorbereitung, ihr werdet schon sehen. Hier findet demnächst eine ganz große Schlacht statt. Darüber solltet ihr euch Sorgen machen. Das Biest tut uns schon nichts. Im Krieg ist sich’s schnell gestorben! Da kann dir keiner helfen.«
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit besuchte Peter Prätorius den Stadtschreiber.
Der verzweifelte Vater saß trotz der Kälte der aufziehenden Nacht auf der Bank vor seinem Haus und starrte in eine Finsternis, die nur er sehen konnte. Er hatte den Kopf in die Hände gelegt, die Ellbogen auf den Oberschenkeln aufgestützt.
Der Medicus schob sich leise neben ihn.
»Ach, Peter! Was für ein grausames Schicksal! Erst meine Frau und nun mein Augenstern.« Tränen schwangen mit, waren aber nur zu hören, nicht zu sehen.
»Was wollte sie allein dort am Fluss?«, fragte der Arzt.
»Das weiß nur der Herr. Sie bekam eine Nachricht von ihrer Tante. Sie solle die Schwester ihrer Mutter zu einem Konzert bei Hofe begleiten. So käme sie in gute Gesellschaft. Natürlich erlaubte ich ihr die Reise.« Der Vater seufzte schwer, hob das Gesicht aus den Fingern und meinte »Ich bin schuld. Hätte ich, wie es vernünftig gewesen wäre, diese Fahrt der Unwägbarkeiten wegen verboten, könnte meine Julia heute bei mir sitzen.«
»Aber! Du konntest doch den schrecklichen Ausgang der Geschichte nicht erahnen! Wann wollte sie denn wieder nach Hause kommen?«
»Vor ein paar Tagen schon. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, weil ich glaubte, sie hat sicher einen schmucken jungen Mann kennengelernt, der ihr den Hof macht, und meine Schwägerin möchte der Kleinen die Gelegenheit bieten, mit ihm näher bekannt zu werden. Ich Esel! Und während ich von ihrer Liebe träume, liegt sie tot ganz in der Nähe! Angefallen und getötet von einer widerlichen Bestie!«
»Oh, ist es das, was vermutet wird?«, staunte Prätorius.
»Alle reden über das Tier! Es muss sehr groß gewesen sein. Und stark. Es hat sie erbeutet und dann achtlos liegenlassen.« Der Vater begann leise zu weinen. »Sie musste einen grausamen Tod erleiden. Fern von mir oder einer anderen Unterstützung, ganz allein.«
»Weißt du denn, ob sie überhaupt bei deiner Schwägerin angekommen ist?«, hakte der Medicus vorsichtig nach.
»Oh mein Gott! Du glaubst, sie wurde direkt nach der Abreise …? Wie entsetzlich!«, ächzte der Stadtschreiber. »Nur weil ich sie nicht begleiten wollte, konnte sich alles auf diese schreckliche Weise entwickeln. Hätte ich doch bloß meine Abneigung überwunden und wäre mitgefahren! Wie ich es drehe und wende: Ich bin schuld an ihrem Tod!«
»Deine Abneigung? Gegen das Fahren in einer Kutsche?«
»Sei nicht töricht, Peter! Nein! Gegen jene Frau in Dresden! Sie ist, nun, wie drücke ich es am besten aus? Schwierig. Das ist ein mildes Wort für ihre Eigenheiten. Ich wollte meiner Julia die Reise nicht verweigern, nur weil ich ihre Tante nicht ausstehen kann.«
»Hat die Tante deine Julia abgeholt?«, wollte Prätorius wissen.
»Nicht einmal das kann ich mit Bestimmtheit sagen. Ich wollte ihr nicht begegnen. So verließ ich unter einem Vorwand früh das Haus und fand es bei meiner Rückkehr leer vor. Und so wird es nun bis ans Ende meiner Tage bleiben: leer und stumm, freudlos und dunkel.«
Wortlos saßen sie nebeneinander.
»Eine Reisetasche hatte sie gepackt? Eher zwei? Und die Hutschachteln?«, unterbrach Prätorius nach einer Weile die Stille.
»Ja, ich weiß es schon: Nichts davon wurde in ihrer Nähe gefunden.«
»Hm. Kannst du mir sagen, was sie mitgenommen hat?«
»Schwerlich. Ihre schönsten Kleider. Eines war smaragdgrün und stand ihr besonders gut.« Wieder starrte der Vater in die Nacht. Dann meinte er: »Wenn ich herausfinde, dass der Kutscher mit ihrer Habe geflohen ist, statt ihr in ihrer Not beizustehen, bringe ich das Schwein um!«
Nun, dachte Prätorius, diese Haltung kann man ihm nicht verdenken.
Als er seinem eigenen Haus zustrebte, überdachte er die Dinge, die der Vater ihm erzählt hatte. Die Tante wollte angeblich der Nichte eine Männerbekanntschaft ermöglichen, eine gute Partie. Zu diesem Zweck lud sie das Mädchen nach Dresden ein. Der Vater konnte keine Angaben zur Reise oder Rückreise der Tochter machen. Bestimmt war er davon ausgegangen, sein einziges Kind werde von einer Vertrauensperson begleitet. Aber vielleicht musste Julia allein fahren? Warum hatte sich die Tante nicht gemeldet? Sie erwartete ihre Nichte zu einem festen Termin, sorgte sie sich gar nicht, als das Mädchen ausblieb?
Nach einigen Schritten begannen seine Gedanken um das Tier zu kreisen.
Die Bisse hatten nicht nach den Zähnen einer gefährlichen Bestie ausgesehen!
Von riesigen Reißzähnen keine Spur!
Er war so in Gedanken versunken, dass er nicht merkte, wie ihm jemand folgte.
Der Leiter der Leipziger Bürger-Nationalgarde war mehr als überrascht.
Seit dem Nachmittag hatte er keine ruhige Minute mehr gehabt. Ganz Leipzig, so meinte er, sei in Aufruhr. Und diesmal ging es nicht um die französischen Truppen, nein, heute hatten die aufgebrachten Bürger ein völlig anderes Anliegen.
Vor den Toren der Stadt hause eine blutgierige Bestie.
Das wurde tatsächlich allenthalben behauptet.
Es habe schon ein Todesopfer gegeben und man sei sicher, es würden noch weitere folgen – es sei denn, er würde eine Gruppe von erfahrenen Jägern zusammenstellen und sie dem Untier auf den Pelz hetzen.
Nun, dann würde er das tun.
Er beauftragte einen jungen Soldaten, die notwendigen Leute zusammenzurufen.
Jäger und Treiber.
Je mehr, desto besser.
Und wären sie am Ende erfolgreich, fiele der ganze Ruhm auf ihn zurück! Die Leipziger würden ihm, dem Retter, endlich mit der ihm zustehenden Achtung begegnen! Und er musste kaum etwas dafür tun.
Im Morgengrauen fand sich im Regen eine überraschend große Anzahl von Jägern zusammen.
Schnaps machte die Runde.
Es war schließlich für diese Tage viel zu kalt, und die ewige Feuchtigkeit bahnte sich ziemlich rasch den Weg bis auf die Haut. Selbst die Pferde zeigten deutliche Anzeichen von Unwillen. Den nächsten Schnaps trank man – und das hätte natürlich keiner der Männer zugegeben – gegen die Angst. Schließlich wusste man nie, was man im Wald antraf und in diesem speziellen Fall schon gleich gar nicht. Sie waren auf der Pirsch auf ein Ungeheuer.
Über Nacht war die Bestie in den Berichten und Erzählungen derer, die das tote Fräulein gesehen hatten, mehr und mehr gewachsen, hatte unglaubliche Dimensionen angenommen.
Ein riesiger Bär?
Inzwischen klangen die Beschreibungen derer, die das Biest genauso wenig zu Gesicht bekommen hatten wie er selbst, so, als könne das Untier mühelos über das Dach des Kirchenschiffes der Thomaskirche sehen.
»Wir sollten versuchen, das Tier in Richtung Mulde zu treiben. Auf jeden Fall weg von der Stadt. Selbst wenn wir es nicht erlegen können, ist es dann jedenfalls weit entfernt.«
»Ha!«, höhnte einer der Jäger. »Was, wenn es umkehrt und zurückkommt, kaum dass wir abgezogen sind? Für solch ein Monstrum ist der Fluss keine Grenze.«
»Ach, der Grünschnabel hat Ahnung? Wie viele Bären hast du eigentlich schon erlegt?«
»Wenn wir hier noch lange diskutieren, bekommen wir ihn heute ohnehin nicht mehr zu sehen.«
»Na, dann los!«
»Ihr zögert nur, weil ihr euch fürchtet!«
Das gab den Ausschlag.
Der Tross setzte sich in Bewegung. Als unordentlicher Haufen zunächst, doch je weiter sie die Stadt hinter sich ließen, desto klarer wurde der Auftrag.
»Wir könnten ihn von der Parthe ausgehend Richtung Stadt scheuchen. Eine Kette Jäger bleibt hier und wartet, Gewehr im Anschlag. Eine weitere begleitet die Treiber zum Fluss. Dort angekommen bilden wir ein möglichst langes Band und jagen ihn aus der Deckung. Wenn er flieht, schießen die Jäger am Ufer, wenn er zu euch hinaufkommt, seid ihr dran.«
Der Vorschlag wurde angenommen.
Einige Reiter und Jäger zu Fuß verteilten sich in einem weiten Bereich, die anderen machten sich auf in Richtung Fluss.
Der Regen nahm an Heftigkeit zu.
Der Alkohol wärmte.
Die Zeit dehnte sich wie die Predigt des Pfarrers beim sonntäglichen Kirchgang.
Da! Plötzlich kam Bewegung ins Gestrüpp.
Es wurde laut gegrölt, mit Stöcken gegen Bäume geschlagen, geklatscht.
Die Jäger brachten ihre Gewehre in Anschlag.
Etwas Gewaltiges brach aus dem Gestrüpp.
Sofort eröffneten die Jäger das Feuer.
Als sich der Pulverrauch verzogen hatte, hörten sie eine Stimme von weit her rufen: »Um Himmels willen, hier liegt noch eine Leiche! Kommt her! Wie schrecklich!«
Der Leiter des Trupps zog die Augenbrauen bis zum Haaransatz. »Eine? Wer hat denn den Kerl zählen gelehrt?«
Kapitel 1
Zwei tote Frauen, auf dieselbe Weise getötet, zerbissen, zerfetzt, grübelte der Medicus, und wir kommen nun schon seit Tagen keinen Schritt weiter bei der Aufklärung. Beide Mädchen aus gutem Hause, beide waren durch ein Schreiben aus dem Haus gelockt worden. Eine Bestie, die schreiben kann? Und doch wollten die Leipziger lieber an ein Untier glauben, als an einen menschlichen Mörder. Der frühere Bürgermeister war völlig gebrochen, seit man ihn zu der Stelle am Fluss geführt hatte, an der seine Jüngste lag. Seither ging er nicht mehr aus dem Haus, verbarrikadierte sich und die ganze Familie, die anderen Mädchen durften nicht ohne Begleitung durch die Straßen der Stadt gehen. Auch er beteuerte, er glaube, ein wildes Tier habe seine geliebte Tochter gerissen. Nur gut, dass die Gräfin von Blanstaff sich überall deutlich dafür aussprach, einen Täter unter den Leipzigern zu suchen und nicht zuzulassen, dass noch mehr Frauen diesem grausamen Mörder zum Opfer fielen. Er seufzte, fuhr sich mit den Fingern durch sein in der Mitte gescheiteltes kinnlanges Haar. Wer käme nur für solche Gräuel in Frage, ließ ihn der Fall nicht los, war es wirklich bei beiden Opfern der gleiche Täter oder sollten sie nach zwei verschiedenen Mordbuben suchen. Der eine konnte ja vom anderen gelernt haben, oder? Gedankenverloren kickte er einen kleinen Stein vor sich her.
»Pssst!«, zischte es direkt neben ihm.
Erschrocken fuhr Prätorius zusammen. Warf nervöse Blicke über seine Schulter in die Umgebung.
»Pssst!«
Im Gebüsch? Prätorius trat näher an das stachlige Strauchwerk heran.
In Zeiten wie diesen galt es besondere Vorsicht walten zu lassen, wenn einem das Leben lieb war. Der Wald gehörte längst nicht mehr den Dörflern allein.
»Hier!«, krächzte es verhalten.
Angesichts der Stacheln der Pflanze war er froh, dass er Handschuhe trug.
Prätorius bog die Zweige auseinander.
Sah direkt in die weit aufgerissenen, intensiv grünen Augen eines blonden Mannes, dessen Gesicht die deutlich aufgeworfenen Lippen etwas Sinnliches verliehen.
»Markus! Verflixt. Musst du mich so erschrecken?«
»Ach Prätorius, tut mir auch leid. Ich hab ja gesehen, dass du mit wichtigen Gedanken beschäftigt warst. Willst du dich Eleonora endlich erklären? Bei ihrem Vater um ihre Hand anhalten?« Der wütende Blick des Medicus brachte ihn für einen Herzschlag zum Schweigen. »Entschuldige, das geht mich natürlich gar nichts an. Deshalb habe ich auch nicht hier auf dich gewartet. Stell dir vor, ich habe wieder eine gefunden! Eine von den ausländischen. Schonthall hieß die, glaube ich jedenfalls.«
»Schon wieder eine? Du meinst, sie sieht aus wie die beiden anderen?«
Markus nickte heftig. Jaulte dann leise auf, weil er mit der Nase an die Stacheln geraten war.
»Komm schon. Es blutet nicht einmal«, tröstete Prätorius. »Also, wo hast du sie gesehen?«
»Unten im Uferdickicht. Ich führ dich hin. Und es ist ihr ergangen wie den anderen, ganz genau wie den anderen.«
Markus eilte voran.
Immer darauf bedacht, möglichst wenig Geräusche zu verursachen.
Prätorius wusste, dass der junge Mann sich vor dem Untier fürchtete. Wie viele Bürger Leipzigs zitterte er vor der riesigen Bestie, von deren Existenz Prätorius so gar nicht überzeugt war.
Eine halbe Stunde später kniete der Medicus neben dem leblosen Körper.
Die Kehle der Frau war zerfetzt, der Körper übersät mit Verletzungen, die Augen trübe und tief in die Höhlen gedrückt, einzelne Finger fehlten, Lippen und Nase waren angefressen, die Haut schimmerte grün.
»Ist eine Weile her, dass sie sterben musste, sie ist kalt«, murmelte Prätorius mehr zu sich selbst denn zu seinem Begleiter. »Auf der anderen Seite ist der Körper noch an manchen Stellen steif. Sehr lange liegt der Tod also auch nicht zurück. Drei Tage, vielleicht vier.«
Er beugte sich näher über das Gesicht.
»Seltsam«, meinte Markus.
»Was?«
»Keine Tiere, die an ihr fressen. An den anderen waren Unmengen zu finden, eklige Tiere. Und Käfer. Hier ist nichts davon zu sehen.«
»Zu kalt, würde ich meinen. Fliegen mögen es nicht, wenn es so nass und eisig ist. Der ständige Regen hält sie vom Erkunden der Gegend ab. Käfer sind ganz gewiss zu finden, aber vielleicht eher unter dem Körper.«
»Vor drei Tagen lag sie hier noch nicht.«
»Das weißt du genau?«
»Ja. Ich war auf der Jagd, als ich hier vorbeikam. Du weißt, es ist auch mit dem Jagen schwierig geworden. Zu viele Leute mit zu großem Appetit.«
Prätorius nickte. Die Soldaten waren nicht zimperlich, wenn es um das Stillen ihres Hungers ging.
»Du sagst, es sei eine von den ausländischen Frauen. Warum denkst du das?«
»Ach so – das. Ich habe sie vor ein paar Tagen gesehen. Sie unterhielt sich mit einem Soldaten. Hinter einem dicken Baum. Bestimmt dachten sie, niemand könne sie dort bemerken. Jedenfalls habe ich gehört, dass er Schonthall zu ihr gesagt hat. Ist doch kein Name bei uns«, pumpte Markus aufgeregt.
»Konntest du verstehen, worüber sie gesprochen haben?«
»Nicht ein Wort!«
»Hm. Vielleicht hast du recht. Auf jeden Fall bedeutet die Sache Ärger.«
»Ja. Das ist nicht zu übersehen. Jemand hat einen der bösen Geister geweckt. Sogar in der Stadt reden sie davon. Eine riesige Bestie, die über junge Frauen herfällt. Der Pfarrer wird eine Messe lesen und das Böse bannen. Die Leute tuscheln, der Teufel habe uns das Tier geschickt.«
»Der Teufel! So ein Unsinn. Derjenige, der hier tötet, ist nicht der Hölle entstiegen. Er ist aus Fleisch und Blut, wie du oder ich.«
»Also doch! Aus Fleisch und Blut sagst du? Ein riesengroßer Wolf, nicht wahr? Wie auf der Zeichnung in einem der Bücher bei dir. Sieben Fuß hoch, wenn er sich aufrichtet.« Markus sah sich nervös um. Senkte seine Stimme zu heiserem Flüstern. »Es soll sogar welche geben, die bei Vollmond zu unfassbarer Größe anschwellen und alle Bewohner eines Dorfes in nur einer Nacht verschlingen.«
»Das glaube ich nicht. Es ist schon die dritte tote Frau. Wie sollte ein Wolf – und sei er noch so groß – Männer von Frauen zu unterscheiden wissen?«
»Das tut er vielleicht gar nicht. Frauen riechen besser, sicher ist ihr Fleisch zarter, und man kann sie leichter fangen. Das weiß der Wolf bestimmt.«
Dazu fiel Prätorius auf die Schnelle kein Gegenargument ein.
In einem Reisebericht hatte er gelesen, dass es in weit entfernten Ländern Tiere gab, die gelernt hatten, Menschen als schnell zu erlegende Beute zu erkennen. Markus konnte demnach durchaus recht haben. Auch wenn es diese Tiere in Sachsen natürlich nicht gab – und Prätorius nicht an die Mär vom riesigen Wolf glauben mochte.
Langsam und bedächtig hob er den Rock der Frau.
Selbst die Unterröcke waren blutdurchtränkt. Prätorius hob die nächste Lage an.
Markus wurde unruhig. »Du kannst doch nicht … Also wirklich! So geht das nicht, Medicus. Lass das mal besser bleiben. Frauen sind in diesem Punkt ziemlich heikel, solltest du wissen«, plapperte er, während Prätorius sich unbeeindruckt von den Einwänden Schicht für Schicht voran arbeitete.
Als er die Scham freigelegt hatte, schauderte er, Bauch und das gesamte darunter befindliche Gewebe waren aufgebrochen und zerfetzt.
»Himmel!«, kreischte Markus schrill auf. »Wie kannst du ernsthaft behaupten, dieses Untier entstamme nicht auf direktem Weg der Hölle!«
Kapitel 2
»Eleonora! Habe ich da nicht gerade ein Stück Schinken in deinem Korb verschwinden sehen?«
Das Mädchen spürte, wie die Röte sich in ihre Wangen brannte.
»Nur ein bisschen Brot. Es wird uns nicht fehlen«, beteuerte Eleonora schnell. »Vielleicht erlaubst du mir, noch einen Krug Wein mitzunehmen«, trat sie dann entschlossen die Flucht nach vorn an. Ich muss tollkühn sein, dachte sie dabei, wie kann ich nur so vorlaut sein?
»Ich habe es dir doch schon oft genug verboten, oder irre ich mich da? Du bist von ihm für seinen Haushalt eingestellt worden, nicht dafür, dass du unsere Speisekammer für ihn plünderst. Der feine Herr Medicus soll mal schön seinen eigenen Geldbeutel bemühen! Aber so ergeht es den kleinen Leuten eben immer«, lamentierte die Mutter lautstark und warf ihre kräftigen Arme in einer hoffnungslosen Geste in die Luft. »Außerdem sag ihm, ich dulde nicht länger, dass du allein durch die Straßen läufst. In Zeiten wie diesen ist das zu gefährlich. Er kann dir jemanden als Begleiter senden. Oder«, sie machte eine Pause und meinte dann listig, »nein, das ist besser. Wir schicken einen Begleiter mit, den er entlohnen soll. Sein Bursche ist viel zu jung und einer solchen Aufgabe sowie der damit verbundenen Verantwortung gewiss nicht gewachsen.«
»Mutter! So weit ist es nun auch wieder nicht. Schließlich liegt sein Haus nur 20 Minuten Fußweg von der Stadt entfernt, nicht in unerforschtem Gebiet. Lass mich nur schnell den Korb zu ihm hin tragen, dann kehre ich sofort zurück«, bettelte Eleonora uneinsichtig.
Die Mutter seufzte. »Komm mit in die Stube. Wir müssen uns unterhalten.«
Artig folgte die Tochter. Widerstand war zwecklos.
Die Mutter griff nach ihrer Stickarbeit und setzte sich in einen bequemen Sessel. Sie prüfte die Spannung des Stoffes zwischen den runden Rahmen, zog ihn dann ein wenig fester und wählte eine neue Farbe für die Blütenblätter aus.
Die Tochter setzte sich auf das Fußbänkchen und wartete schweigend ab, bis alle Vorbereitungen für die Nadelmalerei abgeschlossen waren.
»Ich war heute bei Katharina Ambrosia!«
»Mutter! Wie konntest du nur? Jeder weiß, dass ihre Weissagungen nichts taugen. Die Ambrosia erzählt einfach jedem, was sie glaubt, das er hören will! Niemand weiß, was die Zukunft bringt, weder die eigene, noch die Fremder«, empörte sich die Tochter. »Wenn Vater davon erfährt!«
»Still! Dir fehlt es an ausreichend Lebenserfahrung, um über solche Dinge sprechen zu können. Die Ambrosia hat in ihre Kristallkugel gesehen. Und sie war ganz aufgeregt wegen der Geschehnisse, die dort erschienen sind, Kind. Prätorius wird in eine gefährliche Handlung verstrickt, die auch dich miterfasst. Sie hat euch in Lebensgefahr gesehen. Allerdings meinte sie im gleichen Atemzug, dass der Medicus in Kürze etwas tun wird, das die Geschicke des ganzen Landes betrifft und alles zum Guten wendet.«
»Ach, Mutter!«
»Vielleicht wird der König krank und er wird zu ihm gerufen, um ihn zu behandeln«, mutmaßte die Frau des Bäckers und zuckte mit den Schultern. »Genauer wusste es auch die Ambrosia nicht zu sagen«, schloss sie trotzig.
Eleonora träumte sich fort. Raus aus der Wohnstube, aus der Enge der elterlichen Fürsorge.
Plötzlich holte die Mutter tief Luft und begann zu erzählen. »Peter Prätorius, der Medicus, wie man ihn auch nennt, ist der Sohnessohn von Wolf und der Sohn von Gustav Prätorius. Wie du weißt, umgab und umgibt sie auch noch heute ein Geheimnis. Von jeher beschäftigten sie sich mit Dingen, die unser Herr nicht gutheißen kann. Sie nannten es Experimentieren. Aber viele in der Stadt glauben, sie wählten dieses Wort nur, um zu verschleiern, dass sie in Wahrheit mit dem Teufel im Bunde sind. Sie heilten gar Kranke, die bereits die letzte Ölung erhalten hatten! Wer anderes als der Teufel wird sich derart um eine Seele bemühen? Und die Seele eines Prätorius muss für ihn von besonders großem Interesse gewesen sein.«
»Aber Mutter! Das ist doch nur das Gerede derer, die nicht verstehen, was Dr. Prätorius tut. Schon sein Großvater und Vater waren sehr geschickt darin, Kräuter mit Heilkraft zu finden, aus denen man Tee kochen oder Tinkturen zubereiten kann. Kräuter, von denen bis dahin niemand vermutet hatte, sie könnten überhaupt eine heilsame Wirkung besitzen. Es ist die Natur, die gegen so manches Leiden hilft. Teufelswerk oder Zauberei sind nicht mit im Spiel.«
»Du dummes Kind«, rügte die Mutter zornig. »Wolf Prätorius hat des Nachts bei Vollmond höchst eigenartige Dinge getrieben. Die Alten wissen davon zu berichten, wie er schreiend um einen Kessel rannte, von Dämonen gejagt, die er um Hilfe angerufen hatte, um seinem Gebräu Wirksamkeit zu verleihen.«
»Diese Geschichte kenne ich schon. Ich habe Dr. Prätorius danach gefragt und er erklärt das anders. Seiner Meinung nach hat man sich das ausgedacht, damit die Leute in der Stadt die Familie Prätorius meiden. Manch einem ist es nicht recht, dass ein Arzt Prätorius Krankheilen heilen kann, bei denen andere keinen Erfolg erzielen konnten!«, verteidigte Eleonora vehement die Ehre ihres Arbeitsgebers.
»Ach ja? Und was soll seiner Meinung nach dahinterstecken? Die, die wirklich heilen können, gehen auch davon aus, dass bei Prätorius etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Ist dir schon mal aufgefallen, mein Kind, dass er Linkshänder ist? Die halten es nicht mit dem Herrn, die stehen von Geburt an dem Teufel nah! Ein guter Mensch und Christ mit reinem Gewissen benutzt die rechte Hand!«
»Aber Mutter! Das klingt fast so, als glaubtest du auch daran, dass Rothaarige mit der Hölle im Bund sind.«
»So ist es doch! Sieh dich um. Allenthalben bieten diese Rotschöpfe ihre Hexendienste an. Sie verwirren gute Familienväter, stürzen sie in die Sünde! Sei nicht so blind!«
Eleonora seufzte.