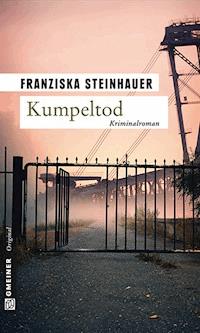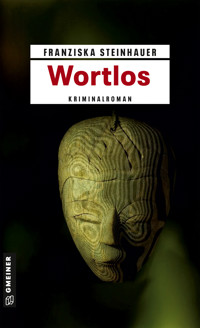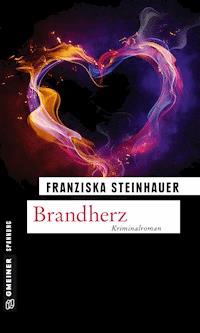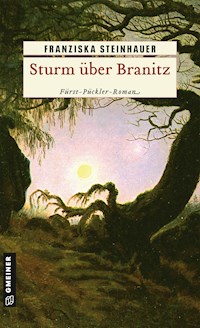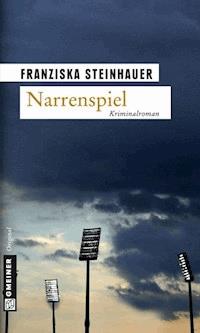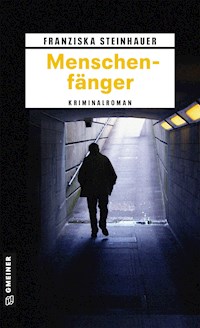
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Peter Nachtigall
- Sprache: Deutsch
Großeinsatz der Polizeikräfte in Brandenburg. Der brutale Vergewaltiger und mehrfache Mörder Klaus Windisch ist aus der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen entflohen. Zeitgleich wird in einem Cottbuser Mietshaus eine mit Maden übersäte weibliche Leiche entdeckt. Steht Windischs Flucht in Zusammenhang mit dem grauenvollen Fund? Hauptkommissar Peter Nachtigall läuft die Zeit davon, denn bereits am nächsten Tag wird wieder eine Tote gefunden - eine junge Frau, die in ihrer Wohnung bestialisch zu Tode gefoltert wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Franziska Steinhauer
Menschenfänger
Peter Nachtigalls vierter Fall
Zum Buch
BESTIE MENSCH Großeinsatz der Polizeikräfte in Brandenburg. Der brutale Vergewaltiger und mehrfache Mörder Klaus Windisch ist aus der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen entflohen – mithilfe einer Mitarbeiterin des Wachpersonals. Aus den Tonbandprotokollen, die bei der letzten Inhaftierung Windischs aufgenommen wurden, erfährt Peter Nachtigall, mit was für einem Menschen er es in diesem Fall zu tun hat: Klaus Windisch mordet aus Freude an der Tat, er empfindet nichts für seine Opfer, er tötet sie, weil er »weiß, wie es geht«. Zeitgleich wird in einem Cottbuser Mietshaus eine mit Maden übersäte weibliche Leiche entdeckt. Steht Windischs Flucht in Zusammenhang mit dem grauenvollen Fund? Bereits am nächsten Tag wird wieder eine Tote gefunden, die in ihrer Wohnung bestialisch zu Tode gefoltert wurde. Hauptkommissar Peter Nachtigall läuft die Zeit davon, denn plötzlich verschwindet eine weitere junge Frau spurlos …
Franziska Steinhauer lebt seit mehr als 25 Jahren in Cottbus. Bei ihrem Pädagogikstudium legte sie den Schwerpunkt auf Psychologie sowie Philosophie. Ihr breites Wissen im Bereich der Kriminaltechnik erwarb sie im Rahmen eines Master-Studiums in Forensic Sciences and Engineering. Diese Kenntnisse ermöglichen es der Autorin den Lesern tiefe Einblicke in pathologisches Denken und Agieren zu gewähren. Mit besonderem Geschick werden mörderisches Handeln, Lokalkolorit und Kritik an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft. Franziska Steinhauers Romane zeichnen sich vor allem durch gut recherchierte Details und eine besonders lebendige Darstellung der jeweiligen Figuren aus. Ihre Begeisterung am Schreiben gibt sie als Dozentin an der BTU Cottbus-Senftenberg weiter.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von sxc.hu
ISBN 978-3-8392-3098-5
1
Montag, 9. Oktober
Die Luft war drückend schwül.
Der Oktober hatte in diesem Jahr mit ungewöhnlich viel Sonne und hohen Temperaturen überrascht.
Alle Fenster der Wohnung waren geöffnet und im warmen, leichten Wind bewegten sich sacht die bodenlangen Gardinen. Sie hatte die Wohnung gründlich aufgeräumt, die Teppiche gesaugt und den Staub von Fensterbänken und Regalböden gewischt. Es wäre ihr sonst unangenehm gewesen, noch peinlicher. Die Blicke der Nachbarn sollten nicht auf Chaos fallen.
Von der Straße drang ab und an das Rauschen vorbeifahrender Autos und knatternder Motorräder bis in die ruhigen Zimmer hinauf. An manchen Tagen war Kindergeschrei zu hören, und in der Ferne bellte mitunter grollend ein Hund. Abends dröhnten die Fernsehdialoge aus der Wohnung der fast vollständig ertaubten Frau Klose durch die Räume, und wenn Frau Martens das Haus verließ, donnerten die Bässe von Steffens Lieblingsmusik durch die Decke.
Aber all das störte hier niemanden.
Auf dem Boden im Flur, gleich hinter der Tür, lag eine regungslose Frau.
Schon etwa eine Stunde nach Eintreten der ewigen Stille kam die Erste. Auf der Suche nach einem feuchten, weichen Plätzchen möglichst ohne direkte Sonneneinstrahlung entdeckte Lucilia das Auge. Es dauerte nur einen weiteren Augenblick und eine zweite fand den Weg, dann eine dritte. Bald schon hatten sie ihre beigefarbenen, stäbchenförmigen Eier abgelegt, unzählige Fliegeneier, aus denen schon in Kürze Maden schlüpfen würden, die den Fortbestand der Art sicherten.
2
Montag, 23. Oktober
»Steffen!«
Die Stimme seiner Mutter drang zwar an das Ohr des 15-Jährigen, erreichte aber nicht sein Bewusstsein. Das war mit wichtigeren Dinge beschäftigt. Zum Beispiel mit der Frage, wie er sich an Marie ranmachen konnte, ohne zum Gespött der anderen zu werden. Marie sah aus wie ein Engel. Ihr langes blondes Haar reichte bis knapp über den Po, und wenn sie beim Gehen mit den Hüften wippte, wurde ihm immer ganz heiß. Er könnte ihr einen kleinen Brief schreiben. Oder war das albern?
Steffen drehte die Musik von ›Sportfreunde Stiller‹ lauter. Den iPod neben sich auf dem Kopfkissen starrte er die Deckenlampe an, als warte er auf eine Eingebung. Es müssten schon ganz besondere Worte sein, überlegte er, nicht so der übliche Quark. Etwas, was Marie wirklich umhaute. Ein Gedicht vielleicht?
Die Tür zu seinem Zimmer wurde schwungvoll aufgerissen.
»Steffen! Los aufstehen!«
Diesmal konnte er seine Mutter nicht ignorieren. Ihre massige Gestalt verdunkelte den Blick auf den sonnenhellen Flur. Das plötzliche Licht blendete ihn. Er lag grundsätzlich in einem durch Rollos abgedunkelten Zimmer. Licht brauchte er nur für die Hausaufgaben oder zum Lesen. Und jetzt waren Ferien!
Er seufzte und zog die Ohrhörer raus.
»Ich hab dich nicht gehört. Hast du was zu mir gesagt?«, erkundigte er sich unschuldig.
Die Mutter schnaubte.
»Es ist halb vier! Was ist mit Training?«
»Schon halb vier?«, fragte er ungläubig. So lange konnte er doch gar nicht hier gelegen haben! Steffen stemmte sich hoch und schwang die Beine aus dem Bett.
»Ich geh ja schon! Bin schon fast weg!«
»Nimm den Müll mit runter!«, rief seine Mutter ihm noch zu und verschwand in der Küche.
»Ja«, antwortete er uninteressiert, während er unter dem Bett nach seinen Sneakers suchte. Keine vier Minuten später stürmte er mit seinem Rucksack auf dem Rücken die Treppen hinunter. Auf dem Treppenabsatz im dritten Stock registrierte er eine Bewegung und entdeckte zwei weiße, dickliche Maden, die sich seltsam windend Richtung Treppe schoben.
»Wo kommen die denn her!«, murmelte er angewidert und rannte weiter.
Als er drei Stunden später vom Training zurückkam, versuchten ungefähr 20 Maden durchs Treppenhaus zu entfliehen. Einige hatten sich dabei allerdings in der Richtung vertan und wanden sich erfolglos an Frau Knabes Wohnungstür hoch. Nach wenigen Zentimetern stürzten sie wieder ab. Andere purzelten bereits vom Treppenabsatz auf die erste Stufe hinunter. Eilig lief Steffen weiter.
»Du hast vergessen, den Müll runterzubringen!«, erinnerte ihn seine Mutter unfreundlich. »Bei den Temperaturen muss der Abfall jeden Tag raus. Sonst kriechen hier bald die Maden durch die Küche.«
»Die Frau Knabe muss einen Müllbeutel hinter der Tür vergessen haben. Bei der kriechen die Viecher über den Treppenabsatz. Voll eklig!«
»Was! Na, da werde ich gleich mal bei ihr klingeln. Du bringst in der Zwischenzeit den Müll zum Container!«
Nebeneinander stapften sie die zwei Treppen in die untere Etage hinunter.
Steffen schienen es noch mehr Maden geworden zu sein. Vorsichtig schob er sich an ihnen vorbei von Stufe zu Stufe, um nicht auf eines der Tiere zu treten. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass seine Fantasie ihm ausmalte, wie glitschig es sich anfühlen würde, eine solche Made unter seinem Fuß zu zerquetschen. Er bekam eine Gänsehaut.
»Frau Knabe?«, Steffens Mutter klingelte und klopfte noch immer, als der Junge von den Containern zurückkam.
»Vielleicht ist sie in Urlaub gefahren. Ich habe sie jedenfalls schon seit Tagen nicht mehr gesehen.«
»Weißt du noch, wann zuletzt?«, fragte seine Mutter, und Steffen konnte hören, dass sie plötzlich besorgt war.
»Montag, glaube ich. Vorletzte Woche.«
Frau Martens drückte ihr Ohr an die Tür, wobei sie sorgfältig darauf achtete, ihre Füße so zu platzieren, dass sie nicht mit den Maden in Kontakt kommen konnten.
»Hast du gesehen, ob ihre Fenster geöffnet sind?«
Steffen überlegte. »Ja, sind offen.«
»Dann ist sie sicher nicht in Urlaub gefahren. Nichts zu hören – nur so ein Rauschen, als ob das Radio ohne Sender läuft. Ich werde mal Frau Just fragen, ob sie was weiß. So kann das hier jedenfalls nicht weitergehen. Das ist ja widerlich!«
Gegen 19 Uhr hatte sich fast die ganze Hausgemeinschaft vor Frau Knabes Tür versammelt und starrte angeekelt auf den wimmelnden Strom. Die Nachfrage unter den anderen Mietern hatte ergeben, dass seit Dienstag der vorletzten Woche niemand mehr Frau Knabe gesehen hatte, niemand wusste etwas über einen geplanten Urlaub, und sie hatte auch bei niemandem die Wohnungsschlüssel hinterlassen. Der Briefkasten quoll bereits über, aber dem hatte bisher keiner der Nachbarn Bedeutung beigemessen.
So beschloss die kleine, aufgeregte Versammlung, den Hauswart zu informieren.
3
Vor Begeisterung hätte Klaus Windisch am liebsten in die Hände geklatscht und albern herumgetanzt. Doch das wäre natürlich ein zu auffälliges Verhalten gewesen – und warum sollte er so dumm sein, seinen Erfolg durch törichte Freudenbekundungen aufs Spiel zu setzen? Als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, war er selbst erstaunt, wie einfach es im Grunde war.
Er war raus!
Einfach so durch die Tür in die Freiheit spaziert!
Warum machten das denn nicht alle so?, fragte er sich und beantwortete sich die Frage gleich selbst: Weil sie nicht wussten, wie man es anstellen musste. Aber ich, ich weiß, wie es geht!
Klaus Windisch wusste auch, dass es ihm schon immer geholfen hatte, so auszusehen wie Muttis liebster Schwiegersohn. Die dichten braunen Haare waren modern geschnitten, immer frisch gewaschen und penibel gestylt. Fettige, ungepflegte Haare ließen einen leicht schmierig aussehen und schon war das Kapital verspielt, wusste er. Sein Gesicht war freundlich und offen, seine stets leuchtenden Augen verliehen ihm etwas unwiderstehlich Lausbubenhaftes. Der Mund lächelte meist, und die vollen Lippen ließen alle Worte wie reine Wahrheit klingen, die Nase hatte genau die richtige Länge, und seine klaren, dunkelgrauen Augen sahen sein Gegenüber immer mit dem exakt dosierten Maß an Vertrauenswürdigkeit und Sehnsucht an, das ihn sofort und überall beliebt machte. Bei seiner Arbeit in der Wäscherei hatte er sorgfältig darauf geachtet, seine Hände und Nägel geschmeidig zu halten. Eine duftende Pflegeseife und eine reichhaltige Handcreme hatten für zarte, weiche Haut ohne Einrisse oder gar abgerissene Nägel gesorgt. Steckte er, wie jetzt, im Anzug, konnte man ihn ohne Weiteres für einen Anwalt oder Banker halten.
Der Zeitpunkt war wirklich gut gewählt. Schon bald würde der prominente Mitbewohner, dieser rechte Anwalt, viel Medienaufmerksamkeit auf sich und die Anstalt ziehen. Das hätte die Dinge unnötig verkompliziert.
Schade, überlegte Klaus Windisch und grinste schief, schade, dass ich nicht dabei sein werde, wenn hier das Chaos ausbricht. Aber vielleicht brachten die Lokalnachrichten später noch etwas über seine spektakuläre Aktion, tröstete er sich, dann würde er schon bei Evelyn auf der Couch sitzen und ihr wortreich die letzten Ersparnisse abnehmen.
Zügig entfernte er sich von dem großen, grauen Gebäude, warf nicht einen Blick zurück, nickte im Vorbeigehen freundlich den Leuten auf der Straße zu und war in Richtung Kahren verschwunden. Drei Kilometer Fußweg, und er hatte die Stadt erreicht, in die er Angst und Schrecken tragen würde.
4
Der herbeigerufene Hauswart besah mit leichtem Ekel die sich windende Bescherung und fuhr ratlos mit allen zehn Fingern durch den Restbestand an langem, weißem Haar.
»Ich kann nicht einfach so die Tür aufsperren! Stellen Sie sich mal vor, ich mach das bei Ihnen! Das wäre Ihnen doch auch nicht recht!«, protestierte er und versuchte, auf eine Lösung zu kommen. All seine Versuche, die anderen Mieter wieder in ihre Wohnungen zu scheuchen, waren fehlgeschlagen, und nun gebärdeten sie sich so hysterisch, als ginge von den paar Maden eine gesundheitliche Gefährdung exorbitanten Ausmaßes aus. Am wahrscheinlichsten war doch, dass Frau Knabe noch vor ihrer Abreise den Müll runterbringen wollte und es dann schlicht vergessen hatte, als sie ihre Koffer nach unten trug. Dann war dieses Gewürm nicht sein Problem.
»Aber sie hat alle Fenster offen! Sie glauben doch nicht, sie fährt in Urlaub und lässt alle Fenster einladend weit auf, damit Einbrecher einsteigen können!«, schrillte die Stimme von Frau Weißgerber an sein Ohr.
»Hat sie vielleicht auch nur vergessen, also ich meine die Fenster zu schließen. Passiert doch mal. Taxi hat geklingelt – und da ist sie runtergestürmt. Außerdem wird wohl kaum einer mit so einer langen Leiter zum Einbrechen vorbeikommen! Das ist viel zu auffällig!«
»Ihr Auto steht unten auf dem Parkplatz!«, beharrte Frau Just.
»Taxi, sage ich doch! Am Flughafen sind die Parkgebühren verdammt hoch, da ist es billiger, mit dem Taxi und der Bahn zu fahren.« So leicht ließ sich der Hauswart nicht aus der Ruhe bringen.
»Was, wenn ihr was zugestoßen ist? Herzanfall?«
Der Hauswart hatte sich inzwischen zu einer Entscheidung durchgerungen. Schließlich würde von dem Müll über kurz oder lang eine Geruchsbelästigung ausgehen. Wenn er ehrlich war, konnte er den Gestank schon jetzt deutlich wahrnehmen, wenn er sich zur Tür beugte.
»Herzanfall!«, widersprach Frau Münzer, »Quatsch! Dafür ist Frau Knabe doch noch zu jung!«
»Das kann auch junge Menschen treffen!«
»Was, wenn jemand sie ermordet hat?«
Schweigen machte sich breit.
Der Hauswart seufzte, kramte sein Handy aus dem Werkzeugkasten und wählte die Nummer des zuständigen Polizeireviers. Besser, er machte sich in deren Augen lächerlich, als vor den Mietern wie ein unfähiger Trottel dazustehen. Und so – mit diesem Getier im Hausflur – konnte es schließlich auch nicht bleiben.
Als Klaus Windisch anderthalb Stunden später in Evelyns Straße einbog, standen mehrere Streifenwagen vor dem Hauseingang. Eine dichte Traube Menschen diskutierte auf dem Bürgersteig und gestikulierte wild in Richtung Haus.
Hatte man Evelyn etwa schon unter Verdacht – oder war die Belastung für sie zu groß geworden und sie hatte selbst gestanden? Klaus Windisch zuckte gleichgültig mit den Schultern. Egal – dann würde er eben woanders unterkriechen. Und, beschloss er dann und grinste fies, er würde jetzt ohnehin erst einmal sein ›Spezialwerkzeug‹ einkaufen gehen. Dann käme alles andere fast von allein. Schließlich wusste er ja, wie so was geht, freute er sich und rieb sich die Hände.
5
Hauptkommissar Peter Nachtigall saß in seinem Garten in Sielow.
Der knapp zwei Meter große, massige Mann streichelte Casanova, seinen Kater, der sich auf seinem breiten Schoß zusammengerollt hatte. Missbilligend hatte die rot-getigerte Katze registriert, dass heute wohl nur Gemüse auf dem Speiseplan stand – zumindest für den Menschen des Hauses.
»Mach dir keine Sorgen«, beruhigte Nachtigall seinen Mitbewohner, »für dich ist auch noch was Anständiges da.«
Seufzend lehnte er sich zurück. Dies war sicher einer der letzten Tage in diesem Jahr, an dem man noch ohne dicke Jacke im Garten sitzen konnte. Die schwarze Kleidung, die er grundsätzlich trug, weil sie an jedem Ort die richtige Wahl war und man beim unüberlegten Greifen in den Schrank keinen Fehler begehen konnte, fing die Wärme ein und verstärkte das wohlige Empfinden.
Der Wetterbericht hatte allerdings eine dramatische Veränderung vorhergesagt, die Temperatur würde nun über Nacht Novemberniveau erreichen. Kaum vorstellbar – aber er hatte das vor fünf Jahren schon einmal erlebt.
»Hoffentlich friert es dann nicht wieder durch bis April.«
Peter Nachtigall hatte seine üppigen, dunklen Haare zu einem Zopf zusammengebunden und seine grünen Augen funkelten amüsiert, als er den Blick des Katers auffing.
»Denk nicht einmal daran – der Zopf ist kein Spielzeug. Ach, ich verstehe dich falsch, nicht wahr? Du meinst, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, den Kühlschrank zu checken, ja?«
Als hätte Casanova die Worte verstanden, sprang er vom Schoß und lief mit in die Höhe gerecktem Schwanz auf die Terrassentür zu.
Nachtigall schlenderte langsam hinter ihm her und warf einen prüfenden Blick in den Himmel. Graue Wolken zogen sich zusammen.
»Casanova – es brechen harte Zeiten an. Der Winter kommt!«
In der Küche mischte sich Nachtigall eine Apfelschorle und füllte dem Kater etwas Katzenfutter in den Napf. Dankbar stieß der große Kopf gegen seine Hand, dann machte sich das eindrucksvolle Tier über sein Abendessen her.
Das Radio dudelte leise, und gerade als der Hauptkommissar überlegte, ob er sich nicht doch noch ein schmackhaftes Wurstbrot richten sollte, wurde das laufende Programm von Radio Cottbus für eine Sondermeldung unterbrochen.
»Vor wenigen Minuten erreichte uns die Mitteilung, dass einem Häftling der JVA in Dissenchen die Flucht gelungen ist. Die Bevölkerung wird um erhöhte Wachsamkeit gebeten. Klaus Windisch ist etwa 30 Jahre alt, hat kurze braune Haare und ein sympathisches, freundliches Auftreten. Er ist 1,74 Meter groß und schlank. Der Entflohene wurde wegen Vergewaltigung und Mordes zu insgesamt 15 Jahren Haft verurteilt. Wenn Sie Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen machen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächste Polizeidienststelle oder unsere Telefonhotline 0180…«
»Shit!«, fluchte Nachtigall. »Wie ist das denn passiert!«
Mit dem Telefon in der Hand kehrte er in den Garten zurück, steckte Casanova im Vorbeigehen ein Stückchen Käse zu und rief die Kollegen an.
»Er hatte alles perfekt vorbereitet: Köfferchen, Anzug, Ausweis, Schlüssel. Auf den Videobändern ist nichts Verdächtiges zu erkennen. Und du weißt doch selbst, wie das ist: Keiner guckt sich die Leute, die gehen, genauer an. Man nickt sich nur zu und gut. Er konnte alle Türen öffnen, an der Pforte wurde er für einen Anwalt gehalten und weg war er.«
»Aber das kann er unmöglich ohne Hilfe geschafft haben – oder arbeitete er in der Schlosserei?«
»Nee«, gackerte der Kollege, »in der Wäscherei. Die Ermittlungen laufen, die Leute sind informiert, Radio und Fernsehen warnen. Wir kriegen ihn schon wieder«, behauptete er dann fest überzeugt.
»Na, wenn du meinst!«
Peter Nachtigall konnte die Zuversicht des Kollegen nicht teilen. Wenn dieser Klaus Windisch alles so gut vorbereitet hatte, war auch für ein sicheres Versteck gesorgt oder für eine Möglichkeit, von Cottbus aus weiter zu kommen.
»Hoffentlich ist das nicht bald mein Fall!«, murmelte er träge und biss in eine saftige Nektarine. Nur kurze Zeit später störte sein Telefon die spätnachmittägliche Ruhe.
»Albrecht hier. Wir haben eine Tote. Der Kollege meinte, sie sähe sehr unappetitlich aus. Bei dir war besetzt, da haben sie mich informiert.«
»Hast du schon gehört, dass der Klaus Windisch aus der JVA geflohen ist? Kam gerade im Radio.«
»Was! Ausgerechnet der! War zwar nicht unser Fall, aber das war ein Ding damals. Hoffentlich kriegen sie ihn bald. – Ich hol dich ab, und dann fahren wir zu der angegebenen Adresse in Sachsendorf. Der Kollege meint, die Frau liege schon eine ganze Weile tot in ihrer Wohnung. Ein Hauswart hat die Polizei verständigt und bei der Wohnungsöffnung …«
»Wieso rufen die dann uns?«, unterbrach ihn Nachtigall. »Eine alte Dame ist unbemerkt verstorben – wahrscheinlich ein Kreislaufversagen oder so etwas wegen der überraschenden Wärme in den letzten Tagen. Das ist ein Fall für den Hausarzt.«
»Nein, nein. Eine junge Frau. Evelyn Knabe, Jahrgang 1973, wohnhaft in der Gelsenkirchener Allee. Mord oder Selbsttötung, das ist die Frage, die wir klären sollen.«
Entsetzt starrte Peter Nachtigall auf den Madenteppich, unter dem sich der Körper einer Frau erahnen ließ. Vermutlich war das die Leiche der Wohnungsinhaberin Evelyn Knabe, was aber im Moment noch niemand bestätigen konnte. Übelkeit packte ihn, und er versuchte, sie hinter einem Taschentuch zu verbergen, das er vor seinen Mund presste. Der intensive Verwesungsgeruch zog derweil durchs ganze Haus und hatte die meisten Schaulustigen zurück in ihre Wohnungen getrieben. Außer einem leisen Rascheln, das den Flur erfüllte, war kaum ein Geräusch zu hören.
»Das kommt von den Maden. Es entsteht, wenn sie übereinander kriechen – also dann, wenn ziemlich viele von ihnen übereinander kriechen«, erläuterte der herbeigerufene Arzt unbeeindruckt. Als er den seltsamen Blick Nachtigalls bemerkte, setzte er hinzu: »Ich bin Notarzt. Sie würden nicht für möglich halten, was man so finden kann, wenn man zu verwahrlosten Menschen gerufen wird, die sich selbst nicht mehr helfen können. Aber so etwas wie dies hier habe ich auch noch nie gesehen.«
»Achten Sie darauf, dass möglichst viele von den Tieren mit in die Pathologie kommen. Vielleicht kann der Rechtsmediziner damit etwas anfangen: Todeszeitpunkt bestimmen oder so etwas«, wies Nachtigall die beiden grau gekleideten Herren an, die gekommen waren, um die Tote abzutransportieren. Als er zum Sprechen das Taschentuch vom Mund nehmen musste, wurde er von einer neuen Welle Übelkeit überrollt – der Schweiß brach ihm aus und er kämpfte den aufsteigenden Mageninhalt nieder.
Hilfe suchend sah er sich nach Albrecht Skorubski um, der schon weiter in die Wohnung vorgedrungen war. Zwei Zimmer, Küche, Bad – offensichtlich nur für eine Person konzipiert. Vor dem Wohnzimmer war ein schmaler Balkon.
»Habt ihr die Fenster geöffnet oder waren die schon auf?«, wollte Nachtigall von einem der Kollegen der Spurensicherung wissen, die in ihren weißen Schutzanzügen wie Wesen von einem fremden Stern aussahen.
»Die standen sperrangelweit offen. Im Flur sind wir schon fertig, hier auch – aber ins Schlafzimmer können Sie noch nicht, da sind wir noch drin.«
»Hm«, Albrecht Skorubski ging in die Hocke, »sieht so aus, als habe es hier sogar reingeregnet.«
»Wann hat es denn das letzte Mal geregnet?«, fragte Michael Wiener, jüngstes Mitglied in Nachtigalls Team, überrascht. »Das muss doch ewig her sein, oder habe ich da was verpasst?«
»Jaja, die jungen Leute und die Liebe. Umweltwahrnehmung spielt in dem Alter nur eine geringe Rolle. Wahrscheinlich mit anderen Dingen wahnsinnig beschäftigt gewesen?«, lachte der Kollege vom Erkennungsdienst und setzte dann, nachdem er Nachtigalls zornigem Blick begegnet war, ernst hinzu: »Am Dienstag der letzten Woche hat es abends geregnet. War ein richtiger Wolkenbruch. Danach nicht mehr.«
»Dienstag der letzten Woche – dann wäre sie ja schon seit fast 14 Tagen tot! Kann das stimmen?«, fragte Nachtigall den Arzt und der zuckte mit den Schultern.
»Dazu müssen Sie rausfinden, was das für Maden sind. Die Entomologen kennen die Entwicklungszeiten und können recht genaue Aussagen treffen. Fliegen gibt es hier viele, sehen Sie, da ist eine und dort, da drüben sitzen gleich drei, hier noch einmal vier, in der Küche sieben. Die, die wir aufgescheucht haben, gar nicht mitgerechnet. Eine schillernde, summende Wolke. Aber ob die nun von draußen reingekommen oder hier geschlüpft sind, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen.«
»Ich dachte immer, man riecht, wenn hinter einer Tür eine Leiche liegt.«
»Um ehrlich zu sein – oft ist es so wie in diesem Fall. Die Nachbarn werden auf die Maden aufmerksam und nehmen den Verwesungsgeruch erst dann wahr, wenn sie sich zur Tür beugen. Und hier war für Lüftung gesorgt – deshalb ist der Geruch auch nur im Flur so belastend.«
»Woran sie gestorben ist, können Sie mir auch nicht sagen, oder?«
»Nein. Da müssen Sie auf das Ergebnis der Obduktion warten.«
Die Wohnung war perfekt aufgeräumt, die Mülleimer geleert, die Kissen auf dem Sofa aufgeschüttelt und in der Mitte geknifft. Kein Geschirr in der Spüle, keine schmutzige Wäsche im Bad. Selbst den Kühlschrank hatte Frau Knabe ausgeräumt, abgetaut und den Strom ausgeschaltet. Vor ihrem Tod musste sie sogar noch das Abtropfbrett ausgekippt haben, damit das Tauwasser nicht auf den Küchenfußboden laufen würde.
»Theoretisch hätte jemand über den Balkon einsteigen und sie ermorden können«, meinte Albrecht Skorubski.
»Meinst du nicht, die Nachbarn hätten die Polizei informiert, wenn jemand im dritten Stock über die Balkonbrüstung steigt?« Peter Nachtigall runzelte die Stirn. »Es sei denn, er kam nachts. Aber selbst dann ist es schwierig, die Straße ist gut beleuchtet und eine so lange Leiter ist auffällig.«
»Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Toten um die Mieterin der Wohnung handelt? Haben wir Anhaltspunkte dafür oder glauben wir das nur, weil in der Wohnung einer Frau eine weibliche Leiche gefunden wurde?«, fragte er dann weiter.
»Tja, wer sollte es sonst sein?«
»Ein Einbrecherduo steigt ein, die Partnerin stirbt an einem Infarkt, der Einbrecher nimmt Frau Knabe als Geisel«, schlug Peter Nachtigall vor und machte dabei ein vollkommen ernstes Gesicht.
»Der Hauswart und die Nachbarn hatten keinen Zweifel. Sie meinen, die Kleidung zu kennen, behaupten, die Haarfarbe stimme auch«, stellte Michael Wiener fest.
»Das muss aber nicht zwingend bedeuten, dass es stimmt. Wir Menschen lassen uns gerne etwas vorgaukeln, wählen gerne die nahe liegende Lösung. Aber gut, gehen wir davon aus, dass es sich bei der Toten um Evelyn Knabe handelt. Wissen wir denn schon etwas über sie?«
»Nein, noch nicht. Aber ich bin schon unterwegs und frage bei den Nachbarn, ob sie mir etwas über sie erzählen können.« Damit eilte er auf den Flur hinaus und entschied sich dafür, bei Frau Martens mit der Befragung zu beginnen.
»Im Schlafzimmer lehnt ein Briefumschlag an einem der Blumentöpfe«, informierte ein anderer Schutzanzugträger Peter Nachtigall.
6
»Oh – Sie sind von der Kriminalpolizei? Das hätte ich ja nicht gedacht! So ein junger Mann!« Damit lud Frau Martens ihn begeistert in ihr Wohnzimmer ein, in dem sich offensichtlich die meisten anderen Mitglieder der Hausgemeinschaft versammelt hatten.
»Das ist Herr Wiener von der Polizei!«, stellte sie den Besucher vor, in einem Ton, als präsentiere sie dem abendlichen Kaffeekränzchen eine exotische Kuchenkreation, gebacken nach jahrhundertealtem Geheimrezept unter Zugabe von Jungfrauenblut.
»Oh – Sie kommen sicher, weil Sie Informationen über die arme Frau Knabe sammeln wollen, nicht wahr?«, fragte ein weißhaarige, ältere Dame aufgeregt.
»Ja. Je mehr wir wissen, desto besser können wir uns vorstellen, was für ein Mensch sie war und …« … wo wir den Täter suchen müssen, hätte er beinahe hinzugefügt, doch gerade rechtzeitig fiel ihm ein, dass sie ja noch gar nicht wussten, ob Frau Knabe ermordet wurde.
»Zum Beispiel wüssten wir gerne, wann Frau Knabe zum letzten Mal gesehen wurde.«
»Da sind wir uns schon ziemlich einig. Am Montag wurde sie noch von Frau Schulz gesehen. Danach nicht mehr.«
Sie wies auf eine magere Frau Mitte 40, die unglücklich auf die Tischdecke starrte.
»Frau Schulz?«
Die Frau nickte schwach.
»War sie denn wie sonst? Oder kam sie Ihnen ängstlich, aufgeregt oder besonders traurig vor?«
»Tja, das kann man bei Evelyn Knabe nicht so einfach beantworten. Wissen Sie, sie hat sehr zurückgezogen gelebt – sie war eben nicht der Typ, der einfach mal auf einen Plausch stehen bleibt. Zeit für Belanglosigkeiten schien sie nicht zu haben«, erklärte Frau Martens an Stelle der Angesprochenen. Die Damen rückten etwas zusammen, und Michael Wiener fand sich auf einem ausladenden Sofa wieder, eine Tasse Kaffee wurde ihm zugeschoben, und ein Stück selbstgebackene Sahnetorte fand seinen Weg auf den Teller vor ihm.
»Hmmm, wunderbar«, nuschelte er den Mund voll Kuchen. »Haben Sie den selbst gebacken?«
»Wir backen immer selbst«, freute sich die Hausfrau und errötete. »Den Kaffee können Sie bedenkenlos trinken. Um diese Zeit nehmen wir entkoffeinierten. Sonst können wir nicht schlafen, wissen Sie?«
»Evelyn Knabe hat nie an unseren Kränzchen teilgenommen. Vielleicht waren wir ihr nicht niveauvoll genug«, stellte eine resolute, sportliche Frau am anderen Ende der Tafel fest.
»Seid nicht so schrecklich ungerecht! Sie hat viel gearbeitet. Da blieb ihr für so etwas einfach keine Zeit«, verteidigte die weißhaarige Frau die Verstorbene.
»Was war sie denn von Beruf?«, fragte Wiener und schluckte den letzten Bissen Torte hinunter.
»Na, wie heißt das richtig? Wärterin ist doch sicher nicht der richtige Ausdruck! Schließerin, glaube ich – draußen in Dissenchen in der JVA. Oh, jetzt weiß ich’s – Vollzugsbeamtin.«
Alle Augen wandten sich der Sprecherin zu, Münder blieben offen stehen, über der Tafel spannte sich ein seltsam lüsternes Schweigen aus.
»Was?«
»Na ja – eine Cousine von mir arbeitet da auch, und die hat sie erkannt, als sie mal bei mir zu Besuch war. Die Frau Knabe hat ein so entgeistertes Gesicht gemacht, als meine Cousine sie freundlich im Hausflur begrüßte, dass ich beschloss, niemandem etwas davon zu erzählen. Ich hatte den Eindruck, es wäre Frau Knabe ausgesprochen peinlich gewesen.«
7
Johanna Merkowski schloss die Haustür auf, indem sie die eine Einkaufstüte an ihren Körper presste und die andere über die Hand auf den Unterarm gleiten ließ. Der kleine Malteser umsprang sie aufgeregt und wickelte ihr dabei die Hundeleine um die Beine.
»Armstrong! So kann ich doch nicht laufen! Wenn du damit nicht aufhörst, kommen wir nie nach Hause und du musst auf dein Abendessen verzichten!« Sie lachte unbeschwert und warf die blonden Haare in den Nacken zurück.
Johanna Merkowski war Anfang 20 und wunderschön. Zu Beginn des Jahres hatte sie einen Werbevertrag als Model bei einer der größten Kosmetikfirmen bekommen. Ihr ebenmäßiges Gesicht strahlte von Plakatwänden und Fernsehzeitschriften. In gut sortierten Kosmetikabteilungen lächelte es von Aufstellern an Verkaufsständen.
Noch immer lachend stellte sie die Einkaufstüte ab und befreite sich aus der liebevollen Umwicklung.
»Kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein?«, fragte eine angenehme Stimme neben ihr, und sie hob den Kopf. Ein freundlich lächelnder junger Mann sah sie an und spontan erwiderte sie das Lächeln.
»Oh, danke! Wir kommen schon klar!«
»Mein Name ist Heiner. Ziemlich altmodischer Name, ich weiß, aber der Vater meiner Mutter hieß so, und also bekam ich den Heiner ab. Schade, dass er nicht Sören hieß, hätte mir persönlich viel besser gefallen. Aber nun ist es zu spät«, lachte er und griff an ihr vorbei, um die Eingangstür aufzustoßen. Ehe sie protestieren konnte, hatte er schon die Einkaufstüte im Arm und eilte voraus.
»Ich heiße Johanna.«
»Und der kleine Wildfang da?«
»Das ist Armstrong!«
Er lachte.
»Aha. Was für ein großer Name! Das ist gut für sein Selbstbewusstsein. Meine Oma, Heiners Frau, hatte auch so einen. Sie war ganz vernarrt in den Winzling. Meine Oma war eine stattliche, große Frau, die wahnsinnig gut kochen konnte. Leider hat sie auch selbst gerne gegessen und so wurde sie immer fetter.«
Sie erreichten den ersten Treppenabsatz. Johanna drehte sich nach dem Portier um, doch die Kabine war leer.
»Ja. Gut. Danke. Ich schaffe das prima alleine weiter«, erklärte die junge Frau entschlossen.
»Ach was. Jetzt bin ich bis hierher mitgekommen, jetzt trage ich die Tüten auch noch bis vor die Tür.«
»Aber ich wohne im vierten Stock! Armstrong hasst es, Aufzug zu fahren. Wir nehmen immer die Treppe«, protestierte sie schwächer.
»Kein Problem. Meine Oma hat ihren Hund Kleopatra genannt. Wenn sie an irgendeiner Ecke stand und laut Kleopatra rief, sind die Leute stehengeblieben und haben sich neugierig umgedreht. Sah aber auch wirklich seltsam aus, meine große Oma und ihr Minihund. Meist hat sie ihn sowieso fest an ihren Busen gedrückt.«
Er bückte sich und fuhr Armstrong mit einer raschen Bewegung übers Fell.
Das gläserne Treppenhaus des Gebäudes in der Stadtpromenade erlaubte einen Blick über die Innenstadt. Schon bald würde man von hier aus auf eine der größten Baustellen Brandenburgs blicken können. Nachdem die Cottbuser endlich ihre Oberbürgermeisterin abgewählt hatten, stand der Verwirklichung des Projekts Blechen-Carré nichts mehr im Wege. Der neue Oberbürgermeister wirkte entschlossen, dem Investor nun alle Wege zu ebnen und der Stadt Perspektiven zu eröffnen. Aber noch war nichts davon zu sehen.
»Schön hier«, stellte Heiner fest und erzählte dann weiter. »Meine Oma hat ihren Hund abgöttisch geliebt. Wie das eben häufig so ist bei alleinstehenden Damen. Ihr Mann, mein Opa, war leider früh an Lungenkrebs verstorben und außer meiner Mutter hatten die beiden keine weiteren Kinder. Nach seinem Tod hat Oma dann beschlossen, etwas so Anstrengendes wie Männer käme ihr nicht mehr ins Haus. Machen nur Arbeit und sind außerdem noch anspruchsvoll.« Wieder lachte er, und fröhliche kleine Fältchen bildeten sich um seine Augen.
»Ach, hier wohnst du schon? Ich hätte mir vier Stockwerke hochzusteigen anstrengender vorgestellt. Aber das liegt natürlich an deiner angenehmen Gesellschaft«, erklärte er entwaffnend.
Johanna Merkowski steckte den Schlüssel in die Tür und sah ihn unentschlossen an.
»Danke für deine Hilfe. Reintragen kann ich die Sachen nun wirklich alleine.«
Sie stellte ihre Einkaufstüte ab und wollte nach der in seinem Arm greifen, doch er wandte sich lachend mit einer koketten Drehung ab.
»Na, die paar Schritte bis in deine Küche, die überlebe ich auch noch.«
Überrumpelt von der Situation wusste sie nicht, wie sie dieses Angebot hätte ablehnen können, ohne unhöflich zu sein. Immerhin hatte er ihr spontan geholfen und einen sympathischen Eindruck machte er auch.
Sie öffnete die Tür und stieß sie mit dem Fuß weit auf, um Armstrong in die Wohnung hineinstürmen zu lassen. Der kleine Hund rannte schnurstracks in die Küche, und die beiden Menschen folgten.
Johanna wandte sich lachend zu ihrem Besucher um, der seine Last bereits abgestellt hatte. In dem Moment fiel ihr zum ersten Mal der Rucksack auf, den Heiner über der Schulter getragen hatte. Der stand nun leicht geöffnet auf der Anrichte.
Johanna sah das blitzende Messer und wusste von einer Sekunde auf die andere, dass Unhöflichkeit ihr das Leben hätte retten können. Ihre Augen weiteten sich und sie öffnete den Mund – doch zu einem Hilfeschrei kam es nicht mehr. Heiner drückte seine weichen Hände auf ihren Mund und erstickte jedes Geräusch. Armstrong, der die Situation als neues Spiel missdeutete, lief um beide herum und bellte auffordernd. Heiner trat kraftvoll nach ihm und schleuderte den Kleinen gegen den Kühlschrank. Ein widerliches Knacken erfüllte den Raum, danach herrschte nur noch Stille. Armstrong glitt an der Tür nach unten, landete auf dem Boden und rührte sich nicht mehr.
Johanna Merkowski weinte. Heiner spürte das Zittern ihres Körpers in seinem Arm, die warmen Tränen, die auf seine Hand tropften und grinste zufrieden.
»Wo ist dein Schlafzimmer?«
Als sie stocksteif stehen blieb, bohrte er die Spitze der Klinge in ihren Rücken. Am heftigen Zusammenzucken merkte er, dass er sie verletzt hatte.
»Wo?«
Langsam setzten sie sich in Bewegung. Über den Flur an einer Tür vorbei bis zur nächsten. Sie hielt an.
»Mach auf!«, forderte er, und sie stieß die Tür auf.
»Wow! Was für ein irres Schlafzimmer. Hier werden wir beide so richtig viel Spaß miteinander haben!«
Der ganze Raum war indisch gestylt. Rote, violette und orangefarbene Kissen mit goldenen Borten und Quasten lagen überall im Raum verteilt. Es gab sie in allen Größen, zum Sitzen und zum Kuscheln. Dunkle Holzmöbel drängten sich an der Wand entlang, fielen aber in der bunten Üppigkeit gar nicht auf. Die Wände waren in einem leuchtenden Orangeton gestrichen, und vor den Fenstern bauschten sich Vorhänge in tiefem Rot. Das Bett war ebenfalls in rot gehalten, über die seidig schimmernde Bettwäsche zogen sich goldene Ornamente. Ein hölzerner Elefant stand links vom Kopfteil, und sein breiter Rücken diente als Nachttisch. Von der Decke fiel ein rotes Mosquitonetz mit goldenen Pailletten, die sich bei jedem noch so kleinen Windhauch bewegten und im Licht funkelten.
Am Fußende des Bettes stand Armstrongs Körbchen, ausgestattet mit einem goldenen Ruhekissen mit roten Quasten an allen vier Ecken.
Heiner spürte, wie sie sich wieder versteifte, als er sie daran vorbeischob.
»Stell dich nicht so an! Von jetzt an läuft sowieso alles nach meinem Plan! Du hast keine Chance, mir zu entkommen!«
Er schlug ihr heftig ins Gesicht, warf sie aufs Bett, schwang sich auf ihre Körpermitte und nagelte ihre Arme mit den Knien fest. Heftig trafen ihre Knie seinen Rücken, doch das schien ihn nicht zu stören. Es dauerte keine 30 Sekunden und er hatte ihr den Mund verklebt, die Hände mit Klebeband an die Streben des Kopfendes gefesselt und die Füße am Fußende vertäut, obwohl sie sich wand wie eine Schlange. Doch Heiner wusste genau, was zu tun war – jeder Handgriff saß perfekt. Und er war stark. Schließlich hatte er während der letzten Jahre Zeit genug gehabt, seine Muskeln zu stählen.
Als sie endlich wehrlos vor ihm lag, klatschte er vor Freude in die Hände. Er hatte es mal wieder geschafft!
Rasch holte er den Rucksack aus der Küche, öffnete ihn und ließ sie sehen, was er extra für sie mitgebracht hatte.
Johanna Merkowski sog scharf Luft durch die Nase ein und in ihren Augen spiegelte sich helles Entsetzen, als sie sich auszumalen begann, wozu die einzelnen glänzenden Werkzeuge wohl gedacht waren, welche Schmerzen sie ihr an den unterschiedlichsten Stellen ihres wunderbaren Körpers zufügen würden.
Dann sah sie ihm dabei zu, wie er den Stecker der Nachttischlampe zog und einen Haarschneider anschloss. Als er mit dem zuckenden Messer über ihre Kopfhaut fuhr und ihr Haar in Bahnen abscherte, ließ sie ihren Tränen freien Lauf.
Heiner, alias Klaus Windisch, nahm sich viel Zeit für Johanna. Schließlich hatte er jahrelang auf dieses Erlebnis warten müssen, konnte es immer nur in seiner Fantasie aufleben lassen. Dabei hatte er dem ursprünglichen Ablauf immer neue Varianten hinzugefügt, um das Vergnügen noch vollkommener zu gestalten. Nun brannte er darauf, seine Träume blutige und für ihn befriedigende Realität werden zu lassen.
Als er nach vier Stunden auf die Frau im roten Bett blickte, war er ausgesprochen zufrieden mit sich. Ein wenig erschöpft vielleicht, aber das lag nur am mangelnden Training. Mit jeder Frau, die er sich ab heute nahm, würde es noch besser werden, bis er sich nicht mehr erschöpft, sondern regelrecht erfrischt fühlen würde, da war er sich sicher.
Nachdenklich runzelte er die Stirn, dann hatte er eine Idee.
Klaus Windisch lief in die Küche und holte den steifen Körper des Hundes.
Sanft legte er ihn der Frau in den schlaffen Arm, wusch seine Werkzeuge im Bad gründlich ab und packte sie sorgfältig in den Rucksack zurück.
Eine Kleinigkeit, dachte er, eine Kleinigkeit konnte er am Gesamtkunstwerk noch verbessern. In den Küchenschubladen suchte er nach einem Messer mit einer langen, spitzen Klinge, die nicht zu schmal sein durfte. Er fand ein Fleischmesser, ganz aus Edelstahl gefertigt. Damit kehrte er zu Johanna zurück, stach es links vom Bauchnabel ein, hob den Nabel mit der Klinge etwas an und führte die Messerspitze auf der rechten Seite des Nabels wieder aus dem Körper heraus.
Es sah aus wie ein silbern glänzendes Schmuckstück.
Fast ein bisschen wehmütig nahm er Abschied, raffte seine Habseligkeiten zusammen und verließ die Wohnung, ohne jemandem im Hausflur zu begegnen. Den Schlüssel mit dem Klangherzen als Anhänger nahm er mit.
8
Peter Nachtigall und Albrecht Skorubski fiel die Aufgabe zu, Frau Beyer, Evelyn Knabes Mutter, über den Tod ihrer Tochter zu informieren. Sie waren sich inzwischen ziemlich sicher, dass es sich bei der Toten um die Mieterin der Wohnung gehandelt hatte – und der Brief aus dem Schlafzimmer ließ kaum mehr Zweifel an dem zu, was sich in den Räumen abgespielt haben musste.
Albrecht Skorubski parkte in der Eilenburger Straße, und sie betraten den frisch renovierten Wohnblock, als ein anderer Mieter ihn gerade verließ.
»Was sollen wir ihr nur sagen? Irgendwie müssen wir ihr klar machen, dass sie ihre Tochter nicht mehr identifizieren kann. Wie sie gestorben ist, wissen wir auch nicht – nur, dass wir von Selbsttötung ausgehen. Hoffentlich reagiert sie nicht hysterisch«, meinte Nachtigall besorgt.
»Ja, das ist wirklich besonders schwierig. Sie wird sich nicht einmal von ihrer Tochter verabschieden können.«
Auf ihr Klingeln erschien eine große, stämmige Frau mit derbem Knochenbau an der Tür. Die schlohweißen Haare hatte sie im Nacken zu einer üppigen Rolle gesteckt, ihre hellgrauen Augen wirkten misstrauisch, und sie sah die beiden Fremden vor ihrer Tür irritiert an.
»Ja?«, fragte sie unterkühlt.
»Kriminalpolizei Cottbus. Mein Name ist Nachtigall und dies ist mein Kollege Skorubski. Dürfen wir reinkommen?«
Zunächst überprüfte Frau Beyer die Ausweise gründlich, dann gab sie den Weg in ihre Wohnung frei und führte die beiden Ermittler in ein kleines Wohnzimmer, das von einer dunkelgrünen Sitzlandschaft dominiert wurde. An der gegenüberliegenden Wand stand eine schwere Kommode aus dunkelbrauner Eiche, auf der ein Fernseher laut die Ergebnisse einer Quizrunde im Raum verbreitete. Frau Beyer schaltete das Gerät aus. Die einsetzende erwartungsvolle Stille empfand Nachtigall als ausgesprochen belastend.
»Frau Beyer, wir haben leider eine schreckliche Nachricht für Sie. In der Wohnung Ihrer Tochter wurde eine Tote gefunden. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich dabei um Ihre Tochter Evelyn handelt.« Er hörte selbst, wie eigenartig diese Eröffnung klang.
Frau Beyer reagierte unerwartet gefasst. »Evelyn ist also tot, ja?«
»Wir gehen davon aus.«
»Heißt das, Sie können sie nicht identifizieren?«, ihre Augen sahen ihn traurig an.
Peter Nachtigall schluckte und nickte dann stumm.
»Sie ist vor ungefähr 14 Tagen gestorben.«
Sie schwieg einen Moment und starrte auf ihre klobigen Hände.
»Wie ist es passiert?«, fragte Frau Beyer dann leise.
»Das wissen wir noch nicht. Tut mir leid. Wann haben Sie Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen?«
»Am vorletzten Samstag. Sie kam, um sich zu verabschieden, weil sie in Urlaub fahren wollte. Ich habe mich darüber gefreut – sie hatte schon seit Jahren keine Reise mehr gemacht – ich wertete es als gutes Zeichen und war froh, dass sich ihr Zustand offensichtlich gebessert hatte. Aber in Wahrheit wollte sie wohl nur in Ruhe sterben.«
»Sie glauben, Ihre Tochter hat sich selbst getötet? Hatte sie Probleme?«, fragte Peter Nachtigall, überrascht von der Offenheit der Mutter.
»Depressionen. Schon seit Jahren. Evelyn kam mit dem Leben nicht klar und mit sich selbst nicht ins Reine. Vielleicht hat es nach dem Tod ihres Vaters vor zehn Jahren begonnen. Er starb an Krebs – es war ein langer, schmerzvoller Abschied. Danach jagte bei Evelyn eine Therapie die andere. Medikamente sollten alles wieder ins Lot bringen. Aber entweder hat sie die nicht genommen oder sie haben nicht gewirkt.«
»Es wurde nicht besser.«
»Ich konnte jedenfalls keine eindeutige Veränderung ihres Zustands feststellen.«
»Würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrer Tochter als eng bezeichnen?«
»Das ist schwieriger zu beantworten, als Sie vielleicht vermuten.« Sie seufzte schwer. »Es ist nicht leicht, zu einem Menschen wie Evelyn etwas wie Nähe aufzubauen. Depressive bewerten viele Dinge anders als Sie oder ich. In Evelyns Augen war die Welt schlecht, und alle hatten sich gegen sie verschworen. Zum Beispiel auch die Kassiererin im Supermarkt, die ihr zehn Cent zu wenig herausgegeben hatte, weil man sich ihr gegenüber so etwas herausnehmen durfte, sie konnte sich eben nicht wehren. Manchmal war sie durchaus gesprächig – erzählte von echten Problemen oder jammerte vor sich hin. Über belanglose Dinge. Dann wieder konnte sie hier den ganzen Nachmittag bei mir sitzen und so gut wie kein Wort sagen – da war sie manchmal unerreichbar fern. Mir erscheint es sehr wahrscheinlich, dass sie ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt hat.«
»Möglich. Wir sind in eine absolut aufgeräumte Wohnung gerufen worden.«
»Ja, das wäre durchaus typisch für Evelyn: Alles sauber, der Kühlschrank abgetaut, die Fenster geöffnet, damit die Mieter nicht vom Geruch aus der Wohnung belästigt werden, Abschiedsbrief leicht zu finden, irgendwo auf dem Tisch oder der Fensterbank – so war es doch, nicht wahr?« Sie wischte sich energisch ein paar Tränen von der Wange.
»Ja«, bestätigte Nachtigall beklommen.
Er zeigte ihr den Abschiedsbrief, der in einer Hülle steckte.
»Könnte das Ihre Tochter geschrieben haben? Erkennen Sie ihre Schrift?«
Frau Beyer nahm die Hülle mit spitzen Fingern entgegen, als sei sie infektiös. Lange starrte sie schweigend auf die wenigen Worte.
Dann seufzte sie tief.
»Ja – genau diese Worte würde sie wählen. Tja, aber was die Schrift angeht – in jedem Gemütszustand schrieb sie anders. Ging es ihr gut, war die Schrift geschwungen, das Bild harmonisch und fließend. Verschlimmerte sich die Depression, waren die Buchstaben eckig, alles wirkte inhomogen, ja direkt unordentlich. Und hier sind nur Großbuchstaben … Wahrscheinlich stammt der Brief tatsächlich von ihr«, schloss sie, reichte die Hülle zurück und erklärte: »Sehen Sie – Evelyn war seit Jahren latent suizidal. Als ihre Ehe scheiterte, wurde sie sich selbst zur Last. Gerd Knabe hatte eines Tages genug von ihr, nahm sich eine andere und zog von heute auf morgen aus. Evelyn war nicht aufgefallen, dass ihre Ehe schon lange nicht mehr bestand, für sie kam es aus heiterem Himmel und traf sie entsprechend unvorbereitet. Wie so oft im Leben gab sie sich die alleinige Schuld, beschloss, sie sei unattraktiv, und da sie keine Kinder bekommen konnte, fand sie, sie sei auch gar keine richtige Frau. Fortan bezeichnete sie sich als ES. Sie ließ sich nicht davon abbringen.«
»Hatte sie denn keine Freundinnen, die ihr hätten helfen können, ihr Weltbild wieder gerade zu rücken?«
»Nein. Evelyn mied andere Frauen. In ihrer Vorstellung waren alle anderen Frauen perfekt, schön und konnten Kinder in die Welt setzen, soviel sie nur wollten. Alle anderen waren glücklich – nur sie nicht.«
»Aber viele Beziehungen bestehen ohne Kinder!«, wandte Albrecht Skorubski ein, und Nachtigall zuckte wie ertappt zusammen. Conny hatte auch vor ein paar Tagen angedeutet, noch sei es nicht gänzlich zu spät, um über die biologische Funktion des gemeinsamen Spaßes nachzudenken. Es war ihm zwar gelungen, diese Diskussion zunächst im Keim zu ersticken – aber er kannte Conny inzwischen gut genug, um zu wissen, dieses Thema war noch nicht vom Tisch.
»Stimmt schon, viele Paare sind ohne Kinder glücklich. Aber Evelyn behauptete, das sei das Ergebnis einer gemeinsamen Entscheidung. Sie empfand ihre Unfruchtbarkeit als Makel, und dieser Gedanke warf sie aus der Bahn. Als Gerd mit seiner neuen Freundin übers Jahr ein Baby hatte, verlor Evelyn endgültig den Boden unter den Füßen. Nach einem Selbstmordversuch wurde sie in die Psychiatrie eingewiesen und hielt sich von da an auch noch für eine Psychopathin.«
Nachtigall hatte einen Kloß im Hals. Was für eine unglückliche Frau musste diese Frau Knabe doch gewesen sein. Er konnte das Gefühl absoluter Hoffnungs- und Freudlosigkeit in sich nachspüren.
»Wenn Evelyn sich umgebracht hat, werden Sie in ihrem Tagebuch sicher mehr dazu finden.« Frau Beyer putzte sich die Nase und wischte mit einer flüchtigen Bewegung einige Tränen weg, als wolle sie lästige Fliegen verscheuchen. Diese Assoziation weckte bei Nachtigall die niedergerungene Übelkeit erneut. Dennoch registrierte er, hellhörig geworden, die Existenz eines Tagebuches. Sie hatten in der Wohnung bisher keines gefunden. Vielleicht war es doch ein Mord und der Täter hatte das Tagebuch womöglich mitgenommen, weil Belastendes über ihn darin zu finden gewesen wäre, überschlugen sich seine Gedanken.