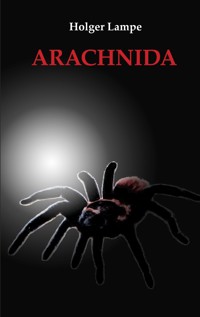Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Steiner ist eine Bestie! Ein Monster, ein Sadist, dem es Spaß macht, Menschen zu quälen! Er ist der Mörder meiner Frau und meines ungeborenen Kindes!“ San Francisco 1985: Auf Bitte eines jüdischen Unternehmers begeben sich der Ex-Polizist Harry Smart und die Staatsanwältin Sandra McReady auf die Spur eines totgeglaubten KZ-Arztes. Der Weg des Schlächters aus dem Dritten Reich führt die beiden nach Brasilien. Schnell geraten sie in einen Sog aus Gewalt und Tod, während sich zwischen ihnen Zuneigung und schließlich Liebe entwickelt. Doch für eine gemeinsame Zukunft müssen sie überleben …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Gegenwart
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Epilog
PROLOG
Januar 1943
Polen
Der eisige Schneesturm peitschte mitten in der Nacht bei alles durchdringender, klirrender Kälte von -16 Grad über eine gottverlassene Einöde. Die Schneeflocken wirbelten herum, wurden von den orkanartigen Böen mal nach links, mal nach rechts geschleudert, bis sie sich schließlich wie ein weißes Leichentuch über die karge Landschaft legten, dürre Sträucher und trockenes Gestrüpp unter sich begruben. Soweit das Auge reichte, gab es kein Anzeichen von Leben, keine Hoffnung, keine Gnade. Selbst der einzige Baum in der Umgebung, eine alte Eiche, knorrig und zerfurcht, ächzte im Griff des Sturmes und schien dem frostigen Tod kaum noch standhalten zu können.
Unweit der alten Eiche, inmitten der Einöde, erhob sich ein dunkler, bedrohlicher Koloss. Vier Scheinwerfer schleuderten aus dem Areal ihre grellen Lichtkegel in den umgebenden Schleier aus Schnee und Finsternis. Es war ein Ort des Grauens, die Hölle auf Erden, umgeben von einem unter Starkstrom stehenden, drei Meter hohen Stacheldrahtzaun, mit einer flatternden Hakenkreuzflagge über dem Eingangstor. Das Innere des lagerartigen Komplexes, nur erhellt durch die Strahlen der Scheinwerfer von zwei Wachtürmen, wirkte gespenstisch. Zwischen Baracken und anderen kleinen, einstöckigen Gebäuden war niemand zu sehen. In keinem der Fenster brannte Licht. Selbst die Wachleute in den Türmen wirkten wie mit der dunklen Masse der Anlage verwachsene Schatten. Eine bedrückende Leblosigkeit umklammerte das Lager, unterbrochen nur durch das Rauschen des Sturmes und den sich wie von Geisterhand bewegenden Scheinwerfern.
In einer der kalten und überfüllten, nur mit einfachsten Holzbänken und Etagenbetten eingerichteten Baracken übernachteten sie: Juden, Polen, Russen, Regimekritiker, Fahnenflüchtige, Menschen mit Behinderung und sonstiges „unwertes Leben“, wie es die Reichsführung so dezent bezeichnete. In der Dunkelheit der kargen Behausung waren die Verhafteten alle gleich. Egal welche Bedeutung, gesellschaftliche Stellung oder berufliche Position sie in der Welt draußen gehabt hatten, hier existierten sie nur noch als unterernährte, kahl rasierte Gestalten in blaugrau gestreiften Häftlingsuniformen, die auf ihr unausweichliches Schicksal warteten.
Unter ihnen saß auch eine hochschwangere Frau, Ende zwanzig, die trotz der Entbehrungen, den Nächten ohne Schlaf und Wochen immerwährender Todesangst, noch immer ein hübsches und ansprechendes Gesicht hatte. Neben ihr auf der Holzbank hockte eine alte Frau, die den rechten Arm schützend und wärmend um ein Mädchen im Grundschulalter gelegt hatte.
Die Baracke war gegen die schneidende Kälte und den fauchenden Sturm, der draußen tobte, so schlecht geschützt, dass selbst im Innern der Unterkunft die Temperaturen kaum über dem Gefrierpunkt lagen. Auch die unter den Gefangenen verteilten Wolldecken vermochten auf Dauer kaum zu wärmen.
Das kleine Mädchen zitterte am ganzen Körper.
„Großmutter, mir ist so kalt!“, stotterte sie, während ihr Atem in der eisigen Luft kondensierte und eine Wolke vor dem Mund entstehen ließ.
Die alte Frau blickte voller Liebe zu ihrer bibbernden Enkelin und nahm sie noch fester in den Arm.
„Ich weiß, mein Schatz! Ich weiß! Doch bald schon wird es vorbei sein! Bald werden wir gerettet.“
Das kleine Mädchen schaute ihre Großmutter mit leuchtenden Augen an. „Wirklich? Aber wie? Wer wird uns helfen?!“
Die Alte streichelte zärtlich die Wange des Kindes. „Gott, mein kleiner Liebling! Gott wird uns helfen!“
„Aber weiß Gott denn auch, dass wir hier sind?“, fragte das Mädchen voller Sorge.
„Natürlich! Gott weiß alles und er sieht alles. Ich habe die letzten Nächte zu ihm gebetet. Du wirst es erleben. Gott wird uns nicht im Stich lassen!“
Die Großmutter strich ihrer Enkelin sanft über den Kopf.
Das Mädchen lächelte. Das Zittern war verschwunden. Sie hatte sich wieder beruhigt. Denn wenn es etwas gab, auf das man sich verlassen konnte, dann ihre Großmutter und den lieben Gott.
Plötzlich wurde von außen die Tür aufgestoßen. Schneeflocken, der Sturm und eine derart eisige Kälte, dass es einem den Atem raubte, fegten durch die Baracke.
Im Türrahmen hatten sich große, bedrohliche, gegen das Scheinwerferlicht abzeichnende Silhouetten aufgebaut, welche die panisch aufgerissenen Augen der Inhaftierten zu durchbohren schienen. Es waren zwei Soldaten, die nun in den Raum hineinmarschierten und direkt vor der Schwangeren stehen blieben.
„Mitkommen!“, stieß einer von ihnen hervor.
Die junge Frau war vor Angst wie gelähmt. Voller Schrecken starrte sie zu den beiden grobschlächtigen Männern auf. Diese warfen sich einen kurzen Blick zu, dann griffen sie nach der geschwächten Frau. Die Schwangere versuchte die kräftigen Hände abzuwehren, doch vergeblich. Sie wurde gepackt und durch den Raum zum Ausgang gezerrt, vorbei an den anderen Gefangenen, die wie eine Herde Antilopen ängstlich und verwirrt auf ihren Plätzen kauerten und froh waren, heute kein Opfer der Raubtiere geworden zu sein. An der offenen Tür sah sich die Schwangere noch ein letztes Mal um, schaute zurück zu dem kleinen Mädchen, das die ganze Zeit neben ihr gesessen hatte. Die Blicke trafen sich und in den Gesichtern der beiden spiegelten sich Entsetzen, Besorgnis und die dunkle Vorahnung einander nie wieder zu sehen.
Dann schloss sich die Tür mit einem lauten Krachen. Es war wieder dunkel in der Baracke.
Kurz darauf wurde der Eingang zu einer anderen Behausung aufgerissen. Die beiden Soldaten stießen ihre Gefangene hinein und schlossen die Tür von außen.
Die junge Frau war allein. Kein Laut war zu hören, außer der vor Kälte und Angst bibbernden Schwangeren.
Verstört inspizierte sie das Ziel ihrer nächtlichen Wanderung. Diese Baracke unterschied sich sehr von der, in welcher sie die letzten Wochen verbracht hatte. Hier drang kein eisiger Wind durch undichte Fugen. Hier war es still und warm, sodass die Frau etwas zur Ruhe kam und ihre Sinne wieder sortieren konnte. Sie sah sich um.
In dem Raum befanden sich links und rechts große Regalwände, vollgestopft mit unzähligen Büchern. Geradeaus, auf der anderen Seite, stand ein Schreibtisch. Der konzentrierte Strahl einer kleinen Bürolampe, der einzigen Lichtquelle im Raum, fiel auf ein aufgeschlagenes Buch. Hinten rechts, im Halbdunkel, erkannte die Frau die Umrisse einer Tür, die zu einem weiteren Raum führen musste. Die Schwangere wagte kaum zu atmen, achtete ängstlich auf jedes Geräusch, jeden Quadratmeter der Umgebung, während sie sich langsam auf den beleuchteten Schreibtisch zubewegte. Warum hatte man sie hierher gebracht? Wer wollte sie sehen?
Vorsichtig ging sie um den Schreibtisch herum, schaute dabei in das aufgeschlagene Buch, das vor ihr lag. Doch schlau wurde sie aus dem Text und den Abbildungen nicht. Mit Begriffen wie ‚Gene’ und ‚Aminosäuren’ konnte sie nichts anfangen. Auf der rechten Seite war eine Zeichnung mit kugelähnlichen Gebilden, die miteinander verbunden waren. Verunsichert blickte die Frau auf das Wirrwarr.
Urplötzlich schlug jemand mit der flachen Hand auf die Abbildung! Die Schwangere zuckte wie vom Blitz getroffen zusammen. Neben ihr stand ein junger Mann im Arztkittel. Die Schwangere stolperte erschrocken zurück. Wie er sich unbemerkt an sie hatte heranschleichen können, war ihr schleierhaft. Doch offensichtlich war er aus der anderen Tür gekommen. Furchtsam musterte sie den Mann, der im Halbschatten der Schreibtischlampe um den Tisch schritt und die Frau lächelnd taxierte. Er war ungefähr Ende zwanzig, also in ihrem Alter, groß und sehr schlank. Der Mann hatte die schwarzen Haare streng nach hinten gekämmt, sah sehr gepflegt aus und machte in seinem gebügelten Arztkittel einen seriösen Eindruck. Doch das, was der jungen Frau an ihm besonders auffiel, waren seine markanten Augen. Kalt, grau und durchdringend, in einem Gesicht mit hohen Wangenknochen und einer dünnen, spitzen Nase.
„Willkommen!“, sagte der Arzt mit einer überraschend sonoren Stimme. „Haben Sie keine Angst. Bei mir sind Sie in guten Händen.“
Die Frau sprach kein Wort, während er sich ihr langsam näherte.
„Sie werden sich bestimmt fragen, warum ich Sie zu so später Stunde noch habe herholen lassen. Nun, wenn Sie erlauben, werde ich es Ihnen zeigen.“
Er streckte ihr seine Hand entgegen, doch die Schwangere bewegte sich nicht.
„Kommen Sie! Vertrauen Sie mir!“
Die junge Frau war irritiert. Da war dieser, trotz des Lächelns, seelenlose, kalte Ausdruck, aber auch eine seriöse Erscheinung und etwas, das sie mit Worten nicht beschreiben konnte. War es der Klang seiner Stimme? Hatte sie denn überhaupt eine andere Wahl?
Zögernd schritt sie ihm entgegen. Er nickte zufrieden und berührte sie fast schon zärtlich an der Schulter.
„So ist es gut. Folgen Sie mir bitte!“
Er öffnete die mysteriöse Tür und führte die Schwangere in einen gefliesten, weiß gekachelten Raum, dessen hintere Hälfte durch einen geschlossenen schwarzen Vorhang nicht einsehbar war. Ohne dass die Frau sich genauer umschauen konnte, hatte der Arzt sie an die rechte Wand dirigiert, vor ein Regal mit von hinten beleuchteten, gläsernen Behältern, die mit undefinierbaren Flüssigkeiten gefüllt waren. In einigen schwammen fleischfarbene, wachsartige Gebilde mit Wucherungen, Verdickungen und knospenähnlichen Auswüchsen, die wie verkümmerte Gliedmaße wirkten.
„Das hier ist der Grund, warum Sie kommen sollten.“
Der Arzt zeigte auf ein großes Gefäß, welches mit einer orangerot-trüben Flüssigkeit gefüllt war. Die junge Frau sah ihn verwirrt an.
„Wissen Sie“, sagte er, „unser glorreicher Führer hat eine Vision. Er will, dass in der Zukunft nur die nordische, arische Rasse über diesen Planeten herrscht. Immun gegen Krankheiten und Schmerzen, und den anderen, minderwertigen Völkern in allen Belangen weit überlegen. Ich bin vom Führer persönlich beauftragt worden die Entwicklung der arischen Rasse voranzutreiben, deren Eigenschaften immer weiter zu optimieren, um eine neue Generation zu erschaffen. Die Krone der Evolution. Und dort sehen Sie das Resultat meiner bisherigen Forschung.“
Wieder zeigte der Arzt auf den gläsernen Behälter und noch immer versuchte die Frau die Zusammenhänge und den Grund Ihres Hierseins zu begreifen.
„Diese Flüssigkeit ähnelt der, in welcher sich Ihr Kind befindet“, erklärte der Arzt und blickte auf den gewölbten Bauch der Schwangeren. „Nur ist sie weiterentwickelter. So perfekt, dass wir Embryonen und Föten darin halten und gleichzeitig deren Zellstrukturen verändern können. Solange, bis wir den vollkommenen, unbesiegbaren Herrenmenschen geformt haben.“
Die Stimme des Arztes hatte sich verändert. Der eben noch sonore Klang war einem enthusiastischen Keuchen gewichen. Er sah sie an und die Frau erstarrte, als sie den gierigen, furchterregenden Glanz in seinen kalten Augen entdeckte.
„Zu diesem Zweck“, fuhr der Arzt lächelnd fort, „werden wir in den nächsten Jahren etliche Versuche an ungeborenen Kindern durchführen. Und Sie, meine Liebe, haben nun die Ehre, uns Ihres dafür zur Verfügung zu stellen.“
Seine Worte hallten in den Ohren der Frau. Sie hatte gehört, was er gesagt hatte, doch ihr Verstand weigerte sich die Konsequenz daraus zu erkennen. Die Schwangere blickte in das dämonisch grinsende Gesicht des Arztes. Sie war vor Angst wie paralysiert, ihre Füße wie am Boden festgeklebt.
Plötzlich wurde hinter ihr mit einem Räuspern der geschlossene Vorhang zur Seite gezogen. Die junge Frau fuhr erschrocken herum und sah nun auch den Rest des Raumes, bemerkte den Operationstisch, rechts davon einen großen Beistelltisch mit einer Vielzahl von chirurgischen Instrumenten. Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen beim Anblick der vier vermummten Personen, die mit Kitteln, Mundschutz und Plastikhandschuhen neben dem OP-Tisch standen und auf sie zu warten schienen.
Schockwellen rasten durch den Körper der jungen Frau. Nun hatte sie endlich begriffen, das Unglaubliche verstanden. Diese Teufel wollten ihr Kind, ihr ungeborenes Kind und ihren Tod!
Sie wollte davonstürzen, doch der Arzt packte sie, hielt sie fest. Instinktiv griff sie nach seinem Gesicht, grub ihre Fingernägel mit aller Kraft tief in das Fleisch. Der Arzt schrie auf und die Frau riss sich los. Sie stolperte durch die Tür und rannte durch das Vorzimmer auf den Ausgang zu. Sie musste fort aus dieser Hölle!
Der Arzt hielt sich die Hand schützend an die blutige linke Wange. Sein Antlitz war eine vor Hass und Schmerzen entstellte Fratze.
„Haltet sie fest! Haltet das verdammte Viech fest!“, keifte er quer durch den Vorraum der Flüchtigen hinterher.
Die junge Frau hatte die Ausgangstür erreicht, riss sie auf, fühlte schon die Schneeflocken im Gesicht, als sie von kräftigen Händen gepackt wurde. Es waren die zwei Soldaten, die sie bereits aus der Gefangenenbaracke geholt hatten.
Die Frau schrie und weinte, schlug blindlings um sich, doch es gab es kein Entkommen. Die Soldaten ließen sie nicht mehr los, zerrten die Schwangere zurück in den Operationsraum. Der Arzt schloss die Tür.
Das Vorzimmer war wieder leer.
Um das Lager tobte der Schneesturm gnadenlos. Und für einen kurzen Moment schien er noch heftiger geworden zu sein.
GEGENWART
1985
- 1 -
Die Luft in dieser sternenklaren Märznacht war unangenehm kühl. Eine leichte Brise wehte vom Pazifik herüber, zog vorbei an den zweihundert Meter hohen Pylonen der Golden Gate Bridge, glitt weiter über die Bucht, um sich schließlich über dem Lichtermeer von San Francisco zu verteilen.
Von irgendwo dort ertönte Musik.
Aus der Vogelperspektive wirkten die unzähligen Fahrzeuge wie kleine, helle Punkte, die sich scheinbar ungeordnet in den endlosen, verzweigten Straßen der Stadt bewegten, während um sie herum die Wolkenkratzer als stumme Giganten in den Himmel ragten.
Von irgendwo dort unten schmetterte die Popgruppe ‚Frankie goes to Hollywood’ mit Leadsänger Holly Johnson ihren Song ‚Two Tribes’ durch die Nacht.
Die Lichter von Ampeln und Straßenlaternen schienen wie absorbiert inmitten der blinkenden Reklamen von Kinos, Diskotheken und Nachtclubs. Erleuchtete Schaufenster der Kaufhäuser und Boutiquen strahlten mit den glitzernden Diamanten in den Auslagen der Juweliergeschäfte um die Wette. Die Illumination der Nacht spiegelte sich im Lack der Autos und in den Augen der Passanten. Italienische Designerschuhe tippelten auf dem Bürgersteig entlang, vorbei an Obdachlosen, deren Blick so leer war wie der Hut, der vor ihnen lag. Junge Frauen, die an der Straße auf Kunden warteten, mit verlockenden Körpern aber toten Seelen. Drogensüchtige Jugendliche, die sich die Nadeln in dürre Unterarme stachen, und deren Zukunft schon endete, bevor sie begann.
Von irgendwoher dröhnten pumpende Bässe durch die Lautsprecher eines Radios, als Sänger Holly Johnson „We’re living in a land where Sex and Horror are the new God!” proklamierte.
Nur einen Steinwurf vom geöffneten Fenster entfernt, aus dem das Lachen der Gäste einer Party drang, starb in seinem Sessel gerade ein allein lebender alter Mann, dessen skelettierter Körper erst Monate später entdeckt werden würde, während im Block gegenüber sich Familie Fries gespannt die TV-Show ‚Glücksrad’ anschaute, und in der Wohnung direkt daneben der biedere Abteilungsleiter einer Versicherung den vierjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin vergewaltigte. Und in der gleichen Sekunde, in der im Kreißsaal des San Francisco General Hospitals Mr. Nicholas Hammond unter Tränen der Freude erlebte, wie seine Frau Lisa ihre gemeinsame Tochter zur Welt brachte, beendete drei Straßen weiter die Klinge eines Messers das Leben eines Menschen wegen des Geldbetrages von exakt fünf Dollar.
Irgendwo Downtown, im Financial District, stand ein Taxi am Straßenrand. Aus dem halb geöffneten Fenster des Fahrers ertönten die letzten Takte des Liedes.
Der Mann hinter dem Steuer blickte in den Rückspiegel.
Seine blauen Augen hatten eine Bewegung ausgemacht.
Zwei Personen näherten sich. Der Fahrer schaltete das Radio aus. Holly Johnson verstummte.
Die hintere Beifahrertür wurde geöffnet. Ein dünnes, schwarzes Mädchen, noch keine zwanzig, mit nichts als Top, Hotpants und High Heels am Körper, kletterte auf den Rücksitz. Ihr folgte ein gut dreißig Jahre älterer Schwarzer in einem flauschigen Polarfuchspelzmantel, mit Goldringen an den Fingern und einer ihn umgebenden Wolke aufdringlich-holzigen Parfums. Er quetschte seinen beleibten Körper neben das Mädchen und nahm sogleich dreiviertel der Rückbank ein.
„Columbus, Ecke Northpoint!“, brummte er mit angerauter Bassstimme.
Der Fahrer nickte, schaltete die Beleuchtung des Taxischildes auf dem Dach aus und das Taxameter ein. Dann fuhr er los, fädelte sich hinter einem Van in den Verkehr ein und gab Gas.
Das Mädchen wühlte mit zittrigen Händen ein zerknülltes Bündel Geldscheine zwischen Brüsten und Top hervor und gab sie ihrem Begleiter. Der Mann betrachtete mit missmutiger Miene den Haufen bedruckten Papiers.
„Soll das etwa alles sein?“, knurrte er.
Das Mädchen zuckte zusammen und blickte ihn eingeschüchtert an. „Es ist nicht meine Schuld! Es war gestern nichts los und …“
„Ach, halt’s Maul!“, polterte er los. „Du bist einfach zu blöd für den Job!“
„Nein, das ist es nicht! Ich bin kaputt. Ich friere“, erwiderte sie verzweifelt. „Und ich brauche dringend wieder was! Ich halt’s ohne nicht mehr lange aus!“
„Verfickte Scheiße! Bei den paar Dollars, die du zusammenvögelst, willst du auch noch neuen Stoff haben?! Bist du bescheuert, du dumme Nutte?!“
Sein Blick prüfte ihre Figur und die langen Beine.
„Naja, ich will mal nicht so sein. Bevor du deinen ersten Kunden besuchst, gebe ich dir was, damit du wieder in Form kommst. Aber vorher besorgst du es mir!“
Er öffnete den Reißverschluss seiner Hose.
„Bitte nicht! Mir ist kalt! Ich habe Hunger“, wimmerte sie.
„Interessiert mich einen Scheißdreck!“, fauchte er. „Umsonst gebe ich dir keinen Stoff! Also halt deine Fresse, du Schlampe, und blas mir einen!“
„Ich kann nicht mehr! Ich bin fertig!“, schluchzte sie.
Der Mann knallte ihr mit der flachen Rechten auf den Hinterkopf, sodass sie aufschrie.
„Ich sage dir, wenn du nicht mehr kannst!“, bellte er. „Und jetzt fang an!“
Die blauen Augen des Fahrers zeigten sich im Rückspiegel.
„Hey Mister, entweder Sie benehmen sich hier, oder Sie können sich ein anderes Taxi suchen.“
„Was war das?“, brummte der Mann im Pelz ungläubig.
Er sah zum Rückspiegel und dann auf das Armaturenbrett des Taxis, an dem der Ausweis des Fahrers prangte. Das Bild zeigte einen gut aussehenden Mann, Anfang vierzig, mit hellbraunen Haaren und Grübchen im Kinn. Unter dem Foto stand sein Name.
„Harry Smart“, las der Zuhälter knurrend. „Hör mal gut zu, … Smartie! Halt’ schön die Schnauze und misch’ dich hier nicht ein. Dann gibt’s vielleicht auch ’n bisschen Trinkgeld für dich.“
Der Fahrer atmete tief durch und blickte wieder nach vorn.
Der Mann im Pelzmantel nickte zufrieden und wandte sich erneut dem Mädchen zu, das ihn mit bebender Unterlippe anstarrte.
„Und du leg endlich los, verdammt!“
Er drückte das wimmernde Mädchen herunter zwischen seine Beine. Sie griff in den offenen Hosenschlitz und er lehnte sich genüsslich zurück.
Die Augen im Rückspiegel blickten wieder nach hinten zum Fond. Sie sahen, wie sich der Kopf des Mädchens über dem Schoß des Mannes auf und ab bewegte.
Der Zuhälter schaute zu ihr hinunter. „So ist es gut, Prinzesschen. Immer weiter so.“
Aber stattdessen stoppte sie und blickte ihn flehend an.
„Bitte, ich hab solchen Hunger …“
Er unterbrach sie, indem er ihren Kopf wieder nach unten drückte.
„Mach einfach weiter, dann kriegst du gleich einen lauwarmen Joghurt zu essen!“ Der Mann lachte dreckig.
Das Mädchen fing an zu weinen. „Es reicht mir! Ich kann nicht …!“
Wütend schlug der Zuhälter ihr eine schallende Ohrfeige.
Sie schrie auf.
„Das ist der Grund, warum du so wenig einbringst!“, schnauzte er sie an. „Du quatschst und jammerst zu viel. Du bist nur zum Ficken da! Und wenn du das nicht kapierst, schicke ich dich zurück in die Gosse, wo du hergekommen bist! Willst du das?!“
Die Drohung ließ das Mädchen nicht verstummen. Im Gegenteil. Sie weinte nur noch lauter. Wieder schlug er zu.
„Hör auf zu flennen, verdammte Fotze!“
Wütend holte er erneut aus, das Mädchen kreischte und hielt schützend ihre Arme vor das Gesicht.
„Das war’s! Raus aus dem Wagen, du mieses Stück Scheiße!“, kam es plötzlich vom Fahrer, der das Auto scharf nach rechts an den Straßenrand lenkte und so abrupt bremste, dass der korpulente Zuhälter fast von der Rückbank gerutscht wäre. Der schlanke Fahrer sprang aus dem Taxi, lief um das Auto herum und wollte gerade die Tür zum Fond aufreißen, als sie von dem Zuhälter bereits aufgestoßen wurde.
„Bist du irre, du verdammter Hurensohn?! Ich schlag dir deine verfickte Fresse ein!“, bellte der Mann im Pelz, während er sich noch beim Aussteigen eilig den Hosenschlitz zuzog.
Zeit zu mehr hatte er auch nicht, denn schon landete die Faust des Taxifahrers mit voller Wucht in seinem Gesicht.
Der Zuhälter torkelte zurück gegen das Fahrzeug und schien durch den unerwarteten Angriff etwas irritiert zu sein. Er musterte kurz seinen Gegner, der kampfbereit vor ihm stand, dann stürzte er sich auf ihn, sein Pelzmantel öffnete sich dabei wie die ausgebreiteten Schwingen eines Adlers. Er griff mit einer rechten Geraden an, aber der Taxifahrer wich dem Schlag aus und prügelte zwei harte Links-rechts-Kombinationen an den Kopf des Zuhälters, der mit einem Stöhnen zu Boden ging.
Das Mädchen im Taxi saß die ganze Zeit da und beobachtete die Szene mit offenem Mund.
Ihr Ausbeuter berappelte sich, kam wieder auf die Beine.
Leicht benommen von den Schlägen aber außer sich vor Wut stürmte er auf seinen Gegner los. Der Fahrer konnte dem plumpen und zu langsamen Angriff erneut ausweichen, rammte dem schmerzverzerrt aufstöhnenden Schwarzen die Faust in die Rippen und eine platzierte Dublette an Nase und Kiefer. Noch während der Zuhälter rückwärts gegen das Taxi fiel, setzte der Fahrer nach, knallte ihm einen rechten Haken gegen die Schläfe und beendete damit den Kampf.
Verächtlich sah Harry Smart zu dem Mann hinunter, der bewusstlos neben dem Taxi lag. Blut lief dem Zuhälter aus der Nase, und einige rote Spritzer hatten seinen weißen Pelzmantel verziert.
Smart trat vor und reichte dem Mädchen die Hand.
„Kommen Sie, Miss! Ich bringe Sie zur Polizei!“
„Bist du bescheuert, Mann? Verpiss dich!“, fauchte sie ihn an, während sie aus dem Auto kletterte und dabei seine Hand wegstieß.
Verwirrt blickte Smart das Mädchen an, als diese beim Anblick ihres verprügelten Zuhälters völlig durchdrehte.
„Was hast du getan? Was hast du nur getan?!“
Sie drehte sich zu Smart und begann plötzlich wie von Sinnen auf ihn einzuprügeln. „Was hast du mit meinem Jack getan, du verfickter Arsch?!“
Smart hatte fast Mühe die Schläge des Mädchens abzuwehren. „Was ist denn los mit Ihnen? Sind Sie verrückt geworden? Ich habe Ihnen geholfen!“
So schnell wie das Mädchen den Angriff begonnen hatte, so abrupt brach sie ihn wieder ab, wandte sich ihrem Ausbeuter zu und kniete sich neben ihn.
„Jack! Jack, bist du in Ordnung, mein Liebling? Sag’ doch was?!“
Fassungslos starrte Smart das Mädchen an. Sie sah zu ihm hoch, Tränen liefen ihr über das Gesicht.
„Er ist doch der Einzige, den ich habe. Der Einzige!“
Smart senkte den Blick. Kopfschüttelnd drehte er sich um und ging, stieg in das Taxi und startete den Motor. Dann fuhr er in die Nacht hinaus, während das Mädchen weinend den bewusstlosen Zuhälter in ihre Arme genommen hatte.
„Ich bleibe bei dir, Jack! Ich brauche dich doch!“, schluchzte sie und legte ihren Kopf an seine Schulter.
Als Harry Smart den Flur zu seinem Apartment im 3. Stock entlangtrottete, war es bereits nach Mitternacht. Dass der unzuverlässige Hausmeister die nur schwach leuchtenden, teils flackernden Glühbirnen in den Deckenlampen noch immer nicht ausgewechselt hatte, störte ihn nicht. Er hatte sich ebenso daran gewöhnt wie an den abgewetzten, fleckigen Teppich und die abgeblätterte Farbe an den Wänden des Korridors.
Smart blieb vor seinem Apartment stehen. Gerade als er die Tür aufschloss und öffnete, hörte er hinter sich Schritte. Gedankenversunken glaubte Smart, dass es einer der Nachbarn war, der jetzt auch nach Hause kam, aber dann registrierte er, dass die Schritte von mehreren Personen stammten und diese direkt auf ihn zusteuerten. Smart fuhr herum, doch da war es schon zu spät. Der Baseballknüppel sauste heran und knallte in seine Magengrube. Smart schrie auf. Er spürte, wie der Schlag seine Eingeweide zusammenpresste, und bekam kaum noch Luft. Smart wurde gepackt und nach hinten gestoßen, hinein in die kleine 1-Zimmer-Wohnung. Er strauchelte keuchend gegen die Lehne seiner alten Couch. In dem Apartment war es nicht dunkel. Eine Leuchtreklame auf der gegenüberliegenden Straßenseite erhellte das Wohnzimmer und tauchte den Raum abwechselnd in rotes, weißes und blaues Licht.
„Oh Scheiße!“, stöhnte Smart, als er aufblickte und zwei der drei Personen erkannte, die nun sein Apartment betraten und die Tür hinter sich schlossen. Einer von ihnen hieß Schwartz, ein hagerer, dauerlächelnder Ungar. Der andere war ein ausrangierter Ex-Marine namens Naismith, der sich nun als Geldeintreiber die Hände schmutzig machte. Der dritte, mit dem Baseballschläger in den Händen, war ein jüngerer Kerl im Muskelshirt.
„Hallo Harry! Wie geht’s?“, grüßte Schwartz freundlich. „Sinclair hat ziemlichen Kummer wegen dir. Er fragt sich, wo sein Geld bleibt.“
Smart setzte sich ächzend auf die Armlehne der Couch. Noch immer japste er nach Luft. „Sinclair macht sich Sorgen? Warum kommt er dann nicht selber, sondern schickt mir stattdessen Tick, Trick und Track?“
„Komm her, Bürschchen! Dir verpass ich …“ Naismith trat wütend auf Smart zu, der sofort die Fäuste ballte.
„Ruhig, Nais!“ Schwartz hob beschwichtigend die Hände. „Wenn du ihm die Knochen brichst, kann er nicht arbeiten gehen. Wie soll er so die Schulden begleichen?“
Der Ex-Marine hielt tatsächlich inne. Smart war erleichtert, denn erst allmählich kamen seine Gedärme zur Ruhe und er wieder zu Atem.
„Mach hier nicht einen auf Klugscheißer, Harry!“, wies Schwartz ihn zurecht. „Du schuldest Sinclair inzwischen sechzehn Riesen!“
„Verflucht, ich tu doch schon, was ich kann! Aber mehr ist einfach nicht drin!“
„Dein Problem! Sinclair will endlich sein Geld zurück! Er gibt dir einen letzten Aufschub von zwei Wochen! Dann hast du zehntausend zu zahlen! Und weitere zehntausend im Monat darauf!“
Smart verzog ungläubig das Gesicht. „Das sind zwanzig! Viertausend zu viel!“
„Zinsen und Bearbeitungsgebühren!“, entgegnete Schwartz trocken. „Ich warne dich, Harry. Ich mache keinen Spaß. Sinclairs Geduld ist am Ende. Wenn du in zwei Wochen nicht zehn Riesen parat hast, lasse ich Nais und Lew von der Leine und dann kannst du deine Zähne vergessen!“
Naismith grinste fies. „Kann’s kaum erwarten!“
„Hast du verstanden, Harry?“, hakte Schwartz nach. „Ist das angekommen bei dir?“
Smart sparte sich jeden Kommentar. Er war nicht mehr in der Lage sich hier und jetzt eine Prügelei mit den beiden Affen zu liefern. Außerdem hätte das an den Schulden nichts geändert. Mit schmerzverzerrter Miene rieb er sich seinen Bauch und nickte Schwartz bestätigend zu.
Dieser erwiderte zufrieden, gab seinen beiden Kompagnons einen Wink und die drei verließen das Apartment.
„Wir sehen uns, Bürschchen!“, knurrte Naismith beim Hinausgehen.
„Vergiss es nicht, Harry! In zwei Wochen!“, mahnte Schwartz noch einmal, bevor er die Tür hinter sich schloss.
Smart lauschte den sich entfernenden Schritten im Flur. Doch erst als er die Stimmen seiner drei Besucher draußen auf der Straße vernahm und hörte, dass sie in ein Auto stiegen und davonfuhren, entspannte er sich. Smart schüttelte den Kopf.
„Verdammte Scheiße!“ Zehntausend Dollar! Wie zum Teufel sollte er so viel Geld in so kurzer Zeit beschaffen? Zweihundert war alles, was ihm für den Rest des Monats noch zur Verfügung stand.
Smart erhob sich stöhnend und schlurfte ans Fenster. Es hatte zu regnen angefangen. Nachdenklich blickte Smart in die Nacht hinaus, während die wechselnden Farben der Leuchtreklame auf sein Gesicht fielen. In den Fängen eines berüchtigten Kredithais und seiner gehirnlosen Schläger. Wie tief er mittlerweile doch gesunken war.
Frustriert trottete Smart zurück und ließ sich müde in die durchgesessene Couch fallen. Er griff sich eine auf dem Couchtisch stehende große Papiertüte und holte eine halbvolle Flasche ‚Jim Beam’ hervor. Smart schraubte den Verschluss ab, nahm ein paar kräftige Schlucke. Das leichte Brennen in seinem Hals und seinem Magen belebte ihn wieder, doch gleichzeitig fragte er sich, ob es richtig war, was er tat. Seit knapp fünf Jahren griff er zur Flasche. Immer wieder und immer öfter. Die Anonymen Alkoholiker hatten ihm nicht helfen können. Wozu auch? Im Grunde seines Herzens wollte er gar nicht von dem Alkohol wegkommen. Wie sollte er sonst sein verkorkstes Leben und auch sich selbst ertragen? Was hatte Smart denn schon Besonderes vorzuweisen? Was hatte er erreicht? Nichts! Absolut nichts! Und das war auch in Ordnung so. Nach dem, was er getan hatte. Nach dem, was er ihr angetan hatte.
Draußen näherte sich die Sirene eines Polizeiautos. Smart horchte auf. Das Heulen wurde immer lauter, bohrte sich geradezu in seinen Kopf. Schließlich preschte das Fahrzeug direkt am Haus vorbei. Die Sirene wurde wieder leiser.
Smarts Augen verengten sich. Diese Sirenen. Die kannte er, die kannte er nur zu gut. Smart erinnerte sich und seine Gedanken wanderten fort, weit fort, fünf Jahre in die Vergangenheit.
Es war außerordentlich ruhig gewesen. Keine besonderen Vorkommnisse. Eine Schicht, wie man sie sich als Polizeibeamter wünschte. Kurz vor Mitternacht fuhren Smart und sein Partner Ross Andru, ein erfahrener schwarzer Kollege, Anfang fünfzig, in ihrem Streifenwagen, rund eine Meile von Downtown entfernt, die Van Ness Avenue entlang. Smart saß hinter dem Steuer.
„Johnny hat mich gestern gefragt, wann du mal wieder vorbeikommst“, bemerkte Andru.
„Du meinst, er will noch immer eine Revanche?“, grinste Smart.
Andru lachte. „Genau. Hat ihn schwer gewurmt, dass du ihn bei ‚Space Invaders’ haushoch geschlagen hast. Das ist für einen Zwölfjährigen echt frustrierend.“
„Tut mir leid für ihn“, entschuldigte sich Smart. „Dabei habe ich mich ein paarmal schon extra abschießen lassen. Noch mehr wäre auffällig gewesen.“
Andru kicherte vor sich hin. „Ich weiß, Mann. Ich hab’s gesehen. Aber du wirst es jetzt deutlich schwerer haben. Johnny hat fleißig trainiert. Die Atari-Konsole war förmlich am Glühen. Gestern hat er dreimal hintereinander fast doppelt so viel Punkte geschafft wie ich.“
„Das heißt nicht wirklich was“, schmunzelte Smart mit einem Seitenblick auf seinen Kollegen. „Ab einem gewissen Alter lässt bekanntlich die Reaktion nach.“
Andru verzog gespielt empört das Gesicht. „Ich glaube, Johnny muss auf seine Revanche noch warten. Zunächst wirst du gegen mich antreten, du Milchbart!“
„Aber erst nachdem du deine Lesebrille aufgesetzt hast.“
„Selbstverständlich. Sonst kann ich ja nicht richtig sehen!“
Beide lachten. Kleine Sticheleien über den Altersunterschied waren fester Bestandteil ihrer Konversation.
„Also? Wie sieht’s aus bei dir? Rita macht wieder ihre preisgekrönten Spareribs!“
Smart schnalzte genießerisch mit der Zunge. „Okay! Wie wäre es nächstes Wochenende? Vorausgesetzt …“
„Vorausgesetzt?“
„… ich darf Debra mitbringen.“
„Debra?“ Ross Andru war baff. „Meinst du etwa diese ganz bestimmte Debra? Deine mysteriöse Traumfrau, die wir seit Monaten kennenlernen wollen?“
Smart grinste seinen Kollegen an. „Ja, ich glaube die Beschreibung passt.“
Andru klopfte ihm begeistert auf die Schulter. „Oh Mann! Du alter Geheimnistuer! Es gibt sie also doch! Rita hat schon befürchtet, dass sie nur …“
„An alle Einheiten!“, ertönte plötzlich über Funk der Ruf der Zentrale. „Ein 211, Larkin Street, Ecke Union Street. Täter ist ein Weißer, um die dreißig, ca. eins achtzig groß. Trägt schwarze Lederjacke, Jeans und Baseballcap. Ist auf der Flucht mit dem Motorrad des Opfers. Achtung! Laut Zeugin ist der Täter mit einer Pumpgun bewaffnet. Ich wiederhole. An alle …“
Smart und Andru sahen sich an.
„Bewaffneter Raubüberfall!“, knurrte Andru. „Soweit zu einer ruhigen Nacht!“
Smart schaltete Polizeilicht und Sirene ein und drückte das Gaspedal herunter.
Andru nahm das Funkgerät. „Roger, Zentrale. Hier ist Einheit Fünf. Fahren auf der Van Ness in nördlicher Richtung …“
Der Polizeiwagen preschte durch die Nacht, bog an der übernächsten Kreuzung mit quietschenden Reifen rechts ab. Zwei Blocks weiter sahen sie bereits die rotierenden blauen und roten Dachleuchten eines anderen Streifenwagens. Als sie näher kamen, entdeckte Smart einen Kollegen, der mit einer Frau redete. Der zweite Beamte stand im Licht einer Straßenlaterne neben einem regungslos am Boden liegenden Mann, sah Smart und Andru und deutete mit hektischen Handzeichen in die Richtung, in die der Täter geflüchtet war. Smart bremste gar nicht erst, sondern gab weiter Gas, jagte geradeaus die Straße hinunter. Andru warf beim Vorbeifahren am Tatort noch einen Blick zu dem leblosen Opfer. Er bemerkte, dass dessen hellblaues Hemd im gesamten Bauchbereich großflächig dunkel gefärbt war.
„Bei dem bringt die Ambulanz nichts mehr“, sagte er mit versteinerter Miene. „Der Typ hat ihm den ganzen Bauch zerschossen.“
„Scheiße!“, fluchte Smart.
Das Polizeiauto raste mit heulender Sirene die Straße entlang, überholte zwei Fahrzeuge, die rechtzeitig und respektvoll Platz machten. Andru schaute links und rechts aus dem Fenster, prüfte die Umgebung. Die meisten Gebäude in dieser Gegend waren zwei- oder dreistöckige Wohnhäuser, teilweise gab es Innenhöfe. Der Flüchtige konnte sich überall hier verstecken, längst untergetaucht sein, während sie sonst wo nach ihm suchten.
„Da vorn ist er!“, rief Smart plötzlich.
Andru sah geradeaus. Knapp zweihundert Meter vor ihnen bog ein Motorradfahrer ohne zu blinken sehr schnell nach links in eine Seitenstraße ab.
Smart trat das Gaspedal bis zum Anschlag herunter. „Das muss er sein!“
„Möglich“, entgegnete Andru. „Oder ein anderer Typ, der es zu eilig hat.“
Er griff das Funkgerät, um Meldung an die Zentrale zu machen.
In dem Moment erreichten sie die Stelle, an welcher der Motorradfahrer abgebogen war. Smart riss das Steuer herum, lenkte den Polizeiwagen mit hoher Geschwindigkeit nach links in die einspurige Seitenstraße hinein. Das Heck des Wagens brach aus, kollidierte fast mit den am Straßenrand parkenden Fahrzeugen, doch Smart hatte das Auto rasch wieder unter Kontrolle.
„Verdammt, Harry!“, fluchte Andru. „Fahr nicht so schnell! Wir knallen noch irgendwo gegen!“
„Keine Panik, mein Freund!“, bemerkte Smart mit schiefem Grinsen. „Ich habe alles im Griff! Ich will nur nicht, dass uns dieses Dreckschwein entkommt!“ Er schaute den Bruchteil einer Sekunde zu seinem Partner. „Du etwa?“
Plötzlich riss Andru die Augen auf. „Pass auf!“, brüllte er.
Smart sah erschrocken nach vorn. Im Scheinwerferlicht, keine fünf Meter mehr entfernt, stand eine kleine Person. Ein dunkelhaariges Mädchen, nicht älter als acht Jahre. Es sah das heranrasende Fahrzeug, kreischte schrill. Smart trat mit aller Kraft auf die Bremse. Doch da prallte der Streifenwagen schon mit voller Wucht gegen das Kind, zertrümmerte sämtliche Knochen in dem zierlichen Körper. Die kleine Gestalt wurde hochgeschleudert. Smart sah, wie das Mädchen auf ihn zuzufliegen schien. Es gab einen fürchterlichen Knall, ein Scheppern, als der Kopf des Kindes gegen die harte Windschutzscheibe schlug, Blut und Gehirnmasse spritzte, sich über das splitternde Glas verteilte, und der zerschmetterte Körper dann nach hinten, aus Smarts Blickfeld heraus, verschwand.
Mit quietschenden Reifen kam das Polizeiauto zum Stehen.
„Großer Gott!“, stammelte Andru und riss die Tür auf, rannte hin zu dem leblosen Mädchen, das knapp zehn Meter hinter dem Streifenwagen auf dem kalten Asphalt der Straße lag.
Smart kauerte hinter dem Steuer, leichenblass, keuchend, geradeaus starrend, die Hände noch fest das Lenkrad umklammernd. Nur langsam ließ er es los, öffnete die Tür und stieg aus. Er war wie betäubt. Die Umgebung, Geräusche, er nahm nichts mehr wahr. Mit zitternden Beinen wankte er auf das tote Kind zu, neben dem sein Kollege hockte und weinte. Smart registrierte den merkwürdig verdrehten Körper des Mädchens, ihren Kopf, um den sich eine große Blutlache auf der Straße immer weiter ausbreitete und ihre geöffneten Augen. Ihre großen, geöffneten Augen, die ihn ansahen und zu fragen schienen: Warum? Warum nur?
Dann fiel er neben ihr auf die Knie.
Smart wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Fünf Jahre. Fast auf den Tag genau fünf Jahre war das jetzt her und es kam ihm vor, als wäre es erst letzten Monat geschehen. Der ungläubige Blick des Mädchens, das, wie sich später herausstellte, aus der elterlichen Wohnung geschlichen war, nur um die entlaufene Katze zu suchen, verfolgte ihn seitdem in immer wiederkehrenden Alpträumen. Smart dachte über sich nach. Was war er nur für ein Haufen Dreck? Er hatte durch Unachtsamkeit und Dummheit ein unschuldiges, wertvolles Leben zerstört. Alles, was sie noch hätte werden können. Alles, was sie noch hätte tun können in den kommenden Jahrzehnten. Ausgelöscht. Für immer. Durch seine Schuld.
Smart nahm einige kräftige Schlucke Bourbon.
In dieser einen Nacht änderte sich sein Leben. Privat und beruflich brach es auseinander. Eine Pechsträhne folgte der nächsten. Smart existierte zwar noch, aber er lebte nicht mehr. Er war ein Nichts und ein Niemand. Und das empfand er selbst als gerecht. Denn seit jener Nacht hatte er kein Glück mehr verdient.
Smart blickte auf den großen Kalender, der gegenüber an der Wand hing, sah das von ihm eingezeichnete Kreuz am morgigen Datum. Ihrem Todestag. Dem Tag, an dem er wieder einmal testen würde, ob er zumindest noch existieren durfte. Doch warum bis morgen warten?
Erneut genehmigte er sich einen ordentlichen Schluck. Dann stand er auf, die Flasche in der Rechten. Der Bourbon tat seine Wirkung. Smart wankte ein wenig, als er zu dem alten Schreibtisch ging, der am Fenster stand. Er setzte sich auf den knarrenden Holzstuhl und stellte die Flasche auf dem Tisch ab. Langsam zog er die oberste Schublade auf.
Sein Blick fiel auf einen 36er Smith & Wesson Revolver. Behutsam, fast ehrfurchtsvoll, nahm er die schwere Waffe und legte sie vor sich auf den Tisch. Wieder langte er in die Schublade. Eine Schachtel mit Patronen kam zum Vorschein. Smart öffnete sie, wühlte eine einzelne Patrone heraus und platzierte diese neben dem Revolver. Einen Moment lang betrachtete er die Tötungsutensilien. Nochmals genehmigte er sich einige Schlucke aus der Flasche, stellte sie ab und atmete tief durch. Dann ergriff Smart den Revolver und mit schnellen Bewegungen entsicherte er ihn, öffnete die Trommel, legte die Patrone ein, schob die Trommel zurück und gab ihr mit der Handfläche einen kräftigen Schwung. Die Trommel rotierte, wurde langsamer und blieb schließlich stehen.
Viermal hatte er es bereits getan. Viermal hatte ihm das Schicksal zu seinem eigenen Erstaunen noch die Chance auf eine weitere Runde gegeben. Smart hob die Waffe, hielt sich den Lauf des Revolvers gegen die Schläfe. Seine Hand zitterte. Er fühlte die Kälte des Metalls an seinem Kopf. Vielleicht würde sein Leben gleich vorbei sein. Vielleicht war es das jetzt. Langsam drückte sein Finger den Abzug nach hinten. Smart schluckte. Er war betrunken, aber er wusste genau, was er hier tat. Er spürte die Schläge seines wild pochenden Herzens bis zur Kehle hinauf. War es Schweiß oder eine Träne, die an seiner Wange herunterlief? Seine Hand zitterte immer mehr. Smart schloss die Augen. Dann drückte er ab.
Klack!! Ein Adrenalinstoß, der sich anfühlte wie ein Stromschlag, jagte durch seinen Körper und ließ ihn zusammenzucken. Seine völlig überdrehten Sinne meldeten Smart, was passiert war: nichts. Es war nichts passiert. Smart saß immer noch auf dem Stuhl. Er war immer noch am Leben, und er hatte immer noch seinen verdammten Kopf auf den Schultern. Schwer atmend senkte Smart den Revolver, legte ihn zurück auf den Tisch. Smart brauchte eine Zeit lang, bis sich der Pegel der Stresshormone in seinem Körper gelegt hatte. Er betrachtete die Waffe. Aufschub. Das Schicksal hatte ihm wieder ein Jahr gegeben.
Er wischte sich Schweiß und Tränen aus dem Gesicht. Dann griff er die Flasche Bourbon und stürzte ihren Inhalt hinunter.
- 2 -
Der frisch polierte Lack des schwarzen Mercedes-Benz 500 SEL glänzte in der Vormittagssonne, als die Limousine vor dem Gerichtsgebäude am Civic Center Plaza anhielt. Ein Chauffeur in perfekt sitzender, dunkelblauer Uniform kletterte vom Fahrersitz, marschierte zur hinteren Tür und öffnete sie. Im gleichen Moment eilten ein Dutzend Reporter und Fotografen sowie zwei Fernsehteams zu dem Wagen und tauchten die nun aussteigenden Personen in ein Meer aus Blitzlichtern und Fragen. Die drei Objekte der Begierde waren Fred und Jessica Wilson sowie ihr Sohn Richard.
Fred Wilson war ein Mittfünfziger Selfmademan, der mit Grundstücken im Silicon Valley und Immobilien in ganz Kalifornien seit Anfang der Siebziger ein Millionenvermögen aufgebaut hatte. Ein gebräunter, graumelierter Alpha-Mann im Armani-Dress mit enormem Selbstbewusstsein und Charisma. Seine blonde Frau Jessica war Anfang vierzig und hatte bis vor wenigen Jahren noch als Model gearbeitet. Obwohl sie wie immer blendend aussah, hielt sie sich, dem Anlass entsprechend, zurück, war nur dezent geschminkt und trug ein hellgraues Kostüm. Es hatte in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gegeben, dass sie vor über zwanzig Jahren als koksendes Filmsternchen in einem Underground-Porno die Beine breitgemacht hatte, aber auf mysteriöse Weise verschwanden die wenigen Kopien dieses Streifens, nachdem sie und Fred ein Paar geworden waren. Crew und Schauspieler konnten sich wundersamerweise nicht mehr an Jessica erinnern. Die beiden Mitarbeiter, die es doch taten, arbeiteten bald darauf in Kanada.
Als Letzter stieg Richard aus dem Auto. Ein Anzug tragendes Würstchen mit einem fast schon ekelerregend arroganten Grinsen und stark gegelten, nach hinten gekämmten blonden Haaren. Richard hatte mit seinem Milchgesicht keine Ausstrahlung und Charme sowieso nicht. Er war von Beruf Sohn und das reichte aus. Seine Noten an der Privatschule, die durch Vater Fred jedes Jahr großzügige Donationen erhielt, waren exzellent und so würde er demnächst entweder nach Stanford oder Harvard gehen. Auch über Richard gab es Getuschel. Von Partys mit exzessivem Drogenkonsum war ebenso die Rede wie von bestochenen Lehrern, aber wie bei Mutter Jessica verdunsteten auch bei Sohn Richard sämtliche Gerüchte ins unbestätigte und vor allem unbeweisbare Nichts.
Familie Wilson baute sich vor dem Mercedes auf. Sohn und Mutter lächelten verbindlich, während Vater Fred mit stechendem Blick signalisierte, dass es besser war, seinem Rudel nicht zu nahe zu kommen, respektive keine zu unangenehmen Fragen zu stellen. Er musste nichts befürchten. Die Reporter fraßen ihm ohnehin aus der Hand.
„Mr. Wilson, sind Sie zuversichtlich oder besorgt, was den Ausgang des Gerichtsprozesses angeht?“, fragte ihn ein junger Reporter und streckte ihm das Mikrofon entgegen.
„Natürlich zuversichtlich!“, erwiderte Fred Wilson bestimmt. „Erstens, weil ich von Natur aus Optimist bin, und zweitens, weil die Anschuldigungen gegen meinen Sohn völlig haltlos sind.“
Richard Wilson nickte und grinste breit in die Kameras.
„Aber es heißt, dass die Staatsanwältin heute schwere Geschütze auffahren wird!“, gab ein kleiner Reporter mit Filzhut zu bedenken.
„Ach, wird sie das?“, entgegnete Fred Wilson betont gelassen. „Auch mit großen Kanonen kann man danebenschießen. Aber das wird sie schon bald selbst feststellen, die Frau Staatsanwältin, diese Miss … wie heißt sie noch gleich?“, erkundigte er sich mit absichtlich lässig gespielter Unwissenheit.
Die Reporter lachten.
„McReady! Sandra McReady!“, antwortete der kleine Reporter mit Hut auf die gar nicht ernsthaft gestellte Frage, während hinter ihm, an einem der Fenster im zweiten Stock des Gerichtsgebäudes, die Gestalt einer schlanken Frau in einem dunkelgrauen Kostüm zu erkennen war.
Sie stand an der Glasscheibe und schaute hinunter auf die Szenerie. Sanfte, blaue Augen erfassten die drei Stars und die Ansammlung von Reportern. Dass dieser Fall mit viel Medienrummel verbunden sein würde, war ihr von Anfang an klar gewesen. Dass sich aber die gesamte Journaille völlig vorbehaltlos um den Angeklagten und seine Eltern scharen würde wie Schmeißfliegen auf einem frischen Kuhfladen, hatte sie dann doch überrascht. Nervös fuhr sie sich mit der Hand durch die weichen, dunkelbraunen Locken. Hinter ihr in dem kleinen Büro saß ein drahtiger Mann Ende fünfzig. Er war frisch rasiert, trug einen dunklen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte und schien doch nicht hierher zu passen. Er wirkte unsicher, wühlte mit seinen Fingern zwischen Hals und Hemdkragen herum, so als ob für ihn der eng anliegende Stoff auf der Haut ungewohnt und unangenehm war.
Plötzlich ging die Tür auf. Ein dicker Mann mit Halbglatze und Schnauzer betrat schnellen Schrittes den Raum. Ein leichter Schweißfilm bedeckte seine Stirn.
„Ah, Miss McReady, hier sind Sie!“, platzte er mit ernster Miene hervor. „Haben Sie mitgekriegt, was da draußen los ist?“
Die Staatsanwältin drehte sich zu ihm um. „Sie meinen die Theatershow vom großen Fred Wilson?“, fragte die hübsche Frau, Mitte dreißig. „Lässt sich kaum übersehen.“
Hektisch wühlte er ein Tuch aus der Innentasche seines Jacketts hervor und wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Der große Fred Wilson. Das können Sie laut sagen. Er wird uns in der Luft zerreißen, wenn Sie den Fall verlieren sollten.“
„Wir haben zwei Zeugen, die heute ihre Aussagen machen. Wir werden nicht verlieren“, erwiderte sie und deutete auf den drahtigen Mann, der sich erhob und dem Oberstaatsanwalt sofort die Hand reichte, welche dieser aber nicht ergriff.
„Hallo Mr. Harris!“, sagte er flüchtig, ohne den Mann weiter zu beachten, schaute stattdessen unruhig im Raum umher. „Wo ist denn Mr. Carnahan?“
„Der kommt immer erst kurz vor Beginn. Keine Sorge.“
„Keine Sorge?!“ Er sah sie verärgert an. „Sie haben wohl vergessen, wer Fred Wilson ist! Der Mann hat beste Kontakte in der Wirtschaft und Politik dieser Stadt. Er spendet jedes Jahr hohe Beträge für soziale Projekte. Und er gibt den Menschen Jobs. Alle lieben ihn. Selbst die verdammte Presse kratzt nicht an seinem Sockel!“
„Das mag sein. Aber …“
„Ich habe Sie von Anfang an vor diesem Fall gewarnt!“ Er atmete heftig vor Aufregung. „Der Mann hat einflussreiche Freunde. Wenn Sie verlieren, bin nicht ich derjenige, der Sorgen hat, sondern Sie.“
McReady schluckte. Die Angst ihres Vorgesetzten drohte auf sie überzugreifen, doch es gelang ihr sich wieder zu fangen.
„Fred Wilson ist mir völlig egal“, entgegnete sie. „Es geht mir um seinen Sohn. Der Mistkerl hat zusammen mit drei Freunden einen Obdachlosen totgeprügelt! Nur so zum Spaß!“
Der Oberstaatsanwalt winkte ab. „Ist mir bekannt. Was mich interessiert ist das, was wir noch gegen ihn in der Hand haben.“
„Wir hatten die Reifenspuren, die zu seinem Auto passen“, erklärte McReady, „Sand und Dreck vom Tatort, den wir im Profil seiner Reifen und im Wagen selbst nachweisen konnten, sowie das Überwachungsvideo eines Supermarktes in der Nähe, auf dem der Ford Mustang kurz vor der Tat zu erkennen ist.“
Ihr Vorgesetzter verzog das Gesicht. „Ja, das hätte was werden können. Bis sein Anwalt gestern aus dem Hut zauberte, dass Richard Wilson keine fünf Minuten vor dem Verbrechen seinen Wagen als gestohlen gemeldet hat.“
„Aber darüber war ich nicht informiert worden!“, warf McReady zerknirscht ein. „Die ermittelnden Beamten meinen nichts davon gewusst zu haben!“
„Ja, diese Schlamperei wird für die Herren noch ein Nachspiel haben! Aber das bringt uns jetzt nicht weiter.“
„Trotzdem. Das Auto wird kurz vor der Tat gestohlen? Das ist doch ein billiger Trick! Die Jungs wollten wahrscheinlich aus Langeweile das perfekte Verbrechen begehen und suchten sich dafür jemanden aus, der in der Gesellschaft ganz unten steht, um dessen Schicksal sich sowieso niemand kümmert. Die fünf Minuten zwischen dem angeblichen Diebstahl und dem Mord waren das einzige Risiko für sie und wohl nur zusätzlicher Nervenkitzel!“
„Aber es hat funktioniert. Genau wie die Aussage seines Schulfreundes unter Eid, dass Wilson und er während der Tatzeit bei ihm zu Hause waren. Dieser verdammte Anwalt Roy Bagley hat gestern ganze Arbeit geleistet. Und deshalb meine Frage. Was haben Sie jetzt noch gegen Wilson in der Hand?“
McReady sah kurz zu Harris. „Ich habe meine beiden Zeugen, die am Tatort nicht nur den Mustang und dessen Kennzeichen, sondern auch den Fahrer gesehen haben, der von ihnen klar als Richard Wilson identifiziert wurde.“
„Das ist alles? Mehr haben Sie nicht? Nur noch Ihre zwei Zeugen, die obdachlosen Freunde des Opfers?“ Der Oberstaatsanwalt schüttelte den Kopf. „Sie müssen verrückt sein jetzt noch weitermachen zu wollen!“
„Was soll ich denn sonst tun?“, erwiderte McReady mit einem Hauch von Empörung in ihrer Stimme. „Einen Mörder einfach davonkommen lassen? Das kann ich nicht!“
„Ich fürchte nur, Sie werden sich bei der ganzen Sache nicht mit Ruhm bekleckern.“
„Es geht mir nicht um Ruhm“, entgegnete sie mit ernster Miene, „sondern um Recht und Gerechtigkeit, die Bösen ins Gefängnis zu stecken, damit sie anderen kein Leid mehr zufügen können.“
Der Oberstaatsanwalt nickte. „Ich weiß. Die furchtbare Sache mit Ihrem Bruder. Aber wenn Sie Gerechtigkeit wollen, dann müssen Sie alles geben. Und endlich die Samthandschuhe ausziehen!“
Er wandte sich ab, ging zur Tür und drehte sich noch einmal um. „Vergessen Sie nicht!“, mahnte er mit erhobenem Zeigefinger. „Die Geschworenen müssen voll und ganz von der Schuld Richard Wilsons überzeugt sein. Wenn es einen Zweifel daran gibt, lautet das Urteil auf Freispruch. Und dann möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken!“
Er ging und ließ Harris und eine etwas eingeschüchtert wirkende Staatsanwältin zurück.
„Miss McReady?“, sagte der Zeuge leise.
Sie sah ihn an.
„Danke. Was Sie bis jetzt getan haben, werde ich Ihnen nie vergessen.“
„Noch habe ich gar nichts geschafft.“
„Oh doch. Durch diesen Prozess haben Sie Danny seine Würde wiedergegeben.“
McReady lächelte etwas verlegen. „Gern geschehen.“
Sie blickte zum Fenster und atmete tief durch. „So, Mr. Harris, und jetzt zeigen wir allen, warum Justitia eine Augenbinde trägt.“
Die Sitzreihen im Gerichtssaal waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Zum einen mit zahlreichen, durch das große Medienecho angelockten Zuschauern, die Spektakel und Sensation witterten, zum anderen durch die Vertreter der Presse, die jede Äußerung der beteiligten Personen, jede ihrer Bewegungen oder auch nur Änderungen in ihrer Mimik eiligst protokollierten.
McReady saß mit Harris am Tisch der Anklage, während am Tisch der Verteidigung, direkt vor Fred und Jessica Wilson, Sohn Richard nebst Daddys beiden Anwälten Platz genommen hatte. Einer von ihnen war eine Frau, Anfang dreißig, dicklich mit Pagenkopf, was ihr Gesicht noch fülliger wirken ließ. Sie beobachtete die Geschworenen, machte sich Notizen, tauschte sich ständig mit dem anderen Anwalt aus und nickte heftig, wenn dieser ihr etwas mitteilte. Denn er war der Boss, der Macher: Roy Bagley, ein in ganz Kalifornien bekannter Rechtsanwalt, ein Star seiner Zunft, berühmt dafür ausweglos erscheinende Fälle doch zu gewinnen. Ihm gehörte eine renommierte Kanzlei mit einem halben Dutzend hervorragender Anwälte, aber bei den großen, publicityträchtigen Fällen betrat er immer wieder gern selbst die Bühne. Roy Bagley war ein charmanter und eleganter Endfünfziger im Maßanzug, groß, schlank und mit einer klaren und angenehm klingenden Stimme, die alles andere übertönte und die Aufmerksamkeit nur auf ihn lenkte.
Über der Szenerie thronte der Vorsitzende Richter John Randolph. Anfang sechzig, mit Halbglatze und einer Hornbrille im Gesicht, wirkte er wie der nette Großvater von nebenan, der den gesamten, durch die Medien aufgeheizten Prozess mit Ruhe und Souveränität führte.
McReady blickte auf die Uhr und schüttelte verärgert den Kopf. Wo, zum Teufel, blieb Carnahan?
„Ich erteile nun der Staatsanwaltschaft das Wort!“, kam es in diesem Moment von Richter Randolph.
McReady erhob sich. „Hohes Gericht, unerklärlicherweise ist der zweite Zeuge der Anklage bis jetzt nicht erschienen. Ich bitte daher um eine Verhandlungspause, in der …“
„Entschuldigung, Euer Ehren! Entschuldigung, sehr geehrte Kollegin, dass ich Sie unterbreche!“, meldete sich plötzlich lautstark Bagley. „Ich habe noch mitzuteilen, dass der betreffende Zeuge, Mr. Ed Carnahan, mich gestern Abend in meiner Kanzlei aufgesucht hat!“
„Was?!“, platzte McReady entsetzt hervor.
Wie auf Kommando setzte im Gerichtssaal unter den anwesenden Zuschauern und Reportern heftiges Getuschel ein.
„Ruhe! Ruhe!“, mahnte Richter Randolph.
„Er kann die Täter nur schemenhaft beschreiben“, fuhr Bagley fort. „Eine klare Identifizierung ist für ihn aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse zur Tatzeit nicht möglich. Ich habe hier …“, er nahm einen Briefumschlag vom Tisch, „… die eidesstattliche Aussage von Mr. Carnahan …“
„Eidesstattliche Aussage?!“, unterbrach ihn McReady. „Das ist unmöglich!“
Richter Randolph winkte die beiden heran. „Miss McReady, Mr. Bagley. Kommen Sie bitte zu mir.“
McReady schritt mit eisiger Miene zum Richtertisch, dabei immer den sichtlich zufriedenen Bagley und das Schriftstück in seiner Hand im Blick, das er Richter Randolph überreichte. Dieser überflog das Papier und sah den Rechtsanwalt pikiert an.
„Was soll das?”, brummte er. „Mr. Carnahan ist heute als Zeuge geladen, also ist es seine Pflicht zu erscheinen!“
Bagley hob entschuldigend die Hände. „Das habe ich ihm auch gesagt, Euer Ehren. Aber er wollte partout nicht hören, bat mich nur seine Aussage aufzunehmen und ist dann gegangen. Ich konnte ihn ja nicht mit Gewalt zurückhalten.“
McReady platzte der Kragen. „Ich glaube Ihnen kein Wort! Warum ist Mr. Carnahan nicht zu mir gekommen? Offensichtlich hat er sich kaufen lassen! Wieviel Geld haben Sie ihm für die Falschaussage gegeben?!“
Bagley verzog theatralisch empört das Gesicht und wollte gerade erwidern, aber Richter Randolph kam ihm zuvor.
„Frau Staatsanwältin! Ich muss doch sehr bitten! Wenn Sie für diese schwere Anschuldigung irgendeinen Beweis haben, dann sollten Sie ihn vorbringen. Ansonsten halten Sie sich mit solchen Äußerungen gefälligst zurück!“
Er reichte das Papier an McReady, die ihm das Schreiben fast aus der Hand riss und mit großen Augen die Erklärung ihres Zeugen las, derweil der verschmitzt grinsende Bagley die Reaktion seiner Kontrahentin genoss. Fassungslos starrte McReady auf das Schriftstück, das ihr schwarz auf weiß bescheinigte, dass ihr Plan gerade zu fünfzig Prozent gescheitert war. Wortlos gab sie dem Richter das Schreiben zurück. Die Enttäuschung stand ihr ins angespannte Gesicht geschrieben.
„Miss McReady?“, fragte Randolph.
„Ich rufe meinen nächsten Zeugen auf“, murmelte sie.
Nur wenige Minuten später hatte Julius Harris im Zeugenstand Platz genommen und war vereidigt worden.
McReady trat vor ihn. Einen kurzen Moment sahen sich beide wortlos an. Jeder von ihnen wusste, dass nun die alles entscheidende Runde begonnen hatte.
„Mr. Harris“, begann McReady. „In welcher Beziehung standen Sie zu dem ermordeten Mr. Morell, und wo lernten Sie sich kennen?“
„Ich bin obdachlos“, antwortete ihr Zeuge. „Einige Monate nachdem ich damals auf der Straße gelandet war, traf ich auf den ebenfalls obdachlosen Danny Morell. Wir wurden schnell gute Freunde.“
„Wie lange sind Sie schon obdachlos?“, wollte McReady wissen.
„Fast zehn Jahre.“
„Wie sah Ihr Leben davor aus, Mr. Harris? Sagen wir mal, vor fünfzehn Jahren?“
„Da war ich Sergeant in der US-Army, Ma’am. Und zu der Zeit in Vietnam stationiert.“
„Und Sie sind definitiv jemand, auf den die Army stolz sein kann“, fügte McReady hinzu, während sie kurz zu den Geschworenen hinüberblickte und die Stimme dabei lauter werden ließ. „Sie haben für Tapferkeit einen Silver Star verliehen bekommen, weil Sie Ihr Leben riskierten, als Sie unter schwerem feindlichen Feuer zwei verwundete Kameraden retteten. Einige Monate später drohten Sie jedoch wegen Befehlsverweigerung und Tätlichkeit gegen Ihren Vorgesetzten unehrenhaft aus dem Militärdienst entlassen zu werden. Jener Vorgesetzte hatte Befehl gegeben ein bestimmtes Areal mit Brandbomben dem Erdboden gleichzumachen, in der sich auch ein vietnamesisches Dorf befand, nur noch bewohnt von Frauen und Kindern. Lediglich durch Mr. Harris’ beherztes Eingreifen wurde der Einsatz gestoppt. Nach Vorliegen aller Fakten wurde er vollständig rehabilitiert.“
„Einspruch!“, jammerte Bagley. „Hat das irgendetwas mit diesem Fall zu tun?“
Richter Randolph sah McReady fragend an.
„Ja!“, antwortete sie. „Denn ich will auf den Hintergrund, auf Charakter und ethisch-moralische Grundhaltung meines Kronzeugen hinweisen und deutlich machen, welche Einstellung er zu Gerechtigkeit und Ehrenhaftigkeit hat. Gerade in Bezug auf die Glaubwürdigkeit von Obdachlosen bilden sich leider sehr schnell Vorurteile.“
Der Richter überlegte kurz. „Einspruch abgelehnt.“
Ein leichtes Lächeln huschte über McReadys Gesicht.
„Mr. Harris“, sagte die Staatsanwältin, „erzählen Sie uns jetzt bitte, was sich am späten Abend des 12. Februar diesen Jahres am Rand des Lafayette Parks ereignet hat, als Daniel David Morrell ermordet wurde.“
Harris räusperte sich. „Nun ja, Ed Carnahan, ebenfalls ein obdachloser Vietnamveteran, und ich warteten dort auf unseren Freund Danny, ich meine Mr. Morrell. Als wir ihn schließlich entdeckten, wie er auf uns zukam und noch ungefähr fünfzig Yards entfernt war, preschte plötzlich dieser Wagen heran.“
McReady unterbrach. „Können Sie uns den Wagen beschreiben?“
„Ein weißer Ford Mustang GT.“
„Was ist dann passiert?“
„Der Mustang hielt direkt neben Mr. Morrell. Vier Typen mit Strumpfmasken auf dem Kopf stürmten heraus. Sie waren mit Eisenstangen bewaffnet und prügelten sofort und ohne Vorwarnung auf ihn ein. Danny hatte überhaupt keine Chance. Und dazu hörten wir das Lachen dieser Kerle.“
„Die Täter haben gelacht?“, fragte McReady.
„Ja, während sie auf ihn eingeschlagen haben. Dann stürzte er zu Boden, aber sie haben einfach weitergemacht. Immer wieder sausten die Stangen auf ihn runter. Das Knacken seiner Knochen tönte bis zu uns herüber, vermischte sich mit seinen Schreien. Es war grauenvoll.“
„Was haben Sie und Mr. Carnahan getan?“
„In den ersten Sekunden leider gar nichts, weil wir völlig überrascht waren durch die Situation. Erst als Danny zu Boden ging, begannen wir zu handeln. Wir schrien und liefen los, wollten unserem Freund helfen.“
„Wie reagierten die Schläger?“, wollte McReady wissen.
„Die haben sich anscheinend mächtig erschrocken, dass plötzlich Zeugen auftauchten. Denn sie sind sofort getürmt, als sie uns herankommen sahen. Nun sind Eddy Carnahan und ich nicht mehr die Jüngsten und Schnellsten. Durch den Krieg haben wir ja auch eine Menge abgekriegt. Aber bis die vier in ihrem Wagen waren, hatten wir sie fast schon erreicht.“
McReady beugte sich ein wenig zu ihm hinunter. „Und dabei haben Sie das Gesicht von einem der Männer gesehen?“
„Oh ja! Das habe ich! Der Fahrer hat sich beim Einsteigen die Maske vom Gesicht gezogen und sich dann beim Losfahren kurz zu uns umgeschaut. Hat wohl in der Eile vergessen, dass das Seitenfenster runter war!“
„Mr. Harris!“, sagte McReady mit lauter Stimme. „Zeigen Sie uns nun bitte die Person, die Sie hinter dem Steuer des Mustang gesehen haben!“
Der Zeuge starrte zu dem Angeklagten, deutete mit dem Finger auf ihn. „Er war es!“, knurrte Harris. „Richard Wilson!“
„Sehen Sie ihn noch einmal ganz genau an“, bat McReady.
„Sind Sie wirklich sicher, dass er es war?“