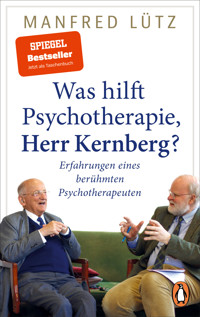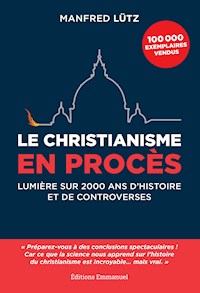9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Europa Edizioni
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Gegenstand seiner Untersuchungen sind die „Mechanismen“ und „Automatismen“, die durch die Eigentumsverhältnisse an Produktionsmitteln, speziell denen des damaligen Ostens, zwangsläufig und gewissermaßen automatisch hervorgebracht werden. Also nicht das, was Politiker von sich gegeben haben, wird angeführt, um damit irgendetwas beweisen zu wollen – an dem, was Politiker sagen, muss man sowieso immer zweifeln, meint Lütz - nein, nur das, was sich aus den veränderten Eigentumsverhältnissen logisch erklären lässt. Und er hat Potenzen gefunden, hat aber auch Fehler, die begangen worden sind, festgestellt. Insgesamt erkennt er aber eine Alternative zu unserer heutigen problemgeschüttelten Gesellschaft und sieht die etwas spätere Zukunft trotz aller zuvor noch zu erwartenden Schwierigkeiten, letzten Endes unter durchaus optimistischem Gesichtspunkt.
Manfred Lütz wurde 1939 in Thüringen geboren, hat nach seinem Abitur den Beruf des Gerbers erlernt und danach ein Studium der Ökonomie in der Fachrichtung Außenhandel als Diplomökonom abgeschlossen.
Er ist immer nur in der Wirtschaft tätig gewesen. „Eine hauptberufliche Arbeit in der Politik wäre auch nie mein Ding gewesen“, sagt der Autor heute im Rückblick.
Mittlere führende Positionen in der Materialversorgung, im Absatz und in der Produktion von Industriezweigleitungen hat er innegehabt und hat dadurch sowohl die wirtschaftlichen Probleme des damaligen Systems kennengelernt als auch die Art und Weise der Zusammenarbeit innerhalb der Wirtschaft und die der Wirtschaft mit den staatlichen Organen, bis einschließlich in die Ministerien und auch ein neues kameradschaftliches, zwischenmenschliches Verhältnis und ein gutes Bildungssystem.
Als Direktor für Import in einem Außenhandelsunternehmen, hat er geschäftlich Kontakte zu Partnern im Ausland gehabt, sowohl im sozialistischen als auch im kapitalistischen System, sodass er auch die Gepflogenheiten auf diesen Märkten kennt.
Schließlich hat sich Lütz 1990 im Alter von fünfzig Jahren in seinem Fachgebiet selbstständig gemacht, und ist darin bis heute tätig – „ohne, dass ich“, so Lütz, „bei allen Tiefen, die ich selbstverständlich auch durchgemacht habe, die weiße Fahne hätte hissen müssen“.
Nach der Wende hat ihn die Frage beschäftigt, ob die Form eines gesamtgesellschaftlichen Eigentums, das man unter dem Namen Sozialismus praktiziert hatte, und von dessen Vorzügen er nach und nach überzeugt gewesen zu sein gemeint hatte, immer und zwangsläufig untergehen muss, oder nicht? Wenn ja, weshalb? Wenn nicht, weshalb dann? Zugutegekommen ist ihm dabei, dass er praktische Erfahrungen sowie im System des Ostens als auch im kapitalistischen System hat sammeln können.
Die Antworten, auf die er dabei gestoßen ist, hat er in diesem Buch niedergeschrieben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Manfred Lütz
Die „Superaktiengesellschaft“
Potenzen eines
gesamtgesellschaftlichen Eigentums
© 2023 Europa Buch | Berlin www.europabuch.com | [email protected]
ISBN 9791220134262
Erstausgabe: Januar 2023
Gedruckt für Italien von Rotomail Italia
Finito di stampare presso Rotomail Italia S.p.A. -Vignate (MI)
Die „Superaktiengesellschaft“
Potenzen eines gesamtgesellschaftlichen Eigentums
„Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen“
Aristoteles
Weshalb ich geschrieben habe
Ich habe in meinem Leben zweimal daran gezweifelt, ob ein gesamtgesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln gut und richtig sei.
Das erste Mal, als ich aus einer Handwerkerfamilie, also aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammend, ganz selbstverständlich lange die gleiche Meinung vertreten habe wie meine Eltern und Großeltern, nämlich, dass das, was in der damaligen DDR angestrebt worden ist, irgendetwas Unsinniges sei, vor dem man sich hüten müsse.
Dementsprechend habe ich dem misstraut, was „die Roten“ gesagt haben, habe bezweifelt und habe abgelehnt, mich in irgendeiner Form damit zu identifizieren. Mir ist es also so oder so ähnlich ergangen, wie vielen anderen meiner Generation, beziehungsweise den Nachkriegsgenerationen im Allgemeinen, die nichts anderes gehört und gekannt haben.
Es hat lange gedauert, bevor ich mir eingestehen musste, dass dadurch tatsächlich ungeahnte Potenzen für die Menschheit eröffnet werden, deren Umfang und Reichweite meinen Eltern und Großeltern als Kinder ihrer Zeit, nie nahegebracht worden sind, und was sie infolgedessen nicht haben erkennen können.
Ich muss an die dreißig Jahre alt gewesen sein, und die DDR muss so etwa zwanzig Jahre bestanden haben, als ich immer noch widerstrebend akzeptiert habe, dass es so falsch doch nicht sein könne. Zumindest vom Grundgedanken her.
Jetzt, als alter Mann, kann ich lächelnd eingestehen, dass ich als Student sogar so vermessen gewesen bin, Marx widerlegen zu wollen. Na, ja…! Ich kann jedenfalls nur sagen, wenn Sie jemanden, vom Marxismus überzeugen wollen, dann überreden Sie ihn dazu, dass er Marx widerlegen soll. Wenn er das dann wirklich sachlich versucht, brauchen Sie nichts weiter zu tun.
Die Wende kam dann völlig überraschend.
Plötzlich, völlig unerwartet, war jene Gesellschaft nicht mehr existent, war zusammengebrochen, von der ich nun verstanden zu haben geglaubt habe, dass sie, wie sie immer dargestellt worden war, die, die den Kapitalismus ablöst und die historisch überlegene und damit die Bessere sei.
Und da habe ich das zweite Mal gezweifelt.
Sollte das alles wirklich nicht mehr wert sein, als unterzugehen?
Sollte das, was ich nach so langem Zögern schließlich für richtig gehalten habe, nichts weiter als eine Bauernfängerei gewesen sein, auf die ich hereingefallen gewesen war?! Bin ich zu dumm gewesen, das zu erkennen? Müsste ich mich fortan nun einen Dummkopf nennen? Einen Trottel?
Es sind deprimierende und quälende Fragen mit der Neigung zu Minderwertigkeitskomplexen gewesen.
Oder, so habe ich mich dann bang gefragt, gibt es doch noch irgendetwas, was den Sinneswandel, den ich vollzogen hatte, rechtfertigen könnte? Zumindest ein wenig. Gibt es so etwas wie mildernde Umstände?
Also habe ich, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, begonnen, nach Antworten zu suchen.
Mir sind viele Erlebnisse eingefallen. Schöne, aber auch negative. Allerdings eigentlich mehr Beispiele der angenehmeren Art. Keinesfalls aber so viel Schlechtes, wie es jetzt oft dargestellt wird.
Allerdings habe ich dabei bald feststellen müssen, dass man Beispiele für alles finden kann. Einzelbeispiele. Für alles Positive, aber auch für alles Negative. Je nachdem, wonach man sucht.
Beispiele erlangen eben erst dann Beweiskraft, wenn man genug von ihnen sammelt, sie statistisch auswertet, und alles wissenschaftlich unter Berücksichtigung der Entwicklungstendenzen bewertet. Aber dafür hatte ich keine Voraussetzungen. Und die Statistiken, auf die ich nun hätte zurückgreifen können? Na, ja, „Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe!“, hat Churchill gesagt. Weshalb sollte ich das nicht beherzigen?!
Anhand von Beispielen kann man außerdem ja auch nicht erkennen, weshalb etwas gescheitert ist. Die negativen zeigen zwar, dass etwas „faul“ ist, aber nicht den Grund, weshalb es „faul“ ist. Von den Gegnern werden sie in der Regel als Fehler des Systems interpretiert. Als etwas grundsätzlich Unvermeidbares. Aber es hat ja schon immer gute Vorhaben und Absichten gegeben, die auch erst einmal gescheitert sind, aber nicht, weil die Idee falsch gewesen ist, sondern, weil bestimmte, notwendige Voraussetzungen noch nicht bestanden haben, um sie schon realisieren zu können. Denken Sie doch nur an die Entwicklung eines Flugzeuges. Immer wieder sind Versuche gescheitert, und heute fliegt der Mensch dennoch. Die Ideen sind nicht verantwortlich für das, die Menschen aus ihnen machen! (Werner Heisenberg)
Die genaueren Ursachen für ein Scheitern zu kennen, ist also wichtig, um den Wert einer Idee überhaupt ermessen zu können.
Deshalb habe ich fortan aufgehört, nach Beispielen zu suchen, sondern habe stattdessen begonnen, mich zu fragen, wodurch es eigentlich zu diesen Beispielen kommen konnte? Wodurch sie eigentlich hervorgebracht worden sind? Welche „Automatismen“, welche Gesetzmäßigkeiten diesem System dafür innegewohnt haben müssen. Jene „Mechanismen“, die meist ja nicht vordergründig ins Auge fallen. Die gewissermaßen „unterhalb der Oberfläche“ aber zwangsläufig wirken, sich aber logisch erklären lassen. Also indem man lediglich „eins und eins“ zusammenzählt, ohne politische Absichtserklärungen und Parteitagsbeschlüsse zu zitieren. Beschlüsse, an deren Richtigkeit ich in Anbetracht des Untergangs ja sowieso gezweifelt habe. Einzelbeispiele habe ich deshalb fortan nur noch genutzt, wenn ich das eine oder andere besser und anschaulicher erklären wollte.
So oft wie möglich habe ich Gespräche gesucht, Diskussionen, um die Argumente anderer Leute, speziell Gegenargumente, kennenzulernen und Antworten darauf zu finden. Und weil Schreiben dazu zwingt, seine Gedanken ganz exakt zu formulieren, zumindest exakter, als wenn man nur über etwas nachdenkt, und weil man außerdem das, was man geschrieben hat, nicht immer wieder neu erarbeiten und formulieren muss, habe ich begonnen, zu schreiben.
Weil das alles aber nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute interessant sein könnte, für solche wie meine Eltern und Großeltern und für solche, die die sich Gedanken über die Zukunft machen, habe ich nach einem Verlag gesucht, um es zu veröffentlichen.
Wenn ich jetzt, nach rund drei Jahrzehnten zurückschaue, muss ich sagen, dass mich in der ehemaligen DDR niemand mehr hätte überzeugen können, als diese schreibende Beschäftigung und das, was ich im jetzigen System seitdem erlebt habe und noch jeden Tag erlebe.
I. Allgemeine Auswirkungen einer „Superaktiengesellschaft“
1. Der Staat in Form einer „Superaktiengesellschaft“
Der Kerngedanke jenes Systems des ehemaligen Ostens hat darin bestanden, die Produktionsmittel zu einem gesamtgesellschaftlichen Eigentum zu machen, sie also zu verstaatlichen, um auf diesem Weg bestehende Probleme zu lösen und neue Potenzen zu eröffnen.
Was hat es aber eigentlich gebracht?
Damit ist also die in der Vergangenheit in viele Eigentümer zersplitterte Wirtschaft in der Hand eines einzigen Eigentümers, nämlich des Staates, und nur des Staates, vereinigt worden. Damit hat als wichtigste und entscheidende Folge der Staat über alle Gewinne verfügt und über deren Verwendung entschieden.
Oder andersherum: Es hat keine Konzerne mehr gegeben, die die Gewinne ihres Unternehmens vereinnahmen, mit diesen Lobbys finanzieren, gefügige Politiker in Regierungsämter lancieren und unliebsame Politiker kaltstellen und so ihre betriebsegoistischen Ziele durchsetzen konnten. Für Zwecke, die nicht immer im Interesse der Gesellschaft liegen, sondern ihr sogar zum Schaden gereichen. Durch die, wie Friedrich Schorlemmer, einer der führenden Bürgerrechtskämpfer der ehemaligen DDR sagt, es zu einem „hemmungs- gar gnadenlos agierenden Kapitalismus“ gekommen ist, der zu einer „Liberalisierungs-, Deregulierungs- und Privatisierungsorgie“ und zu
einem „gigantischen wie fragilen Weltfinanzsystems“ geführt hat (Sein Zitat wird ausführlicher im 11. Kapitel betrachtet.)
Derart durch Macht- und Geldgier die Existenz der Menschheit bedrohenden Konzerne hat es nicht mehr gegeben. Wie es übrigens überhaupt keine großen Unternehmen mehr gegeben hat, die sich noch in Privathand befunden hätten.
Weil niemand, keiner der Entscheidungsträger, keiner der Politiker, einen direkten Anteil am Eigentum eines konkreten Betriebes gehabt hat, weil also keiner Veranlassung gehabt hat, sich als Lobbyist oder gar aus persönlichem Interesse für irgendeinen bestimmten Betrieb einzusetzen, waren die Eigentumsverhältnisse also so, dass alle Entscheidungen potenziell wirklich und abstrichlos im Interesse der gesamten Gesellschaft, der Allgemeinheit, getroffen werden konnten.
Nun sind die großen Konzerne ja aber nicht von ungefähr entstanden. Nichts in der Welt kann entstehen, wenn keine Notwendigkeit dafür besteht und es keinerlei Voraussetzungen und Lösungsansätze dafür gibt. - Man hätte das erste Mikroskop zum Beispiel nicht erfinden können, wenn es das Glas nicht schon gegeben hätte, und ohne die mittelalterlichen Städte mit ihren Zünften und ohne Manufakturen hätte sich die bürgerliche Gesellschaft nie herausbilden können. Und so haben Wissenschaft und Technik besonders im letzten Jahrhundert derart produktive Produktionsmittel hervorgebracht, die nur durch dementsprechend große Unternehmen genutzt werden können und die zwangsläufig solche auch haben entstehen lassen. Mittlerweile haben sich Konzerne herausgebildet, die zwanzig, dreißig Prozent eines Industriezweiges beherrschen. Oder sogar noch mehr. Oft mit Tochterunternehmen in verschiedenen Industriezweigen und zunehmend auch über die Landesgrenzen hinaus, also international. Und sie werden größer und größer. Diese Entwicklung zu großen und immer größeren Wirtschaftseinheiten ist unvermeidbar. Kein Mensch kann sie aufhalten. Selbst Kartellämter nicht. Die Konzerne werden größer und größer. Eigentümer kleiner und mittlerer Betriebe, wie sie für die Anfangszeiten des Kapitalismus typisch gewesen sind und die man gewissermaßen als die klassischen kapitalistischen Eigentümer bezeichnen kann, können heutzutage nur noch in Nischen oder als Zulieferer für die „Großen“ existieren.
Damit haben diese Konzerne insofern eine Daseinsberechtigung, indem sie diejenigen Unternehmen sind, die die Potenzen der vorhandenen Produktionsmittel am effektivsten ausschöpfen und nutzen können. Sie haben außerdem den großen Vorteil, dass sie, und zwar je größer und heterogener sie sind, Wissenschaft und die Technik in einem solchen Maße vorantreiben können, wie es keins der kleineren Unternehmen kann. Beispiel Mikroelektronik, Telekommunikation oder Raumfahrt. Sie sind damit also ein zwangsläufiges Ergebnis der Aufwärtsentwicklung von Wissenschaft und Technik, können dieser Entwicklung auch gerecht werden, führen aber im gleichen Zuge zu gewaltigen negativen Auswirkungen. Das heißt, man braucht sie, hätte gleichzeitig aber auch gute Gründe, sie zu beseitigen, was man aber wiederum nicht kann, weil sie eben gebraucht werden.
Weil sie die Entwicklung nicht aufhalten kann, und man es auch gar nicht erst versuchen darf, steht die Menschheit also vor der schwierigen Aufgabe, eine Lösung zu finden, wie sie der Entwicklung folgen und deren positive Ergebnisse übernehmen kann, aber gleichzeitig deren negativen Auswirkungen verhindert. Ganz nach der Maxime „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen.“
Schwierig. Sehr schwierig.
Und dennoch gibt es eine Lösung! Eine Lösung, die der Gründungszeit der Sowjetunion und nach 1945 in den Ländern des Sozialistischen Lagers praktiziert worden ist, als man alle oder zumindest alle wichtigen Unternehmen in einem Staatseigentum vereinigt hat. Man hat den Anteil eines Konzerns am Industriezweig also nicht nur bei zwanzig oder dreißig Prozent belassen, sondern man hat dort, wo es möglich gewesen ist, sogar einhundert Prozent vereinigt. In jedem Industriezweig einen. Im Fahrzeugbau. In der Schuhproduktion. In den Bereichen der Webereien, der Spinnereien und so weiter. Jeweils wie zu einem Industriezweigkonzern. Und alle Industriezweige in der Hand des Staates, also eines einzigen Eigentümers. Wie zu dem größten Konzern, den es innerhalb eines Landes überhaupt geben kann.
Man hat damit der Entwicklung zu großen Produktionseinheiten also Rechnung getragen, hat sie aber nicht nur schlechthin aufgegriffen, sondern sie sogar noch fortführt. Ganz bewusst. Bis an die Grenzen des Möglichen und Machbaren. Und damit war viel Überraschendes entstanden: Man hat die Volkswirtschaft wie einen Konzern führen, hat dessen Vorzüge nutzen können, hat die negativen Auswirkungen, die die Existenz von (mehreren oder vielen) Konzernen innerhalb einer Volkswirtschaft mit sich bringt, aber verhindert.
Weil sich die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln aber verändert hatten, hatte sich auch alles andere, hat sich das gesamte Leben verändert. Das ist nun einmal so. Die bürgerliche Gesellschaft hat zum Beispiel auch so gut wie alles verändert, als sie mit ihren Fabriken zuerst wirtschaftlich dominiert und dann auch die politische Macht übernommen hatte. Sie hat nicht nur eine ganz neue Art der Wirtschaftsführung hervorgebracht, die Naturalwirtschaft abgeschafft und der Geldwirtschaft zum Durchbruch verholfen, sie hat auch das gesamte übrige Leben verändert. Die Rechtsauffassungen, die Kunstformen, die Lebensauffassungen und sogar die alltäglichen Sitten und Gebräuche, von der Mode bis zu der Art, Feste zu feiern.
Vergleichbar umfangreich hatte sich auch im Osten alles verändert. Professor Wolfgang Elsner hat ein sehr lesenswertes Buch über China geschrieben, aus dem ich noch des Öfteren zitieren werde. Der Buchtitel lautet: „Das chinesische Jahrhundert“. Aber es trägt auch noch den Zusatz: „Die neue Nummer eins ist anders“. Zu Recht.
So darf man zum Beispiel nicht in den Fehler verfallen, die staatlichen Betriebe des Ostens mit den Staatsbetrieben des Westens gleichzusetzen. Erstere sind wie ein einziges Unternehmen vom Staat geleitet worden. Die gesamte Wirtschaftspolitik, das gesamte Wirtschaftsrecht sind darauf zugeschnitten gewesen. Die Vorschriften und Weisungen, die die Staaten des Ostens der Wirtschaft gemacht haben, ist Leitungstätigkeit der eigenen Wirtschaft gewesen. Sie sind ihrem Charakter nach „innerbetriebliche Weisungen“ gewesen. Kein „Hineindirigieren“ und keine Kommandowirtschaft.
Letztere unterliegen dagegen den Grundsätzen und den juristischen Gesetzen einer kapitalistischen Wirtschaft. Sie unterscheiden sich von den rein privaten Unternehmen lediglich dadurch, dass der Eigentümer oder einer der Eigentümer der Staat ist. Dass es also nicht allein nur Privatpersonen sind wie die Herren Müller, Meier oder Schulze. Mit den Vorschriften und Weisungen, die die Staaten des Westens der Wirtschaft machen, greifen sie in fremdes Eigentum, in das von Privatleuten, ein. Auch wenn die Vorschriften noch so notwendig sind, wie zum Beispiel solche, die dem Arbeitsschutz dienen, sind sie von ihrem Wesen her ein „Hineindirigieren“.
Weil die gesamte Wirtschaft wie zu einem riesigen Konzern geworden war, ist viel von dem übernommen worden, wie Konzerne funktionieren. Man findet deshalb tatsächlich viel davon, was mit einem Konzern vergleichbar gewesen ist. Selbstverständlich den viel größeren Dimensionen des Staatseigentums angepasst.
Zum Beispiel: In jedem großen Unternehmen müssen die Rechte und Pflichten eines jeden Mitarbeiters, vom einfachen Hofarbeiter bis zum Topmanager, aufeinander abgestimmt, also durch einen Arbeitsvertrag geregelt werden. Jeder, also auch der Topmanager, wird damit formell zu einem „Arbeitnehmer“!
Mit der Konsequenz, dass man solche Arbeitsverträge auch mit jedem abschließen kann. Auch mit solchen, die keine (Mit-)Eigentümer, sondern wirklich und tatsächlich echte „Arbeitnehmer“ sind. Es genügt, wenn sie fähig und willens genug sind, um die ihnen übertragenen Aufgaben zum Nutzen des Unternehmens zu erfüllen. Selbst Manager in der höchsten Position müssen nicht mehr, unbedingt selbst noch Anteile am Unternehmen besitzen.
Sicher sind in den Konzernen viele wichtige Positionen von Leuten besetzt, die selbst große Aktienanteile besitzen. Aber auch sie haben sich an die mit ihnen vereinbarten Rechte und Pflichte zu halten. Nur in den Vollversammlungen können sie grundsätzliche Entscheidungen durchsetzen.
Im Osten ist es genauso gewesen. Da sind alle, die Arbeiter sowieso, aber auch jeder Leiter oder „Chef“ nichts weiter als nur „Arbeitnehmer“ gewesen. Und die grundsätzlichen Entscheidungen sind auch in einer „Vollversammlung“ gefällt worden, in der Volkskammer.
Auch die Art und Weise, wie man solch großen Unternehmen finanzieren kann, ist übernommen worden.
Die benötigen ja immer viel Geld. Mehr, als eine Person üblicherweise aufbringen kann. Die pragmatische Lösung besteht darin, dass mehrere Leute Geld zusammenlegen und eine Gesellschaft gründen. Niederländische Kaufleute haben deshalb 1602 in Amsterdam die erste Aktiengesellschaft der Welt, die „Verenigte Oost-Indische Compagnie“ gegründet. Nicht ohne Grund gibt es heute nur noch ganz wenige große Unternehmen, die sich wirklich noch im Besitz einer einzigen Person befinden. Selbst, wenn es sich um einen Familienbesitz handelt, werden sie ja bereits Eigentum mehrerer und ihrem Wesen nach schon zu Gesellschaften.
Keine heutige Gesellschaft, kein modernes Staatswesen kommt noch ohne Kapitalgesellschaften aus.
Im Osten hat hinter der Wirtschaft doch aber auch nichts anderes gestanden, als nur eine Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft zwar. Nicht nur eine, die lediglich aus einer Anzahl Leuten besteht, die Geld besitzen und die bereit sind, einen Teil davon zur Verfügung zu stellen, sondern der Staat als Ganzes. Aber eben eine Gesellschaft. Der Staat war also nicht nur schlechthin zu einem Konzern geworden, sondern von der Form her auch zu einer Kapitalgesellschaft.
Völlig neu ist dadurch folgendes: Durch dieses staatliche Eigentum ist jeder einzelne Bürger in seiner Eigenschaft als Bürger des Staates automatisch zu einem Miteigentümer am staatlichen Eigentum gemacht worden.
Weil das Wohl jedes Bürgers aber entscheidend davon abhängig gewesen ist, wie gut oder wie schlecht es diesem großen Unternehmen, diesem Staat, gegangen ist, ist jeder in irgendeiner Form zum Nutznießer von dessen Erfolgen oder zum Betroffenen von dessen Problemen geworden. Deshalb hat jeder in seiner Eigenschaft als Bürger daran interessiert sein müssen, dass gute Ergebnisse erzielt und Verluste verhindert worden sind. Objektiv. Unabhängig davon, ob es ihm bewusst geworden war oder nicht. Unabhängig davon, ob er wirklich dementsprechend gehandelt hat oder nicht. Jeder musste sich logischerweise so verhalten oder hätte sich so verhalten müssen wie ein Aktionär. Wie ein echter Aktionär. Diesbezüglich hat es also nicht einmal einen Unterschied zu echten Aktionären gegeben.
Echte Aktien hat allerdings niemand besessen. Selbst die Direktoren, die Minister und die höchsten „Parteichefs” nicht.
Man hat auch keine gebraucht, denn alle sollten im gleichen Maße am Gesamteigentum beteiligt sein. Wo aber alle den gleichen Anteil haben, braucht man keine Aktien auszugeben. Die sind ja nur dort notwendig, wo jemand unterschiedlich viele erwerben kann. Jeder war also vom Wesen her zum Aktionär geworden, allerdings zum „Aktionär ohne Aktien“. Oder zu einem „Aktionär der besonderen Art“.
Ich bekomme immer wieder einmal zu hören, dass im Osten das notwendige Interesse an guten Ergebnissen, das notwendigerweise gute unternehmerische Interesse gefehlt haben müsse, weil niemand Eigentümer gewesen sei und dass demzufolge eine desaströse Interessenlosigkeit bestanden haben müsse.
Weshalb sollte das aber eigentlich so sein?! Es kommt doch nicht darauf an, ob die Menschen ihre Aufträge von der Vollversammlung einer Kapitalgesellschaft bekommen oder von einem Parlament, das die Aufgaben einer Vollversammlung übernommen hat. Entscheidend ist doch, dass beide, sowohl die Vollversammlung einer Kapitalgesellschaft als auch das Parlament eines Staates, der Eigentümer nahezu der gesamten Wirtschaft ist, die Menschen anleiten müssen, die von ihrer Stellung her sowohl hier wie da lediglich „Arbeitnehmer“ sind. Deren Recht und Pflichten also in Arbeitsverträgen vorgeschrieben sind. Die miteinander kooperieren müssen. Von denen also keiner mehr wie ein klassischer Unternehmer etwas, was ihm gemäß Arbeitsvertrag nicht zugestanden worden ist, allein entscheiden darf.
So gesehen hatte der Osten sogar den Vorteil, dass jeder Einzelne einerseits genug Aktionär gewesen ist, um an hohen Ergebnissen interessiert sein zu müssen. Und indem jeder seinen Lebensunterhalt und den seiner Familien grundsätzlich nur durch Arbeit hat verdienen können, hat jeder andererseits an seinem Arbeitsplatz ganz aktiv und fachlich konstruktiv mitarbeiten können. In etwa so, wie es nur noch diejenigen Aktionäre können, die in dem Unternehmen aktiv tätig sind, an dem sie beteiligt sind. Die also dort einen Job haben.
Sicher hat es Leute gegeben, die das noch nicht begriffen hatten, und die sich dementsprechend tatsächlich wenig interessiert gezeigt haben. Es ist aber eine sehr gute Basis dafür gewesen, dass alle wirklich aktiv und schöpferisch haben mitarbeiten können, und es hat viele gegeben, die sich voll engagiert haben. Ich vermute sehr stark, sogar noch mehr als die meisten „Arbeitnehmer“ im Westen. Also mangelndes Interesse an Erfolgen aufgrund der anderen Eigentumsverhältnisse? Das ist eine Verunglimpfung. Mangelndes Interesse durch fehlendes Verständnis, - das ja. Das hat es gegeben. Aber das Gemeinschaftseigentum ist nicht der Grund gewesen.
Dass die anfallende Dividende unter diesen Umständen anders ausgeschüttet werden mussten, ist logisch. Zwar immer im Interesse der Gesellschaft, wie es auch in jeder normalen Aktiengesellschaft üblich ist, und trotzdem anders.
Für Investitionen selbstverständlich.
Leider, leider musste auch viel zu viel für den ruinösen Rüstungswettlauf während des Kalten Krieges ausgegeben werden.
Aber zum erheblichen Teil sind sie als soziale Leistungen ausgeschüttet worden. In Form von Lohnerhöhungen, Renten, Kindergeld und um viele Dinge zu subventionieren, wie die Mieten, die Ausbildung, die medizinische Hilfe, die Kultur und den Sport, die Kindergärten, die Schulhorte, die Schulbücher, die Ferienlager, auch Schuhe und Kleidung für Kinder, die Fahrkarte für die Straßenbahn, die immer nur fünfzehn bis zwanzig Pfennige gekostet hat …
Vielen Leuten ist es ein Rätsel, wieso der Osten trotz seiner wirtschaftlichen Schwierigkeiten seine sozialen Leistungen im damals beachtlichen Umfang noch hat finanzieren können. Die Antwort ist ganz einfach: Der Staat hat damals die Millionen an Dividenden nur anders ausgeschüttet. Und zwar nach dem Grundsatz: Derjenige, der es benötigt, soll es bekommen.
Er hat tatsächlich große Teile des Mehrwertes, den sich anderswo der oder die privaten Eigentümer aneignen dürfen, den arbeitenden Massen nach deren Bedürfnissen zugutekommen lassen.
Weil der Staat die gesamte Wirtschaft besessen hat, und sie deshalb auch lenken und leiten musste, weil er also neben seinen Aufgaben, die er in seiner Rolle als Staat ohnehin zu erfüllen hatte, eine zusätzliche Aufgabe übernommen hatte, hatte sich auch der Charakter des Staates verändert. Er war zu einem neuen Staatstyp, zu einem ganz anderen Staatstyp geworden als es ein bürgerlicher Staat ist. Die Staaten in Ost und West lassen sich deshalb nicht „eins zu eins“ miteinander vergleichen. Und schon gar nicht unter dem Aspekt: ‚Was ein westlicher Staat macht, ist richtig. Was anders gemacht wird, ist falsch!‘ Der Osten hat zwar auch manches von dem übernommen, wie ein bürgerlicher Staat seine Gesellschaft führt, dazu gehört zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch, in angepasster Form selbstverständlich, er konnte aber nur wenig davon gebrauchen, was das Verhältnis eines bürgerlichen Staates zur Wirtschaft des Landes anbetrifft. Diesbezüglich hat er deshalb viel mehr von dem übernommen, wie Konzerne geführt werden als von der Arbeit des Staates.
Was sich im Osten vollzogen hatte, als man die gesamte Wirtschaft zum größtmöglichen Konzern vereint hat, hat philosophisch gesehen zu einem Umschlag von Quantität in eine neue Qualität geführt. Sie wissen doch, dass sich mit zunehmender Menge die Eigenschaften einer Sache ändern. Die Menge macht das Gift, haben die alten Römer schon gewusst. Nach fest kommt locker. Sonne im richtigen Maß ist lebensspendend. Zu viel wirkt katastrophal. Ein Ein-Mann-Unternehmen, ein mittelgroßes Unternehmen, ein Konzern oder gar ein Staat, der wie ein einziger Konzern arbeitet, bringen infolge ihrer unterschiedlichen Größen eben jeweils unterschiedliche Eigenschaften mit sich. Man muss sich also davor hüten, zu schlussfolgern, dass das, was und wie es der eine tut, der andere auch so machen müsste.
Aber, dass man ausgerechnet auf diese Weise das Problem gelöst hat, was „normale“ Konzerne an Nachteilen mit sich bringen, ist doch faszinierend!
Selbstverständlich wird die Leitung eines Unternehmens immer komplizierter, je größer es ist. Und das Ganze hätte nicht funktioniert, wenn nicht die entsprechenden Leitungsstrukturen dafür geschaffen worden wären.
Eine Möglichkeit, wie eine solche Leitungsstruktur hat aussehen können, möchte ich anhand der ehemaligen DDR in groben Zügen beschreiben.
Die verstaatlichten Betriebe sind als „Volkseigene Betriebe“ bezeichnet worden, abgekürzt „VEB“. Sie sind die kleinsten selbständigen Wirtschaftseinheiten gewesen.
Betriebe, die für die gesamte Volkswirtschaft von Bedeutung gewesen sind, wie die der Stahlindustrie, die der Schuhindustrie, die der Zuckerindustrie und so weiter, sind wie schon erwähnt zu jener Art „Industriezweigkonzern“ zusammengeschlossen gewesen. Das ist jeweils eine „Vereinigung Volkseigener Betriebe“ oder kurz „VVB“ gewesen (später sind daraus die sogenannten Kombinate geworden).
Jede VVB ist für alle den Industriezweig betreffenden Aufgaben allein zuständig und verantwortlich gewesen. Für die gesamte Versorgung des Landes, für die Produktentwicklung, für die Ökonomie, für alles. Die VVB hatten im Rahmen der gesamten Wirtschaft vergleichbare Aufgaben, wie sie eine Produktions-Abteilung innerhalb eines Unternehmens hat.
Zu den VVB hat darüber hinaus alles das gehört, was für den Industriezweig wichtig gewesen ist; die Betriebe des fachspezifischen Maschinenbaus, spezielle Reparaturbetriebe, die Forschungseinrichtungen und die Ausbildungsstätten für Facharbeiter und Ingenieure.
Jede VVB ist durch einen Generaldirektor geleitet worden, der die alleinige Verantwortung für alles zu tragen gehabt hat, was in der VVB getan oder nicht getan worden ist. Ihm haben die Direktoren der Fachbereiche der VVB und die Direktoren der VEB, also der Betriebe, direkt unterstanden. Alle wichtigen Entscheidungen des Zweiges hatte er mit ihnen zu beraten und gemeinsam zu erarbeiten.
Die VVB haben jeweils einem von 17 Fachministerium direkt unterstanden. Dieser Teil der Wirtschaft ist als Zentral geleitete Industrie bezeichnet worden.
Banken, Versicherungen, die Justiz, die Feuerwehr, die Polizei und jeder andere Bereich des Staates und des täglichen Lebens und so weiter sind ebenfalls unter eine einheitliche Leitung bis hinauf in ein Ministerium gestellt und nach einheitlichen Prämissen geleitet worden. Sogar die Vereine, die Kulturgruppen wie Chöre und Tanzgruppen, der Sport, die Kleintierzüchter und Kleingärtner und so weiter.
Dadurch hatte sich auch deren Charakter verändert: Die Banken waren dadurch zu so etwas geworden wie zur Finanzabteilung der gesamten Wirtschaft und des Staates. Die Justiz, Polizei, Armee und Feuerwehr zu dem, was in einem normalen Unternehmen der Betriebsschutz ist. Das gesamte Bildungswesen zur Abteilung für die innerbetriebliche Ausbildung. Die gesamte Sportbewegung wie zu einer Betriebssportgemeinschaft. (Damit haben sich übrigens unter anderem völlig neue Möglichkeiten ergeben, die Sportbewegung finanziell zu unterstützen, sie zu sponsern. Das ist einer der Faktoren gewesen, auf denen die damaligen großen sportlichen Erfolge beruht haben.)
Die Betriebe, deren Arbeit für die jeweiligen Territorien eine größere Bedeutung gehabt haben, wie Baubetriebe, Bäckereien, das Reparaturgewerbe und grundsätzlich auch die vielen kleinen Privatbetriebe, sind territorialen Leitungen unterstellt gewesen und von diesen angeleitet worden.
Das ist als „Örtlich geleitete Industrie“ bezeichnet worden.
Die Unterteilung in die Zentral- und in die Örtlich geleitete Industrie ist deshalb erfolgt, damit alles dort entschieden werden konnte, wo das größte Fach- und Sachwissen über die konkreten Gegebenheiten vorgelegen hat, und wo auch das Interesse an schnellen und unkomplizierten Entscheidungen am größten gewesen ist.
In der ehemaligen DDR hat es 15 Bezirke mit je etwa zehn bis zwanzig Kreisgebieten gegeben. Die örtlich geleiteten Betriebe haben den jeweiligen Räten der Kreise unterstanden, diese den Räten der Bezirke und diese dann dem Ministerium für Örtlich geleitete Industrie.
In mancher Hinsicht hat es außerdem noch Doppelunterstellungen unter mehrere Ministerien gegeben.
Den VVB hat beispielsweise die fachliche Ausbildung ihrer Fachleute unterstanden, für das, was jedoch die Lehr- und Lernmethoden und die allgemeinen Fächer anbetroffen hat, ist das Ministerium für Volksbildung verantwortlich gewesen. Die Forschungseinrichtungen der
VVB haben auch dem Ministerium für Forschung und
Entwicklung unterstanden. Das hatte die Aufgabe, alle Forschungsthemen zu koordinieren, Doppel- und Mehrfachentwicklungen zu vermeiden. Es hat unter gesamtvolkswirtschaftlichen Aspekten darüber zu entscheiden gehabt, in welcher Rangfolge die Forschungsthemen zu bearbeiten waren. Konnte, falls notwendig, die gesamte Kraft der Gesellschaft auf die Lösung zentraler Aufgaben konzentrieren. Darin hat übrigens eine der ganz großen Potenzen jenes Systems gelegen.
Die Territorien, und damit letztendlich das Ministerium für Örtlich geleitete Industrie, sind für die Bereitstellung der Arbeitskräfte und der Immobilien für alle im Territorium ansässigen Betriebe und staatlichen Institutionen zuständig gewesen, für die fachlichen Entscheidungen solcher Institutionen, wie der Volksbildung, der Justiz, des Gesundheitswesens sind es aber die entsprechenden Ministerien und für die Betriebe der Zentralgeleiteten Industrie die entsprechenden VVB und deren Ministerien gewesen.
Jedes der Ministerien ist durch einen Minister geleitet worden. Ebenso in alleiniger Verantwortung. Ihm haben seine Stellvertreter, die Abteilungsleiter des Ministeriums und die Generaldirektoren der VVB unterstanden. Dem Minister für Örtlich geleitete Industrie außer seinen Stellvertretern, und den Abteilungsleitern seines Ministeriums die Vorsitzenden der Räte der Bezirke. Jeder Minister mussten diese Leute genauso in ihre wichtigen Entscheidungen einbeziehen, wie ein Generaldirektor einer VVB die seinen.
Die Aufgaben aller Arbeitsbereiche der Ministerien, aller Arbeitsbereiche der VVB, die aller Betriebe und aller Institutionen waren so aufeinander abgestimmt, dass sie leicht miteinander kommunizieren konnten, dass sie gewissermaßen kompatibel gewesen sind.
Die Ministerien hatten, falls erforderlich, an der Lösung jedes Problems ganz konkret und wirklich mitzuarbeiten.
Sie waren also zu echten Arbeitsorganen gemacht worden, die sich dank der erwähnten Kompatibilität Einblicke bis in die kleinsten fachlichen Details auch des kleinsten Betriebes haben verschaffen können.
Das Wort Ministerium ist zwar noch benutzt worden. Das, was sich dahinter verborgen hat, war also mit einem heutigen, dessen Tätigkeit ja mehr oder weniger nur darauf beschränkt ist, nur allgemeine Rahmenbedingungen zu schaffen, aber nicht mehr vergleichbar.
Selbst die Ministerien sind noch nicht die letzte Leitungsebene gewesen.
Es hat noch den Ministerrat gegeben. Er ist zuständig gewesen für die Entscheidungen, die über die Bereiche der einzelnen Ministerien hinausgegangen sind. Jeder Minister hat ihm angehört und die Leitung hat der Vorsitzende des Ministerrates innegehabt.
Der Ministerrat ist das höchste operativ wirkende wirtschaftsleitende Organ des gesamten Staates gewesen. Ihm ist die Staatliche Plankommission als Arbeitsorgan beigeordnet gewesen.
In ihr sind alle Daten des gesamten Landes erfasst und ausgewertet worden. Die Meldungen über Produktion, über Transport, über den Stand von Forschung und Entwicklung, über die Versorgungslage und so weiter und so fort. Sie hat daraus Vorschläge für die Weiterentwicklung der Wirtschaft, des Wohnungsbaus, der Infrastruktur, der Bildungs- und Kulturpolitik, des Sozial- und Gesundheitswesens und dergleichen für den gesamten Staat erarbeitet.
Das allerhöchste Gremium für alle Entscheidungen ist aber die Volkskammer gewesen. Also das Parlament. Auch etwas völlig Neues: Ein Parlament als oberstes, wirtschaftsleitendes Organ. Ein Parlament, das nicht nur für die staatlichen Aufgaben zuständig gewesen ist.
Als ich das niedergeschrieben habe, ist mir wieder bewusst geworden, wie gut diese Strukturen doch durchdacht, wie gut alle Kompetenzen mit- und aufeinander abgestimmt gewesen waren. Ohne damit behaupten zu wollen, dass das die einzig richtige und ideale Lösung gewesen sei und, dass es nicht auch anders funktionieren könne. Funktioniert hat es aber allemal.
Indem aber der Staat mit einer Kapitalgesellschaft und die Bürger mit Aktionären gleichzusetzen gewesen sind, haben die wichtigsten Teile bestanden, die zu einer Aktiengesellschaft gehören: Eine richtige Aktiengesellschaft hat Aktionäre, eine Vollversammlung, einen Vorstand und einen Aufsichtsrat.
Die DDR hatte „Aktionäre der besonderen Art“, die Volkskammer, die sich von einer normalen Vollversammlung eigentlich nur dadurch unterschieden hat, dass die Millionen von „Aktionäre der besonderen Art“ dort nicht alle auftreten konnten, sondern durch gewählte Obmänner, durch Abgeordnete vertreten worden sind. Dann hat es den Ministerrat gegeben als operativ wirkendes Leitungsorgan.
Fehlt nur noch der Aufsichtsrat. Als solchen kann man aber die Partei ansehen. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz die SED. Sie hat in allen wichtigen Entscheidungen das letzte Wort gehabt. Ohne ihre Zustimmung oder ihre Duldung ist nichts gelaufen. Insofern hat sie in gewisser Weise die Rolle eines Aufsichtsrates gespielt.
Inwieweit die Institutionen in beiden Systemen genau die gleichen Aufgaben zu erfüllen gehabt haben oder nicht, ist nicht so wichtig. In beiden Fällen sind aber die gleichen Aufgaben angefallen und in beiden Fällen hat es die entsprechenden und sogar ähnliche Arbeitsgremien gegeben.
Weil diese „Aktiengesellschaft“ im Osten aber so groß und so heterogen gewesen ist, wie es umfassender und größer nicht mehr geht, bezeichne ich sie als „Superaktiengesellschaft“. Diesen Begriff hat es zwar nie gegeben. Jedenfalls, nicht, dass ich wüsste.
Wenn Sie, liebe/r Leser/in, sich diesen Begriff ebenfalls zu eigen machen, werden Sie leichter verstehen können, wie der Osten „funktioniert“ hat.
Deshalb werde ich den Begriff hin und wieder benutzen.
2. Geld, Gewinn, Preis
und die Rüstung in der „Superaktiengesellschaft“
Geld ist doch Geld! Oder? Kaum vorstellbar, dass auch solche Begriffe wie Geld, Gewinn und Preis nicht mehr in jeder Hinsicht so gewirkt haben sollen wie vorher. Und doch ist es so. Selbst das, was die Rüstung betrifft, hatte sich verändert.
Beginnen wir mit dem Geld! Weil und nachdem im Osten die Produktionsmittel vergesellschaftet worden waren, hat der Staat dann auch nicht mehr zugelassen, dass wieder größeres privates Eigentum entstehen konnte. Unabhängig davon, ob man die Verstaatlichung nun für gut und rechtens hält oder nicht, ist das eigentlich logisch. Der Staat hat also keiner Privatperson mehr gestattet, im größeren Maße investieren zu dürfen. Das alleinige Recht hat er sich als „Superaktiengesellschaft“ vorbehalten. Die Folge: Niemand mehr hat mehr „viel“ Geld gebraucht.
Wenn mir damals zum Beispiel jemand fünfzig Millionen hätte schenken wollen, hätte ich nicht gewusst, was ich damit hätte anfangen sollen. Wenn mir heute fünfhundert Millionen angeboten würden, würde ich fragen, ob es nicht noch etwas mehr sein könne.
Weil dem so gewesen ist, haben die allermeisten Ostdeutschen, zumindest kurz nach der Wende, oft etwas ganz anderes darunter verstanden als Westdeutsche, wenn über „viel Geld“ gesprochen worden ist. Letztere haben schon immer schnell hunderte von Millionen gemeint. Milliardäre sind ja dort immer schon das Maß der Dinge gewesen. Wer im Osten dagegen nur einige hunderttausend oder gar ein paar Millionen besessen hat, hat dort schon zu den reichen Leuten gezählt. Aus Sicht des Westens ist er immer noch ein armer Schlucker gewesen.
Weil aber niemand mehr privat hat investieren können, zumindest nicht mehr in erheblichen Größenordnungen, hat niemand mehr viele andere Menschen für sich arbeiten lassen können. Das Geld hat also nicht mehr als Kapital fungieren, hat nicht mehr zu „Geld heckendem Geld“ werden können, wie Marx es bezeichnet hat.
Dadurch haben keine reichen und superreichen Leute mehr entstehen können, die als Finanzoligarchie ihre Interessen mit ihrem Geld durchsetzen können.
Damit hatte das Geld auch aufgehört, Maß aller Dinge zu sein. Das Motto: „Hast du was, dann bist du was, hast du nichts, dann bist du nichts“, hat nicht mehr gegolten. Es hatte aufgehört, der Hauptgrund dafür zu sein, dass beim Geld die Freundschaft aufhört und die Ellbogengesellschaft beginnt.
Die hauptsächlichen Funktionen des Geldes waren darauf beschränkt, Gewinne oder Verluste und Preise beziffern, und planen und kalkulieren zu können. Also als Maßstab, als Messlatte der Leistungen zu dienen.
Geld hat selbstverständlich jeder Einzelne noch gebraucht, um seine täglichen Ausgaben bestreiten zu können. Ganz natürlich und selbstverständlich ist dabei, dass die Menschen immer besser leben und ihren Kindern immer mehr zukommen lassen wollen, und dass deshalb grundsätzlich jeder daran interessiert ist, mehr Geld zu bekommen.
Es ist eine der hervorragendsten Eigenschaften des Menschen, dass er sich nie mit dem erreichten Zustand zufriedengibt, sondern immer danach strebt, besser zu leben, sich das Leben zu erleichtern, es schöner zu gestalten. Auch immer mehr haben zu wollen. Darin liegen doch die Anreize, denen die Menschheit all ihre Fortschritte verdankt.
Aber im Osten hat sich jeder seinen Lebensunterhalt nur durch seine eigene Arbeit verdienen können. Die Beträge, um die es sich dabei aber gehandelt hat, bewegen sich, abgesehen von Ausnahmen wie bei großen Erfindern oder Künstlern, in sehr überschaubaren Größen. Es sind Peanuts im Vergleich zu den Summen, um die es für die Finanzoligarchie geht.
Überall gibt es Habgierige, Maß- und Rücksichtslose. Indem aber niemand mehr großes Eigentum an Produktionsmitteln hat erwerben können, hatte die Gesellschaft diesem Streben sehr enge Grenzen gesetzt. Und damit auch der „Ellbogengesellschaft“!
Kurz: Dem Geld sind seine folgenschwersten und fatalsten Eigenschaften genommen gewesen. Das sind die wohl größten Veränderungen des Geldes, was sein Wesen anbetrifft, gewesen.
Und Gewinn und Preise?!
Die haben gewissermaßen zwei Gesichter. Einmal, wenn sie innerhalb eines Unternehmens, beziehungsweise eines Konzerns wirken und zum anderen, „auf dem Markt“, also in den Beziehungen zwischen den Unternehmen.
Auf dem Markt wird um Preise gehandelt und gefeilscht. Ziel eines jeden Verkäufers ist, einen möglichst hohen Preis zu erzielen, also möglichst hoch über Wert zu verkaufen, Ziel jedes Käufers ist es, möglichst billig einzukaufen, also möglichst weit unter Wert. Weil dabei der eine aber immer nur das und nur so viel gewinnen kann, wie der andere verliert, entsteht dadurch gesamtvolkswirtschaftlich gesehen keinerlei Zuwachs. Es kommt volkswirtschaftlich gesehen einem „Von-der-einen-Hosentasche-in-die-andere-stecken“ gleich. Und wenn es gar um gegenseitigen Betrug geht, dann entsteht nicht nur kein Zuwachs, sondern in der Regel sogar noch zusätzlicher Aufwand, wenn der Betrogene die gekauften Waren zum Beispiel nachbessern muss.
Durch kaufmännisches Geschick oder gar durch Betrug erzielte Extragewinne sind also keine echten Gewinne.
Handeln und Feilschen um Preise sind in der „freien Marktwirtschaft“ allerdings der dominierende Mechanismus, über den sich die Relationen zwischen den Zweigen einpendeln. Ist zu wenig Ware da, steigen die Preise und damit der Gewinn und zusätzliche Produktionskapazitäten werden aktiviert, ist das Angebot zu groß, sinken die Preise, die Gewinne fallen und die Produktion wird eingeschränkt. Der Nachteil besteht dabei allerdings darin, dass die Korrekturen grundsätzlich erst im Nachhinein erfolgen können, also erst dann, wenn etwas bereits geplant oder gar schon produziert worden ist, und es sich dann erst herausstellt, dass gar kein Bedarf, besser formuliert: kein zahlungsfähiger Bedarf, besteht. Dass dadurch also in der Regel Verluste entstehen.
Innerhalb eines Unternehmens oder eines Konzerns sieht das dagegen ganz anders aus. Wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will, dann muss es seine Produkte nicht nur technisch hochentwickeln, sondern muss produktiv und effizient produzieren. Und dazu gehört insbesondere, dass jede Produktionsabteilung ihr benötigtes Material zum richtigen Termin, in der exakt notwendigen Menge und in der richtigen Qualität erhält.
Das heißt, dass die materielle Seite der Produktion, dass der Materialfluss innerhalb der Unternehmen also wichtiger ist, als die finanzielle. Dass ihr die Priorität gehört.
Ich habe einen Fernsehfilm gesehen, der einen Einblick in den Produktionsablauf bei Mercedes im Lastkraftwagenwerk in Wörth gewährt. Dort wird das alles per Exzellenz praktiziert. Dort werden nicht nur rund 400 LKW pro Tag produziert. Je nach Kundenwusch hintereinander sogar mit unterschiedlichen Motorenstärken, unterschiedlichen Ladekapazitäten, unterschiedlichen Farben, unterschiedlich ausgestatteten Fahrerhäusern und so weiter, also in ständig wechselnder Reihenfolge auf ein und demselben Band! Dort ist auch der Ablauf des gesamten Produktionsprozesses so exakt konzipiert, dass jeder Arbeiter jedes Teil, das er gerade benötigt, rechtzeitig zur Hand hat, ohne dass auch nur ein einziges fehlt, aber auch ohne, dass ein einziges Teil zu viel bereitgestellt wird. Ein Überwachungssystem sorgt dafür, dass jede Schraube an der richtigen Stelle und fest genug eingeschraubt wird. Die Qualitätsüberwachung stellt jeden kleinen Mangel sofort fest und weist die Fehlerquelle aus, sodass binnen kürzester Zeit wieder die richtige Qualität geliefert wird.
Das ist Stand von Technik und Logistik auf ganz, ganz hohem Niveau, wie ihn sich nur große Konzerne leisten können. Selbstverständlich erreichen nicht alle Unternehmen das Niveau von Mercedes, aber trotzdem strebt jedes an, dass alles so gut und so perfekt wie möglich funktioniert. Die innerbetrieblichen Prozesse sind grundsätzlich alle sehr gut und hoch organisiert. Geld, Gewinn und Preise spielen dabei eine viel kleinere Rolle als auf dem Markt
Denn, sobald sich die Bereiche beziehungsweise die Tochterunternehmen gegenseitig übervorteilen würden, könnte der eine nur das gewinnen, was der andere verlöre. Was der eine als Gewinn ausweisen könnte, würden den anderen belasten. Es bliebe ohne positive Auswirkung auf das Gesamtergebnis des Unternehmens. Im Gegenteil, zusätzliche, unnötige Kosten könnten entstehen. Es geschähe das gleiche, was auf die Volkswirtschaft zutrifft, wenn sich Unternehmen gegenseitig übervorteilen. Das hat der innerbetriebliche Ablauf in einem Unternehmen einer in selbstständige Unternehmen zersplitterten Volkswirtschaft voraus.
Weil jede Geschäftsleitung auch weiß, wie viel sie produzieren will, kann sie errechnen, wie groß die Kapazität jedes einzelnen Bereiches sein muss, wie viele Arbeitskräfte und Maschinen benötigt werden, wie viel Material und so weiter. Bevor die Produktion überhaupt beginnt, kann sie also alles schon konzipieren. Planen. Auch dazu braucht kein Unternehmen die Preise und deren selbstregulierende Wirkung mehr.
Dass die Preise innerhalb der Unternehmen eine untergeordnete Rolle spielen können, zeigt sich beispielsweise auch daran, dass eine Geschäftsleitung die Preise zwischen den Bereichen festlegen kann. Sogar unabhängig vom wirklichen Wert des Produktes oder der erbrachten Leistung. Das Gesamtergebnis des Konzerns bleibt trotzdem das gleiche. Ein Konzern kann auf diese Weise zum Beispiel Gewinne zwischen seinen Tochterunternehmen umverteilen. Und das wird aus steuerlichen Gründen auch gemacht. Geld und Preise werden also nur noch benötigt, um die Ergebnisse der Bereiche planen, messen und abrechnen zu können.
In den Unternehmen wird grundsätzlich so gearbeitet, wie man es sich für die gesamte Wirtschaft wünschen könnte. Sie sind gewissermaßen so etwas, wie ein Mikrokosmos dessen, was im Großen erstrebenswert wäre. Es steht im krassen Gegensatz zum „Selbstlauf“ auf dem Markt, wo sich sogar innerhalb eines Landes, vom internationalen Markt ganz zu schweigen, Unternehmen betriebsegoistischer Ziele wegen um Preise streiten und sich im mitunter gnadenlosen Konkurrenzkampf bekämpfen und schädigen.
Und nun stellen Sie sich die Staaten im ehemaligen Osten als das vor, was sie de facto waren: als riesige Konzerne. Als „Superaktiengesellschaften“.
Sie sind genauso wie jeder normale Konzern gezwungen gewesen, die Produktion so effektiv wie möglich zu leiten, genauso vernünftig, so pragmatisch. Sie mussten genauso daran interessiert sein, dass moderne Produktionsmethoden genutzt worden sind, dass genauso sparsam mit Material umgegangen worden ist und dass jeder Bereich sein Material genauso zum richtigen Termin, vor allem aber auch in der richtigen Menge und in der richtigen Qualität bekommen hat. Und, was das Wichtigste dabei ist, sie hatten als Eigentümer der gesamten Wirtschaft die Voraussetzungen, ohne Ausnahme jeden Betrieb mit einzubeziehen!
Damit die Qualität gewährleistet worden ist, waren in der ehemaligen DDR für jedes Produkt verbindliche Gütevorschriften, die sogenannten TGL, erarbeitet worden. Ähnlich streng und penibel wie die bei Mercedes oder die der heutigen Bundeswehr. Die zuständigen Überwachungsorgane sind Bestandteil der „Superaktiengesellschaft“ gewesen. Sie haben „das“ innerbetriebliche Kontrollsystem gebildet. Sie sind in ihrer Eigenschaft als Teil der „Superaktiengesellschaft“ dadurch finanziell unabhängig gewesen von denen, die sie kontrollieren sollten und haben Einblick in alle relevanten Unterlagen und jede Zuarbeit von jedem einzelnen Werktätigen verlangen können. Sie waren ja keine betriebsfremde von „außen“ kommende Institution.
Alles Dinge, die ihre Position als Überwachungsorgane ganz erheblich gestärkt haben.
Damit will ich wiederum keineswegs gesagt haben, dass es damals nicht auch Qualitätsprobleme gegeben habe. Aus Materialmangel oder auch aus Dummheit oder aus Schluderei - ja! Aber nie aus Profitgier. Ohne etwas entschuldigen zu wollen: Es ist aber eben doch ein Unterschied, ob etwas nur aus Mangel oder nur fahrlässig vorkommt, oder ob jemand vorsätzlich im großen Stil Wein panscht, gesundheitsschädigende Präparate einsetzt oder gar verdorbenes Fleisch vermarktet, nur um sich zu bereichern oder vielleicht auch nur um Verluste oder gar einen drohenden Konkurs abzuwenden.
Und vom Staat erlaubte Manipulationen? …Wenn er zum Beispiel einem seiner Betriebe am Oberlauf eines Flusses erlaubt hat, dessen Gewinnes wegen Wasser zu verschmutzen, dann haben seine Betriebe am Unterlauf erhöhte Kosten für die Aufbereitung tragen müssen. Das ganze Land ist doch sein „Betriebsgelände“ gewesen. Wenn er seiner Landwirtschaft erlaubt hätte, die Tiere mit schädlichen Wachstumshormonen und mit Antibiotika vollzupumpen, dann hätte er dadurch eben ganz automatisch entsprechend mehr Kosten für die Behandlung der erkrankten Menschen und für Arbeitszeitausfällen zu tragen gehabt. Er hat sich so etwas also reiflich überlegen müssen.
Wenn also bestimmte Missstände zum Beispiel in Bezug auf die Umwelt trotzdem zugelassen worden sind, liegt das daran, dass der Staat technisch, finanziell oder materiell zu diesem Zeitpunkt noch(!) nicht in der Lage gewesen ist, das Problem zu lösen, und dass er sie zugelassen hat, weil sie das kleinere Übel im Verhältnis zu anderen gewesen sind. An ihrer Lösung musste er aber allemal interessiert sein! Er hat ja, und das sehe ich als weiteren Vorteil an, nicht nur einseitig profitieren können, ihn haben ja auch alle negativen Folgen in voller Höhe getroffen.
Niemand hat Qualitätsmanipulationen in betrügerischer Absicht oder gar den bewussten Einbau von Schwachstellen in technische Geräte befürchten müssen. Im Gegenteil: Jeder konnte darauf vertrauen, dass eine Langlebigkeit aller Produkte angestrebt worden ist.
Viele Ostdeutsche werden bestätigen können, dass damals modisch manches zwar nicht aktuell, dass aber alles grundsätzlich haltbarer gewesen ist, als heute. Ja, dass manches Produkt von damals heute noch in Gebrauch ist. Der „Wegwerfgesellschaft“, die von den Unternehmen inszeniert wird, um ihren Absatz zu erhöhen, war jedenfalls die Basis entzogen gewesen.
Das ist dann eben so, allerdings nur dann so, wenn ein Staat wie ein einziges Unternehmen arbeitet, und wenn er dadurch zwar alle Gewinne vereinnahmen kann, andererseits aber auch allein alle Verluste übernehmen muss. Nur eine Gesellschaft, die Wirtschaft und Staat wie eine „Superaktiengesellschaft“ führt, hat die Voraussetzungen, alle Auswirkungen aller Bereiche gegeneinander aufrechnen und jene Variante verfolgen zu können, die unter Berücksichtigung aller Umstände für die gesamte Gesellschaft am besten geeignet ist!
Das macht ihre Überlegenheit gegenüber jeder anderen Gesellschaftsordnung aus!
Was die Preise anbetrifft, so hat der Osten auch die Möglichkeit genutzt, die jeder Konzern hat: Er hat die Preise festgelegt. Und zwar in seinem gesamten Unternehmen. Das heißt: für das gesamte Land und bis hin zu den Endverbraucherpreisen. Erarbeitet worden sind sie durch Fachleute aller betroffenen Bereiche der Industrie und des Handels.
Durch die Preisbildung ist alles das subventioniert worden, was in allgemeinem Interesse gelegen hat. Wie, wie im vorangegangenen Artikel beschrieben, Brot, das Bildungswesen, Mieten, Eintrittskarten für Theater, Konzerte und Museen, die Fahrpreise für die öffentlichen Verkehrsmittel und vieles mehr. Oder sie sind bewusst hoch angesetzt worden, um den Verbrauch einzuschränken, wie für Alkohol und Tabak. Und sie sind für längere Zeit gültig gewesen.
Weil die sogenannten Endverbraucherpreise, oder kurz EVP, grundsätzlich aber schon in der Produktion auf jedes Produkt haben aufgedruckt werden müssen, haben die Menschen nirgends befürchten müssen, preislich betrogen zu werden.
Sehr effizient ist gewesen, dass in allen Bereichen die gleichen Vertragsbedingungen angewendet worden sind. Also einheitliche Liefer- und Zahlungsbedingungen, die gleichen Bestellfristen, Garantien, der Zwang, Lieferverträge abzuschließen, Vertragsstrafen und so weiter. Nur dort, wo es tatsächlich zweckmäßig oder gar erforderlich gewesen ist, hat es Sonderregelungen gegeben.
Alles das ist im sogenannten Wirtschaftsgesetz verankert gewesen.
Das Wirtschaftsgesetz ist für die gesamte Wirtschaft und den gesamten Staatsapparat gewissermaßen das gewesen, was man unter „Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen“ eines Unternehmens versteht. Ein dünnes Gesetzbüchlein. Übersichtlich, einfach und für alle bindend. Und nur ein einziges! Keine tausende von Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit ihren vielen Fallstricken im Kleingedrucktem.
Das ökonomische Interesse der Betriebe am Gewinn ist trotzdem geweckt worden, indem sie Prämien erhalten haben, wenn sie mehr als jenen Gewinn erbracht haben, der in jedem Preis einkalkuliert gewesen war, und wodurch sie zur ordentlichen Arbeit gezwungen worden sind. Aber überbieten konnten sie ihn nur durch echte Gewinne! Also nur durch Überbietung der geforderten Leistungen und/oder durch Unterschreitung der kalkulierten Kosten. Keinesfalls durch gegenseitige Übervorteilung oder gar durch Betrug. Selbst Vertragsstrafen, sind nicht zum normalen Gewinn gezählt und deshalb auch nicht auf die Erfüllung des Gewinnplanes angerechnet worden.
Was die Herstellung der notwendigen Relationen zwischen den einzelnen Industriezweigen anbetrifft, so hat der Staat damals genau wie jedes Unternehmen errechnen können, wie groß die Kapazität jedes einzelnen Bereiches, in seinem Fall jeder Industriezweig, sein musste, wie viele Arbeitskräfte und Maschinen benötigt worden sind, wie viel Material und so weiter. Er hat also genauso planen können, wie es jeder Betrieb, jedes Unternehmen kann.
Aufgrund dessen, dass im Osten ein einziges einheitliches Eigentum bestanden hat, hat er also jene positiven Wirkungsweisen landauf, landab übernehmen können, die die Kategorien Geld, Gewinn und Preis innerhalb der Unternehmen beziehungsweise innerhalb von Konzernen hervorbringen, während er das, was ihnen auf dem Markt eigen ist, nicht hat übernehmen müssen und auch nicht übernommen hat.
Erst wenn die Produkte ins Ausland verkauft worden sind, ist wieder um Preise gerungen worden. Erst dann haben Geld, Preise und Gewinn, hat die finanzielle Seite wieder Bedeutung gehabt. Vorher nicht.
Darin liegt einer der ganz großen Vorzüge einer als einheitliches Eigentum geführten Wirtschaft gegenüber einer in zigtausende Einzelunternehmen zersplitterten.
Im Zusammenhang mit Preis und Gewinn ist das Verhältnis von Staat zur Rüstungsindustrie noch besonders interessant.
Immer und überall in der Welt muss der Staat, muss die jeweilige gesamte Gesellschaft die Kosten für Rüstung und Krieg tragen. In der kapitalistischen Gesellschaft befindet sich die Rüstungsindustrie aber grundsätzlich in Privatbesitz. Und dabei geschieht doch folgendes: In den Preis für die Waffen kalkuliert jeder Waffenhersteller die Kosten und einen Gewinn ein. Der Staat, also letzten Endes der Steuerzahler, zahlt diesen Preis. Sowohl die angefallenen Kosten, als auch den Gewinn. Also beides. Indem die Rüstungsindustrie aber diesen Gewinn einheimst, bringt sie das Zauberkunststück fertig, dass sie nicht nur trotz der, sondern sogar gerade aus den Belastungen, die die Gesellschaft zu tragen hat, ihren Profit schlägt.
Ja, dass sie sogar umso mehr verdient, je mehr die Völker sowohl finanziell als auch im wahrsten Sinne des Wortes „bluten“. Deshalb ist sie immer daran interessiert, dass ihr Land viel Geld und immer mehr Geld für die Rüstung ausgibt. Die Lobby des Militärindustriellen Komplexes schleust deshalb die entsprechenden Hardliner zum Beispiel durch finanzielle Wahlhilfen in die entsprechenden Funktionen des Staates ein, stellt andere, ihr hinderliche Leute, durch gezielte Maßnahmen kalt und sorgt dafür, dass es immer irgendwo Konfliktherde gibt, dass sich die
Menschen immer irgendwie und von irgendwoher bedroht fühlen und dass möglichst immer irgendwo sogar Kriege geführt werden.
Sicher beteiligt sich der Staat mithilfe der Steuern am Gewinn. Holt einen Teil zurück. Aber das ist doch nur ein Teil dessen, was er vorher selbst bezahlt hat. Und wenn Waffen exportiert werden, verdient im exportierenden Land die Privatindustrie und auch der Staat ist über Steuern daran beteiligt, allerdings aber immer auf Kosten eines anderem, dem Käufer-Staat. Also auch auf Kosten der menschlichen Gesellschaft insgesamt.
Wenn der Staat aber auch Eigentümer der Waffenindustrie ist (und er wie jeder Eigentümer von allen positiven wie negativen Vorgängen betroffen wird, die sich innerhalb seines Eigentums abspielen), dann kann er die Waffen in seinen eigenen (!) Betrieben produzieren. Jede Waffe, die er für die Aufrüstung seiner (!) eigenen Armee verwendet, bekommt er dadurch zwar billiger als ein westlicher Staat. Nämlich ohne jenen Teil, den sich die private Industrie als Gewinn aneignet, trotzdem muss er aber immer noch das Geld in Höhe der Selbstkosten, also ein Mehrfaches des eingesparten Gewinnes, zahlen und gewissermaßen dem Fenster hinauswerfen. Gewinn könnte er selbstverständlich einplanen. In jeder Höhe sogar. Aber abgesehen davon, dass er als Eigentümer dann sowieso Anspruch auf diesen Gewinn hat und der an ihn abgeführt werden muss, hätte er den dann beim Waffenkauf immer erst selbst einmal mitbezahlen müssen. Ein Gewinnmachen durch Aufrüstung seiner Armeen wäre für ihn lediglich so gewesen, als würde er Geld aus der einen Westentasche in die andere stecken. Ein Sichreich-Rechnen.
Deshalb ist im Osten zum ersten Mal in der Geschichte einer der größten Anreize für die Aufrüstung der eigenen Streitkräfte und für Krieg beseitigt gewesen: nämlich das Profitstreben.
Zum ersten Mal hat ein Staat nicht nur ein Interesse daran, sondern auch die realen Voraussetzungen dafür gehabt, die Ausgaben für die Rüstung so niedrig wie möglich halten zu können.
Dazu kommt noch: In einem Krieg wäre außerdem fast nur oder hauptsächlich sein Eigentum geschädigt worden. Fabriken, Brücken, Straßen, Schulen und so weiter. Nicht oder nur im geringen Maße das Eigentum irgendeines Herrn Müller, Meier oder Schulze. Und für alles hätte er, der Staat, dann zahlen müssen, zwar auch nur die Materialkosten, aber auch das wäre immer noch sehr viel gewesen. Auch an der Beseitigung solcher Schäden hätte, wenn man von den wenigen kleinen Privatbetrieben absieht, keine Privatperson verdienen können. Ganz im Gegensatz zum westlichen System. Auch deshalb hat er also auch daran interessiert sein müssen, dass es überhaupt nicht erst zu einem Krieg kommt.
Das gehört zu den ganz, ganz großen Vorzügen des damaligen Systems! Auch, wenn das oft anders dargestellt wird.
Lediglich bei Waffenexporten kommt ein solcher Staat in den Genuss des Gewinnes. Aber, wie gesagt: Zulasten anderer Länder. Etwa 1,7 Billionen Dollar werden jährlich in der Welt für Rüstung ausgegeben. Sinnlos. Schlimmer noch: Waffen dienen doch keinesfalls dazu, Leben zu erhalten oder Werte zu schaffen. Sie werden ja sogar dafür gebaut, um Leben und Werte zu vernichten.