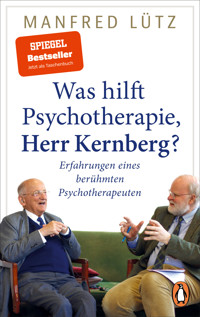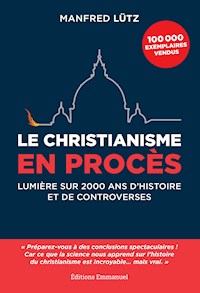3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die fesselnde Autobiografie eines NS-Widerständlers, entdeckt und herausgegeben von Bestsellerautor Manfred Lütz
Manfred Lütz hat die zeitgeschichtlich bedeutsame Autobiografie seines Großonkels entdeckt und herausgegeben. Als Mitglied des Kreisauer Kreises fühlt sich Paulus van Husen von seinem Gewissen aufgerufen, Widerstand gegen die NS-Diktatur zu leisten, auch unter Einsatz des Lebens. In seinen Erinnerungen schildert Paulus von Husen, wie ihn der Erste Weltkrieg aus seinem wohlgeordneten Leben wirft, wie er in die internationale Politik und nach 1933 in Konflikt mit den Nazis gerät. Er erzählt, wie er Claus Schenk Graf von Stauffenberg begegnet, nach dem missglückten Attentat auf Adolf Hitler verhaftet wird und die Gestapo-Verhöre und das KZ mit Glück und Geschick überlebt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird Paulus von Husen schließlich der erste Verfassungsgerichtspräsident Nordrhein-Westfalens, seine fesselnde Lebensgeschichte liest sich wie ein Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dr. med. Dipl. theol. Manfred Lütz ist Psychiater, Psychotherapeut, Kabarettist und Theologe. Geboren 1954 in Bonn studierte er Medizin, Philosophie und katholische Theologie in Bonn und Rom. Von 1997 bis 2019 war er Chefarzt des Alexianer-Krankenhauses in Köln. 2003 gründete er das Alexianer-Therapie-Forum mit renommieren internationalen Referenten, das er weiterhin organisiert. Bekannt wurde Lütz als Autor zahlreicher Bestseller. Er ist gern gesehener Gast von Talkshows und nimmt in Kolumnen und Artikeln immer wieder zu aktuellen Themen Stellung. Außerdem ist er ein gefragter Vortragsredner und tritt mitunter auch im Kabarett auf.
Paulus van Husen (1891–1971) entstammte einer westfälischen katholischen Arztfamilie und war nach Jurastudium und Teilnahme am Ersten Weltkrieg im Leutnantsrang ab 1920 in der politischen Verwaltung Schlesiens tätig, wo er zu einem führenden Zentrumspolitiker aufstieg. Ab 1934 beim Oberverwaltungsgericht in Berlin tätig, wurde er wegen seiner Ablehnung eines NSDAP-Eintritts nicht befördert. Ab 1940 war er Rittmeister beim Wehrmachtsführungsstab und pflegte Kontakte zum Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von Moltke und Peter Graf Yorck von Wartenburg. Für den Fall eines gelungenen Umsturzes als Innenstaatssekretär vorgesehen, wurde er nach dem 20. Juli 1944 festgenommen, dann im April 1945 von der Roten Armee aus dem Strafgefängnis Plötzensee befreit. Van Husen gehörte zu den Mitbegründern der CDU in Berlin und war von 1949 bis 1959 Präsident des Oberverwaltungsgerichts und des Verfassungsgerichtshofs von Nordrhein-Westfalen.
Manfred Lütz | Paulus van Husen
Als der Wagen nicht kam
Eine wahre Geschichte aus dem Widerstand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieser Titel erschien erstmals 2019 im Herder Verlag, Freiburg im Breisgau.
Alle Abbildungen im Innenteil: © Manfred Lütz
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: © Prisma by Dukas / Universal Images Group via Getty Images
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31228-2V001
www.penguin-verlag.de
Inhalt
Mein Großonkel Paulus van Husen
Als der Wagen nicht kam
I. Das pralle Leben
1. Eine herrliche Kindheit in der »guten alten Zeit« – Kriegsspiele, der Kaiser in Münster, Absurditäten am Badestrand
2. Die große weite Welt: Oxford, London, Genf – ein abenteuerliches Studentenleben
3. Die Ruhe vor dem Sturm – ein Traumjob, ein Traumregiment, eine Traumhochzeit
4. Das Ende aller Träume: Krieg – mit Glück durch das Grauen und am Ende noch ein echtes Husarenstück
II. Plötzlich mitten in der großen Politik
1. Wie man eine Republik verteidigt – mit Mut und Geschick gegen revolutionäre Westfalen
2. Auf in die nächste Krise – an entscheidender Stelle inmitten internationaler Verwicklungen in Oberschlesien
3. Eine Traumkarriere – als Generalbevollmächtigter des Prinzen Hohenlohe mit eigenem Schloss, Chauffeur und reichlich Personal
4. Auf internationalem Parkett – deutsches Mitglied der Gemischten Kommission
III. Das braune Verhängnis nimmt seinen Lauf
1. »Aber das sind doch Verrückte« – Göring süß und sauer, »Unsere Liebe Frau vom Hakenkreuz« und eine braune Operettenfigur
2. Auf Konfrontationskurs – riskante Maßnahmen gegen die Judenverfolgung und eine Kampfansage auf Leben und Tod
3. »Dem Löwen auf den Schwanz treten« – als Preußischer Oberrichter in immer brauneren Zeiten
4. Tagtägliche Gefahr – Leben in der braunen Diktatur
IV. Im Auge des Orkans
1. Plötzlich im Zentrum der Macht, dem Oberkommando der Wehrmacht – auf eine Zigarette mit Keitel
2. Sand im Getriebe des totalitären Staates – Widerstand auf eigene Faust
3. Wie man Nazis einschüchtert – Auge in Auge mit Reinhard Heydrich, dem »Schlächter von Prag«
4. Erschreckende Blicke hinter die Kulissen – Belgrad, Paris und die Judenvernichtung im Osten
V. Hitler töten
1. Vom Gewissen getrieben – im Kreisauer Kreis mit Moltke, Yorck und den anderen: Ringen um die Zukunft Deutschlands
2. Tyrannenmord – auf dem Weg zum Attentat vom 20. Juli 1944
3. Drama – Begegnungen mit Stauffenberg und dann überschlagen sich die Ereignisse
4. Als Letzter in Freiheit – am Ende schnappt die Falle zu
VI. Abrechnung, die Rache des Tyrannen
1. Verhaftung in Torgau – wie ein Reichsrichter Angst vor einer Frau bekam
2. KZ Ravensbrück – im Rachen des Löwen
3. Gespanntes Warten auf den Prozess – ein Kommunist bringt heimlich die Kommunion
4. Der Prozess vor dem Volksgerichtshof und das Urteil – Verlegung nach Plötzensee und Befreiung
VII. Die Stunde null, Aufbruch in eine neue Zeit
1. Zwischen den Fronten in ständiger Gefahr – eine abenteuerliche Flucht nach Hause
2. Mitbegründer der CDU – die ersten Schritte in eine neue Demokratie
3. Berater der amerikanischen Militärregierung – Mitarbeit an der Neugestaltung Deutschlands
4. Wieder Richter am Kölner Obergericht – politische Turbulenzen um das oberste Gericht Nordrhein-Westfalens
VIII. Große Ämter, die Adenauer-Affäre und Gedanken an das Ende
1. Zurück in Münster – Präsident des Oberlandesgerichts und zugleich erster Präsident des Verfassungsgerichts
2. Ein Angebot, das man eigentlich nicht ablehnen kann – die Adenauer-Affäre
3. Verlockende Aussichten und Bilanz – die Arbeit an der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen
4. Nachtgedanken – am Ende Humor und Zuversicht
Lebenslauf Paulus van Husen
Abbildungen
Mein Großonkel Paulus van Husen
Manfred Lütz
Paulus van Husen war mein Großonkel. Ich habe ihn, den in der Familie immer eine geheimnisvolle Aura umgab, nie persönlich kennengelernt. Aber dann wurde ich ganz unerwartet durch schicksalhafte Fügung sein Erbe. In einem Schrank fand ich tief unten einen verschnürten Papierstapel mit der Notiz, das hier Niedergeschriebene erst zu veröffentlichen, wenn es niemandem mehr schaden könne. Es waren seine Memoiren, die Ernte seines abenteuerlichen Lebens, die nun diesem Buch zugrunde liegt. Es waren die Lebenserinnerungen eines Mannes, der als einer der wenigen Mitverschwörer des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 überlebt hat, der nicht nur Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Peter Graf Yorck von Wartenburg und Helmuth James Graf von Moltke kannte, sondern der auch mit dem obersten Nazipropagandisten Joseph Goebbels, dem SS-Führer Reinhard Heydrich und Feldmarschall Wilhelm Keitel persönlich gesprochen oder gar verhandelt hatte, der von Bundeskanzler Konrad Adenauer ein spektakuläres Angebot bekam, das man eigentlich nicht ablehnen konnte, und am Ende der erste Verfassungsgerichtspräsident Nordrhein-Westfalens wurde.
Es war ein unheimliches Haus, das ich im Jahre 1996 zum ersten Mal in meinem Leben betrat. Die Fenster waren mit alten schweren Vorhängen zugehangen, die Lampe beleuchtete trübe eine Szene, die jedem Hitchcock-Film alle Ehre gemacht hätte. Alte, dunkle, massige Möbel starrten mich im Wohnzimmer an. Da waren Bücherregale, düstere Gemälde mit mir unbekannten Gestalten, alte Fotos in Bilderrahmen auf den wuchtigen Kommoden und Tischen. Und überall lagen Stapel von Papieren und Büchern. Man hätte sich nicht gewundert, wenn zwischen all dem Zeug, das da offenbar schon seit Jahren seinen Platz hatte, der Blick mit der Zeit im Dämmerlicht auf eine vergessene Leiche gefallen wäre.
Hans-Norbert van Husen hatte mir geöffnet, der unverheiratete Neffe und Erbe meines Großonkels. Er war nur zehn Jahre älter als ich, hatte Medizin studiert, war Professor geworden, einer der führenden deutschen Gastroenterologen, am Ende hochangesehener Chefarzt der Raffaelsklinik in Münster. Ich war ihm nur selten begegnet, aber schätzte ihn außerordentlich mit seiner feinen, liebenswürdigen, aber etwas scheu-zurückhaltenden Art. Wir schrieben uns ab und zu. Zuletzt hatte ich ihn auf meiner Hochzeit 1995 gesehen, da war er noch froh und zuversichtlich gewesen. Aber der mir da jetzt die Tür öffnete, war ein gezeichneter Mann. Vor einem Jahr hatte er bei sich selber Darmkrebs diagnostiziert und kurz danach ganz unerwartet einen Schlaganfall erlitten. Hans-Norbert, der nur der Wissenschaft gelebt, Bücher und Aufsätze publiziert und deswegen kaum ein Privatleben gehabt hatte, konnte nun weder lesen noch schreiben und man verstand ihn nur schwer. Er lächelte, als er mir öffnete, und humpelte mir voraus ins Wohnzimmer.
Ich erinnere mich, dass wir mit unserer ganzen Familie Ende der 1960er Jahre nach Münster gefahren waren, um Onkel Leo und Tante Marli, die Eltern von Hans-Norbert, zu besuchen. Leo van Husen war der zwölf Jahre jüngere Bruder von Paulus van Husen. Und dann gab es da noch die Schwestern, meine Großmutter Maria und Luise, die alle Tante Ite nannten, und die unverheiratet mit dem ebenso unverheirateten Paul zusammenlebte. Er legte übrigens wert darauf, Paulus genannt zu werden – was die Familie nicht daran hinderte, immer nur von »Onkel Paul« zu reden. Merkwürdigerweise besuchten wir ihn damals nicht, fuhren mit dem Auto nur an seinem Haus am Aasee vorbei. In diesem Moment machte oben jemand die Fensterläden zu. Meine Mutter zuckte zusammen: »Das war Tante Ite«, flüsterte sie.
Tante Ite, die ich ebenso nie persönlich erlebt habe, hatte in der Familie einen Ruf wie Donnerhall. Das kam daher, dass meine ganz jung verwitwete Großmutter Maria 1935 bei Onkel Paul und Tante Ite in Berlin-Grunewald eingezogen war – mitsamt ihren sechs Kindern zwischen neun und 18 Jahren. Maria war mit ihrer Situation offenbar heillos überfordert und deswegen nahm ihr Bruder sie auf. Doch Paulus van Husen und noch mehr seine Schwester Ite waren von dieser Invasion offenbar genauso überfordert, denn das unverheiratete Geschwisterpaar wusste mit Kindern nichts anzufangen. Das führte vor allem zu endlosen Spannungen mit Tante Ite, die bei Einzug der Großfamilie gerade mal 29 Jahre alt war. In seinen Memoiren spricht Paulus van Husen immer in den höchsten Tönen von seiner »tapferen Schwester«. In Wahrheit war sie wohl, wie alle, die mit ihr zu tun hatten, übereinstimmend berichten, ziemlich schwierig, jedenfalls äußerst launisch und unberechenbar. Onkel Leo sagte mir mal auf meine penetranten Nachfragen zu Tante Ite, seiner jüngeren Schwester, in seinem unnachahmlichen schwarzen westfälischen Humor liebevoll schmunzelnd: »Se is wohl nich ganz gar geworden«. Man erzählte sich, dass Paulus seinem Vater auf dem Sterbebett versprochen habe, für »das Itekind« zu sorgen. Er muss wohl dieserhalb eine Verlobung gelöst haben, hat sich dann aber sein Leben lang wirklich rührend um seine Schwester gekümmert. Und stand natürlich bei Auseinandersetzungen immer auf ihrer Seite. Aber auch sie setzte sich leidenschaftlich für ihren Bruder ein. Dabei nutzte sie offensichtlich auch ihre in der Familie gefürchteten Eigenheiten, als sie zum Beispiel, wie in den Memoiren beschrieben, einen gestandenen Senatspräsidenten am Reichsgericht mit der Androhung, sofort das ganze Gericht zusammenzuschreien, dazu brachte, bei der Gestapo anrufen zu lassen, um nähere Informationen über ihren soeben verhafteten Bruder zu erhalten.
Jedenfalls entstanden offenbar erhebliche Spannungen zwischen der vaterlosen Großfamilie und dem kinderlosen Geschwisterpaar. Meine Mutter berichtete mir, dass auch Onkel Paul wohl für Kinder kein rechtes Verständnis hatte. Als umfassend gebildeter Europäer war er entsetzt, dass sie zum Beispiel Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon nicht kannte. Von den Treffen der Verschwörer im Haus von Onkel Paul hat sie, die zum Zeitpunkt des Attentats immerhin 22 Jahre alt war, nicht das Geringste mitbekommen. Das Einzige, was ihr auffiel, war, dass öfter ein Kaffeewärmer über das Telefon gestülpt wurde und dass einmal Pater König in einem Schrank verschwand, als es an der Tür schellte. Immerhin fand das letzte Treffen Stauffenbergs mit den Mitgliedern des Kreisauer Kreises am 14. Juli 1944 in dem Haus statt, in dem meine Mutter damals wohnte, dennoch hat sie überhaupt nichts davon bemerkt. Mit dieser strengen Geheimhaltung wollte Paulus van Husen natürlich seine Angehörigen schützen. Übrigens hat es bei meiner Mutter einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass er einmal bei irgendeinem Anlass laut durchs Haus rief: »Wie kann man ein Kind nur Horst nennen!« Horst war für ihn ein heidnischer Name, da es keinen heiligen Horst gab, und vor allem war er bei Nazis beliebt, die ja schmetternd das Horst-Wessel-Lied sangen. Onkel Paul war tief katholisch. Ich habe in seinem Haus mehr Madonnendarstellungen pro Quadratmeter gefunden als an jedem anderen Ort, Kirchen eingeschlossen.
Meiner Mutter verübelte es Onkel Paul wohl vor allem, dass sie 1945, festgeklammert auf dem Kühler eines Botschaftsautos, in letzter Minute Berlin verlassen hatte, da sie mit ihren 23 Jahren damals nicht den Russen in die Hände fallen wollte, die sich gerade anschickten, den Ring um die Hauptstadt zu schließen. Daher war Tante Ite im Haus im Grunewald alleine zurückgeblieben.
Aus all diesen Gründen war das Verhältnis meiner Mutter und ihrer Geschwister zu Onkel Paul nicht unkompliziert. Dennoch sieht man Onkel Paul auf den Bildern der Hochzeit meiner Eltern 1953 zusammen mit seiner Schwester, meiner Großmutter Maria, sozusagen als Vaterersatz. Man schrieb sich auch bisweilen, aber der Kontakt war jedenfalls distanziert und so habe ich weder Onkel Paul noch Tante Ite jemals persönlich kennengelernt, was ich natürlich im Nachhinein sehr bedaure. Als Paul am 1. September 1971 starb, erbte alles seine Schwester Ite, nach deren Tod 1974, wie bereits von Paul verfügt, der Sohn von Onkel Leo, Hans-Norbert. Allerdings gab es noch ein kleines juristisches Geplänkel, weil Onkel Paul das Erbe für Hans-Norbert an die Bedingung geknüpft hatte, dass er dermaleinst eine gut katholische wohlbeleumundete Frau heiraten müsse. Das sei sittenwidrig, meinten einige Juristen in der Familie, aber sie ließen das Ganze dann doch auf sich beruhen, zumal Hans-Norbert sich allseitiger Beliebtheit erfreute.
Im Jahre 1997 starb Hans-Norbert mit nur 53 Jahren. Er hatte sehr unter seiner Hilflosigkeit gelitten. Ich hatte ihn einige Male besucht und vor allem Freunde vor Ort hatten sich rührend um ihn gekümmert. Zu meiner völligen Überraschung teilte mir seine Mutter, Tante Marli, mit, dass Hans-Norbert mich immer schon als Erben genannt habe, so dass ich nach ihrem Tod tatsächlich das Erbe von Onkel Paul antrat. Tante Marli konnte mir noch viel von Onkel Paul erzählen. Sie selber war als Tochter eines deutschen Kolonisten in Deutsch-Ostafrika geboren. Zum offensichtlichen Kummer von Onkel Paul war seine Schwägerin evangelisch. In Münster kam hinzu, wie sie mir erzählte, dass sie eben »keine Geborene« sei, keine Münsteranerin also. Onkel Leo, der blitzgescheit, humorvoll, aber völlig ohne Ehrgeiz war, so dass er sein Leben lang Amtsrichter blieb und damit auch zufrieden war, lebte in einer winzigen Wohnung mit seiner Frau und ihrem einzigen Kind, Hans-Norbert. Er war genauso grundsolide wie Paul, nahm aber das Leben wohl etwas leichter. Tante Marli litt unter der westfälischen, etwas ritualisierten Biederkeit der Familie. Regelmäßig gab es ziemlich steife Treffen von Leo und Hans-Norbert bei Paul und Ite, zu denen sie oft nicht dazugebeten wurde. Am Ende ihres Lebens lebte sie geradezu auf, da sie endlich keine Rücksichten mehr nehmen musste.
Bei unseren Besuchen in Münster nach dem Tod von Hans-Norbert bat Tante Marli meine Frau und mich, das Haus am Aasee auszuräumen, und das wurde zu einem monatelangen Abenteuer. Wir fanden das Gedicht, das die Kinder meiner Ururgroßeltern anno 1865 zur Silberhochzeit ihrer Eltern verfasst hatten, die Poesiealben meiner Urgroßmutter von anno 1870, ebenso von meiner Großmutter und manch andere Memorabilien. Aber wir fanden auch historisch spannende Dokumente zu Paulus van Husen, so den Original-Haftbefehl, die vom Chef der Reichskanzlei unterzeichnete Ausstoßung aus dem Beamtenstatus, die Original-Landkarte von Pater Lothar König mit den darin eingezeichneten Grenzen der Länder, in die das Deutsche Reich aus Sicht der Kreisauer nach dem Ende des Grauens eingeteilt werden sollte, auch ein Telegramm von Staatssekretär Hans Globke, in dem er Paulus van Husen zum Gespräch mit Adenauer bittet, und Briefe von seinem Freund, dem ehemaligen Reichskanzler Heinrich Brüning, der ihn in der Nachkriegszeit mit Care-Paketen aus Amerika unterstützte. Es gab auch eine schmale Akte, die von einer Angelegenheit handelte, die er nirgends erwähnt, die ihn aber hinter seinem kantigen Äußeren ganz menschlich erscheinen lässt. Er hat jahrelang einen Strafgefangenen betreut, ihn regelmäßig besucht und ihm auch sonst vielfach geholfen. Noch am 9. Januar 1971, also kurz vor seinem Tod, schreibt er an einen Pfarrer, er möge sich doch bitte um die vereinsamte Witwe eines Freundes kümmern. Das und vieles andere mehr fanden wir bedeckt vom Staub der Zeit.
Das Haus wirkte ohnehin wie ein verwunschenes Dornröschen-Schloss, in dem seit über 25 Jahren nichts geändert worden war. Hans-Norbert schlief im Bett seines Onkels, überall standen noch Erinnerungsbilder von Onkel Paul, insbesondere Fotos seines besten Freundes, des letzten Oberpräsidenten von Oberschlesien und ersten Vertriebenenministers der Bundesrepublik Hans Lukaschek. An den Wänden hingen Fotos und Bilder meiner Vorfahren, von denen ich bis dahin überhaupt nicht wusste, wie die ausgesehen hatten. Da war eine Daguerreotypie meiner Urururgroßeltern, also ein Foto aus dem Jahre 1848, Fotos meiner Ururgroßeltern, es gab große Ölgemälde meines Urgroßvaters, der wie ich Arzt gewesen war und dem ich etwas ähnlich sehe, und seiner Frau, der Mutter von Onkel Paul, die ja noch bis zu ihrem Tod im Jahre 1942 in Berlin in seinem Haus gewohnt hatte. Es gab ein Familienbild mit meinen Urgroßeltern und all ihren vier Kindern, Paul, meiner Großmutter Maria, Leo und Ite. Und dann gab es da noch ein Gemälde, von dem auch in den Memoiren die Rede ist, das in seiner ersten Version eine etwas zu nackte Waldgöttin zeigte und das dann vom Maler zu einer angezogeneren Muttergottesdarstellung im Wald umgeschaffen wurde. Der Garten, in dem Onkel Paul Rosen, aber auch Essbares angepflanzt hatte, war total verwildert und das Haus im Grunde auch. Tante Ite hatte nach dem Tod ihres verehrten Bruders nichts geändert und das Haus wie ein Museum gehalten. Und genauso hatte es Hans-Norbert nicht gewagt, das Haus für sich selber einzurichten. Auch er wohnte in diesem Anwesen offenbar wie ein Museumswärter, der die alten Stücke bewacht. Freunde hat er in sein Haus, wie ich erfuhr, nie eingeladen. Über allem schwebte der Geist von Onkel Paul.
Und dann fand ich die Memoiren. Sofort war klar, dass das, was ich da las, von außerordentlicher historischer Bedeutung war, denn es gab ja nur wenige überlebende Mitverschwörer vom 20. Juli und außerdem hatte Paulus van Husen als Mitbegründer der CDU in den ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Aber auch seine Erlebnisse bei der Stabilisierung der chaotischen Zustände in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg, sein Amt als deutscher Vertreter in der dem Völkerbund verantwortlichen Gemischten Kommission für Oberschlesien und seine Tätigkeit beim Oberkommando der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg mussten für Historiker von großem Interesse sein. Deswegen gab ich den ganzen Packen der Memoiren an Professor Karl-Joseph Hummel von der Bonner Kommission für Zeitgeschichte, der gemeinsam mit seinen Mitarbeitern nach gründlicher Recherche im Jahre 2010 eine sorgfältig kommentierte Auswahl unter dem Titel »Paulus van Husen (1891–1971)« im Schöningh-Verlag herausgab. Dort waren vor allem all die über eintausend Personen, die in den Memoiren genannt werden, mit interessanten kurzen biografischen Bemerkungen bedacht. Dem Ganzen wurde eine ausführliche Einleitung von Professor Hummel vorangestellt, die Paulus van Husen aus der Sicht der Geschichtswissenschaft würdigte.
Allerdings hat das natürlich nicht dazu geführt, dass Onkel Paul einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden wäre. Die Auswahl eines Historikers konzentriert sich nämlich auf historisch relevante Informationen, die bei Paulus van Husen reichlich fließen, aber nicht unbedingt auf die packend geschriebenen erzählenden Teile. Doch das ist das eigentlich Spannende an diesen Lebenserinnerungen. Viktor Klemperer hat seine Erlebnisse in der Nazizeit in Dresden mit beklemmender Eindringlichkeit beschrieben und dem Leser damit einen Einblick in die Denk- und Gefühlswelt eines Juden in dieser entsetzlichen Situation gegeben. Paulus van Husen beschreibt in glänzendem, zuweilen auch höchst unterhaltsamem Stil, wie er als Jurist und treuer Staatsbürger des Kaiserreichs die Weimarer Zeit erlebt und dann von vorneherein als bekennender katholischer Christ in Opposition zum Nationalsozialismus gerät. Welche Konsequenzen er daraus von der ersten Stunde des Dritten Reichs an zieht, wie er auf verschiedene, auch witzige Weise die Nazis austrickst und lustvoll »dem Löwen auf den Schwanz« tritt, wie sich sein Widerstand langsam immer mehr steigert, bis er schließlich vor dem Tyrannenmord nicht mehr zurückschreckt, das kann man in seinen Memoiren sozusagen live miterleben.
In eine großbürgerliche Familie wurde er hineingeboren und diese Ursprünge hat er sein Leben lang nie verleugnet. Obwohl er am Ende »die parlamentarische Demokratie für die derzeit beste Möglichkeit« hielt, »um einigermaßen erträglich unter der Macht zu leben«, war für ihn die Monarchie sozusagen die natürliche Staatsform. Das sagte er auch so freimütig, dass es mitunter zu leichten Irritationen kommen konnte. Als er als erster Präsident des Verfassungsgerichts des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich eines Freundschaftsbesuchs in den Niederlanden eine Tischrede halten musste, geriet ihm der diplomatisch wohlmeinende Lobpreis der dortigen Monarchie wohl so enthusiastisch, dass weniger wohlmeinende deutsche Zuhörer versuchten, daraus eine Staatsaffäre zu machen, was aber zu seinem Glück misslang. Dabei war für ihn das Urbild der Monarchie die Habsburger-Herrschaft: »Der Kaiser sitzt in Wien«. Dennoch hat er sich an den Spötteleien über Kaiser Wilhelm II. nicht beteiligt, denn dieser Hohenzoller war für ihn damals selbstverständlich das legitime Staatsoberhaupt. Aber genauso selbstverständlich war Paulus van Husen dann ein treuer Diener der Weimarer Republik.
Insofern könnte man versucht sein, ihn einfach als Konservativen einzuordnen. Doch das wäre ganz falsch. Denn er war zugleich in einem speziellen Sinne liberal. Sein tief katholischer Vater, der jeden Morgen die Heilige Messe besuchte und der ihn sehr geprägt hatte, war immer stolz darauf gewesen, im Revolutionsjahr 1848 geboren zu sein, und hatte im Kulturkampf gegen die preußische Obrigkeit immer eindeutig die Freiheit der Kirche vertreten. Der Großvater hatte sogar persönlich den Bischof von Münster 1875 ins preußische Kreisgefängnis nach Warendorf begleitet, wo Paulus später als Regierungsreferendar tätig sein sollte. Da der Katholizismus im 19. Jahrhundert durchaus nicht staatsfromm auftrat, in Belgien 1830 mit den Liberalen zusammen die Revolution organisiert hatte und auch in Deutschland unter Bismarck in Opposition stand, taugte die vergleichsweise seltene Spezies des katholischen Großbürgers keineswegs zum »Untertan«, wie Heinrich Mann ihn eindrücklich beschrieb, sondern war ein kritischer Staatsbürger mit eigenem Kopf.
Diese besondere Art der katholischen Prägung aus einem tiefen Glauben heraus war ganz offensichtlich bei Paulus van Husen, wie sich später immer wieder zeigte, der Glutkern seiner starken und kantigen Persönlichkeit. Aber auch da war er nicht einfach hierarchiegläubig. Heftig kritisiert er das Reichskonkordat, das der Papst mit Hitler geschlossen hatte, heftig empört er sich in einem persönlichen Gespräch mit dem Bischof von Osnabrück, Berning, über dessen laue Haltung dem Nationalsozialismus gegenüber, heftig kritisiert er auch nach dem Zweiten Weltkrieg den Bischof von Münster. Ein einfacher Untertan war er nie. Treu war er seinen Freunden, wahrhaftig war er gegen jedermann, wenn er etwas nicht einsah, dann sagte er das freimütig. Dennoch war er auch den schönen Dingen des Lebens zugetan, wusste charmante Frauen zu schätzen, liebte einen guten Tropfen und führte überhaupt ein gastfreies Haus. Mit Paulus van Husen wurde es nie langweilig.
In Windeseile studiert er, nicht ohne in Oxford und Genf ein paar Auslandssemester zu genießen. Er beginnt eine aussichtsreiche Karriere in der preußischen Verwaltung, da gerät ihm der Erste Weltkrieg dazwischen. Er kommt irgendwie durch und am Ende gelingt ihm noch ein Husarenstück, als er in voller Uniform mit der Straßenbahn ins revolutionäre Berliner Zentrum fährt, um seinem Garderegiment, das die Regierung Ebert unterstützen soll, das Quartier zu sichern. Alles, was dann passiert, ist unerwartet. Wieder preußischer Beamter, gerät er mitten in den heftigen Kampf um die vom Völkerbund abgehaltene Abstimmung in Oberschlesien, die zur Teilung des Landes zwischen Deutschland und Polen führt, wird dann Generalbevollmächtigter des Prinzen Hohenlohe in Koschentin und lernt die ganze große oberschlesische Gesellschaft kennen. Sein Freund Hans Lukaschek empfiehlt ihn als seinen Nachfolger in der dem Völkerbund verantwortlichen Gemischten Kommission für Oberschlesien, die unter Leitung des ehemaligen Schweizer Bundespräsidenten Calonder insbesondere die Minderheitenrechte der Polen und Deutschen wahren soll. Er engagiert sich leidenschaftlich für dieses Anliegen – im Übrigen das entscheidende Thema auch der heutigen internationalen Politik – und erlebt entsprechende Sitzungen beim Völkerbund in Genf. In seiner Funktion hat er dann auch mal einen kurzen humorvollen Wortwechsel mit Reichspräsident von Hindenburg. Als die Nazis kommen, kann er noch geschickt die Judenverfolgung in Oberschlesien hemmen, indem er mit internationalen Verwicklungen droht. Seine Unbotmäßigkeit führt dann aber schnell zur Abberufung. Da er über verbindliche Zusagen auf Weiterbeschäftigung im Staatsdienst verfügt, muss er als Richter am Berliner Oberverwaltungsgericht angestellt werden. Anschaulich schildert er die abenteuerlichen Situationen, in die er dabei in der immer brauner werdenden Umgebung gerät.
Der Kern des hier abgedruckten Auszugs betrifft dann seine Tätigkeit im Oberkommando der Wehrmacht nach Ausbruch des Krieges und natürlich seine Verschwörertätigkeit im Kreisauer Kreis, seine Verhaftung, seinen KZ-Aufenthalt und seine Befreiung. Man wird Zeuge, wie er im Kreisauer Kreis mit den anderen um eine gerechte Nachkriegsordnung ringt, die moralische Voraussetzung für ein Attentat. Denn einen Tyrannen zu töten, ohne daran zu denken, was danach kommt, hat auch in unseren Tagen zu schlimmen Konsequenzen geführt. Er befasst sich dabei vor allem mit der Behandlung der »Rechtsschänder« und seinem Thema, dem Minderheitenschutz. Manche dieser Gedanken sind später in die neue staatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland eingegangen. Er hält auch den Kontakt mit Bischof Clemens August Graf von Galen in Münster, der ihm beim letzten Gespräch nachruft: »Ich bete auch, dass der Kopf draufbleibt«. Wie er dann mit Stauffenberg im Zug fährt und Zeuge eines erschütternden Gesprächs wird, wie er unter höchster Anspannung nach dem Attentat auf den Wagen wartet, der ihn zum Bendlerblock bringen soll, oder wenigstens auf den vereinbarten Anruf von Yorck, das ist spannend wie ein Krimi. Aber auch die erschütternden Erlebnisse danach machen klar, warum er am Ende sagt, das sei »die hohe Zeit meines Lebens gewesen«. Zwar ist er in Berlin Mitbegründer der CDU, gerät aber schon bald in Konflikt mit den allzu wendigen Parteifreunden. Bis auf die interessante Affäre mit Bundeskanzler Adenauer ist die Nachkriegszeit dann eher von seinen mühsamen Auseinandersetzungen als Präsident des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs mit den jeweiligen Ministerpräsidenten geprägt, die ihn immer mehr resignieren lassen. Der erste nordrheinwestfälische Ministerpräsident Rudolf Amelunxen vom Zentrum hatte Paulus van Husen dem zweiten Ministerpräsidenten Karl Arnold (CDU) mit politischem Druck aufgenötigt, was van Husen wegen der Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt, auf die er großen Wert legte, eigentlich auch gut fand. Er ist dann aber in den folgenden Jahren immer wieder überrascht bis empört, dass Arnold ihn mit seinen unverdrossenen Eingaben stets kühl abblitzen lässt. Davon ist hier nur Weniges aufgenommen. Ganz am Ende ereilen ihn noch die Reformen seiner katholischen Kirche nach dem II. Vatikanischen Konzil, die ihn eher ratlos zurücklassen.
Paulus van Husen hat seine Memoiren, die übrigens einen durchaus humorvollen Menschen zeigen, mit Sinn für Ironie bis hin zum Sarkasmus, offensichtlich in den 1960er Jahren bis kurz vor seinem Tod 1971 verfasst, wobei er am Ende wohl vor allem durch eine starke Sehbehinderung sehr eingeschränkt war. Von den 977 Seiten des Originaltextes sind hier ungefähr 280 Seiten wiedergegeben. Sie folgen, wie schon gesagt, einem ganz anderen Auswahlprinzip als die verdienstvolle Publikation von Karl-Joseph Hummel. Vor allem die vielen Urteile über Personen und Zeitläufe sind weggelassen, aber auch manch Dokumentarisches zum Beispiel zur Münsteraner Stadtgeschichte und ebenso die zahlreichen historischen und kunsthistorischen Exkurse. Es wird also vor allem das wiedergegeben, was auf persönlichen Erlebnissen beruht. Der Lesbarkeit halber sind die Auslassungen nicht kenntlich gemacht und nur an ganz wenigen Stellen kurze Informationen zu einigen Personen eingefügt. Außerdem sind sprachliche Altertümlichkeiten dem modernen Sprachgebrauch angepasst. Die Kapitel-Überschriften sind ebenfalls neu.
Für den Historiker wird die zusätzliche Lektüre des Hummel-Werkes unabdingbar sein, zum Beispiel was die verwickelten Verhältnisse und die unzähligen handelnden Personen in Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg oder die endlosen Auseinandersetzungen mit den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten nach dem Zweiten Weltkrieg betrifft.
Natürlich können übrigens auch die Originalmemoiren konsultiert werden, denn sie stehen der Forschung in der Kommission für Zeitgeschichte in Bonn zur Verfügung.
Für das hier vorliegende Buch ist also nur das ausgewählt worden, was für den heutigen Leser von Interesse ist, der wissen will, was einem Mann zustieß, dessen eigentlich so wohlbehütet begonnenes Leben ganz unerwartet durch zwei Weltkriege und eine brutale Diktatur aus den Fugen geriet. Dadurch aber wuchs er zu einer persönlichen Größe, die ihn zum Vorbild in Zeiten macht, die wieder Charakter verlangen, damit die Welle der Barbarei nicht erneut alle Menschlichkeit hinwegschwemmt. Aber auch persönlich ist dieses Leben eindrucksvoll. Kein Wort verliert Paulus van Husen darüber, dass er aus Pflichtgefühl auf eine eigene Familie verzichtete und sich ganz selbstverständlich für seine hilfsbedürftige, wohl auch etwas mühsame Schwester Ite aufopferte, deren finanzielle Sicherstellung ihn bis an sein Lebensende übermäßig umtreibt. Und dann nahm er auch noch seine zweite Schwester Maria samt anstrengenden Kindern klaglos auf. So etwas wirkt heute fast provozierend.
Gibt es Gewissenspflichten, auch wenn alle ringsumher die Moral zu verspotten scheinen? Wann muss man Widerstand leisten, persönlich und öffentlich? Gibt es etwas, für das man bereit wäre, sein Leben einzusetzen? Das waren Fragen, die mir in den Sinn kamen, als ich zum ersten Mal in diesen Memoiren blätterte, und das wird sich wohl jeder fragen, der das Lebenszeugnis dieses Mannes liest.
Nicht ohne Stolz druckt er in seinen Memoiren die »politische Beurteilung« ab, die dazu führte, dass er nicht zum Reichsrichter befördert wurde und die ihm nach dem Krieg zugespielt wurde: »Van Husen ist aus weltanschaulichen Gründen abzulehnen, da er katholisch bis zur fixen Idee gebunden ist und von ihm in dieser Hinsicht eine Einsicht und damit eine nationalsozialistische Überzeugung nicht erwartet werden kann. Was den sogenannten rückhaltlosen Einsatz betrifft, so kann er bei van Husen höchstens für den Katholizismus in Frage kommen; der bedingungslose Einsatz für den Nationalsozialismus muss ihm aus seiner katholischen Gebundenheit heraus stets unmöglich bleiben.« Manches an Paulus van Husen erscheint für den heutigen Menschen etwas merkwürdig. Seine kämpferische Art, seine Penetranz in Auseinandersetzungen, seine tiefe katholische Frömmigkeit. Doch möglicherweise sind es gerade diese Merkwürdigkeiten, die diesen Menschen wirklich bemerkenswert machen. In Zeiten, wo jeder instinktiv weiß, was er zu sagen hat, um nicht anzuecken, wirkt eine solche Persönlichkeit etwas fremd. Aber vielleicht muss man den Mut haben, befremdend zu wirken, wenn man nicht Gefahr laufen will, als unauffälliger Mitläufer mit der irregeleiteten Masse wieder mal in einen Abgrund zu stürzen. Die Geschichtswissenschaft sieht seine Lebensleistung übrigens erheblich positiver als er selbst, der am Ende seines Lebens enttäuscht war, nicht das erreicht zu haben, was er sich vorgenommen hatte. Was mich betrifft, so finde ich seine Charakterfestigkeit in schwierigsten Lagen tatsächlich bewundernswert, sein Einstehen für Überzeugungen und für Menschen, auch für Menschen anderer Überzeugung. Mir ist mein Großonkel Paul, dem ich nie begegnet bin, durch seine Memoiren ein wenig ans Herz gewachsen und ich glaube, ich hätte den tapferen alten Mann, der seine hohe Sensibilität wohl mit einer gewissen Kränkbarkeit bezahlen musste, wirklich gerne gehabt.
75 Jahre nach der Befreiungstat vom 20. Juli 1944 wird in diesen Texten eine Zeit wieder lebendig, in der auf der einen Seite hemmungsloser Hass und Menschenverachtung die Macht ergriff, aber andererseits Menschen, die sonst unscheinbar ihrem Beruf nachgegangen wären, sich vor ihrem Gewissen aufgerufen fühlten, Widerstand zu leisten – unter Einsatz ihres Lebens. Wir hatten alle gedacht, dass gerade wir Deutschen die Lehren aus dieser schrecklichen Geschichte gezogen haben. Doch das scheint ein Irrtum. Daher ist es heute nötiger als je zuvor, die Erinnerung an die Gefahren menschenverachtender Überzeugungen wach zu halten, denn wie schnell werden solche unmenschlichen Überzeugungen zu unmenschlichen Taten! Und andererseits ist es heilsam, an die Kräfte zu erinnern, die damals dafür gesorgt haben, dass Deutschland und die Deutschen international nicht völlig ihr Gesicht verloren und deswegen auch so erstaunlich bald wieder in der Völkergemeinschaft aufgenommen wurden. Das lag eben nicht nur an der Weltkonstellation des Kalten Krieges, in der die Bundesrepublik Deutschland im Spiel der Mächte gebraucht wurde, das lag auch am 20. Juli. Wir Deutschen verdanken den Männern des Widerstands viel mehr, als die meisten heute ahnen. Und daher ist es auch nicht richtig, das Attentat vom 20. Juli 1944 nur als Misserfolg darzustellen. Das unmittelbare Ziel wurde gewiss nicht erreicht und so mussten in den zehn Monaten nach dem 20. Juli bis zum Ende des Krieges noch genauso viele Menschen ihr Leben lassen wie in den fünf Jahren vorher zusammen. Aber die moralische Wirkung war enorm. Deswegen haben Männer wie Henning von Tresckow, die Zweifel am unmittelbaren Erfolg hatten, gesagt: Das Attentat muss erfolgen, koste es, was es wolle. Dafür haben auch wir heute noch zu danken.
Paulus van Husen zitiert Churchill, der in einer Unterhaussitzung gesagt haben soll: »In Deutschland lebte eine Opposition, die quantitativ durch ihre Opfer und eine entnervende internationale Politik immer schwächer wurde, aber zu dem Edelsten und Größten gehört, das in der politischen Geschichte aller Völker hervorgebracht wurde. Diese Männer kämpften ohne Hilfe von innen oder von außen, einzig getrieben von der Unruhe ihres Gewissens. Solange sie lebten, waren sie für uns unerkennbar, da sie sich tarnen mussten. Aber an den Toten ist der Widerstand sichtbar geworden. Diese Toten vermögen nicht alles zu rechtfertigen, was in Deutschland geschah. Aber ihre Taten und Opfer sind das unzerstörbare Fundament des neuen Aufbaus. Wir hoffen auf die Zeit, in der erst das heroische Kapitel der inneren deutschen Geschichte seine gerechte Würdigung findet.«
Bornheim, den 18. März 2019
Manfred Lütz
Als der Wagen nicht kam
Paulus van Husen
I. Das pralle Leben
1. Eine herrliche Kindheit in der »guten alten Zeit« – Kriegsspiele, der Kaiser in Münster, Absurditäten am Badestrand
Es war ein wohlwattiertes, schön ausfestoniertes, gutbürgerliches Bettkörbchen, in das ich am 26. Februar 1891 hineingelegt wurde unter Vorhängen und Pompondraperien aus Cretonne mit großen, rosaroten Rosen auf hellblauem Grund. Heute ist ein solches Bettchen schneeweiß lackiert aus Stahlrohr und Plastik, und meine Wiege würde als unwissenschaftlicher und unhygienischer Missbrauch sehr getadelt werden. Mir hat sie nicht geschadet, wohl nach der Regel: praesente medico nihil nocet (In Gegenwart des Arztes schadet nichts). Mein Vater war nämlich Arzt. Obwohl er auf Robert Koch und die damals neumodischen Bakterien schwor, nahm er diese doch wohl wiederum nicht so ernst, dass er an der bakterienfördernden Schmuckhaftigkeit meines Bettchens Anstoß genommen hätte. Diese sollte offenbar Ausdruck der großen Freude der Eltern darüber sein, dass nach elfjähriger Ehe endlich ein Kindchen geboren wurde, ein Ereignis, für dessen Eintreten ein Jahrzehnt lang ungezählte Hl. Messen, Novenen zum Hl. Josef und Wallfahrten nach Kevelaer abgehalten worden waren. Ein großer, neugotischer Schnitzaltar für die Krankenhauskapelle wurde dafür gestiftet. Hoffentlich sehen die Eltern im Himmel das alles jetzt nicht als Fehlinvestition an. Getauft wurde ich auf den Namen des Diözesanpatrons Paulus. Der Standesbeamte machte aber »Paul« daraus, und dabei ist es dann leider formell verblieben.
Meine Wiege stand in Horst-Emscher. Als mein Vater sich dort Ende der siebziger Jahre niedergelassen hatte, war es ein friedliches, ländliches Dörfchen, wo es außer Pastor, Vikar und dem Rentmeister des Hauses Horst keine Honoratioren, nicht einmal eine Apotheke gab. Das Haus Horst, eine dem Baron Fürstenberg-Hugenpoet gehörige Wasserburg, war ursprünglich eines der großartigsten Renaissanceschlösser Westfalens, aber bis auf ein Wohngebäude für den Rentmeister abgebrochen. Das elterliche Haus lag etwas außerhalb des Dorfes nach Gladbeck zu im Freien. Der große Garten wurde von einem Bach durchflossen, auf dem Enten und Gänse gehalten wurden. Neben dem Haus, das an ein weites Fürstenbergsches Weidegelände grenzte, lagen unter Kastanienbäumen Stall und Remise.
Alle meine Vorfahren väterlicherseits stammen von schönen Höfen am Niederrhein, ursprünglich wohl von dem auf den Messtischblättern noch als solchen bezeichneten Husenhof bei Rheinberg. Einer der ersten Träger unseres Namens, der urkundlich auftritt, beschwört 1265 vor dem Bischöflichen Gericht in Rheinberg in einer im Staatsarchiv Düsseldorf befindlichen Urkunde anlässlich eines Streits mit dem Grafen von Moers um Zinspflicht: quod nonnulli hominum, sed soli Deo attinemus (Nicht auf Menschen, sondern allein auf Gott verlassen wir uns). Das ist ein im rechtlosen Interregnum gegebener, schöner Ausdruck eines ausgeprägten Gefühls für Recht und Freiheit, das am Niederrhein den jeweiligen staatlichen Machthabern immer zu schaffen gemacht hat. Mein Vater pflegte häufig darauf hinzuweisen, dass er im Freiheitsjahr l848 geboren sei, obschon er sonst die Jakobinermütze gar nicht liebte, und auch ich habe immer in der oben gekennzeichneten Haltung zu leben versucht.
Alle meine Vorfahren sind immer katholisch geblieben. Der Niederrhein ist katholisch geblieben, und der Gegensatz zu dem neuen, protestantischen Fürstenhaus hat die religiösen Kräfte des von Natur tief gläubigen Volkes nur vertieft. Besonders ist das durch den verhängnisvollen Bismarck’schen Kulturkampf geschehen, der das Volk in einer Weise aufgewühlt und erregt hat, die kaum noch vorstellbar ist. Mein Großvater war mit dem Wagen nach Münster gefahren zur Begleitung des Bischofs Johann Bernhard auf seiner Gefängnisfahrt und wurde noch mit neunzig Jahren erregt, wenn er von diesen Zeiten sprach. Ein lebendes Mahnmal für die damalige Gewaltherrschaft war die Schwester meines Vaters, die mit 18 Jahren bei den Kreuzschwestern in Aspel eingetreten, bei der Konfiskation dieses Klosters nach Lüttich fliehen musste und dort bis zu ihrem Tode mit 86 Jahren verblieben ist. Auch die Nonnen, bei denen meine Mutter zur Schule gegangen ist, waren vertrieben worden. Dazu mahnten überall im Lande die zweckentfremdeten Klostergebäude neben den in der sogenannten Säkularisation geraubten Kirchen und Klöstern das Volk zur Anhänglichkeit an die Kirche und machte diese zum Mittelpunkt allen Geschehens, den Staat aber zu einer fremden und misstrauisch angesehenen Einrichtung.
Mein Vater stammte also aus einer tief religiösen, treu kirchlichen Umwelt, hat seinen katholischen Glauben stets bewahrt und vorbildlich nach ihm gelebt und gehandelt. Die Eltern hatten Horst zum Wohnsitz gewählt, weil es so nahe bei Essen, dem Heimatort meiner Mutter, und trotzdem angenehm ländlich lag. Der Vater legte allen Stolz in drei gute Kutschpferde. Das Haus war so geräumig, dass es fünf Gästezimmer hatte, die stark frequentiert wurden. Besonders die Jesuitenpatres, die sich ja nur geheim von ihren holländischen Klöstern aus einschleichen konnten, hatten dort einen guten Unterschlupf und einen bequemen Ausgangspunkt für ihre versteckte Tätigkeit im Lande. Dazu kam ein ständiges Hin und Her mit Verwandten und Freunden aus Essen, Theaterbesuch dort und Verkehr mit den Ärzten und Geistlichen der Nachbarschaft. Die sorglose Behaglichkeit eines solchen damaligen bürgerlichen Haushalts ist heute nur noch schwer vorstellbar. Nach Tisch spielte die Mutter Klavier, und dann sang man gemeinsame Lieder, wobei der Weinkeller in weit höherem Maße zu seinem Recht kam, als es heute üblich ist. Mein Vater hat mir als feste Regel wohl aus dieser Zeit beigebracht, dass man bei größerem Weinkonsum abends die leeren Flaschen selbst in den Keller tragen müsse, da es das Personal nichts angehe, wie viel Flaschen Wein mit den geistlichen Herren am Abend geleert worden seien. Auf guten Wein wurde großer Wert gelegt und unter Nichtachtung von Bier und Schnaps die Annehmlichkeit eines Landes nach seiner Weinproduktion bemessen. Wein galt als treffliche Medizin, als Kinder bekamen wir bei Erkältung einen Teelöffel Tokaier, und es freut mich, dass ich meinem Vater zehn Minuten vor seinem Tode noch ein großes Glas Moët-Chandon geben konnte.
Nach meiner Geburt hatte sich das Interesse von der Gastlichkeit auf mich verlagert, und man schaute bereits nach besseren Schulmöglichkeiten aus. Schließlich wurde unter Verkauf der Besitzung in Horst ein Haus in Münster auf der Warendorfer Straße gekauft. Damals war dieser Vorort St. Mauritz die hübscheste Wohngegend von Münster, mit ländlichem Charakter.
In dem großen Garten durften in einer Ecke Höhlen gegraben und Indianerhütten gebaut werden. Das weite, grüne Hintergelände mit seinen versteckten Gartenstiegen bot Gelegenheit für ausgedehnte Kriegszüge, die sich bis zur jetzigen Piusallee erstreckten, damals ein verlassener Bahndamm, der zum Spielen besonders geeignet war und wo mit Kinderbanden der dortigen Gegend regelrecht Krieg gespielt wurde. Nach dem Burenkrieg – niemand wollte Engländer sein – gab es dort sogar Schützengräben mit Dornen als Drahtverhau. An die Ereignisse des Burenkriegs und an Ohm Krüger erinnere ich mich lebhafter und mit intensiverer Parteinahme als an die Schlachten des Weltkrieges, während der spätere russisch-japanische Krieg uns nicht sehr beeindruckt hat. Er war wohl schon zu mechanisch für die Nachgestaltung in der kindlichen Phantasie.
In dieser harmlosen, sicher gegründeten Umwelt drehte sich für die Eltern alles nur um die Kinder, auf deren körperliche und geistige Pflege der ganze Tagesablauf abgestellt war. Der Vater ging jeden Morgen um 6 Uhr in das Franziskanerklösterchen zur Kirche, wenn er nicht um 10 Uhr im Dom die Hl. Messe hörte, und oft tat er beides an einem Tag. Dadurch erhielt das ganze Familienleben ohne jede Mahnung und nur durch ein sich als selbstverständlich darstellendes Beispiel die richtige Ordnung und Sinngebung. Aus der Kirche brachte er auch seinen inneren Frohsinn mit und die unerschütterliche Geduld für die Schwierigkeiten des Alltags, die es natürlich auch damals gab, wenn sie uns heute auch weniger gewichtig erscheinen als unsere eigenen Sorgen. Meine Mutter war entsprechend ihrem fragil zierlichen Körperbau – Schuhnummer 36 und kleinste Handschuhnummer – sehr feinnervig, gefühlsbetont, empfindsam und impulsiv, peinlichst bedacht auf gute Formen, äußeres Dekorum, tadelloses Schreiten, tadelloses Sitzen und gepflegte Kleidung. Ich habe sie nie in einem Morgenrock oder gar unfrisiert gesehen.
Ostern 1900 wurde ich in die Sexta des humanistischen Gymnasiums Paulinum aufgenommen, das sich rühmen kann, das älteste deutsche Gymnasium zu sein, entstanden aus der Domschule und dann von den Jesuiten neu geformt. Das Gymnasium wurde ganz von katholischem Geist getragen. Der Geschichtsunterricht allerdings war preußisch ausgerichtet. Brandenburgische Markgrafen und Kurfürsten standen im Vordergrund, und der Sinn der Geschichte schien hauptsächlich auf das Zusammenbringen eines möglichst großen preußischen Länderbesitzes gerichtet zu sein. In Münster ließ sich die Territorialgeschichte nicht ganz verbergen, schon weil die Steine sie zu laut kündeten in den zahlreichen schönen Bauten aus der fürstbischöflichen Zeit. Zu viele weinende Kirchen und entweihte Klöster mahnten im Münsterland daran, dass das ideale preußische Geschichtsbild doch recht trübe Flecken aufwies. Entsprechend dem örtlichen Milieu lag unsere Klasse auf der Linie der Zentrumspolitik.
Revolutionäre politische Meinungen gab es in Münster nicht, wo man ja zwei Mal bereits mit den Wiedertäufern und bei der Auflehnung der Stadt gegen den Fürstbischof Christoph Bernhard so schlechte Erfahrungen mit Revolutionen gemacht hatte. Deshalb wollte auch niemand etwas von den Sozialdemokraten wissen, und wenn diese in einem kleinen Trupp mit einer roten Fahne am 1. Mai zur Maifeier in das Restaurant an der Schleuse zogen, so nahmen das nur die Kinder ernst, die johlend hinterherliefen, und die Erwachsenen zogen nur die Folgerung, dass man eine so anrüchige Wirtschaft nicht mehr besuchen dürfe. Großen Auftrieb hatte das monarchische Gefühl, das damals mit der Bejahung des staatlichen Gefüges identisch war, in Münster durch den etwas späten Besuch des Kaisers im Jahre 1906 erhalten, bei dem die Kaiserin nicht anwesend war, was das Volk unliebsam vermerkte. Der Schmuck der Stadt war überaus prunkvoll und hätte dem Geschmack des Kaisers entsprechen müssen; ebenso groß war der Jubel der Bevölkerung. Es hat uns Sekundanern daher missfallen, als wir in Spalierstellung auf dem Domplatz sahen, wie der Kaiser ohne einen Blick nach rechts oder links mit eiserner Imperatorenmiene vorbeiritt. Der Kronprinz hatte dagegen mit seiner lächelnden Eleganz alle Herzen für sich.
Von meinem dritten Lebensjahr ab wurde ich jeden Sommer mit nach Borkum genommen, das früher noch ein schöner, ländlicher Ort mit einem herrlichen Strand war, der sicher viel zu meinem gedeihlichen Aufwachsen beigetragen hat. Früh morgens ging es an den Strand in das Zelt zum Burgenbau und Baden an den noch streng getrennten und durch Strandwärter abgeschirmten Badestränden. Die Herren trugen unbekümmert ihre dunklen Straßenanzüge, aufgelockert nur durch eine scheußliche, weiße Strandmütze. Das gebotene Strandkleid der Damen war aus Rohseide oder blauem Foulard mit einer nur leicht angedeuteten Schleppe, aber immer noch so lang, dass der Rock mit der Hand gehalten werden musste, wenn er nicht durch den nassen Sand schleppen sollte. Ein Sonnenschirm – ein en tout cas auch für Regen – gehörte unbedingt dazu, denn Damen mussten damals noch selbst an der See ihren blassen Teint hüten. Im Badeanzug den Strand außerhalb des eigentlichen Badestrands zu betreten, wäre undenkbar gewesen, obschon die Badeanzüge der Damen sehr viel »angezogener« waren als heute ein dickes, winterliches Straßenkleid. Der noch vorhandene Badeanzug meiner Mutter bestand aus dickem, flanellartigem Stoff mit mehreren Schulterkragen und Hüftüberwürfen, die mit gelben, schweren Litzen paspeliert waren; im Vergleich zum Bikini waren es Ritterrüstungen. Der viktorianische Geist war so vorsichtig, dass man von Badekarren aus baden musste. Diese wurden von einem Pferd bis ins Wasser gezogen, und erst dann durfte man hinausklettern; auf Klopfen hin wurde nach dem Bade der Karren dann wieder aufs Trockene zum Aussteigen gebracht. Dieses System vorbeugenden Sittenschutzes konnte recht lästige Folgen haben. Eines Tages hatte die Badefrau vergessen, bei steigender Flut den Badekarren meiner Mutter zeitig wieder an Land zu fahren zum trocknen Aussteigen, und ihr Rufen und Klopfen verhallte im Seewind, so dass sie in höchste Not geriet, bis sie schließlich doch bemerkt und zurückgefahren wurde. Ich glaube, das Wasser hätte schon sehr hoch steigen müssen, ehe sie der Konvention so weit zuwider gehandelt hätte, den Badekarren selbsttätig zu verlassen.
Höchlichst interessiert hat uns natürlich die erste große Automobilfernfahrt Berlin-Paris, ich glaube, es war 1903; die Etappenstation in Münster am Gertrudenhof lockte Jung und Alt her, um diese erstaunlichen Gefährte zu bewundern, die übrigens bis 1914 nur in ganz geringer Zahl in Münster bodenständig wurden. Noch größer waren Staunen und ergriffene Bewunderung, als einige Jahre später ein Zeppelinluftschiff in erhabener Größe seine Schleifen über dem Münsterland zog.
Unter Führung des guten Professor Iwan Baeumer bestand ich dann in den ersten Märztagen 1909 das Abitur. Das mündliche Examen wurde mir erlassen, und das Abiturzeugnis enthielt keine anderen Prädikate als gut und sehr gut. Die Welt stand mir offen.
2. Die große weite Welt: Oxford, London, Genf – ein abenteuerliches Studentenleben
Die Eltern waren großmütig, und so durfte ich das erste Semester in Oxford verbringen. Reisen in das Ausland waren vor 1914 einfach. Pässe oder gar Visa brauchte man nicht in Europa außer für Russland; man besaß keinerlei Ausweis, abgesehen von der Visitenkarte, deren erstmaliger Besitz mein Selbstbewusstsein sehr anhob. Die Zollkontrollen waren bei der Einreise in Freihandelsländer wie England und Holland eine reine Formalität, während die Rückkehr in das schutzzollgepanzerte Deutschland infolge der berüchtigten Tüchtigkeit der deutschen Beamten jedes Mal ein Abenteuer darstellte, das den Reiz des Reisens sehr verstärkte.
Ich wohnte in einem kleinen »boarding-house« nahe bei St. Giles, bei Mr. Rothwell, einem Ingenieur, der in den Kolonien nicht prosperiert hatte und deshalb auf »paying guests« verfallen war. Außer zwei charmanten Töchtern gab es ein halbes Dutzend Gäste, alles Engländer, und dann und wann auch Amerikaner, die Mr. Rothwell, wie alle Engländer es früher gewohnt waren, etwas von oben herab behandelte. Sie waren damals noch selten und hatten alle dasselbe Ziel: »to do the cathedrals«, womit der Besuch der Kathedralen in Salisbury, Gloucester, Exeter, Ely, Wells, Lincoln, Durham und York gemeint war. Die gebildeten Engländer legten großen Wert auf eine saubere Aussprache von »the Kings English«. Schon bei Dickens galt ja das Auslassen des Buchstabens »H« beim Sprechen als schlimmer Vorwurf, und nun gar in Oxford, wo die Studenten mit ihrem nonchalanten, schleppenden Tonfall, dem »Oxford drawl«, es fertig bekamen, eine gesellschaftliche Sprachgrenze durch die ganze englischsprechende Welt zu ziehen. Ich habe diesen »drawl« nie voll herausbekommen – so etwas wird nur ererbt –, kann ihn aber sofort heraushören, was später oft sehr nützlich war. Die Amerikaner mit ihrer nasalierenden, aus dem Londoner East-end und »broad Scotch« stammenden Sprachweise standen tief unter dieser sprachlichen Scheidegrenze und wurden deshalb von den Engländern tiefer einklassiert als europäische Ausländer. Außerdem hielten sie sich nicht an das ihnen unbekannte, in allen Lebenslagen gebotene viktorianische Decorum und erregten so immer Anstoß und Missbilligung; Die Königin Viktoria war doch erst acht Jahre tot. Ein ganz schlimmer Fall ergab sich, als eine recht hübsche, relativ junge Amerikanerin auftauchte mit dem damaligen amerikanischen »dernier cri«, nämlich einem Brillanten, der in eines ihrer perligen Vorderzähnchen eingesetzt war.
Das Leben der Universität bewegte sich in den Formen des Mittelalters. Die Vorlesungen wurden in den schönen, mit kostbaren Bildern ausgestatteten Räumen der Colleges abgehalten, und nach Beendigung eines Collegs musste man mit dem Rad zur nächsten Vorlesung in eins der anderen Colleges fahren, was bei der weiten Streuung der Colleges mit ihren Parks und Höfen Eile erforderte. Niederschriften in der Vorlesung durften nur vermittels Gänsekiel, von denen mehrere wohl zurechtgeschnitten auf den Pulten lagen, und Streusand gemacht werden.
Auch 1909 war einer der Hauptdiskussionsgegenstände ein kriegerischer, nämlich die Frage des Dreadnoughtbaus. Der Bau dieser kostspieligen Superschlachtschiffe, als Abwehr gegen das deutsche Flottenbauprogramm, hatte die öffentliche Meinung in England zur Siedehitze gebracht, und auch die Stimmung war scharf antideutsch und für eine starke Aufrüstung. Man hatte das Gefühl, dass etwas Neues, Unbekanntes in der Luft lag, eine erregende Spannung und dunkle Ahnung schrecklicher Möglichkeiten, die dieser köstlichen Welt bevorstehen könnten. Dass zu diesen Möglichkeiten der konkrete Fall des wirklichen Schießens von Deutschen auf diese netten, gutangezogenen, jungen Engländer und dieser umgekehrt auf die von den Ausländern doch immer noch passabelsten deutschen Studenten gehören könnte, ist wohl niemandem ernstlich bewusst geworden.
Auf Grund der insularen Lage, der Europa abgewandten, auf die große koloniale Welt hin gerichteten, historischen Entwicklung und des unerhört hohen Macht- und Wirtschaftsstandards Englands war eine merkwürdige Überheblichkeit der Engländer gegenüber allen Ausländern entstanden, die ihre in England immer erforderliche sittliche Rechtfertigung erhielt durch den Gedanken der Abwehr irriger und unsittlicher Ideen vom Kontinent. Man war sehr höflich und freundlich zu Ausländern, wenn man aber besonders liebenswürdig sein wollte, so sagte man »Sie sehen aus und betragen sich wie ein Engländer«, ohne dabei zu spüren, welche beleidigende Arroganz in diesem gut gemeinten Kompliment lag. Franzosen standen tief in der Wertung wegen revolutionärer und leichtfertiger Ideen und ihrer geschniegelten, unsportlichen Kleidung.
Italiener wurden nicht ernst genommen, Russen warfen Bomben und Polen und andere Slawen waren »dirty«. Deutsche, besonders aber Österreicher, standen noch am besten im Kurs, und dann Skandinavier und Holländer. Schwarze, braune und gelbe Hautfarbe war natürlich »impossible«. Inder rangierten hierbei noch am höchsten und galten zur Entschuldigung immer als Söhne von Maharadschas. Auch vereinzelte Neger waren in Oxford, natürlich nur Söhne von Sultanen oder Häuptlingen, mit denen aber niemand etwa Tennis spielen wollte.
Es gab in Oxford ein bescheidenes Saaltheater, das kleine Unterhaltungs- und Spektakelstücke spielte, von denen mir unvergesslich geblieben ist »Under the Tsar«, in dem ein Anarchist mit feinster, realistischer Kleinarbeit am Galgen zu Tode gebracht wurde. Es ging dort rau her wie zu Shakespeares Zeiten; Studenten sprangen auf die Bühne und spielten mit oder überreichten den Schauspielern nicht nur Blumen, sondern auch Whisky und Esswaren. Applaus und Missfallen fanden gleicherweise stürmische Äußerung, kurz: Es war ein Fest, aber doch Theater. In London habe ich dann noch mancherlei Theater aller Art gesehen, so die große Destinn in Madame Butterfly in Covent Garden; ich habe nie im Leben wieder eine solche Häufung kostbaren Schmucks erblickt, dessen Funkeln aus dem Parkett in die Logen des ehrwürdigen, alten Saals emporbrandete, wie an diesem Abend. Man war reich und konnte es sorglos und neidlos zeigen, und wenn eine besonders gut aussehende und wohlgeschmückte Dame vor dem Theater aus dem Wagen stieg, klatschten die Zuschauer fröhlich Beifall.
Für das zweite Semester fiel die Wahl auf München. Der Vater verlangte eine Universität mit süddeutscher, katholischer Umwelt. Eigentlich war Wien oder Innsbruck geplant, aber da ich mit meinem Freund Felix Jungeblodt zusammen fahren sollte, weil davon die Väter eine gegenseitige moralische Stützung erwarteten, einigten sich diese schließlich auf München. Wir fanden dort ein Quartier, bestehend aus einem gemeinsamen Wohnzimmer und zwei angrenzenden Schlafzimmern auf der Türkenstraße bei sehr netten Leuten. An der Haustür hatten sie ein großes, ovales Porzellanschild mit der Aufschrift »Josef Lidl emeritierter Fürstlich Thurn und Taxischer Kammerdiener«. Dementsprechend war dort für unser leibliches Wohl gut gesorgt, und auch für unser im damaligen Faschingsmünchen nicht ungefährdetes Seelenheil waren sie mehr bemüht, als uns lieb war.
Wir belegten unsere üblichen Vorlesungen in dem prächtigen Neubau der nahen Universität und waren auch gewillt, von diesen so viel wie möglich zu profitieren, weil wir beide Oxford als großes wissenschaftliches Loch empfanden. Der Profit war dann aber auch hier mäßig, weil wir zu oft eine Zeiteinteilung hatten, die mit den Kollegstunden kollidierte. Es waren bedeutende Professoren da: Professor Seuffert bot Zivilprozess an, v. Amira deutsches Recht, Brentano im Auditorium Maximum geistreiche, antiklerikale Nationalökonomie und Schneider scholastische Philosophie. Trotz oder wegen des hohen Grades von Wissenschaftlichkeit ging das alles aber über unsern, wohl in Oxford nicht hinreichend aufpolierten Horizont, besonders die »Vorlesungen« von Seuffert, was sich bald negativ auf die Zahl der Stunden auswirkte, die wir bereit waren, der Universität zu widmen. Bei Amira, von dessen geistvollen Konstruktionen wir meinten, er erfinde überhaupt erst das deutsche Recht, gab es wenigstens oft Spaß. Er war empört, wenn jemand unter Missbrauch der akademischen Freiheit zu spät in die Vorlesung kam. Dann unterbrach er seinen Vortrag und machte böse Bemerkungen. Als er eine solche einmal etwas länger ausdehnte, rief der Spätling: »Ich dachte, hier sei Vorlesung«, sprachs und verschwand unter lautem Trampeln. Einmal hatte Amira sogar versucht, die Tür durch den Pedell nach Beginn des Kollegs schließen zu lassen. Was aber zu einem solchen Aufruhr führte, dass er grimmig sein langbärtiges Germanenhaupt beugte und nachgab, was ihm dann durch späteres, besseres Betragen auch honoriert wurde. Besonders anregend war es, wenn ein junger, bayerischer Prinz in Begleitung eines Mentors zur Vorlesung erschien. Jeder wartete dann gespannt auf das, was kommen musste. Amira war nämlich innerlich so von altgermanischen Freiheitsgefühlen erfüllt, dass er es dann immer irgendwie fertigbrachte, einen Lobpreis der republikanischen Staatsform in sehr sachlichen Worten in sein Thema einzuflechten. Das Auditorium scharrte oder trampelte dann, und Prinz und Mentor saßen unbekümmert da. Man lebte eben in Bayern in einem freien Land.
Zur Abrundung wurde noch ein weiteres Auslandssemester in Genf verstattet. An der Genfer Universität, wo ziemlich viele Deutsche studierten, wurde im Vorlesungsplan auf die deutsche Ausbildungsordnung Rücksicht genommen, und es gab z. B. regelrecht Kollegs über deutsches, bürgerliches Recht. Die Genfer Universität war ein Gemisch aller Nationalitäten, und von eigentlichem studentischen Leben und einem Zusammenhang der Studenten habe ich wenig gemerkt. Höchst misstrauisch wurden die vielen Russen betrachtet, von denen man meist annahm, dass sie zur Anlernung in der Fabrikation von Bomben, jedenfalls zu subversiven Zwecken oder mindestens aus verdächtigen Gründen sich dort aufhielten. Auch zu gesellschaftlichem Verkehr in der Stadt kam es nicht, da die eingesessenen Genfer sich abgesondert hielten entsprechend dem puritanischen Sinn dieser Stadt. Der Geist Calvins wehte fühlbar durch die düstern Gassen der alten Stadt, deren dunkel drohende, mit unguter Geschichte beladene Mauern keinen Frohsinn aufkommen lassen wollten. Es war besser, sich an den neuen, internationalen Teil Genfs am See und dessen lachende Umgebung zu halten. Selbst dort gab es die böse Stelle, wo vor zwölf Jahren bei dem Hotel Beaurivage die Kaiserin Elisabeth ermordet worden war, und der Mörder Lucheni saß noch in dem unheimlichen, alten Gefängnis der Stadt.
Ich war also angewiesen auf den Umgang mit Leuten, die in meiner Pension, meist als Dauergäste, wohnten. Die Pension der Madame Hornung lag auf dem Boulevard George-Favon, nahe bei der katholischen Herz-Jesu-Kirche, die wie ein griechischer Tempel aussieht und früher Freimaurerloge war, bis die Jesuiten sie durch einen Mittelsmann erworben hatten – ein seltener Vorgang, der sich sonst meist umgekehrt abwickelt. Mme Hornung war eine gebildete Frau aus guter Familie, die es verstand, der seltsamen Mischung, die bei ihr wohnte, eine Art von familiärem Zusammenhang zu geben. Der Ehrengast war Mrs. Skeene, eine liebenswerte, alte Engländerin. Ihr Mann war englischer Generalkonsul in Aleppo gewesen, auf einer Reise vor vierzig Jahren in Genf verstorben, und sie war dort aus Pietät sitzen geblieben als schönes Beispiel der leider hingeschwundenen Geisteshaltung, die man als »spleen« zu bezeichnen pflegte. Ferner gab es ein nettes, baltisches Ehepaar, das die studierende Tochter überwachte, einen griechischen Levantiner, der sich byzantinischer Kaiserabstammung rühmte, was Mrs. Skeene vorsichtig bezweifelte, eine bildhübsche, blonde Signorina englischer Abkunft aus Süditalien, den Österreicher Baron Mahlschedl und einige andere. Die Tischunterhaltung war entsprechend der bunten Zusammensetzung amüsant und nicht nur sprachlich lehrreich. Man ging zusammen in das Casino zum Tanzen, ruderte und machte Ausflüge auf dem See und in die geschichts- und literaturträchtige Umgebung. Ein besonderes Ereignis war ein Gastspiel von Sarah Bernhardt. Hinreißend war sie in der Cameliendame, besonders zum Schluss in ihrer hauchdünnen Zerbrechlichkeit.
Die anderthalb Jahre unbekümmerten Umherziehens hatten mir sicher nicht viel juristischen Lernertrag gebracht. Dementsprechend stand für mich fest, dass die restlichen drei Semester als reine Arbeitssemester zu Hause an der Universität Münster zu absolvieren seien, und zwar ohne Überschreitung der normalen Studiendauer von sechs Semestern. Ich kam zu diesem Entschluss aus dem natürlichen Ehrgeiz jedes jungen Menschen zu einer Leistung und aus der Dankespflicht gegenüber den Eltern, die so viel Geld, Mühe und Liebe auf mich verschwendet hatten.
Die Professoren gingen dem positivistischen Zuge der Zeit entsprechend davon aus, dass nur vom Staat gesetzte oder wenigstens staatlich anerkannte Normen Recht seien, so dass gerade noch für Kirchen- und Völkerrecht die rechtliche Eigenschaft gerettet war, während alle überstaatlichen Normen aus dem Rechtsbereich ausschieden. Damit aber nicht genug wurde sogar das Wesen des Rechts umgekehrt durch den Satz: »Recht ist Macht«, den ich so wörtlich in seiner markigen Sprache von Krückmann wiederholt gehört habe. Wenn das ein so tüchtiger und anständiger Mann wie Krückmann in voller Überzeugung lehrte, so braucht man sich nicht darüber zu wundern, wie leicht es später dem Hitlerregime wurde, das Recht zu schänden, eine Möglichkeit, die Krückmann nicht erkenntlich wurde, da er im liberalen Fortschrittsglauben und in der sicheren Gegründetheit der friedlichen Zeit des 19. Jahrhunderts lebte.
Die Bewältigung des Lernstoffes in drei Semestern konnte nur gelingen mit Hilfe des Repetitors. Da war einmal Herr Kleene, der es sicher in der Ewigkeit nicht böse vermerkt, wenn ich ihn entsprechend der herrschenden Meinung der Studenten als verkrachtes Genie bezeichne. Genial war er sicher in der souveränen Beherrschung des Stoffes, messerscharfer Logik und glanzvoller Darstellungsgabe. Seine Beispiele saßen und hafteten. Seinem sprühenden Geist konnte man sich nicht entziehen, und sein beißender Spott eiferte an, sich keine Blößen zu geben. Auf Professoren und die Prüfer beim Oberlandesgericht war er ebenso schlecht zu sprechen wie diese auf ihn. Bei der Darlegung der unterschiedlichen Lehrmeinungen hieß es nicht selten: »Dies ist die überwiegende Meinung, jenes die richtige, Professor X vertritt folgende dritte Ansicht: Hüten Sie sich also im Examen bei ihm, die richtige Erkenntnis zu äußern.« Das war sehr wenig liebevoll, die Thesen saßen dann aber. So weit, so gut. Die Sache hatte aber einen Haken, Kleene hatte nämlich einen Hang zu alkoholischen Getränken und sonstigem lockeren Lebenswandel, der ihn öfter unversehens nach auswärts und mit Vorliebe nach Dortmund entführte. Durch die Universität aber hallte dann der Schreckensruf: »Kleene bremst!« Aus der Kenntnis dieser unbestrittenen Eskapaden heraus verwalteten die Studenten seine Einkünfte und maßen ihm in bar nur beschränkte Mittel zu. Das nützte aber auch nichts, denn er fuhr dann eben ohne Geld los und machte in Dortmund so lange Schulden, bis einer der treuhänderischen Studenten ihn dort aufgespürt und ausgelöst hatte. Es war daher nützlich für diese Intervalle, einen zweiten Rückhalt zu haben, nämlich Herrn Schaefer, der sehr tüchtig und zuverlässig war, dem aber die bewegliche geistige Spritzigkeit des dann früh verstorbenen Kleene fehlte, während Schaefer als Lohn seiner Tugend noch bis 1957 Repetitorium gehalten hat.
Zum frühesten Termin habe ich mich dann zum Referendar-Examen in Hamm gemeldet und es im Juni 1912 mit dem Prädikat gut bestanden im Alter von 21 Jahren und drei Monaten, worauf ich stolz war, denn ich hatte in Münster eisern gearbeitet.
3. Die Ruhe vor dem Sturm – ein Traumjob, ein Traumregiment, eine Traumhochzeit
Zur Ausbildung wurde ich dem Amtsgericht in Warendorf überwiesen. Beleidigungsklagen stellten in der Kleinstadt einen amüsanten Prozessgegenstand dar. In diesem Zusammenhang war die kleine, unpolitische, örtliche Zeitung des Redakteurs Klostermann von Bedeutung. Dieser war früher einmal wegen Majestätsbeleidigung mit den Behörden in Konflikt geraten und lebte seitdem in einem für die Zeitung nicht uneinträglichen Kampf gegen alle Träger öffentlicher Autorität, besonders natürlich gegen den Landrat. Dieser wohnte auf seinem Gut vor der Stadt und fuhr täglich mit seinem Kutschwagen zum Büro, wo in dem kleinen, friedlichen Kreis nicht allzu viel Arbeit anfiel. Klostermann schrieb dann in seine Lokalnachrichten nur den Satz: »Gestern traf das bekannte schöne Schimmelgespann um 11 Uhr in den Mauern unserer Stadt ein und verließ diese nach getaner Arbeit um 11:42 Uhr.« Ob und unter welchen Straftatbestand das nun fällt, ist sicher eine knifflige Frage, die schmunzelnd abends im Klub besprochen wurde, der seine für die kleine Stadt sehr schöne Unterkunft in dem früheren Kasino des Kürassierregiments 4 hatte, von dem eine Eskadron in Warendorf stationiert gewesen war.
Das Amtsgericht, ein würdiges Biedermeierhaus, war bescheidenst mit schlichten, ungestrichenen Tannenholzmöbeln eingerichtet. Gelöscht wurde mit Streusand aus der nahen Heide. Im Hof war das meist nur im Winter von Landstreichern bewohnte Gerichtsgefängnis, das gut dreißig Jahre vorher dem Bischof Johann Bernhard als Aufenthalt hatte dienen müssen. Es war ein stilles, behagliches Leben an diesem Amtsgericht ohne Ereignisse und Aufregungen. Mittags um 12 Uhr rief Professor Brinkhaus von unten nach meinem oben gelegenen Zimmer laut das Wort: »Wasserklub«. Auf dies Zeichen gingen wir zur Ems zum Schwimmen. Nachmittags wurde im Kaffeehaus »Herrlichkeit« Tennis gespielt, und der Abend wurde mit Lesen oder Klub verbracht. In Warendorf habe ich einen guten Freund fürs Leben gefunden, den Grafen Michael Matuschka aus Schlesien, der ein Jahr älter als ich und Regierungsreferendar beim Landratsamt war. Die Gleichheit der Anschauungen führte uns zusammen, und so ist es geblieben, bis er am 14. September 1944 den Hitlerhenkern zum Opfer fiel, nachdem er die Worte gesprochen hatte: »Es ist eine hohe Ehre, zu Kreuzerhöhung gehängt zu werden«.