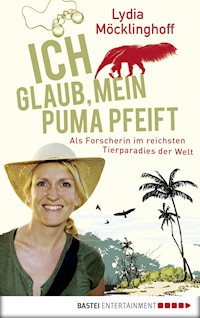Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dass der Ameisenbär noch nicht ausgestorben ist, versteht keiner. Er ist langsam, sieht schlecht, und sein Gehirn ist nur erbsengroß. Lydia Möcklinghoff, Deutschlands bekannteste Ameisenbärforscherin, nimmt den Leser mit an die Orte, an denen Tiere wie der Ameisenbär, das Flussneunauge oder der Rote Wendehalsfrosch mit Tricks ums Überleben kämpfen. Mit Humor und echter Leidenschaft erzählt sie von der Zeit, die sie im brasilianischen Busch verbracht hat, um herauszufinden, warum der Ameisenbär überleben kann. Dieses Buch ist eine Reise zu den wunderbarsten Kreaturen unserer Erde und zu den Menschen, die sich überall auf der Welt in das Abenteuer Wildnis stürzen, um unsere Natur zu schützen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dass der Ameisenbär noch nicht ausgestorben ist, versteht keiner. Er ist langsam, sieht schlecht und sein Gehirn ist gerade mal erbsengroß. Lydia Möcklinghoff erzählt mit Humor und echter Leidenschaft vom Abenteuer Artenschutz. Sie nimmt den Leser mit auf Forschungsreisen zu langsamen Ameisenbären im brasilianischen Pantanal, in die kargen Küstenlandschaften Grönlands, die Bergregenwälder Panamas oder die Savanne Afrikas, wo seltene Arten mit Tricks überleben.
Die Autorin hat viele Jahre im brasilianischen Busch verbracht, sich mit der Machete durchs Dickicht gekämpft und ist vor Wildschweinen auf Bäume geflohen – all das um herauszufinden, wie der Ameisenbär überleben kann. Dieses Buch ist eine Reise zu den wunderbarsten Kreaturen unserer Erde und zu den Menschen, die sich zu ihrem Schutz überall auf der Welt in das Abenteuer Wildnis stürzen.
Hanser E-Book
Lydia Möcklinghoff
DIE SUPERNASEN
Wie Artenschützer Ameisenbär & Co. vor dem Aussterben bewahren
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-44888-9
© Carl Hanser Verlag München 2016
Illustrationen: Lydia Möcklinghoff
Umschlag: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Satz: Satz für Satz, Wangen im Allgäu
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
INHALT
Ameisenbärenforschung!
Prolog im Pantanal in Brasilien
Afrika – du liebst es, oder du wirst bekloppt
Ein Jahrzehnt in Westafrika mit Dr. Frauke Fischer von der Universität Würzburg
Afrika – du liebst es, oder du wirst bekloppt Afrika – du liebst es, oder du wirst bekloppt
… in der Zwischenzeit auf Fazenda Barranco Alto in Brasilien
Polarpost vom Lemming
Eine Expedition nach Grönland mit Oliver Bechberger von der University of Iceland und Dr. Benoît Sittler von der Universität Freiburg
Der Jaguar – Phantom am Rio Negro
… in der Zwischenzeit auf Fazenda Barranco Alto in Brasilien
Mit Klebeschnurrbart, Tarnkappe und Hautkrankheit
Ein Besuch in Bénin und Kamerun in Afrika mit Mareike Hirschfeld vom Museum für Naturkunde in Berlin
Big Brother im Feuchtgebiet
… in der Zwischenzeit auf Fazenda Barranco Alto in Brasilien
Ein (gem)einsamer Kampf
Eine Reise nach Panama mit Jörn Ziegler von der Organisation First Aid for Wonderful Nature (F.A.W.N. Deutschland e.V.) und dem Volk der Naso von der Organización para el desarollo del Ecoturismo Naso (ODESEN)
Rumsumpfen für Fortgeschrittene
… in der Zwischenzeit auf Fazenda Barranco Alto in Brasilien
Zwischen allen Stühlen in Sierra Leone
Eine Reise nach Sierra Leone mit Ricarda Wistuba und Dr. Jan Decher vom Zoologischen Forschungsmuseum Koenig in Bonn
Geliebtes Land des Plastiks
… Schlammschlacht durchs Pantanal und galoppierender Weihnachtswahnsinn in Campo Grande
Man muss ja Prioritäten setzen
… Finale bei den Naso
Anmerkungen
Weiterführende Links zu den Projekten
AMEISENBÄRENFORSCHUNG!
Mensch, das ist aber ein nettes Hobby!
Prolog im Pantanal in Brasilien
Langsam wird’s eng. Direkt vor mir gräbt sich der Große Ameisenbär schnaufend durch den Sand. Wenn er noch näher kommt, steht er mir auf den Füßen. Gesehen, gehört oder gerochen hat er mich offensichtlich noch nicht, so vollkommen gelöst in seiner Existenz, wie es nur ein Ameisenbär sein kann. Abgesehen von einem großen »Ameisen« passt gerade nichts in sein kleines Hirn (das ist nur so groß wie eine Walnuss).1 Die lange, bananenförmige Schnauze stöbert im Gras, während der Wind in der Savanne den buschigen, dunkelbraunen Schwanz zerzaust. Ich hocke in ziemlich verrenkter Haltung im kurzen Gras. Über 40 Grad in der brasilianischen Savanne. Puh … Das Tier ist mittlerweile so nah, dass ich nicht wage, mich zu bewegen. Na ja, nicht, dass ich mich aktuell bewegen könnte – meine Beine sind schon lange eingeschlafen. Expertentipp direkt zu Beginn dieses Buches: Wenn man Position an einer Stelle bezieht, an der mit großer Wahrscheinlichkeit demnächst ein Wildtier vorbeikommt, sollte man auf eine bequeme Körperhaltung achten. Ist es nämlich erstmal da, müssen ruckartige Bewegungen vermieden werden, um es nicht aufzuscheuchen, und so leidet man dann leise mit schmerzendem Rücken und tauben Extremitäten vor sich hin. Vielleicht auch eine Altersfrage? War das anders, als ich vor zehn Jahren anfing, Brasiliens eigenartige Tierwelt zu erforschen?
Es gibt vier Arten von Ameisenbären, die kleinsten sehen ein bisschen aus wie Eichhörnchen, die größten, die ich erforsche, sind bis zu zwei Meter lang. Sie sind so hoch wie ein Schäferhund, bestehen aber zu großen Teilen aus Schwanz und Schnauze. Der offizielle Artname dieser großen Ameisenbären ist auf Deutsch »Großer Ameisenbär«. Da hat sich jemand bei der Namensgebung kreativ ausgetobt. Der lateinische Name ist ein bisschen fetziger und verrät auch mehr über das Tier an sich: Myrmecophaga tridactyla, also der dreifingrige Ameisenfresser. Tatsächlich haben Große Ameisenbären drei lange Krallen. Mit denen kämmen sie beim Baden gewissenhaft ihren Schwanz oder graben im Boden nach Ameisen und Termiten. Die fressen sie nämlich ausschließlich. Darum auch die auffällige Rübenschnauze, die kann man prima in das gegrabene Loch stecken, um dann die bis zu 60 Zentimeter lange Zunge abzuseilen, an der die Beute wie am Klebeband pappen bleibt.2 30.000 Ameisen und Termiten frisst ein Großer Ameisenbär auf diese Weise pro Tag.3 Das hört sich spektakulär an, sind aber nur 180 Gramm Nahrung für das große Tier. Der Ameisenbär ist daher permanent mangelernährt und deshalb nicht von der schnellsten Sorte. Im Zuge meiner Forschung konnte ich zeigen, dass er sich (auch wenn er zumindest auf kurze Distanz recht schnell galoppeln kann) mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 200 Metern in der Stunde vorwärtsbewegt. Eins möchte ich Ihnen sagen: Tierforschung kann sehr spannend sein. Aber, wie im Falle dieser Datenerhebung, manchmal auch sehr zäh. Faultierforscher haben’s da vermutlich nicht besser. Übrigens sind Faultiere mit Ameisenbären verwandt. Genau wie Gürteltiere. Alles typische Tiere für die Natur Süd- und Mittelamerikas.4 Sie gehören zur Ordnung der Nebengelenktiere und werden so genannt, weil sie ein extra Gelenk in der Wirbelsäule haben. Darum kann sich ein Kugelgürteltier bei Gefahr zusammenklappen wie ein Schweizer Taschenmesser, und ein Faultier kann sich rücklings vom Baum baumeln lassen. Ameisenbären können sich durch das Gelenk komfortabel auf die Hinterbeine stellen, um die Krallen zur Verteidigung oder zum Befummeln von Bäumen und Termitenhügeln frei zu haben.
Weil so ein Großer Ameisenbär doch recht auffällig durch die Savanne streift, ist es ziemlich überraschend, dass es kaum Forschung zur Ökologie dieser Tierart gibt. Die Ökologie untersucht die Wechselbeziehung eines Lebewesens zu seiner Umwelt. Also wie ein Ameisenbär zum Beispiel auf das Wetter reagiert, oder in welchen Lebensräumen er sich am liebsten aufhält. Auch über das Verhalten der Tiere weiß man nur wenig. Die meisten Studien sind mehr als 30 Jahre alt.
Ganz schön alt. So alt wird ein Ameisenbär maximal im Zoo, und alt fühle ich mich auch gerade, wie ich da so verrenkt im Sand sitze. Kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit, dass ich auf einen Aushang an der Uni für ein Praktikumsangebot in Brasilien reagierte und kurz drauf in der nordbrasilianischen Savanne vor meinem allerersten Großen Ameisenbären stand. Ausgerechnet eine Mutter mit einem kleinen, flaschenkürbisförmigen Baby, das sie nach Ameisenbärentradition auf dem Rücken mit sich herumtrug. Bis zu neun Monaten reitet ein kleiner Ameisenbär bei Mama mit, dann muss er sehen, wo er bleibt, denn die Tiere sind Einzelgänger. Und einfach wahnsinnig faszinierend.
Luxusprobleme
Wie die Ameise an seiner Zunge blieb ich forschungstechnisch am Ameisenbären kleben. Erst setzte ich während meines Tropenökologiestudiums in Würzburg meine Forschung in Nordbrasilien fort. Dort sind Ameisenbären in Akazienplantagen extrem häufig. Nicht, weil die Plantagen eine Wohltat für die Savanne dort sind. Im Gegenteil: Sie verändern die Natur möglicherweise unwiederbringlich, denn die Wurzeln von Acacia mangium, der Baumart, die dort angebaut wird, können in der Erde Stickstoff akkumulieren. Bodenbewohnende Ameisen und Termiten finden die Nährstoffe im Boden prima. Es gibt sie dadurch viel häufiger als in der Savanne und somit auch mehr Ameisenbären. Viel mehr! In der Pflanzung stehen bis zu zehn Ameisenbären pro Quadratkilometer herum. Ansonsten sieht man eigentlich gar keine Wildtiere. Pampashirsche und Wasserschweine kommen mit dem künstlichen Wald, der sich dort breitmacht, wo eigentlich gelbes, wogendes Gras wachsen und Palmenhaine kleine Bäche umstehen sollten, überhaupt nicht zurecht.
Die Ameisenbären haben derweil fast so etwas wie Luxusprobleme: Sie sind in den Plantagen so häufig, dass sie in sozialen Stress geraten. Das Einzelgängertum ist schwer umzusetzen, wenn überall Artgenossen herumstehen. Vermutlich ist es in einem überfüllten Hörsaal im Grundstudium Physik ganz ähnlich. Die auffälligen Kratzspuren, die Ameisenbären hier an den Bäumen der Pflanzung hinterlassen, könnten ihre Antwort auf den ganzen Stress mit den Artgenossen sein. Eine Kratzspur möchte demnach sagen: »Also, ich hab hier gerade gekratzt, geh bitte woanders lang, sonst hau ich dir auf die Schnauze.« So ein System kennt man zum Beispiel von Hauskatzen, bei denen funktionieren Markierungen wie Ampeln: Frisch – »Hier bitte nicht langgehen, hier bin ich schon.« Mittel – »Okay, geh ruhig weiter, aber halt die Augen offen, ich bin hier vielleicht auch unterwegs.« Alt – »Ewig her, dass ich hier war. Du hast freie Fahrt.« Gut denkbar, dass der Ameisenbär es ähnlich hält. Solche Unterhaltungen mithilfe von Kratzbäumen wären ein völlig neuer Aspekt im Ameisenbärenverhaltenskatalog. Bisher wusste man gar nicht, dass die Tiere überhaupt miteinander kommunizieren, und ging davon aus, dass jeder unorganisiert in seinem Privatuniversum herumtapert. Vielleicht sind die Kratzbäume aber auch lediglich ein Stressventil – kratzen anstelle nervöser Zuckungen?
Um das herauszufinden und um mal zu sehen, wie sich ein ungestresster Ameisenbär in seinem natürlichen Lebensraum verhält, landete ich einige Jahre später im Westen Brasiliens, nahe der Grenze zu Paraguay und Bolivien. Und blieb. Wenn ich nicht in Bonn am Zoologischen Forschungsmuseum Koenig arbeite, schlage ich mich seit fast sieben Jahren durch das Dornengestrüpp des brasilianischen »Pantanals«, eines der größten Binnenfeuchtgebiete und Naturparadiese der Erde. Dort werde ich von Wasserbüffeln attackiert – und vom Forschungsobjekt ignoriert. Jaguare und Riesenotter leben an den Flüssen, Pumas und Tapire durchstreifen die Wälder. Es gibt knapp 700 Vogelarten – in ganz Deutschland sind es um die 500. Die Natur ist fernab der Stadt noch unberührt und wunderwunderschön. Ich arbeite auf einer Rinderfarm am Rio Negro. Vier Stunden Schlammpiste liegen zwischen mir und der nächsten Siedlung, nur passierbar zur Trockenzeit, in der Regenzeit muss man ein- und ausgeflogen werden. Hier wechseln sich Galleriewälder mit Salz- und Süßwasserseen ab. Gelb blühende Cambará-Bäume wachsen entlang des Flussufers. Große, weite Ebenen mit Carandá-Palmen werden durch regelmäßige Überschwemmungen auf natürliche Weise frei gehalten. Einmal jährlich zur Regenzeit steht das vielfältige Mosaik aus Wäldern, Savannen, Flüssen und Seen nämlich großflächig unter Wasser. Dann kann man (oder besser ich) prima Geländewagen im Matsch festfahren.
Momentan ist aber Trockenzeit, so gerade noch, die macht es möglich, am Ufer eines ausgetrockneten Salzsees vor diesem gut gelaunten Ameisenbären zu hocken. Ganz ohne Eile tapst er noch etwas näher auf mich zu, schnuppert versunken im Sand an einem Grasbüschel herum und fängt dann entschlossen an, mit den Krallen ein Loch auszuheben. Ich bin derweil damit beschäftigt, meinen eingeschlafenen rechten Fuß möglichst geräuschlos unter meinem linken Bein hervorzuarbeiten. Der Ameisenbär presst seine lange Schnauze ruckartig nach vorne in die Kuhle. Offenbar hat er ein Ameisennest unter der Erde erschnüffelt. Großen Ameisenbären wird ja ein sehr feiner Geruchssinn nachgesagt. Supernasen! Sagt man. Hm, na ja, ich will es ihm nicht absprechen … Das wäre, als würde man dem kleinen Justin auch noch eine Fünf auf sein gemaltes Bild geben, wo es doch schon in den anderen Schulfächern nicht so gut läuft. Sehen und hören können Ameisenbären nämlich schlecht. Selbst wenn man sich mit einer Gruppe amerikanischer Touristen in knisternden, raschelnden und neonfarbenen Regenjacken an eines dieser Tiere »heranpirscht«, bekommt es nichts davon mit und treibt weiter in seinem Paralleluniversum durch die Zeit. Aber riechen. Das klappt einigermaßen. Zwar nicht so gut wie beim Hund oder bei der Katze oder beim Albatros oder beim Aal, aber immerhin: Ein Ameisenbär riecht vierzigmal besser als ein Mensch. Er riecht vor allem seine Nahrung: Ameisen und Termiten. Und wenn der Wind ungünstig steht, auch den Odor von Insektenmitteln aus einhundert Prozent DEET, der die Gruppe von Amis unweigerlich umweht. Dann galoppiert er panisch in den Wald.
Die Tragik des Ameisenbären
Die Tragik des Ameisenbären? Die Tiere sind eigentlich sehr scheu. Das klappt nur nicht so gut. Eben weil sie nicht so viel von ihrer Umwelt mitbekommen. Vor allem, wenn ein Ameisenbär frisst, versinkt er vollkommen in dieser für ein Erbsenhirn komplexen Tätigkeit. Monotasking in seiner Reinform, ein Ameisenbär ist verhaltenstechnisch so weit von ADHS entfernt wie der kleine Justin vom Nobelpreis. Solche Flow-Erlebnisse, wie sie der Ameisenbär eigentlich permanent erlebt, sind durchaus erstrebenswert. Zum Beispiel, wenn man ein Buch schreiben will. Wenn man allerdings als brasilianisches Wildtier auf dem Speiseplan von Großkatzen steht, nicht so sehr. Auch nicht, wenn man im Straßenverkehr teilnehmen will. Und wenn man als brasilianisches Wildtier im Straßenverkehr teilnehmen möchte, dreimal nicht.
Ein begriffsstutziger Ameisenbär bekommt ein herannahendes Fahrzeug in der Regel erst dann mit, wenn sein Geist schon über seiner platten Leiche schwebt.5 Tatsächlich ist der Straßenverkehr einer der Hauptgründe, warum Große Ameisenbären auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) ziemlich weit oben stehen. Erst vor wenigen Jahren wurden sie dort von »potenziell gefährdet« auf »gefährdet« hochgestuft. Das bedeutet, dass ein hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft besteht.6
Nicht nur Autos, sondern auch Pumas und Jaguare können den kleinen Autisten zum Verhängnis werden. Große Ameisenbären gehören durchaus zu den Beutetieren der Wildkatzen, aber sie haben Glück im Unglück: Sie schmecken nämlich scheiße. Na ja, man weiß zwar nicht, was Jaguare so lecker finden, aber in jedem Fall sind Ameisenbären im Vergleich zu Schweinen, Wasserschweinen oder was sonst noch im Pantanal herumhampelt, eine unattraktive Beute: mager, behaart und dank der langen Krallen ziemlich wehrhaft. Fühlt sich ein Ameisenbär bedroht, stellt er sich auf die Hinterbeine und breitet die Arme aus. Aufrecht stehend ist er fast so groß wie ein Mensch. Eine verfängliche Willkommensgeste, die in einer tödlichen Umarmung enden kann, bei der der Ameisenbär seine Krallen im Rückgrat seines Feindes versenkt. Auf diese Art können Ameisenbären sogar Jaguare töten. Und auch Menschen. Nicht umsonst spricht man in Brasilien von der »Abraço do Tamanduá«, also der »Umarmung des Ameisenbären«, wenn jemand vorneherum freundlich zu einem ist, einem mit offenen Armen begegnet und gleichzeitig hinter dem Rücken gegen einen arbeitet oder lästert. Damit ein Ameisenbär tatsächlich einen Menschen attackiert, muss viel passieren. Ich habe noch nie erlebt, dass einer aggressiv wurde. Im Gegenteil! Einmal zogen die Waldarbeiter in den Plantagen einen Ameisenbären am Schwanz, und der kletterte in seiner Verzweiflung in den nächstbesten Baum, anstatt sich zu verteidigen. Da hing er dann in sechs Meter Höhe und wirkte recht ratlos, wie er da jemals wieder runterkommen sollte.
Wie auch immer. In jedem Fall ist das Gefressenwerden kein zentrales Problem des Ameisenbärs. Die Zerstörung seines Lebensraumes dagegen schon. In vielen Teilen seiner Verbreitung brechen die Bestände der Tierart deshalb zusammen. Zum Beispiel im Cerrado östlich des Pantanal. Dort pflanzen Farmer für die Rinderzucht afrikanische Grassorten an. Mit denen kommen die Ameisen nicht zurecht, und es gibt weniger davon. Kein Futter für den Ameisenbären. Außerdem düngen die Farmer, und der Dünger versaut das Wasser. Nichts zu trinken für den Ameisenbären. Wälder werden abgeholzt, um Viehweiden Platz zu machen. Kein Schatten für den Ameisenbären.7 In Nicaragua, wo der Ameisenbär ohnehin extrem selten ist, kommt die Jagd hinzu. Ameisenbären werden dort zwar nicht direkt gejagt, warum auch, die schmecken ja nicht, und die Nutzung der Schwänze als Besen ist heutzutage auch out. In Nicaragua wird aber traditionell mit Hunden gejagt. Attackiert ein Hund einen Ameisenbären, erschießt der Jäger den Bären, bevor der den Hund töten kann.8 Aufgrund dieser Vielfalt von Problemen, denen der Ameisenbär überall begegnet, ist die Tierart in Teilen Mittelamerikas und in Nordargentinien vermutlich schon ausgestorben.
Im Pantanal sind sie Gott sei Dank noch weit davon entfernt, sogar einigermaßen häufig, zumindest in diesem gut geschützten Eckchen des Feuchtgebietes, auf der Fazenda Barranco Alto am Rio Negro. Hier meistern die Farmbesitzer Lucas und Marina den Spagat zwischen Naturschutz und wildtierverträglicher Landnutzung. Und so kann es dann wie jetzt gerade passieren, dass man als Forscher lächerlicherweise Sorge haben muss, dass das Forschungsobjekt versehentlich mit einem zusammenstößt. Der Ameisenbär hat die Nase mittlerweile in das nächste Loch gesteckt, das er mit seinen Krallen ausgebaggert hat. Sein Schniefen und Schnauben und die trappelnden Vorderpfoten verheißen nichts Gutes. Auch für mich. Wenn der Ameisenbär so mit seiner Nahrung kämpft, sind es immer Feuerameisen. Feuerameisen zeichnen sich durch hohe Aggressionsbereitschaft und Giftstoffe mit unterhaltsamem Wirkungsrepertoire aus. Plündert ein Ameisenbär ihr Nest, fallen sie im Gegenzug rücksichtslos über alles im Umkreis von einem Meter her. Und das betrifft im Augenblick nicht nur den Bären, sondern auch mich. In Brasilien nennt man die Feuerameisen »Lava pé«, also »Wasch die Füße«, weil sie einem blitzartig über die Füße schwappen, wenn man auf ihren Bau tritt (oder eben neben einem risikofreudigen Ameisenbären sitzt). Die Stiche sind schmerzhaft, und man hat lange was davon. Weit weg von der Stadt als schöne Alternative zu Nachtleben und Unterhaltungsindustrie, kann man in den folgenden Tagen beobachten, mit welcher Flüssigkeit sich die Blasen rund um die zahlreichen Stiche füllen.
Vielleicht findet der Ameisenbär das auch so unterhaltsam wie ich? Oder warum fressen die besonders gerne Feuerameisen? Dass es für ihn ebenso unangenehm ist, kann man sehen: Gerade versucht sich das Tier vor mir, mit der Kralle die Insekten von der langen Schnauze zu streifen. Vielleicht ein Thrill, wie wenn wir uns tränenüberströmt die extrascharfe Currywurst reinziehen. Oder helfen die Feuerameisen etwa bei der Verdauung wie ein Schnaps? Das ist gar nicht so weit hergeholt: Ameisenbären haben nämlich einen sehr muskulösen Magen, mit dem sie die Ameisen zerreiben. Tatsächlich werden die Insekten dann in ihrer eigenen Ameisensäure verdaut. Damit spart sich der Ameisenbär in freier Wildbahn die Produktion von Magensäure. Daher könnten Feuerameisen mit ihrer starken Säure möglicherweise als Verdauungsanreger dienen. Aber wen interessiert das überhaupt? Was haben wir vom Großen Ameisenbären? Warum sollte man ihn erforschen und schützen?
Warum überhaupt Artenschutz?
Weil Ameisenbären (ausschließlich!) Ameisen und Termiten fressen, und das bekanntermaßen nicht zu knapp, spielen sie eine Rolle für das Gleichgewicht der Natur. Es sind die einzigen Tiere in Südamerika, die sich auf diese Krabbeltiere spezialisiert haben. Fallen diese lebenden Insektenvernichter auf einmal weg, könnte es unbequem werden. Trotzdem bricht nicht sofort die Apokalypse los, Uruguay liegt ja auch nicht in Trümmern, weil Ameisenbären dort ausgestorben sind.
Wenn der Verlust von Ameisenbären oder anderen Tierarten nicht gleich das Ende der Welt bedeutet, brauchen wir dann überhaupt Artenschutz? Die restliche Natur scheint zumindest an vielen Aussterbeereignissen nur begrenzt interessiert zu sein und macht auch ohne die Goldkröte (Bufo periglenes) so weiter wie bisher.9 Und unser Interesse ist ja auch eher begrenzt, oder kommt drauf an: Einige Schlüsselarten, also Arten, bei denen so ziemlich alles aus den Fugen gerät, wenn sie fehlen, sind für uns und die Natur schon von gesteigertem Interesse. Auch wirtschaftlich. Die Dienstleistungen, die die Biene für uns zum Beispiel kostenfrei abliefert, sind kaum in Geldwerten zu bemessen.10 Deren Aussterben geht uns unmittelbar etwas an, denn ohne Biene keine Pflanzen, ohne Pflanzen keine Pflanzenfresser, ohne Pflanzenfresser keine Fleischfresser, ohne Pflanzen und Tiere kein Essen, kein Mensch. Mal grob generalisiert.
Abgesehen von solchen Schlüsselarten bedeutet aber nicht jede fehlende Art das Absterben des ganzen Ökosystems. Nur – wie viele fehlende Arten können wir uns leisten, bis alles zusammenklappt? Wie hoch können wir noch pokern?
Schwer zu sagen. Unsere Natur kann man sich wie »Jenga!« vorstellen – das ist dieses Spiel mit dem Turm aus Holzklötzchen, man zieht nach und nach die Klötzchen raus, und irgendwann kracht der Kram zusammen. In unserem Fall sind die Klötzchen Tier- oder Pflanzenarten. Zieht man eine raus und stellt sich dabei nicht total dämlich an, bricht nicht gleich alles zusammen. Je mehr Klötzchen oder Arten dann aber flöten gehen, desto wackliger wird die ganze Angelegenheit.11 Und vielleicht ist es am Ende das Aussterben des Ameisenbären, das plötzlich zum Kollaps führt. Oder nicht. Aber wer weiß das schon?
Ökosysteme haben tatsächlich diesen einen Punkt, an dem sie keine weiteren Veränderungen mehr ertragen und einfach ohne Vorwarnung zusammenklappen.12 Wie beim Jenga-Turm kann man auch beim Ökosystem kaum vorhersagen, wann dieser Punkt erreicht ist, weil die Arten sich gegenseitig bedingen. Außerdem sind Jenga-Türme verschiedener Ökosysteme auf unserer Erde unterschiedlich stabil: Wenn von vorneherein nur wenige Klötze den Turm bilden, fällt es zum Beispiel mehr ins Gewicht, wenn einer wegfällt.13 Die Menge solcher Klötzchen im Jenga-Turm, die die Lebewesen eines Ökosystems repräsentieren, bezeichnet man jedenfalls als »Biodiversität«.
Und um uns herum ist es jengatechnisch schon mehr am Wackeln als in allen kanadischen Kneipen zusammen. Da ist Jenga Nationalsport. Also das echte Klötzchenjenga, nicht das Artenjenga, das wir aktuell weltweit mit unserer Natur spielen. Heutzutage sterben nach aktuellen Schätzungen der Weltnaturschutzunion drei bis 130 Tier- und Pflanzenarten pro Tag aus. Aussterbende Arten gab’s zwar schon immer, ganz normal, heute passiert das aber tausend- bis zehntausendmal schneller als bei diesem Hintergrundrauschen der letzten Jahrmillionen.14 Jede vierte Säugetierart, ein Drittel aller Amphibienarten und jede achte Vogelart sind gefährdet. Hauptursachen sind Lebensraumzerstörung, Klimawandel und Umweltverschmutzung, aber auch der illegale Handel oder das Einschleppen fremder Tierarten.15 Letzteres kann man sich dann so vorstellen, als wollte man einen anders geformten Klotz in den Jenga-Turm reindrücken.
Ameisenbärenforschung? Na dann viel Spaß und schönen Urlaub!
Erkenntnisse, die mir im Pantanal jetzt gerade nicht besonders weiterhelfen, denn die ersten Feuerameisen stürmen von ihrem vom Ameisenbären zerstörten Bau in Rage zu mir herüber. Sie stechen und beißen oberhalb der Socken in die nackte Haut. Also die Stiche spüre ich trotz eingeschlafener Beine. Die hektische Rückwärtsrolle, die ich vollziehe, um der Insektenarmee zu entkommen, bekommt sogar der Ameisenbär mit. Sein Fell sträubt sich, er hält kurz inne, misstrauischer Blick aus kleinen, braunen Augen, dann dramatische Flucht ins nächste Gebüsch.
Ich bleibe allein im Sand sitzen und versuche herauszufinden, was da jetzt gerade kribbelt – die Stiche der Ameisen oder die Beine, die wieder aufwachen. In meiner Heimatstadt Köln denken ja immer alle, ich fahre schön in den Urlaub, wenn ich für meine Forschung wieder nach Südamerika aufbreche: »Ach super, Brasilien! Na dann entspann dich gut und trink eine Caipi für mich mit!« Auf alle Versuche zu erklären, dass es sich um alles andere als gemütliche Ferien handelt, erntet man nur Augenzwinkern: »Jaaaaa, klar, Arbeit!«
Dass ich mich in den nächsten Monaten zwischen Moskitos, Feuerameisen und Zecken mit der Machete durch den Dornenwald schlage, bei brütender Hitze in der Savanne rumstehe, bis sich ein träger Ameisenbär endlich aus dem Wald bemüht, und ich mir mit einem Haufen von Frosch-, Riesenotter- und Fledermausforschern ein kleines Haus im Sumpf teilen werde, wollen die Leute, glaube ich, gar nicht hören. Sämtliche Erklärungen, dass es sich um Arbeit, um Forschung und nicht um mein vergnügliches Hobby handelt, werden mit einem augenzwinkernden »Jaja, dann mach du mal. Viel Spaß und schönen Urlaub!« weggewischt.
Tatsächlich verlangen Tierforschung und Artenschutz eine Menge Zeit und Herzblut. Sie bedeuten viel Arbeit, wenig Geld, große Glücksmomente und auch viele Rückschläge. Sie gelten als schwer antiquiert. Heute steht man als Biologe dem Klischee zufolge eher mit Pipette und Schutzbrille in steril gekachelten Labors neben großen, brummenden Maschinen. Und doch gibt es uns noch. Nicht nur mich, überall auf der Welt kämpfen Biologen und Artenschützer gegen die Zeit. Denn in rasantem Tempo verschwinden Tier- und Pflanzenarten für immer von der Bildfläche, und man kann nichts schützen, was man nicht kennt.
Darum dieses Buch
Dies ist ein Buch über Tierforschung und Tierforscher und natürlich über die Tiere, die wir mit unserer Arbeit schützen wollen. Ich schreibe es nicht mit dem Anspruch eines Edward O. Wilson, der mit Weitsicht und Übersicht nach einem Leben für den Artenschutz die richtigen Schlüsse ziehen kann, zum Beispiel in seinem Buch Der Wert der Vielfalt.16 Ich bin auch nicht neutral, jemand Fachfremdes, der staunend durch den Artenschutz stolpert wie Douglas Adams in Die Letzten ihrer Art17 oder der von außen eine objektive, ganz schön vollständige Faktensammlung liefert wie Elizabeth Kolbert in Das sechste Sterben18 (alles großartige Bücher). Ich bin Ameisenbärenforscherin. Ich stehe im Sumpf und sehe oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich verknackse mir den Fuß, weil ich so fasziniert hinter einem Ameisenbären herrenne, dass ich das Gürteltierloch vor mir übersehe. Ich verliere mein einziges Maßband beim Pinkeln im Wald. Ich schreie vor Freude, wenn meine Kamerafalle eine Ameisenbärenmutter fotografiert hat, die mit ihrem Baby spielt. Ich versuche vergeblich, mein Maultier vom Durchqueren eines Sees zu überzeugen, an dessen anderer Seite meine Forschungsausrüstung steht. Ich breche in Tränen aus, wenn die Sonne im brasilianischen Farbspektakel untergeht. Das sind meine Erlebnisse im Artenschutz. Und so schreibe ich auch dieses Buch. Mittenraus und doch mit dem Anspruch, dass wir alle hinterher etwas schlauer sind.
Wir werden in diesem Buch meine Freunde besuchen, die in allen Ecken dieser Welt versuchen, das Leben der Tiere zu verstehen, um sie in Zukunft schützen zu können. Zum Beispiel Mareike, die an den Berghängen Kameruns mit schwindendem Erfolg ihre ebenfalls schwindenden Frösche erforscht. Oder das Volk der Naso-Indianer, mit denen Jörn und ich im Bergregenwald Panamas eine Schlammschlacht par excellence hingelegt haben, um ein Staudammprojekt aufzuhalten. Olli begegnen in Grönland wegen des Klimawandels zu viele Eisbären und zu wenig Lemminge. Frauke muss Antilopen und neue Heimat im Bürgerkrieg der Elfenbeinküste zurücklassen. Natürlich besuchen wir auch »meine« Ameisenbären und das Naturparadies des Pantanal, das ich mein Zuhause nennen darf.
Es ist ein Buch über Artenschutz und Artensterben. Es ist aber vor allem ein Buch über die Abenteuer, die man erlebt, wenn man (mehr oder weniger) zielstrebig über den Tellerrand hinausschaut. Wie es dazu kommt, dass ich Tierforscherin und vor allem Ameisenbärenforscherin geworden bin, werde ich ständig gefragt. Ich erzähle dann die Geschichte, wie mir als Tropenökologiestudentin langweilig war und ich einen Aushang an der Uni sah, auf dem irgendwas stand wie: »Praktikum in Brasilien an Großen Ameisenbären zu vergeben. Abreise sofort!« Also bin ich gefahren und seitdem Ameisenbärenforscherin.
Das ist die eine Geschichte. Wie es überhaupt zu diesem Aushang und somit zu meiner Forschung und meinem Leben in Brasilien kam, ist eine andere Geschichte. Sie beginnt 1993 in Westafrika und endet beim Ameisenbären. Versprochen.